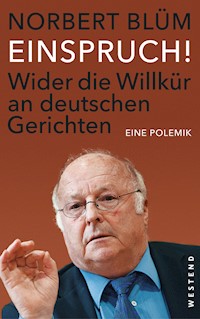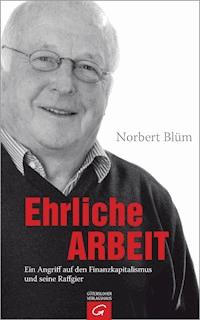
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Finanzkapitalismus ist ein Angriff auf ehrliche Arbeit – eine Streitschrift
- Norbert Blüm lässt die Blase der Finanzwirtschaft zerplatzen
- Ein leidenschaftliches Plädoyer für die Rehabilitierung einer aussterbenden Spezies: ehrliche Arbeit
»Wer nur in Geldkategorien denkt, ist kein Unternehmer, sondern eher ein Unterlasser. Er lässt die Chancen ungenutzt, die sich daraus ergeben, dass der Mensch nicht ein ständig von Vorteilssuche getriebener Homo oeconomicus ist.« Norbert Blüm im manager magazin, 6/2006
Geld regiert die Welt, Geld ruiniert die Arbeit. Arbeit und Einkommen werden entkoppelt, Realwirtschaft und Finanzwirtschaft trennen sich. Geld »arbeitet« und verdient mehr als man mit Arbeit verdienen kann. Unternehmen werden reduziert auf eine Geldgröße und gemessen an ihrem Augenblickswert (cash flow). Der arbeitende Mensch scheint in diesem Szenario nur noch eine lästige Größe zu sein, die auf Dauer eliminiert werden muss.
Aber: Der Aufstand der alten Arbeit wird kommen! Die existenzielle Schwere der Arbeit ist ein anthropologisches Grundbedürfnis, welches durch die virtuelle Leichtigkeit des Geldspiels nicht befriedigt werden kann. Schon deuten sich Vorboten einer Renaissance der Arbeit an. Miteinander handeln wird wichtiger als Produzieren.
Norbert Blüm ist ein Freund deutlicher Worte und als gelernter Werkzeugmacher weiß er wovon er spricht, wenn er über Arbeit redet. Der frühere Arbeitsminister legt hier eine kluge Analyse unserer modernen Wirtschaftswelt vor und wagt mutige Prognosen darüber, wie ein tragfähiges Zukunftskonzept aussehen muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Für Brigitte Schreiber
Inhaltsverzeichnis
Biografisches: Mein Opel. Mein erster Arbeitsplatz
Mit 14 Jahren kam ich zu Opel. 1949. Das war wie ein Lottogewinn. Von 1.000 Bewerbern wurden 21 genommen. Ich war einer der Glücklichen. Es war ein kalter, nasser, trüber Oktobermorgen, als ich mit den 20 neuen Stiften um 6.30 Uhr am Opel-Hauptportal abgeholt und in die Lehrwerkstatt verfrachtet wurde. Mir kam es vor wie ein Gefangenentransport. Schnell wurde jedem von uns ein Spind im Waschraum zugeteilt. Nur eine kurze Zeit wurde uns eingeräumt zum Wechsel von der Bubenkleidung zum Blaumann, einem von meiner Mutter zusammengeflickten Arbeitsuniform. Dann stand ich vor einem Schraubstock, der viel zu hoch für mich war. Eine kleine Kiste schaffte Abhilfe und war fortan mein Standplatz in des Wortes wahrster Bedeutung. Auslauf: 60 cm nach links, 60 cm nach rechts, 60 cm nach hinten, 10 cm nach vorne. So stand ich mit einer großen Feile in beiden Händen vor einem U-Eisen, das zwischen den Backen des Schraubstocks eingeklemmt war. Es ist mir schwer gefallen. Feilen, wie die Väter feilten. 9 Stunden am Tag, 5 Tage in der Woche und jeden zweiten Samstag noch einmal 6 Stunden obendrauf. So war das mit der 48-Stunden-Woche damals. Blasen bildeten sich bald in meiner rechten Hand, die den Feilgriff umklammerte. Die Linke drückte auf das Feilblatt, welches ich schier unendlich und gleichmäßig stur gerade vorwärts schieben und rückwärts ziehen musste. Von Sisyphos wusste ich noch nichts, aber seine Gefühle habe ich damals allesamt durchgemacht. Ein »verhaltensauffälliges Kind« mit großem Bewegungsdrang, das ich war – meine Mutter nannte das »Flegel« –, in die Disziplin des Schraubstocks zu bringen, gleicht dem Zwang, den einstmals die Ruderer auf der Galeere erdulden mussten.
Kilian Lauck, der Gute.
Kilian Lauck, mein guter alter Lehrgeselle, immer einen großen Hut auf dem Kopf und mit einem kalten Zigarrenstummel im Mund bewaffnet, brachte mir den fachgerechten Umgang mit Feile, Hammer, Meißel, Bohrer etc. bei. Es war auch für ihn mühsam. »Herrgott«, höre ich ihn heute noch neben mir flüstern, »gib mir doch einen Fingerhut Geduld, bis der Bub endlich kapiert, was er kapieren muss.« Und so machte er mir zum zehnten Mal vor, was ich schon neunmal nicht nachzumachen gekonnt hatte. Und wenn es dann beim elften Mal immer noch nicht klappte, gerieten seine Ratschläge immer mehr in die Nähe von Flüchen. Kilian Lauck bleibt mir in Erinnerung als ein herzensguter Mensch, von dem ich viel, viel gelernt habe, was ich im Leben gut gebrauchen konnte, auch wenn es später nicht mehr um’s Feilen ging. Ich habe nämlich bei Lauck Ausdauer trainiert und Hartnäckigkeit gelernt: »Nur nicht aufgeben.« Dieses Studium hat mir im Leben mehr genutzt als die Universität. Ich hätte die Politik als Beruf nie überlebt, hätte ich nicht bei Opel in der Lehrwerkstatt Ausdauer geübt. Die freilich ist eine politische Tugend, die vom Aussterben bedroht ist. Denn wer nicht jeden Tag in Deutschland eine neue Idee verkündet, auch wenn er die von gestern noch nicht einmal versucht hat umzusetzen, gilt als einfallslos und verkalkt.
Karl Kirsch, der Unerschrockene.
Ich hatte Glück. Ich habe nicht nur zu meinem Lehrgesellen Kilian »hochgeguckt«, sondern später nach der Lehrzeit im Werkzeugbau auch zu meinem »Kolonnenführer« Karl Kirsch. Der »Kirsche Karl« war mein erster Vorarbeiter: Ein »Schwarzer«, also in der CDU wie ich, nebenbei noch Kirchenvorstandsmitglied in Heidesheim, seinem Heimatort, aus dem er jeden Morgen mit der Eisenbahn angereist kam. Ein »Schwarzer« im »Roten« Werkzeugbau. Das war wie ein Eskimo in der Sahara. Ganz so war es dann doch nicht. Die Roten Genossen wählten nämlich den Schwarzen Karl in den Betriebsrat, in dem seinerzeit noch zehn Kommunisten saßen. Der Betriebsrat war kein Gesangverein, aber Karl hatte auch dort Autorität. Denn er war unbeirrbar gradlinig.
Eines frühen Morgens war Hallodria im Werkzeugbau. Die Nachtschicht hatte eine Ratte gefangen und in einen Kugelkäfig gesperrt. Mit dem Schweißbrenner jagten die Brutalinskis das arme schreiende Tier durch den Käfig. Zirkuslaune ringsum. Da erschien mein »Karl Kirsch« an der Hallentür des Werkzeugbaus. Ein Blick genügte ihm. Wie Zorro aus dem Nichts stand er plötzlich in der Mitte der Meute, schlug dem nächststehenden Tierquäler seine mit Butterbroten und Henkelmann gefüllte Aktentasche um die Ohren, drehte den Schweißbrenner ab, sprach kein Wort, drehte sich um und sah allen wutentbrannt in die Augen. Es wurde mucksmäuschenstill. Sie schämten sich und trottelten von dannen. Ich war stolz auf meinen »schwarzen Kirsche Karl«. Sein Mut vor geiler Meute ist tief in meine Erinnerung eingebrannt.
Die »Opel-Familie«
Wir Opelianer schimpften auf die Bosse an der Spitze der Firma. Das gehörte sich so. Ich habe dieses Spiel schon früh geübt, nämlich als Jugendvertreter. Aber wenn jemand draußen auf Opel und seine Chefs schimpfte, dann schlossen wir die Reihen und verteidigten alles, was mit Opel zu tun hatte. Wir waren Opelianer und wollten dazu gehören. Und selbst die, die als alte, aufmüpfige Rädelsführer im ganzen Werkzeugbau bekannt waren, überkam der Stolz, wenn ihnen zu ihrem Arbeitsjubiläum ein Fresskorb geschenkt wurde und eine Urkunde dazu, auf der ihre Betriebstreue gelobt wurde. Die Urkunde hing fortan über der Kommode im Wohnzimmer und neben der Urkunde das Bild, auf dem der Chef dem Jubiliar die Hand schüttelt.
Ja, wir Opelianer waren stolz auf unsere Firma. Ein Opel als Auto, das war das Ziel aller Kinder des Wirtschaftswunders in Rüsselsheim. Denn das Auto, das war die Erfüllung aller Wünsche, die in der Nachkriegszeit nach der Fresswelle die Reisewelle ausgelöst hatte. Wir jedenfalls, die Familie Blüm, reiste in jedem Sommer stolz über die wildesten Alpenpässe – vollgeladen mit Utensilien, vor allen Dingen Fressalien, denn meine arme, zarte Mutter Gretel glaubte anscheinend noch immer, es könnte unverhofft – vielleicht sogar im Urlaub – eine Hungersnot ausbrechen. Das Auto war der Nachkriegskinder liebstes Spielzeug, und für die Rüsselsheimer hieß dieses Transportmittel »Opel«. Selbst mein Onkel Adolf, Kommunist von Kindesbeinen bis an sein seliges Ende, aktiver Genosse in der Kommunistischen Betriebsgruppe der Firma Adam Opel AG, deren härtester Konkurrent die Christliche Betriebsgruppe war, der ich angehörte, selbst dieser antikapitalistische Kämpfer verehrte sein Auto mehr, als wir Katholiken die Knochen von Heiligen anbeten. Er pflegte sein Schmuckstück nahezu zärtlich. Samstags badete er sein Auto in Schaum wie eine Mutter ihr Kind, massierte und polierte es sanft mit einem weichen Lederlappen. Im Winter bockte er es sogar auf, damit es sich nicht auf seinen Reifen müde stehen musste. Nach dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, kurz vor oder nach seiner Frau – ich weiß es nicht genau –, war der Opel für Onkel Adolf das Schönste, was er im Leben besaß.
Als der erste »Olympia« vom Band lief, war an diesem Tag ganz Rüsselsheim gleichsam in einem großen Festzelt seliger Seelen vereint. Der Männergesangverein sang »Die Himmel rühmen«, der Bürgermeister sprach, der Opel-Chef auch, und wir Opelianer, Erbauer des Olympia Rekord, fühlten uns wie Olympia-Sieger.
Es war einmal … Die Zeiten sind vorbei.
I. Geld regiert die Welt
1. Des Kaisers neue Kleider. Oder: Die Heuchelei der Finanzwelt
Von allen Märchen, die meine Mutter mir erzählte, hat mir das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern immer am meisten Spaß gemacht. Andere Geschichten beeindruckten mich zwar stärker. So hatte ich bei »Hänsel und Gretel« große Angst. Beim wechselvollen Schicksal des »Aschenputtel« zitterte ich buchstäblich mit. Und »Tischlein deck dich« befriedigte meine frühkindlichen Rachegelüste. Über die Blamage des eitlen Kaisers jedoch, der für schöne Kleider sein ganzes Geld ausgab und schließlich von zwei Betrügern reingelegt wurde, habe ich so laut gelacht wie bei keinem anderen Märchen. Schadenfreude über die Dummheit der Obrigkeit und Bewunderung für kecke Kinder, die unverhohlen die Wahrheit sagen, sind für mich bis heute die Quintessenz meines Lieblingsmärchens geblieben. Die Heuchelei der Diener, so lehrt es uns, ist das missratene Pendant einer bürgerlichen Selbstgefälligkeit, von der wir ab und zu in die Irre geführt werden. Auch die leichte Verführbarkeit des Volkes ist eine zeitlose Erfahrung – nicht nur im Märchen.
Schwankend zwischen Schein und Sein, entscheiden sich der Kaiser und sein Hofstaat für den Schein. Weil alle ihn für wirklich halten. Dabei ist der Trick der Betrüger im Grunde leicht zu durchschauen: Sie behaupten, ihre Kleider seien aus einem Stoff gefertigt, der »die wunderbare Eigenschaft besitzt, dass sie für jeden Menschen unsichtbar sind, der nicht für sein Amt taugt oder der unverzeihlich dumm« ist. Heute nennen sich diese Betrüger »Experten« oder »Lobbyisten«. Und wer ihrem Rat nicht folgen will, den erklären sie ohne Umstände für unfähig oder nicht hinreichend sachkundig. Nur dass sie das meist vornehm »Beratungsresistenz« nennen.
Auch im Märchen fällt das Volk auf derlei Propaganda herein und bejubelt die Pracht der nicht vorhandenen Gewänder. Mehr noch: Es ist sozusagen das demokratische Plebiszit, das die Täuschung erst in eine vermeintliche Realität verwandelt. Wenn alle der Unwahrheit huldigen, verwandelt sie sich scheinbar in Wahrheit. Das ist das Betriebsgeheimnis der Meinungsforschung.
Die Betrüger hatten Kaiser und Volk richtig eingeschätzt. Keiner wollte als dumm, niemand als untauglich gelten. Vor die Wahl gestellt, zu lügen oder sich eine derartige Blöße zu geben, entschieden sich fast alle für das erstere. Auch das Volk, dem die Betrüger selbst ihren Bären gar nicht aufgebunden hatten, will nicht glauben, dass die Obrigkeit derart töricht sein kann. Obwohl der Kaiser unzweifelhaft im Adamskostüm über die Straße schreitet, murmeln die Leute am Straßenrand: »Wie unvergleichlich sind des Kaisers neue Kleider! Welche Schleppe er am Kleide hat! Wie schön sie sitzt!« Ja, ihre untertänige Bewunderung scheint mit der Dreistigkeit des Betrugs sogar noch zu wachsen. Und wäre »BILD« dabei gewesen, das Blatt hätte wahrscheinlich am lautesten die Kunst der Weber gefeiert – und dazu noch ein Exklusivinterview mit dem begeisterten Meister der Weberinnung veröffentlicht.
Alles klappt wie am Schnürchen und wie von den Betrügern geplant. Bis, ja bis zu dem Augenblick, in dem ein kleines Kind, das einfach seinen Augen traut, laut ausruft: »Aber er hat ja gar nichts an!«. Und also bald gehen auch dem Volk buchstäblich die Augen auf, und es erkennt, dass der Kaiser nackt ist. »BILD« würde nunmehr mit einer neuen Schlagzeile aufmachen: »Unfähiger Kaiser reingelegt!« Das Exklusivinterview würde der Reporter mit den Eltern des klugen Kindes führen.
Und der arme Kaiser und sein Hofstaat? Sie wissen natürlich sofort, dass das Kind recht hat. Aber was sollen sie machen? Sie müssen ihre seltsame Parade bis zum bitteren Ende durchstehen …
Die große Blamage
»Des Kaisers neuer Kleider« ist die märchenhafte Antizipation der Finanzkrise 2008. Stellen wir uns vor, der Kaiser hätte Börsenanalysten, Bankexperten, Vertreter der Rating-Agenturen und seine klügsten Wirtschaftsprofessoren an die Börsen der Welt geschickt, um die allgemeine Wirtschaftslage und die globalen Konjunkturaussichten einzuschätzen. »Die Aussichten sind prima«, hätten sie allesamt gemeldet, »die Wirtschaft prosperiert.« Professor Hans-Werner Sinn, Krone der deutschen Nationalökonomie, hätte vermutlich sogar vor einer »Überhitzung der Konjunktur« gewarnt. Zu einem Zeitpunkt, als gar kein Feuer mehr im Ofen war.
Die globalen Wirtschaftshelden, die »Masters of the Universe«, sie haben die Weltöffentlichkeit, ihre Kunden und die Politik an der Nase herumgeführt: Noch am 12. März 2008 erklärte der Chef der Investmentbank Bear Stearns, Alan D. Schwartz, das Institut habe genügend Liquidität und man sei mit den Gewinnschätzungen der Analysten für das erste Quartal zufrieden. Gerüchte über Zahlungsschwierigkeiten seien »absolut lächerlich«. Acht Tage später musste die Bank mit Hilfe von Staatsgeldern gerettet und an den Konkurrenten JP Morgan verkauft werden.
Selbst Kanzlerinnen-Berater Josef Ackermann von der Deutschen Bank, der Mann mit den Super-Renditen, wusste es nicht besser. Er behauptete noch kurz vor der Pleite der Investment-Bank Lehman Brothers, es gäbe keine systemischen Risiken in der Weltfinanzordnung. Inzwischen haben die angeblich gar nicht vorhandenen Risiken einen weltweiten Wohlstandsverlust von mindestens 15 Billionen Dollar verursacht. Das ist ungefähr das 35-fache des deutschen Bundeshaushaltes. Island, Irland, Griechenland standen am Abgrund. In Portugal, Spanien, Italien proben die Spekulanten die Macht.
Die Staatenlenker der G7-Gruppe lobten noch zu Beginn des Jahres 2008 die robuste Weltkonjunktur. Mitte Juli 2008 erklärte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung: »Der Aufschwung geht in die Verlängerung.« Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut gab noch nach dem Zusammenbruch von Lehmann Brothers Entwarnung. Führende Mitarbeiter der IKB Deutsche Industriebank AG, in deren Aufsichtsrat Spitzenleute aus Politik und Wirtschaft saßen, überwiesen noch Geld an Lehman Brothers, als die Bank schon dichtgemacht hatte. Die internationale Finanzelite war derart unvorbereitet auf eine drohende »Kernschmelze« der Geld- und Kreditmärkte, dass sie sie nicht einmal bemerkte, als diese in vollem Gange war. Was aber soll man von Leuten halten, die in hohepriesterlichem Ton blumige »Prognosen« verkünden – und nicht einmal gegenwärtige und zurückliegende Entwicklungen richtig einschätzen können? Niemand von diesen gescheiten Leuten hat das Desaster kommen sehen. Alle verließen sich darauf, was die anderen gesagt hatten, um selber nicht als dumm zu gelten – ganz so wie am Hofe des Kaisers.
Nie hat sich eine Zunft, die beansprucht, eine strenge Wissenschaft zu vertreten, mehr blamiert als die Ökonomen. Ihre Auskünfte entpuppten sich als ähnlich seriös wie die von Astrologen. Eine alte Spekulantenweisheit besagt, dass man dann besser ist als die anderen, wenn sich 51 Prozent der eigenen Entscheidungen als richtig erweisen. Was diese Weisheit unterschlägt: Auf dieselbe Quote kann man auch kommen, wenn man einen Gorilla mit Pfeilen auf eine Zielscheibe werfen lässt. Oder wenn man seine »Prognosen« mit Hilfe einer Glaskugel ermittelt. Es gibt auch sonst viel Ähnlichkeit zwischen modernen Wirtschaftsexperten und mittelalterlichen Hofschranzen. So erfüllen sie weitgehend jene Funktion, welche einst die Hofastrologen für einen Fürsten hatten. Deren Platz in der höfischen Hierarchie befand sich allerdings üblicherweise in der Nähe der Hofnarren.
Die Koryphäen der Wirtschaftswissenschaft und die journalistischen Deuter der Weltwirtschaft hatten vor dem Sommer 2007 keinen blassen Dunst von dem, was sich zum größten finanzwirtschaftlichen GAU aller Zeiten entwickeln sollte. Als der GAU dann eintrat, waren die Marktideologen am Ende ihres Lateins und riefen entgegen all ihren Glaubenssätzen nach dem Staat. Nicht die Selbstheilungskräfte des Marktes, sondern »eine ganze Reihe von hoheitlichen Gewaltakten«, so der SZ-Journalist Thomas Steinfeld, verhinderte das Schlimmste.
Was tun mit diesen Wirtschaftswissenschaftlern? Dass sie »nicht wissen, was sie nicht wissen können«, wie der Ökonom John Gray (1724 – 1811) einmal über seine Zunft bemerkte, kann man ihnen nicht vorwerfen. Dass sie aber nicht wissen, dass sie nicht alles wissen können, ist schuldhafte Arroganz. Es war die Anmaßung der Volkswirtschaftslehre, sich als exakte Wissenschaft zu gebärden, welche das Desaster der Wissenschaft von der Wirtschaft auslöste. Wirtschaft ist Menschengeschäft. Und Menschen bleiben nun einmal ihrem Wesen nach weitgehend unberechenbar.
Der Grundirrtum der neoliberalen Wortführer vom Typ des Nobelpreisträgers Gary Stanley Becker ist, dass sie einem imperialistischen Rationalismus frönen, »der alles menschliche Handeln nach Maßstäben bewusster Entscheidungen zu beschreiben versucht – Kategorien, die nicht einmal dann gelten, wenn man sie nur auf das Verhalten am Markt bezieht« (John Gray). Der Mensch, so diese Denkweise, ist immer ein rationaler Nutzenmaximierer. Dass er sich meist aufgrund eher dünner Informationen oder gar aufgrund rein emotionaler Antriebe für oder gegen etwas entscheidet, wird weitgehend ausgeblendet. Eine solche Wirtschaftswissenschaft bleibt deshalb auf Distanz zu gesellschaftlichem und politischem Denken. Beides könnte ja die Reinheit des Rechnens beschmutzen. »Vernunft ist Rechnen«, hatte der Philosoph Thomas Hobbes behauptet. Gleichzeitig hatte er die Behauptung aufgestellt, der Mensch sei des Menschen Wolf (homo homini lupus). So gesehen wäre der Mensch das Tier, das ständig kalkuliert, wie es seinem Nächsten so schaden kann, dass für ihn das Meiste dabei herausspringt. Ein trostloses, zudem auch noch wissenschaftlich völlig überholtes Menschenbild.
Nicht minder versagt haben die Orakel der Hochfinanz: Die drei großen Rating-Agenturen Moody’s, Standard & Poor und Fitch sind so etwas wie globale Platzanweiser der Finanzmärkte. Sie entscheiden über die Kreditwürdigkeit von Banken, Unternehmen und Staaten. Und sie bewerten achtzig Prozent der weltweiten Kapitalflüsse. Dabei versahen sie faule Kredite noch mit Auszeichnungen, als der erste Gestank bereits aus den Luftblasen der Börsenspekulation entwichen war.
Der Kalifornische Pensionsfonds Calpers zum Beispiel verlor mit Papieren, denen die Rating-Agenturen höchste Bonität attestiert hatten, eine Milliarde Dollar. Jochen Sanio, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), nannte die privaten Rating-Agenturen zu Recht »eine der größten unkontrollierten Machtstrukturen im Weltfinanzsystem«.
Ludwig Erhard besaß – Gott sei Dank – eine ausgeprägte Abneigung gegen die mathematisierte Volkswirtschaftslehre. Mit ihrer Hilfe hätte er weder die Währungsreform zum Erfolg geführt noch soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik durchgesetzt. Erhard stützte sich stattdessen lieber auf Alfred Müller-Armack, der den Begriff »soziale Marktwirtschaft« als erster geprägt hat. Der Nationalökonom war von Haus aus Religionssoziologe.
Die Liturgie der Globalisierung
Wie einstmals am Hofe des eitlen, modesüchtigen Kaisers redeten auf dem internationalen Parkett der wirtschaftlichen und politischen Eliten alle lange einander nach dem Munde. Wer als gescheit gelten wollte, malte die Globalisierung in goldenen Farben. Die heilige Trinität der Weltreligion des Finanzkapitalismus hieß Deregulierung, Privatisierung und Kostensenkung. Dieser dreieinige Fetisch wurde verehrt wie einst in der Französischen Revolution die Göttin der Vernunft. In deren Namen hatte sich zunächst das Bürgertum von den Fesseln einer überkommenen Feudalwirtschaft befreit. Dann köpften Robespierre und seine Gefolgsleute in ihrem Namen erst die Vertreter der alten Ordnung, anschließend alle anderen, die nicht bis aufs I-Tüpfelchen nach dem jakobinischen Katechismus beten wollten. Am Ende verwüstete Napoleon in ihrem Namen halb Europa.
Gewiss, die Kardinalskollegien des Kapitalismus verzichten auf Scheiterhaufen, Schafott und militärische Schlachten. Sie exkommunizieren ihre Widersacher vielmehr, indem sie die von Menschen gemachten Regeln und Strukturen unserer Weltwirtschaft zu höheren Mächten oder gar zu einer Art von Naturgesetzen erklären. Gegen diese sich widersetzen zu können, das glauben natürlich nur Dummköpfe oder Demagogen.
Also zelebrierten die neoliberalen Ökonomen die Liturgie der Liberalisierung, bis auch die letzten Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft die Regeln der Finanzmärkte für den einzig wahren Glauben hielten. Ganze Regierungen fühlten sich geschmeichelt, wenn sie von Experten und Kommissionen gelobt wurden, die sie zuvor selbst eingesetzt hatten. Immer mehr Regeln wurden immer schneller aufgehoben, auf dass sich die Spekulanten ungehemmt Bahn brechen konnten. Jedes halbwegs entwickelte Industrieland kannte irgendwann keine Parteien mehr, sondern nur noch Propheten des unregulierten Geldflusses. Ein sozialdemokratischer Bundeskanzler wie Gerhard Schröder oder ein Labour-Premier wie Tony Blair entpuppten sich als neoliberale Musterschüler. Schröder ließ sich etwa von der Finanzlobby die Börsenumsatzsteuern ausreden. Das sollte den Finanzplatz Deutschland, Hauptstadt Frankfurt, stärken. Der Finanzplatz London floriert trotz Börsenumsatzsteuer. Babynahrung, Hundefutter, Medikamente, Bücher: Für alles erheben wir Umsatzsteuer, aber wir weigern uns, diese für Finanztransaktionen zu erheben, selbst wenn diese giftig sind.
Nicht einmal die traditionell wirtschaftskritischen Grünen wagten noch zu widersprechen, als in Deutschland ausgerechnet eine rot-grüne Koalition den Verkauf von Unternehmensanteilen von der Steuer befreite, und damit dem Getriebe des Aktienhandels ein bis dato ungeahntes Schmiermittel verschaffte. Banken, die über Jahrzehnte als Anteilseigner wie als Kreditgeber die inländische Wirtschaft mit produktivem Kapital versorgt hatten, trennten sich binnen Wochen von ihren Beteiligungen, als handle es sich um faules Obst. Damit bekamen sie die Hände frei für das scheinbar lukrativere globale Investment-Banking. Zusammen mit ihrer traditionellen Stellung in der »Deutschland-AG« verloren sie dabei allerdings ihre unternehmerische Bodenhaftung und ihren praktischen Sachverstand. Irgendwie konnte man es den Bankvorständen zunächst nicht mal verübeln, dass ihnen Eigenkapitalrenditen von 25 Prozent und mehr seliger waren als solide, realwirtschaftliche Investitionen, die sich mit 5 Prozent per annum verzinsen.
Doch dass phantastische Gewinnaussichten stets mit ebenso phantastischen Risiken behaftet sind, wurde munter verdrängt. Je höher die Coupons undurchsichtiger Finanzprodukte und windiger Wettscheine notierten, umso lauter pfiff die Internationale der Investment- und Hedgefonds-Manager, der Bankvorstände und Börsengurus das Lied der freien Finanzmärkte. Am Ende stimmten selbst solche Manager und Unternehmer in den Chor ein, die im Grunde wussten, dass sie mit ihrem Stammgeschäft bei der Rendite-Rallye kaum würden mithalten können. Kein Wunder, dass sich am Ende auch viele konservative Finanzvorstände an den Börsen verzockten, um ihren von Gier geblendeten Aktionären zum Jahresende möglichst aufgeblähte Bilanzen präsentieren zu können. Ja sogar biedere Stadtkämmerer schlitterten plötzlich über die Parketts, weil sie hofften, durch Privatisierung von Tafelsilber oder mithilfe waghalsiger Kreditpapiere ihre drückenden Schulden im Schnellverfahren loszuwerden.
Befeuert wurde die Blasenwirtschaft von einer pseudo-ökonomischen Geschwätzigkeit ohne Maß und tieferen Sinn. Das atemlose Börsenfernsehen der privaten Nachrichtensender wurde zum Muster fast der gesamten Wirtschaftsberichterstattung. Statt Zusammenhänge zu erläutern, setzt dieser Adhoc-Journalismus auf eine Häppchenkost, deren Verfallsdatum immer mehr dem gleicht, was auch »die Märkte treibt«: PR-Luftballons von Unternehmen, Parkettgerüchte und halbgare Einschätzungen von »Analysten«, deren Brötchengeber ihr Geld mit exakt den Papieren verdienen, die sie gerade vor laufender Kamera anpreisen. Am unteren Bildrand laufen derweil Kurse und Katastrophennachrichten nebeneinander her, als sei das alles ein und dasselbe. Zeitweise lagen an den Kiosken mehr Zeitschriften mit Wörtern wie »Money« und »Investor« im Titel aus als Klatschblätter oder Sportzeitschriften. Studienräte drängelten sich zu Hunderten in »Anlegerseminaren«. Und vom ursprünglich verschwiegenen, exklusiven »Weltwirtschaftsforum« im Schweizer Nobelkurort Davos wurde berichtet wie von einem Gipfeltreffen bedeutender Staatsmänner – nicht zuletzt, weil immer mehr Politiker die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen, sich im Licht der internationalen Managementelite zu sonnen. Wirtschaft – von Weltmarktfans meist »Business« genannt – als globales Event.
Finanzkapitalismus als Hochstapelei
Die hektische Partylaune, die da verbreitet wurde, hätte man zur Not noch ertragen. Immerhin wurden von der Regierung ja nicht vier Stunden n-tv pro Tag oder das Abonnement eines Börsenbriefes zur Bürgerpflicht erklärt. Doch leider fielen auch die meisten Hemmungen, die die eigentliche Wirtschaft vor Exzessen schützen sollen. Zum Beispiel die einfache Regel, dass man eigentlich nur so viel ausgeben darf, wie man eingenommen hat; jedenfalls nicht mehr, als man einigermaßen überschauen kann. Der Kredithunger entfernte sich stattdessen völlig aus der Reichweite der Rückzahlungsmöglichkeiten. Vor allem das Leistungsbilanz- und das Haushaltsdefizit der USA saugten Geld aus aller Welt an. Neue Finanzinstrumente, Derivate genannt, die niemand mehr durchschaute, dazu Institute wie Hedge-Fonds und Private Equity-Fonds verstärkten den Finanz-Tsunami.
Der Finanzkapitalismus verwandelte sich mehr und mehr in eine Illusionswelt, in der die Herstellung nützlicher Güter und die Erbringung von Dienstleistungen mit dem verwechselt wurden, was doch eigentlich nur Mittel zum realwirtschaftlichen Zweck ist: Geld. Keine Frage, dass jede wirtschaftliche Transaktion Geldflüsse erzeugt. Keine Frage auch, dass in einer hochgradig arbeitsteiligen Weltwirtschaft viele Schritte zwischen Hersteller und Kunde mit Krediten zwischenfinanziert werden müssen. Doch die Finanzmärkte erlaubten dem Kredit ein derart unkontrolliertes Eigenleben, dass er schließlich in ein reines Credo zurückverwandelt wurde. Irgendwann überstieg die Summe der weltweiten Finanztransaktionen die des Welthandels um mehr als das Hundertfache. Erwartungen wurden für Wirklichkeit gehalten. Illusion, Hoffnung und Erwartung stapelten sich wechselseitig hoch.
Kredite sind Erwartungen an die Zukunft. Eine Bank leiht einem Unternehmen Geld, weil sie von seiner Geschäftsidee überzeugt ist. Sie rechnet mit künftigen Erlösen, aus denen die Schulden bedient werden, und mit Gewinnen, von denen sich ein vernünftiger Zins abzwacken lässt. Eine Bank leiht Ihnen oder mir Geld, weil sie immerhin darauf hoffen kann, dass wir mit ehrlicher Arbeit absehbar genug verdienen werden, um den Kredit zu tilgen – selbst wenn wir ihn für ein Sofa oder eine schöne Reise aufnehmen – sprich: zur Finanzierung von Konsum statt von Investitionen.
Doch Erwartungen, die an keine realen Wahrscheinlichkeiten mehr gebunden sind, gleichen dem Geld, hinter dem keine Arbeit steht. Sie sind im Grunde Träume. Hohlräume, die sich mit Luft füllen. Zirkusclowns produzieren mit einer speziellen Lauge riesige, bunt glitzernde Seifenblasen. Banken, Fonds und Investment-Gesellschaften produzierten mit viel spezielleren Tricks riesige Finanzblasen. Beiden Arten von Blasen ist freilich eines gemeinsam: Sie steigen in die Luft, das erstaunte Publikum ruft laut »Ah!« und »Oh!« – bis die Blase platzt.
Im Zirkus geben wir uns allzu gerne dem schönen Schein hin. Doch leider tat auch in der Finanzblasenwelt jeder so, als hätte er das Schauspiel zum ersten Mal erlebt. Dabei platzen Finanzblasen in regelmäßigen Abständen und mit der gleichen Zuverlässigkeit wie die Seifenblasen im Zirkus. John Kenneth Galbraith, verstorbener Altmeister der amerikanischen Wirtschaftswissenschaften, meinte einst, das Gedächtnis reiche in der Finanzwelt lediglich zwanzig Jahre zurück. Galbraith hat das Erinnerungsvermögen der Ökonomen wohl überschätzt. Der Abstand zwischen der Internet- und der Hypothekenblase war nicht einmal halb so groß. Alan Greenspan, einst verklärter, heute zu recht hart kritisierter Ex-Chef der amerikanischen Notenbank, löste vor nicht einmal zehn Jahren die Internet-Krise durch die Vorbereitung der Hypotheken-Krise auf. Der Realzins, der Preis des Geldes, sank gegen Null. Pump wurde auf Pump finanziert. Die Nachfolgeblase sog die Vorgängerblase auf. Seine an sich erschreckend simple Politik des billigen Geldes umgab Greenspan allerdings mit dem Glanz eines magischen Spektakels. Ein Wimpernschlag von ihm – und die Börsenkurse wackelten. Ein Murmeln, und Finanzgurus wie Finanzminister erstarrten. Seine ganz bewusst rätselhaften Verlautbarungen verhalfen ihm zum zweifelhaften Ruhm eines »Kryptomanen«.
Was aber taten die in der staatlich verordneten Geldschwemme badenden US-Banken? Sie schraubten die Bedingungen für die Gewährung von Krediten immer weiter nach unten und reduzierten damit die Sicherheit ihrer Rückzahlung. Das Geld wurde wie Kamelle im Kölner Karneval unters Volk geworfen. Wer ein Formular ausfüllen und seinen Namen schreiben konnte, erhielt Geld von der Bank. Die Sparquote in Amerika sank zeitweise unter Null, und die Eigenheimpreise stiegen und stiegen – zunächst. Weil die Amerikaner sich daher auf dem Papier reich fühlten, beliehen sie ihre auf Pump gekauften Häuser gleich noch einmal, um sich von diesem Geld die Möbel, das Auto in der Garage und die Kleider im Schrank zu kaufen. Den vielen regionalen Hypothekenbanken wurde bei der Sache natürlich bald mulmig, weshalb sie ihre Kredite möglichst schnell an größere Institute weiterreichten. Diese bündelten sie zu raffiniert verschleierten Kreditbriefen, die man sodann in alle Welt verscherbelte. Die Rating-Agenturen segneten den Prozess ab und verdienten dabei gut.
Zum Schluss konnten selbst US-Bürger ohne festes Einkommen und ohne jedes Eigenkapital ein Eigenheim erwerben. Diese Nachfrage-Explosion wiederum reizte die Immobilienspekulanten: Bald wurden ahnungslosen Käufern auch die letzten windschiefen Bruchbuden in heruntergekommenen Provinznestern als Traumhäuser in Bestlage aufgeschwatzt. Damit war der baldige Preisverfall auf dem Wohnungsmarkt endgültig programmiert.
Der Werbespruch »Kaufe jetzt, zahle später!« wurde auf die Spitze getrieben. Das wahre Geschäftsgeheimnis lautete nun: »Zahle nie!«. Damit verhielt sich die Finanzwelt wie jener Mann, der aus dem Fenster eines zwanzigstöckigen Hauses stürzt. Als er am 5. Stock vorbei fliegt, denkt er: »Ist es bis jetzt gut gegangen, wird es auch weiter gut gehen.« Andere ahnten zwar Schlimmes, tanzten aber weiter. Der Chef der Citibank, Charles Prince, soll gesagt haben: »Wenn die Musik aufhört, wird es in Bezug auf die Liquidität schwierig werden. Aber solange die Musik spielt, muss man aufstehen und mittanzen. Wir tanzen immer noch.« So hatte es mehr als zwei Dekaden lang funktioniert. Doch diesmal war die Blase zu groß, um sie durch eine nachfolgende, noch größere Blase aus der Welt zu schaffen. Als die Eigenheimpreise fielen, war das Blaskonzert über Nacht zu Ende.
Was allenthalben »Globalisierung« genannt wird, das ist zu weiten Teilen eine rein virtuelle Finanzakrobatik, die nur am Laufen gehalten werden kann, solange alle der Geldillusion erliegen. Die größten Gaukler sind die bewunderten Gurus der Finanzwelt. Sie sind allerdings Überlebenskünstler, und außer ein paar spektakulären Fällen, in denen Strafen als Alibi für die scheinbar unveränderte Seriosität der Geldwechsler herhalten müssen, fallen die meisten der großen Betrüger bis heute selbst nach dem größten Desaster wieder auf die Füße.
Nick Leeson hatte 1995 als kleiner Devisenhändler in Singapur die Barings Bank, die älteste Investmentbank Großbritanniens, in den Ruin getrieben. Nach sechs Jahren Haft kehrte er nach London zurück – und war nach eigener Aussage innerhalb einer Woche schon wieder Besitzer von fünf neuen Kreditkarten. Er verdient inzwischen gutes Geld, indem er auf Finanzkongressen amüsierten Zuhörern seine Tricks verrät.
George Soros wirbelte Anfang der Neunziger Jahre die internationale Finanzwelt durcheinander. Er zwang das britische Pfund in die Knie, verdiente dabei viel, viel Geld und missioniert heute mit diesem Geld die Welt, um sie vor den Häresien zu bewahren, mit denen er einst reich geworden ist.
Jérôme Kerviel war eher ein kleiner Mitläufer im großen Bankapparat der französischen Société Général. Sein Jahressalär betrug weniger als 100.000 Euro. Doch in drei Jahren baute er ein Kartenhaus aus 143.904 Terminkontakten mit einem Volumen von 50 Milliarden Euro auf. Dabei bediente er sich zahlreicher Scheingeschäfte, bei denen in Wahrheit kein einziger Cent floss. Erstaunlicher Weise wirtschaftete der tüchtige Mann allerdings nie in die eigene Tasche. Es war offenbar nicht private Gier, sondern pure Freude am Spiel, die ihn zu seinen Höchstleistungen trieb. Am Ende hatte Kerviel 4,82 Milliarden Euro verzockt. Das ist kein Kleingeld. Davon hätte man 112.000 französische Lehrer ein Jahr lang bezahlen können. Wie aber konnte ein »kleines Licht« wie Kerviel, der seine Prüfungen mit Ach und Krach bestanden hatte, die Revisoren und erleuchteten Finanzgenies seines angesehenen Bankhauses drei Jahre lang hinters Licht führen? Kerviel hatte 2007 einen Profit von 1,4 Milliarden Euro erzielt. Das reichte offenbar als Deckungssumme für das blinde Vertrauen seiner Vorgesetzten. Dabei lag das Volumen seiner Wettscheine beim 1,7fachen des Eigenkapitals der Bank. »Gier frisst Hirn«, sagen sogar die Börsianer. Kerviel soll den von ihm angerichteten Schaden laut Gerichtsurteil übrigens ersetzen. 4,9 Milliarden Euro! Um diesen Traum der blinden Justitia wahr zu machen, müsste der junge Mann, der heute für eine EDV-Beratungsfirma tätig ist, selbst bei einem sechsstelligen Jahresgehalt gut viertausend Jahre arbeiten. Man sieht: Arbeit ist dem Geld nicht gewachsen. So viel, wie man mit Geldgeschäften gewinnen (oder eben verlieren) kann, kann mit ehrlicher Arbeit kein Mensch verdienen. Dabei ist Jérôme Kerviel kein Krimineller, sondern nur der Prototyp eines hemmungslosen Zockers. Er handelte nicht gegen das System, sondern im System.
Mancher Systemspieler im Börsenroulettesaal trieb es noch dreister als Kerviel mit seinen Luftbuchungen. Eines der lange Zeit angesehensten Finanzgenies der Welt, Bernard Madoff, betrog seine Kundschaft um 50 Milliarden, in diesem Fall »nur« Dollar. Mit Charme, Cleverness und krimineller Abgebrühtheit griff er zu einem der simpelsten und ältesten Betrügertricks der Welt: dem Prinzip des Kettenbriefs. Er versprach jedem Kunden phantastische Renditen – die er freilich niemals durch Anlage des eingesammelten Kapitals erzielte, sondern dadurch, dass er einfach das Geld seiner früheren Kunden an die nächstfolgenden weiterreichte. Über ein Jahrzehnt lang funktionierte der Betrug – schlicht weil der Betrüger beliebt war. So gehörte Madoff etwa zu den bedeutenden Spendern beider politischen Parteien in den USA sowie zahlreicher karitativer Organisationen. Unter seinen Gläubigern fanden sich viele große Namen der amerikanischen High Society, ebenso wie andere Profi-Zocker des Finanzsystems, aber natürlich auch zahllose unschuldige, kleine Mitläufer. Madoff wurde 2009 zu 150 Jahren Gefängnis und 120 Milliarden Euro Schadensersatz verurteilt. Eine Summe, die nicht einmal ein unsterblicher Neandertaler hätte abarbeiten können, wenn er bis auf den heutigen Tag gegen ehrlichen Lohn schuften würde.
Im Rückblick erscheinen die Wettspiele der großen und kleinen Zocker, der Profis und der Amateure, der großen Banken und der kleine Leute sehr oft als verblüffend einfach: Ein Anleger kann sich zum Beispiel mit dem Kauf eines so genannten »Futures« das Recht sichern, eine bestimmte Menge von Aktien – einzelne Papiere oder Indexmischungen wie den DAX oder Dow Jones – zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen. Liegen die künftigen Kurse über diesem Preis, macht er ein gutes Geschäft. Liegen sie darunter, zahlt er drauf. Das Schöne an diesen Wetten ist, dass die Bank immer gewinnt. Denn für jede »Call«-Position gibt sie eine exakt gleiche Zahl von »Puts« aus. Das ist eigentlich ein Nullsummenspiel. Aber die ausgebende Bank kassiert natürlich von beiden Wettpartnern Gebühren. Die sorgen dafür, dass von 102 Dollar der 101. und 102. immer an die Bank gehen. Im Casino sorgt dafür die Null, ohne die Roulette ebenfalls ein reines Nullsummenspiel wäre.
Die Krise der internationalen Währungs- und Finanzordnung sollte eigentlich dafür sorgen, das globale Illusionstheater zu entlarven. Falls die Welt nicht erkennt, dass der Kaiser nackt ist, ist ihr nicht mehr zu helfen. Doch leider ziehen die Kurse schon wieder an, wenn auch oft nur bis zur nächsten Horrormeldung. Bankmanager, die 2008 oft nur knapp dem Kittchen entrinnen konnten, streichen schon wieder fette Bonuszahlungen ein. Institute, die damals am Abgrund standen, verdienen wieder prächtig, das Renditeziel der Deutschen Bank etwa liegt unverändert bei 25 Prozent. In der Realwirtschaft wäre das ein Traumergebnis, gelten doch in der Industrie Renditen von mageren 5 oder 6 Prozent als Spitzenleistung. Wie aber soll Geld in das Geschäft mit Arbeit und Gütern fließen, wenn mit Geld allein so viel mehr Geld verdient werden kann?
Geld regiert die Welt
Geld ist der Stoff, aus dem die Träume des Finanzkapitalismus geschneidert sind. Wie weit die Täuschung getrieben wurde, zeigt sich schon an dem unwidersprochenen Versprechen, dass »Geld arbeitet«. Dabei macht es doch keinen Finger krumm. »Mit eigenen Augen gesehen habe ich es nie, wie Geld arbeitet. Entweder habe ich Geld gesehen oder Arbeiter«, stellt der Bankkassierer in Max Frischs Stück »Graf Öderland« fest. Und er hat recht. Geld schafft keine Werte. Geld ist seiner Natur nach nur ein wirtschaftliches Mittel. Ein nützliches Vehikel, wenn es als Tauschmittel, als Recheneinheit oder zur Aufbewahrung von Werten eingesetzt wird – mehr nicht!
Die großen Finanzkapitalisten und ihre intellektuellen Hehler haben das Geld jedoch mit einer Wertschöpfungsillusion ausgestattet. Dem Geld wurde mit dem gleichen Trick, mit dem die vermeintlichen Stoffweber und Hofschneider des Kaisers arbeiteten, eine Rolle zugeschanzt, die ihm nicht zukommt. Das Geld hat sich von seinem instrumentellen Charakter emanzipiert, und ist vom Mittel zum Zweck geworden. Geld maßt sich Eigenschaften an, die herkömmlicher Weise Substanzen und Subjekten eigen sind. Geld ist jedoch nichts Selbstständiges.
Das Geld und seine Geschwister Aktie, Anleihe, Zertifikat oder Derivat generieren jedoch inzwischen mehr Geld, als jede Produktion Güter hervorbringen kann. Das Geld läuft den Waren davon. Es ist gleichsam auf der Flucht vor der Realität und verursacht als Phantom eine gigantische ökonomische Konfusion. Während 1980 die »Finanzprodukte« noch der Weltgütermenge entsprachen und beide ungefähr ein Volumen von 12 Billionen Dollar umfassten, sind 25 Jahre später aus diesen 12 Billionen Dollar in Form von Aktien, Anleihen, Schuldtiteln aller Art oder Bankeinlagen 150 Billionen Dollar geworden. Der Wert von Gütern und Dienstleistungen erhöhte sich dagegen im gleichen Zeitraum weltweit nur auf rund 60 Billionen Dollar. Allein das Handelsvolumen der Terminbörse Eurex war 2006 beispielsweise 46 Mal größer als das deutsche Bruttoinlandsprodukt.
Tatsache ist, dass die reale Wirtschaft gegenüber dem Finanzkapitalismus zur Restgröße schrumpft. Die Welt der Arbeit und die Welt des Geldes trennen sich voneinander. Aus der Zweiklassengesellschaft wurde die Zweiweltenwirtschaft. Arbeit und Geld haben nur noch wenig miteinander zu tun.
Die amerikanische Notenbank wies zur Jahresmitte 2008 58,8 Billionen Dollar an öffentlichen und privaten Krediten aus. Dem stand eine Wirtschaftsleistung von nur 14,2 Billionen Dollar gegenüber. Die USA erreichten so eine nie da gewesene Schuldenquote von 370 Prozent. Folge: Es ist mehr Geld in der Welt unterwegs, als sich überhaupt Anlagemöglichkeiten dafür finden lassen. Und nur ein Bruchteil des Geldes wird noch für Konsum oder Investitionen ausgegeben. Weltweit betrug der Anteil der Realwirtschaft am gesamten Geldverkehr 2008 gerade einmal 0,4 Prozent. Umgekehrt bedeutet dies: 99,6 Prozent aller getätigten Investments haben nichts mehr mit der realen Wirtschaft zu tun. Etwas anschaulicher formuliert: Von jedem Dollar, Euro oder Yen, der irgendwo auf der Welt zu Buche steht, wird heute nicht einmal mehr ein halber Cent für Brot, Bücher, Kleidung und Autos, für Löhne und Gehälter, für Maschinen und Rohstoffe, für Champagner und Villen im Tessin oder für Flugzeugträger ausgegeben!
Das durchschnittliche Nettoeinkommen eines deutschen Haushaltes liegt derzeit bei knapp 2700 Euro. Verhielte sich eine Familie nach den Spielregeln der Weltwirtschaft, dann dürfte sie monatlich, man kann es kaum glauben, nur 10,80 Euro für ihren gesamten Lebensunterhalt ausgeben. Den »Rest« müsste sie in Devisenspekulationen oder DAX-Futures stecken.
Kürzlich kam deshalb eine der großen Wirtschaftskoryphäen, der Nobelpreisträger Edmund Phelps, auf eine scheinbar überraschende Idee: »Wir müssen zurückkehren zu altmodischen Banken, die Investitionen für reale Dinge finanzieren.« Ein origineller Vorschlag! Ungefähr so originell, als hätte man nach dem Untergang der Titanic den Reedern empfohlen, dass sie Schiffe bauen, die schwimmen.
»Nur Trottel tanzen, die noch größeren Trottel aber sehen zu«, fasste der amerikanische Investor Barton Bigas den Zynismus einer Finanzwelt zusammen, die ums Geld tanzt wie einst das auserwählte Volk ums Goldene Kalb. Die Israeliten machten sich entgegen dem Zweiten Gebot ein Bildnis von Gott, womit sie ihn lästerten und letztlich leugneten. Unsere Welt setzt die Vergötzung des Geldes an die Stelle ehrlicher Arbeit und unternehmerischen Einsatzes. Damit wird das Geld zu einem Symbol der Realitätsvergessenheit und – verleugnung. Es maskiert sich als Produkt, erschleicht sich im Unwort »Finanzprodukte« sogar den Namen dafür. Wo ist das Kind, das endlich sagt, dass die Kaiser und Könige der Geldwirtschaft nackt sind? Oder wird es uns gehen wie Midas, dem mythischen König von Phrygien? Er erbat sich einst von Dionysos die Gnade, dass alles, was er berühre, zu Gold werde. Der Gott tat ihm den Gefallen. Alles, was Midas anfasste, verwandelte sich in das Ziel seiner Gier, auch jeder Schluck Wasser und jeder Bissen Brot. Midas konnte nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Und hätte Dionysos sein Jammern und Klagen nicht erhört und den Fluch von ihm genommen, Midas wäre jämmerlich verhungert und verdurstet.
Tatsächlich verwandelt sich zwar nicht alles in der Welt in Geld, aber mithilfe des Geldes lässt sich in unserer Welt fast alles in alles verwandeln. Damit spielt das Geld in einer monetaristischen Gesellschaft die gleiche Rolle, die der Hostie im Geheimnis des Glaubens an die Transsubstantiation zukommt, der Wandlung von Brot und Wein in das Fleisch und Blut Christi. Seine Funktion als Allesverwandler verleiht dem Geld einen pseudoreligiösen Nimbus. Nur dass wir hier nicht das Geheimnis der Erlösung unseres Daseins erleben, sondern seiner Verdrängung. Die virtuelle Welt der Finanzen erdrückt die reale Welt der Güter, der Leistungen, der Arbeit. Der Schein besiegt das Sein.
Diese völlige Verkehrung unserer Wahrnehmung führt, wie der amerikanische Soziologe Benjamin R. Barber gezeigt hat, zugleich zu einer ungeheuerlichen Infantilisierung der Gesellschaft. Der Prozess des Erwachsenwerdens ist herkömmlicher Weise ein Abschiednehmen von kindlichen Allmachtsphantasien und utopischen Träumen. Die Hörner der infantilen Illusionen stoßen sich an den Widerständen des Lebens ab. Im Widerstreit zwischen Ideal und Realität vollzieht sich Erziehung. Was aber geschieht, wenn die Realität schwindet? Wenn wir ewig in dem Glauben leben, alle unsere Wünsche ließen sich sofort erfüllen, weil man doch alles kaufen kann? Wenn wir sogar glauben, das Wünschen selbst kenne keine Grenzen, so wie die Geldgier offensichtlich unstillbar ist? Dann bleiben wir ewig Kinder.
Unbemerkt haben wir es heutzutage mit einer schleichenden Regression der Gesellschaft zu tun. Jeder will zwar länger leben, aber niemand will alt werden. Achtzigjährige kostümieren sich wie Disco-Besucher, Dreißigjährige spielen noch im Sandkasten der Universität und drücken sich vor dem Ernstfall des Lebens. Die Gesellschaft flüchtet in eine kindliche Idylle, um sich die Zumutungen der Wirklichkeit vom Hals zu halten. Es ist eine permanent-pubertäre Wohlfühlphase, welche die Kindheit golden und endlos erscheinen lassen soll. Anstelle des Kant’schen kategorischen Imperativs tritt ein katalogischer Infantilismus: »Kauf’ alles, was Du haben kannst!«. Aber auch Karl Marx hat sich geirrt. Nicht die produktiven Kräfte sprengen die Produktionsverhältnisse, sondern die ständig unbefriedigten konsumtiven Gelüste sprengen die Gesellschaftsverhältnisse.
Vom Hochmut der Bankiers
Hochmut kommt vor dem Fall. Die meisten Finanzgenies hielten sich für die neuen Götter der Globalisierung, für die »Masters of the Universe«. Der ehemalige Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer verkündigte 1994 in Davos mit leisem Tremolo in der Stimme den Mächtigen der Erde: »Die Geldmärkte werden zunehmend die Rolle von Polizisten spielen (…) Die Politiker müssen begreifen, dass sie in Zukunft der Kontrolle der Finanzmärkte und nicht nur den nationalen Debatten unterworfen sein werden.« Die so gescholtenen Politiker spendeten damals zu ihrer öffentlichen Entmachtung devot Beifall.
15 Jahre danach entpuppt sich die globale Geldpolizei als eine Art von Geldmafia, und die Politiker, die sich nach Tietmeyers Empfehlung der Disziplin der Geldmärkte unterwerfen sollten, sind jetzt die Rettungssanitäter, die von den schwer angeschlagenen Finanzinstituten zu Hilfe gerufen werden. Die einst als Totalderegulierer und Privatisierer auszogen, sind mit zerrissenen Hosenbeinen und aufgehaltenen Händen in die Arme des einst verteufelten Staates, des »einzig wirklich imponierenden Kapitalisten« (Peter Sloterdijk), zurückgekehrt.
Rolf-Ernst Breuer, der ehemalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, hatte seinerzeit noch einen draufgesetzt und die Börsendemokratie über die politische gestellt. Schließlich werde bei allgemeinen Wahlen nur alle vier Jahre abgestimmt, während an der Börse eine tägliche Abstimmung stattfinde.
Später fügte Breuer hinzu: »Wenn die Politik im 21. Jahrhundert in diesem Sinne im Schlepptau der Finanzmärkte stünde, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht.« (Die ZEIT vom 27.04.2000) Jetzt sitzen die Schlepperkapitäne im Rettungsboot.
Herr Breuer wurde inzwischen von seinen Großaktionären aus dem Aufsichtsrat der Frankfurter Börse vertrieben. Auch Herr Tietmeyer sitzt nicht mehr im Aufsichtsrat der inzwischen verstaatlichten Hypo Real Estate. Er hatte die Tricks nicht durchschaut, mit denen sich diese Bank der Disziplin des einfachen, anständigen Steuerzahlers entzog, der bekanntlich seine Steuern in dem Land zahlt, in dem er es verdient. Wie viele andere Banken, gründete die HRE »Zweckgesellschaften« im Ausland, die keinem anderen Zweck dienten als dem, Steuern im Inland zu vermeiden. »Irland statt Inland!«, so hieß die Strategie, die von ebenso zahn- wie ahnungslosen Grüßaugusts in den Aufsichtsräten abgenickt wurde. Gegenwärtig kämpft die von den internationalen Großbanken künstlich aufgepumpte Volkswirtschaft der Grünen Insel gegen die Staatspleite. Die neoliberale Revolution frisst ihre Kinder.
Hilmar Kopper, einer der Vorgänger von Ackermann bei der Deutschen Bank, antwortete auf die Frage, ob es möglich sei, mit den Konsequenzen der heutigen Krise zukünftige zu vermeiden, mit einem schlichten »Nein«. Es sei zu viel Geld zu schnell bei zu wenig Leuten unterwegs (Süddeutsche Zeitung 22./23. Januar 2010). Ist die Geldergebenheit der Finanzbosse das letzte Wort der Gesellschaft? Nein!
P.S.: Die Obszönität der Finanzwelt entlarvt sich manchmal mit beiläufiger Symbolik. Auf dem Höhepunkt des Bankencrashs surften etliche Top-Leute der US-Börsenaufsicht SEC auf ihren Dienstcomputern täglich durch die Welt der Sex-Webseiten. Und das nicht etwa als kleiner Zeitvertreib zwischendurch, sondern gleichsam hauptberuflich. Ein Jurist der SEC-Zentrale hatte bis zu acht Stunden am Tag Pornos konsumiert. Andere klickten 16.000 Mal im Monat entsprechende Webseiten an. 17 der Ertappten gehörten mit einem Jahresgehalt von über 200.000 Dollar zu den Spitzenverdienern der Börsenaufsicht. Auch wenn das meist empört geleugnet wird: So eng sind die Varianten männlicher Gier miteinander verwandt.
2. Die Preisfrage: »Geld – warum?«
»Warum brauchen wir eigentlich Geld?«, fragte mich einmal Felize, eine meiner Enkelinnen, als sie acht Jahre alt war. Ich liebe diese kindlichen Warum-Fragen. Warum? Weil sie nach ihrer Beantwortung unausweichlich zu einem weiteren »Warum?« führen, und zwar ad infinitum. Vier Jahre ist das jetzt her, und noch immer quält mich Felizes Frage nach dem Warum des Geldes. Offiziell habe ich längst die weiße Fahne rausgehängt und die Frage auf sich beruhen lassen. Aber im Hinterkopf treibt mich das Problem seitdem immer wieder um. Ich habe einschlägige Lexika und Lehrbücher, dazu kluge Abhandlungen von Philosophen, Soziologen und Ökonomen über Geld gelesen. Vieles davon war so gescheit, dass es fast nicht wahr sein kann. Zum Glück bestehen Kinder auf der Wahrheit. Also habe ich versucht, die Früchte meiner Studien so einfach darzulegen, dass auch Felize verstehen kann, warum wir Geld brauchen. Nicht, dass sie irgendwann aufgehört hätte, »Warum?« zu fragen. Aber vielleicht sind wir der Sache ja wenigstens etwas näher gekommen.
Meine erste Antwort an Felize lautete damals: »Geld ist ein Tauschmittel.« Diese Erkenntnis entspricht ungefähr dem Wissensstand der Geld-Grundschule. Die Antwort ist schön und einfach. Man kann sich ohne Ende tolle Geschichten ausdenken, mit denen man die Tauschmittel-Theorie illustrieren kann.
»Stell Dir vor«, sagte ich zu meiner Enkelin, »wie in der Jungsteinzeit, also vor etwa 12.000 Jahren, lange nachdem sie von den Bäumen heruntergestiegen waren, ihr Fell verloren und den aufrechten Gang erlernt hatten, die Menschen sich in Jäger, Hirten und Ackerbauern aufteilten. Was war das ein großer Fortschritt! Denn nun machte nicht mehr jeder alles, sondern jeder das, was er am besten konnte, jedenfalls besser als die anderen.
Keine Frage, dass die Spezialisten mehr zuwege brachten als die, die nur aufs Geratewohl vor sich hingewurstelt hatten. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Jeder nach seinen Bedürfnissen. Diese frühsozialistische Regel war der erste Schritt zur Arbeitsteilung und der Anfang des Wohlstands. Der eine konnte wilde Tiere erlegen, der andere Tiere zähmen und hüten. Wieder andere machten aus den Fellen der Tiere Kleider. Und andere beackerten den Boden, säten und ernteten. Irgendwann fingen Einzelne an, sich auf das Backen von Brot, das Brauen von Bier oder die Herstellung von Hacken, Pflügen und allerlei anderen Dingen zu spezialisieren. Ihre Erfahrungen gaben sie an die nächste Generation weiter, und so wurden alle diese Dinge langsam besser, praktischer, nützlicher – und ihr Einsatz damit produktiver. Neben den Handwerkern kümmerten sich weitere Spezialisten um die Verteidigung, den Kontakt zu den Göttern oder die Oberaufsicht über die vielen Spezialisten. Weil viele mehr Güter herstellen konnten, als sie selbst benötigten, konnte sich die Gesellschaft sogar Leute leisten, die gar nichts herstellten.
Das einzige Problem: Je mehr die Menschen sich spezialisierten, umso mehr Dinge des täglichen Bedarfs mussten ständig den Besitzer wechseln. Dazu kam noch, dass Menschen in manchen Gegenden Dinge fanden oder herstellen konnten, die es anderswo überhaupt nicht gab. Also fingen die Menschen an zu tauschen. Aber ohne Geld war das eine mühsame Sache. Nicht immer hatte der eine genau davon zuviel, was der andere gerade besonders dringend brauchte. Um ein Kochgeschirr gegen Felle einzuhandeln, waren manchmal weite Umwege nötig. Und wenn der Bauer kein Bärenfell wollte, sondern einen besseren Pflug, dann konnte ihm der Jäger nicht helfen.
So erfanden kluge Köpfe ein Tauschmittel, das alle akzeptierten – das Geld. Ein Zahlungsmittel, mit dessen Hilfe man kreuz und quer tauschen konnte. Man suchte sich dafür der Einfachheit halber etwas aus, mit dem sich leicht rechnen ließ und das zudem noch relativ haltbar war, also zum Beispiel nicht schimmelte oder leicht zerbrach. Noch bevor Geld zu Gold emporgestiegen und später zu Papiergeld abgesunken war, erklärte man Sachen zu Tauschmitteln, die man auch ge- oder verbrauchen konnte, selbst wenn man sie gerade nicht als Tauschmittel einsetzte. Man konnte das »Geld«, wenn alle Stricke rissen, auch als Schmuck am Hals tragen oder zum Beispiel als Nuss essen. Geld war also am Anfang noch nützlich.
Später streifte das Geld das Kleid des Nützlichen ab und begnügte sich damit, wertvoll zu sein; irgendwann genügte es sogar, dass die Leute es nur für wertvoll hielten. Die Indianer tauschten mit den Mannschaften des Kolumbus Gold gegen bunte Glasperlen. Noch viel später kam man von der subjektiven Wertschätzung ab und suchte eine objektive. Bei Licht betrachtet war der objektive Wert allerdings nur das, worauf sich alle geeinigt hatten, notfalls auf höhere Anordnung. So ist es bis heute geblieben.
Geld ist kein Naturprodukt, sondern ein soziales Kunstwerk. Billiges Papier, aus dem Geldscheine gemacht sind, wird erst durch eine staatliche Garantie zu einer ›Währung‹ und damit wertvoll. So wird aus Schein Sein.«
So ungefähr habe ich das meiner Enkelin Felize damals erklärt. Um eine Antwort drückte ich mich damit allerdings herum. Warum kann man mit Geld reich werden? Ohne jemals einen Bären zu erlegen, ein Brot zu backen oder ein Auto zu bauen? Praktischer gefragt: Wie kommt man an Geld, wenn man gerade keins hat?
»Durch Arbeit.« Antwortete ich Felize etwas naiv. »Arbeitet das Geld auch?«, fragte sie. »Wo? Wann? Und warum sieht man das nicht, wenn Geld arbeitet?«
»Weil es nicht wirklich arbeitet, so wie jemand, der in eine Fabrik geht, in ein Büro oder Dir in einem Laden etwas verkauft. Man sagt das nur so. Eher ist es so, dass bestimmte Leute, man nennt sie Bankiers, mit Geld arbeiten, damit es mehr wird. Aber das ist ziemlich kompliziert …«
»Sind Bankiers so was wie Heinzelmännchen, die nachts, wenn die Bank zu ist, heimlich neues Geld machen?«
Na ja, sie machen das schon tagsüber, aber nicht so, wie Du denkst, dass sie vielleicht neue Münzen herstellen oder Papier bedrucken. Dafür gibt es zwar auch Firmen, aber die vermehren das Geld eigentlich nicht. Das meiste Geld kann man nämlich heute sowieso nicht mehr anfassen.
»Warum?«
»Weil es nur in einer Art Büchern steht, so wie die Zahlen deiner Rechenaufgaben im Schulheft. Na ja, eigentlich nicht mal mehr das. Das meiste Geld ist heute irgendwie in großen Computern drin.«
»Wie in einem Sparschwein?!«
»Ja. Nein. Ach, es ist halt kompliziert.«
»Warum?«
»Felize, bitte hör auf mit deinem ›Warum?‹«
»Und wie wird man nun mit diesem Geld reich, von dem Du nicht mal genau weißt, wo es ist?«