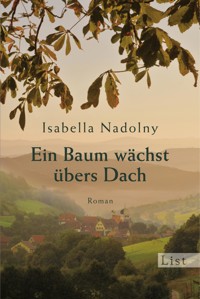
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Sommerhaus am Chiemsee: Für die Familie der jungen Isabella geht mit dem Bau eines Ferienhauses ein Traum in Erfüllung. Doch wer hätte zum Zeitpunkt der Planung und des Baus daran gedacht, dass dieses kleine Holzhaus eines Tages eine schicksalhafte Rolle im Leben seiner Besitzer spielen würde? Beginnend mit der Kindheit in München, wo sie als Tochter wohlhabender Eltern aufwuchs, schildert Isabella ihre Heirat mit einem Schriftsteller, die Kriegsjahre und die damit verbundene Verarmung der Familie, die Geburt des Sohnes und schließlich die Nachkriegswirren und den langsamen Wiederaufbau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Isabella Nadolnys autobiographischer Roman ist ein Klassiker der Nachkriegsliteratur und ein Stück deutscher Unterhaltungsliteratur, das erstmals 1959 erschienen ist.
In ihrem Buch beschreibt die Autorin ihre eigene Geschichte und die ihrer Familie zwischen Zweitem Weltkrieg, Armut und Wiederaufbau.
Und mit all diesen Schilderungen ist ein kleines Holzhaus am Chiemsee eng verknüpft, ein Haus, das die Eltern ursprünglich als Ort der Sommerfrische gebaut hatten und das in den Kriegsjahren zum einzigen Zufluchtsort der Familie wurde.
Die Autorin
Isabella Nadolny wurde 1917 als Tochter eines aus Moskau stammenden Malers in München geboren. Sie lebte als freie Schriftstellerin und Übersetzerin am Chiemsee. 2004 starb Isabella Nadolny im Alter von 87Jahren.
Von Isabella Nadolny sind in unserem Hause außerdem erschienen:
Seehamer Tagebuch
Isabella Nadolny
Ein Baum wächst übers Dach
Roman
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-taschenbuch.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0801-2
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch
1.Auflage Juni 2009
2.Auflage 2010
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009
© 1989 Paul List Verlag
in der Südwest Verlag GmbH & Co. KG, München
© 1959 Paul List Verlag, München
Konzeption: semper smile Werbeagentur GmbH, München
Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München
Titelabbildung: masterfile; © David Madison, Getty Images
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
eBook: CPI – Clausen & Bosse, Leck
1
»Wenn wir«, sagte mein Bruder Leo, »jeden Sommer zu viert auf Sommerfrische gehen, so kostet das pro Jahr … Warte mal.« Er griff nach einem Blatt Papier und fragte mich über die Schulter:
»Wie lange dauern deine Ferien eigentlich?«
Ich gab mürrisch Auskunft. Gegen die Autorität eines um elf Jahre älteren Bruders war nichts auszurichten.
»Und zwei Jahre mußt du doch noch zur Schule gehen – ist sowieso wenig genug«, murmelte er, »zweimal Ferien à sechs Wochen. Also das macht …« Er blinzelte gegen den Rauch seiner Zigarette und rechnete. »Da ist es viel billiger, wir bauen uns ein Sommerhaus.«
Er strich die Zahlen aus und begann einen Grundriß zu zeichnen.
Wir saßen im Eßzimmer, Mama in dem Sessel unter ihrem Porträt, so daß man prüfen konnte, ob es ähnlich genug war. Nur drei der vielen Porträts, die von Mama gemalt worden waren, hatten in unserer Wohnung Platz gefunden, einer großen, altmodischen Wohnung mit hochherrschaftlichen Stuckdecken.
»Ein Sommerhaus«, sagte Mama und drehte mit gedankenvoll gerunzelter Stirn an ihrem Ring, »ein Sommerhaus wäre fein. Man könnte einen Hund dort halten!«
Hunde und Pferde waren vielleicht das einzige, was Mama seit jenem Tage entbehrt hatte, als sie neunzehnjährig das Schloß ihrer Ahnen verließ, um zu heiraten. Hätte sie, der Pferde und Hunde wegen, damals den ungarischen Offizier genommen, der sie so glühend verehrte, so wäre ich heute schwarzhaarig und braunäugig, was ich mir immer gewünscht habe. Sie verzichtete jedoch auf die Pferde und Hunde und heiratete Papa. Das ist zu verstehen. Papa war reizend, hochmusikalisch und ungewöhnlich sprachbegabt, wenn auch etwas schüchtern. In seinem Paß stand als Berufsbezeichnung »Kaufmann«, ein dehnbarer Begriff, der nichts besagte, außer daß Papa Geld genug hatte, um nur gelegentliche weite Geschäftsreisen unternehmen zu müssen, und zwar von Moskau aus, wo er und seine ganze Verwandtschaft lebten. Mama zog mit ihm nach Rußland. Nach ein paar Jahren äußerte Papa den ungewöhnlichen Wunsch, Rußland zu verlassen und ausgerechnet in München malen zu lernen. Nichts hinderte ihn, auch Mama nicht. Sie war nicht einmal verblüfft, sondern packte ihre Koffer, nahm den kleinen Leo, die russische Kinderfrau, fuhr nach Bayern und suchte sich mit Papa eine Wohnung in Schwabing. Eine hochherrschaftliche Wohnung mit Stuckdecken. Papa lernte malen, Mama, die bildschön war, wurde gemalt, und beide besuchten mit Erfolg die legendären Künstlerfeste jener Zeit, die man im Simplicissimus älterer Jahrgänge abgebildet findet.
Als der Weltkrieg vorüber war und die alljährlichen Rußlandreisen zur Familie für immer aufhörten, kam ich zur Welt. Und just um diese Zeit begannen auch die ersten Vermögensschwierigkeiten und die ersten Sorgen. Papa malte weiter, ihm genügte es, von den leidigen Geldangelegenheiten nicht zu sprechen und alles damit Zusammenhängende zu ignorieren. Von Mamas Gefühlen und Erwägungen ist nichts bekannt, sie war eine echte Dame und ließ sich nichts anmerken. Nun zum erstenmal seit Jahren sahen wir die Hoffnung auf einen Hund zugleich mit dem Gedanken an ein Sommerhaus in ihrem Auge aufleuchten.
Bruder Leo zeichnete noch immer. Jetzt ergriff er ein Lineal und zog eine Linie.
»Wie viele Zimmer brauchen wir denn?« fragte er.
»Bloß nicht zu viele«, sagte Mama, die sich seit langem in der Wohnung mit einem Mädchen behelfen mußte.
Papa saß am Schreibtisch und legte eine Patience. Er hatte noch den Malmantel an, mit dem er aus dem Atelier gekommen war, und an seinem Hosenbein klebte ein wenig Preußischblau. Er hatte Schwierigkeiten beim Durchzeichnen einer Birkengruppe in einem Abendhimmel und durfte sich eine Pause gönnen. Rein zufällig geriet er in das allgemeine Sinnen und Trachten.
»Hinter dem Haus muß ein Tisch stehen, auf dem man die Fische schuppen kann, die ich fange«, sagte er und schaute mit zusammengepreßten Lippen nach, wo die Pique-Zehn hingehörte.
Ich hatte die letzten fünf Minuten am Flügel herumgelungert, wie eben ein Backfisch lungert, der noch unfähig ist, schlicht und frei im Raum zu stehen. Nun warf ich mich in den großen Teppichsessel und flocht Zöpfchen in die Fransen. Das ganze Projekt interessierte mich recht wenig. Es war nicht anzunehmen, daß ausgerechnet in diesem geplanten Sommerhaus Willy Fritsch unser Nachbar würde, oder daß mich dort jemand für Hollywood entdeckte. Der Ort des Bauvorhabens stand nämlich fest. Es war Seeham in Oberbayern.
Papa hatte dieses Dörfchen einst auf einem Ausflug mit seiner Malklasse von München aus entdeckt und war seinen Reizen von Stund an verfallen. Es lag am Ufer eines Sees in jenem Gebiet, das in den Wetterberichten als »am Alpenrand auch anders« eine Sondererwähnung erfährt. Dieses Ufer war flach, bestand aus abwechslungsreich geformten und gefärbten Steinen, und durch die Spiegelung des klaren Wassers sah man die bläulich behauchten Berge doppelt. Durchdrang man die zum Trocknen gespannten Fischernetze, die den Strand vom Landesinneren trennten und Seeham silbern verschleierten, so konnte man, einer Legende zufolge, zwanzig Stunden lang wandern, ohne je den Wald zu verlassen. Und was war das für ein Wald, teils lieblich, teils majestätisch, je nach dem Anpflanzungsjahr des bayerischen Forstverwaltungsamtes. Die Aussicht von dem Kirchturmhügel, der Seeham beherrschte, war zum Jauchzen schön, und man fühlte sofort das dringende Bedürfnis, sie mit anderen zu teilen. Führte man jedoch Leute dorthin, um ihnen diese Pracht zu zeigen, so nebelte sich das Gebirge ein, und man war gezwungen, mit einer weiten Armbewegung zu sagen: »Schade, was ihr dort nicht seht, das sind die Ostalpen!« An dieser Eigenheit Seehams hatte sich seit dem Jahre 1910 kaum etwas geändert.
Im übrigen war Seeham ein ganz gewöhnliches Dorf mit Spritzenhaus und Viehwaage, einem Bach mit Enten und Forellen, mit drei Dorftrotteln, zwei Kropfträgern und einer Schwäche für den Fremdenverkehr. Schon in den guten alten Zeiten vor meiner Geburt hatten die Eltern alljährlich samt Mädchen und Großmama eine Etage in einer jener Villen gemietet, die in so manchen Dörfern Oberbayerns herumstehen und deren Dächer in eine Unzahl sinnloser Türmchen und Erkerchen ausblühen. Bei dieser Sommergewohnheit war man geblieben. Die Fotoalben im Salon, deren Messingbeschläge die Tischplatten zerkratzten, wenn man sie besah, waren voller Strandbilder: die fröhlichen Eltern, Fische räuchernd, Schwemmholz zusammentragend, Bruder Leo in gestreifter Badehose und schließlich eines Tages sogar ich, heidnisch nackt, die Korkenzieherlocken hochgebunden, damit sie nicht in den See hingen, mißvergnügt gegen die Sonne in die Kamera blinzelnd. Das war nun eine Weile her. Ich hatte nur noch Erinnerungen an die wundervollen Steine, die ich sorgfältig abwusch und wieder ins Wasser legte.
Bruder Leo zeichnete noch immer an seinem Plan. Papa schob die Patiencekarten zusammen und sah ihm über die Schulter.
»Das Lange dort, soll das eine Kegelbahn werden?«
»Das ist eine Veranda«, sagte Leo.
»Wir werden ja hauptsächlich draußen essen«, sagte Mama entschieden. Essensgeruch war ihr stets zuwider, sie fand ihn spießig.
»Du kennst Oberbayern noch immer nicht genügend, scheint’s«, sagte Papa sanft und schloß leise die Tür hinter sich.
»Die Hundehütte muß windgeschützt stehen, die könnte zum Beispiel innerhalb der Veranda in einer Ecke untergebracht werden«, schlug Mama vor.
Leo sah auf und grinste. Ich glaubte, die Haut seiner Wangen knistern zu hören.
»Je nachdem, was wir investieren«, sagte er, »wird vielleicht das ganze Projekt nur eine Hundehütte. – Wir bauen sowieso aus Holz!«
»Natürlich«, bekräftigte Mama, »in Rußland baut man immer aus Holz, auch für den Winter.«
Ich entflocht die Sesselfransen und stand auf. »Holz?« fragte ich. »Da quellen doch immer die Türen und Fensterrahmen und nachher geht nichts mehr auf und zu, oder?«
Bruder Leo sah mich mit jenem Ausdruck an, den man so oft in den Augen älterer Brüder findet. Er besagt, daß man als Kind nicht genügend verhauen worden ist, und schließt die Frage ein, ob vielleicht noch Zeit sei, dies nachzuholen.
Da meine Beiträge zur Diskussion nicht willkommen zu sein schienen, bat ich Mama um sechzig Pfennig, weil ich in die Vieruhrvorstellung im Capitol gehen wollte.
»Aber den Film hast du doch schon zweimal gesehen«, sagte Mama. »Das ist ja Unsinn. Du kommst überhaupt viel zu wenig an die Luft. Hol Inge ab und geht in den Englischen Garten.«
Der Englische Garten war eine der üblichen Härten des Lebens, weil es dort außer der frischen Luft für einen Backfisch nicht das geringste Interessante gab. So blieb ich denn noch ein Weilchen und hörte weiter zu.
»Ein Keller wird zu teuer, ist ja auch unnötig. Soll man ein Bad vorsehen?«
»Ein Bad? Für die paar Wochen? Kinder – Ihr habt ja den See vor der Tür.«
»Nun ja, aber doch wenigstens einen Kachelofen und Doppelfenster«, sagte Leo. »Womöglich heirate ich eines Tages, und von meinen sechs Kindern haben dann mindestens drei gleichzeitig Keuchhusten. Die brauchen Luftveränderung, und wenn es da gerade Winter ist …«
Mama lachte. »Meinetwegen, sieh einen Kachelofen vor, es gibt ja auch mal kühle Sommer. Das Holz holen wir uns vom Strand, da liegt genug«, meinte sie optimistisch.
Leo schlug noch einen kleinen Vorratskeller vor, in den man von der Küche aus durch eine Klappe im Fußboden hinunterstieg, kaum größer als ein Schrank, aber gleichmäßig temperiert.
»Wozu denn?«
»Für die Apfel!«
»Die sind doch erst im September reif, da sind wir doch längst wieder in der Stadt«, wandte ich ein.
»Man kann nie wissen«, sagte Bruder Leo und schraffierte die Fußbodenklappe in den Küchengrundriß hinein.
Dies wäre der Augenblick gewesen, in dem ich hätte ahnungsvoll erschauern müssen. In Wagneropern erklingt jeweils das passende Motiv, damit auch diejenigen erschauern können, die den Text nicht rechtzeitig verstanden haben. Im Leben ist das anders. Insbesondere bei mir. Ich erkenne mein Schicksal niemals, auch dann nicht, wenn es sozusagen schon mitten im Zimmer steht.
So verabschiedete ich mich denn mit einem Kuß von Mama, ahnungslos, daß meine Zukunft schon begonnen hatte, und kehrte zu meinen wichtigen Privatangelegenheiten zurück.
Die Privatangelegenheiten eines Backfisches sind ebenso albern wie unüberschaubar: ich stritt mich mit Freundinnen wegen nichts und wieder nichts, wartete atemlos auf Anrufe eines Tanzstundenjünglings, schrieb Aufsätze über Themen, von denen ich nichts verstand, zum Beispiel »Alles hohe Leben quillt aus Opfern«, trug eine Mickymaus am Mantelaufschlag und konnte von Mama nur mit Mühe zurückgehalten werden, mir bei Sally Marx in der Barer Straße einen Halbschleier zu kaufen, um meiner Baskenmütze etwas Dämonisches zu geben. Abwesenden Blickes streifte ich die Wahlplakate an den Litfaßsäulen, auf denen Stahlhelme und Hakenkreuze vorkamen, die mich nichts angingen, sondern höchstens die Erwachsenen.
Nachdem wir genügend Gründe für den Bau eines Sommerhauses beisammen hatten, brauchten wir nur noch einen Grund, auf dem es stehen sollte. Durch bäuerliche Freunde in Seeham fanden die Eltern einen. Sie kauften ihn sofort. Er lag außerhalb des Dorfes, was Leo zu der Bemerkung: »Wir bauen einen Einödhof« veranlaßte. Mama stellte frohlockend fest, daß man auf einem so abgelegenen Anwesen nur die halbe Hundesteuer würde bezahlen müssen. In mäßiger Entfernung ging die Lichtleitung daran vorüber. Nicht so jedoch die Wasserleitung. Als Bruder Leo erfuhr, was es kosten würde, vom Dorf bis zu uns hinaus eine Wasserleitung zu legen, murrte er, er sei nicht Ferdinand von Lesseps, und erkundigte sich nach weiteren Möglichkeiten der Wasserversorgung. Es wurde beschlossen, dem Beispiel unseres einzigen Nachbarn zu folgen und einen Brunnen zu graben. Eine Handpumpe würde das Grundwasser in ein dreihundert Liter fassendes Wasserreservoir unter dem Dach des Hauses befördern.
Das Grundstück war billig, und erst Jahre später erfuhren wir, daß unser Kauf eine heimlich glimmende Fehde zwischen zwei Bauern wieder anfachte, weil jeder von ihnen ein Auge auf unser Stückchen Land geworfen hatte.
»Los! Worauf warten wir? Unser Geld wird höchstens weniger, nicht mehr«, eröffnete Bruder Leo eines Tages den Endkampf. »Der Zimmermeister in Seeham hat Bauholz liegen, das fünfundzwanzig Jahre gelagert hat, einfach ideal, das zieht sich bestimmt nicht mehr. Den Plan zeichne ich mit einem Schulfreund von mir, der Architekt ist. Ich überwache die Erdarbeiten selber und helfe mit. Wir könnten schon diesen Sommer die Ferien draußen verbringen!«
Wie gut ist es doch, wenn ein Bruder gerade keinen Beruf ausübt, weil auch in seinem Paß der verwaschene Begriff »Kaufmann« steht. So kann er zwischen gelegentlichen ausgedehnten Auslandsreisen in geschäftlichen Missionen in aller Ruhe Häuser bauen. Bruder Leo fuhr also hinaus nach Seeham, und wenn er wieder bei uns in München auftauchte, dann berichtete er vom Fortgang der Dinge in dürren Fachausdrücken, in die meine Phantasie nicht einhaken konnte. Undeutlich erinnere ich mich, ein kleines Pappmodell des Sommerhauses auf Papas Schreibtisch gesehen zu haben. Das Mädchen Emma krümmte sich beim Staubwischen zu ihm nieder und versuchte, in die winzige Veranda hineinzublicken.
»O mei! Liab!« sagte sie.
Das war ihr einziger Kommentar.
Die Eltern genossen den Bau auf ihre Weise. Es war das zweite Haus, das sie in ihrem Leben bauten. Sie hatten schon vor meiner Zeit einmal eines gehabt. Mit dem zweiten Haus schien es ähnlich zu sein, wie mit dem zweiten Kuß: Man genoß ihn mehr, weil man nicht mehr so überrascht war und nicht mehr fürchtete, dabei etwas falsch zu machen. Sie unterhielten sich angeregt über die Vorteile von Einbauschränken, Balkonverschalungen und dergleichen, das heißt, Mama ließ die Begriffe genußreich auf der Zunge zergehen, und Papa behielt seine ironisch-amüsierte Distanz bei.
Diesmal bauten wir nach Maß. Ich meine das durchaus wörtlich. Ich mußte unzählige Male mit einem Stapel Handtücher in die Kniebeuge gehen, damit festgestellt werden konnte, wie tief ein bequemer Wäscheschrank sein darf. Das Mädchen Emma mußte eine imaginäre Essigflasche in die Höhe heben, damit das unwiderruflich oberste Fach des Küchenregals nicht wieder oberhalb ihrer Reichweite läge.
Wenn eine Familie wie die unsere sich chronisch in den falschen Ländern ansiedelt und bei politischen Wirren, Kriegen, Revolutionen das Geld immer wieder nicht rechtzeitig in der Schweiz deponiert, dann erleichtert das gewisse Entscheidungen beim Bau eines Sommerhauses sehr: Von zwei Möglichkeiten wählt man immer die billigere. Das spart Kopfzerbrechen.
Nicht, daß ich mich damals an solchen Erwägungen beteiligt hätte. Ich war, wie stets, damit beschäftigt, in jemanden verliebt zu sein, und das füllte mich neben dem Schulbesuch völlig aus. Die Objekte wechselten, mal war der Deutschlehrer dran, mal Gustav Fröhlich, mal ein Student, der gegenüber wohnte. Ich erfuhr beim Mittagessen bruchstückweise, daß sich die Arbeiterschaft von Seeham, wenn auch mit bayerischer Reserviertheit, so doch mit leuchtenden Augen auf das Bauvorhaben gestürzt hatte. Es herrschte gerade Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise und an günstig gelegenen elektrischen Masten klebten kleine Plakate mit der Aufforderung, doch bitte die Wirtschaft anzukurbeln. Nun denn, wir kurbelten.
Die kleine Kreisstadt mit ihren Baumaterialien- und Eisenlagern lag 11 km weit ab. Bruder Leo wurde zu einem geübten Sechstagefahrer, hart trainiert durch die Aufgabe, schwappendes, wedelndes und sperriges Gut auf seinem Rade fortzubewegen. In seiner Doppelrolle als Bauherr und Erdarbeiter verhinderte er das Schlimmste und hielt auch den bayrischen Handwerkerbrauch, zwischen Brotzeit und Brotzeit fieberhaft herumzustehen, weitgehend hintan.
Die freudig erwarteten Ferien waren unvermutet da, und wir machten uns auf den Weg nach Seeham. Zunächst nahmen wir nur das Allerwichtigste mit: die Teemaschine aus Moskau, auch Samowar genannt, das Dienstmädchen Emma, ein Meßtischblatt »Seehams nächste Umgebung«, Angelzeug und eine Farbenmühle, eine wahre Höllenmaschine, mit der Papa sich seine Farben zum Malen an Ort und Stelle selber bereiten konnte.
Um den Einzug noch aufregender zu gestalten, überquerten wir den See per Dampfer. Dieser Dampfer war mit I. und II. Klasse und einem prachtvollen bärtigen Kapitän ausgestattet, der seine Befehle durch ein dünnes Messingrohr ins Schiffsinnere hinunterspuckte. In beiden Klassen zog es gleich stark, aber in dem neutralen Raum zwischen ihnen konnte derjenige, dem die Aussicht nicht genügte, sich einige bunte Postkarten von dem unglücklichen König Ludwig kaufen.
Der Himmel war blaßblau und viel höher als in München, die Berge zauberhaft. Ich ließ mir ihre Namen sagen und brachte sie sofort alle durcheinander. Etwa von der Mitte des Sees an rief man mir von allen Seiten zu: »Da! Da! Siehst du’s? Am Ufer schaut es durch die Bäume! Nein, weiter links, das daneben mit dem hellen Dach!«
Ich sah nichts und sagte aus Höflichkeit: »Jaja.« Unser Gefährt legte unter imponierender Schaumentwicklung der Schaufelräder am Landungssteg an, und dort stand Bruder Leo, um uns zu empfangen, neben sich einen gewaltigen Schubkarren für das Gepäck.
Außerhalb des Dorfes, allein auf der Wiese hinter dem Bach und daher ganz leicht zu finden, lag neben einem mißförmigen Erdhaufen ein blondes Holzhäuschen mit riesengroßem Dach. Es war zweifellos viel zu klein, als daß wir alle hätten darin Platz finden können. Außerdem wimmelten noch viele Handwerker darin herum. Da man es von außen zur Zeit nicht besichtigen konnte, weil ständig Balken und Bretter vom Dach niederprasselten, wobei von oben der Ruf: »Oha!« ertönte, gingen wir gleich hinein.
Innen war es fast geräumig, wenn man es nicht mit unseren Zimmern in München verglich, die die Ausmaße von Radrennbahnen hatten. Es waren noch gar nicht alle Räume fertig, und wenn erst die vielen Klötzchen, Absägsel, Abschnitzel und Hobelspäne hinausgeschafft sein würden, war es bestimmt groß genug für die paar Sommerwochen. Wir wollten ja hauptsächlich am Strande leben. An Brennmaterial für den Herd, den das Mädchen Emma für gut und brauchbar befand, war vorläufig kein Mangel.
Der Korridor war sehr eng. Wenn wir uns alle gleichzeitig dort die Mäntel auszogen, wurden immer einige die untersten Treppenstufen hinauf gedrängt. Unten war ein großes Wohnzimmer mit vier Riesenfenstern und einem leuchtend blauen Kachelofen von erstaunlicher Schönheit. Die vier großen Fenster waren der reine Vogelmord: Seehams gefiederte Sänger konnten sich nur schwer daran gewöhnen, daß diese über Eck stehenden Durchblicke auf Garten und Himmel Glas sein sollten, und stießen sich die Köpfe ein. Die Sitzbank im Bauernstil hatte Bruder Leo nach seinem Maß anfertigen lassen. Menschen von über 1,95 Meter saßen dort wie in Abrahams Schoß. Pygmäen hätten quer auf der Sitzfläche schlafen können. Auf der Veranda, die auch Tisch und Bank enthielt, war es wieder enger, aber durch das Ungeziefer abwechslungsreicher. Die vielen Bremsen und Pferdefliegen, hieß es, würden nicht so sehr von den schwitzenden Arbeitern angezogen, als vielmehr vom Harzduft des frischen Holzes. In die Zimmer, unten zwei und die Küche, oben zwei und ein Kämmerlein, konnten sie aber nicht hinein, Leo hatte überall Fliegengitter vor die Fenster legen lassen. Es dauerte eine Weile, bis die Familie begriffen hatte, daß jeder Apfelbutzen und jeder Zigarettenstummel, den man hinaus warf, einem sofort wieder ins Gesicht flog.
Papa beschlagnahmte das Zimmer im oberen Stock, das nach Norden ging. Dort sei das beste Licht zum Malen.
Wir kehrten und schaufelten und hatten unser Häuschen schon am ersten Abend so weit hobelspanfrei, daß man die Betten an die hierfür vorgesehenen Stellen rücken konnte. Abends und morgens war die Familie damit beschäftigt, die verschiedenen Astlöcher und Maserungen in Gesichter, Profile, Tiere und Alraunen aufzuteilen.
Das ganze Haus sah aus wie eine helle Schachtel aus Holz, und zunächst wußte man nicht recht, wo man seine Kleider hinhängen sollte. Es kamen noch immer Handwerker, doch nahm ihre Wichtigkeit von Tag zu Tag ab, schließlich wurden nur noch Lehrbuben geschickt, die Läden anbrachten, oder aus dem Dachfenster hängend etwas draußen annageln sollten, wobei Mama die kleineren unter ihnen ängstlich an der Lederhose festhielt.
An einigen Fenstergriffen war zu merken, daß die kleine Kreisstadt gegen Ende des Baues ausverkauft gewesen war: mancher Riegel, der rechtsherum gehen sollte, ging nur linksherum und umgekehrt. Manches Rohr-Kniestück, das in entsprechender Krümmung, Biegung oder Stärke nicht mehr vorhanden gewesen war, wurde durch etwas ähnlich Gebogenes, Gekrümmtes ersetzt, und es kam innerhalb des häuslichen Röhrensystems zu barocken Schnörkeln. Mama konnte über derlei gelegentlich verdrießlich sein. Papa zog lachend an seiner Nase und meinte, Kniestück hin, Kniestück her, er sei froh, daß er keines malen müsse, das sei noch unangenehmer. In diesen Kleinigkeiten zeigte sich sofort, daß das Haus, von uns erbaut und bewohnt, uns in gewisser Weise ähnlich zu werden drohte. Es huldigte schrankenlosem Individualismus.
Gleich am ersten Tag wurden die einzelnen Familienmitglieder zum Dienst eingeteilt. Die Versorgung der Küche mit Fischen und das Heizen des Samowars mit Tannenzapfen war Papas Aufgabe, das Herbeischaffen der Tannenzapfen die meine. Mama holte die näher gelegenen Viktualien, die ferner gelegenen hatte ich mit dem Rad heimzutransportieren. Alles, was nicht zu deklinieren war oder technisches Können und Einfallsreichtum voraussetzte, fiel Bruder Leo zu. Jeder von uns mußte täglich fünf Minuten die Handpumpe bedienen. Bei jedem Schlag erzitterte ein Gewicht, das an einer Schnur vor der Wand hing, und senkte sich nur sehr allmählich. Wenn die Spitze des Gewichtes dort angelangt war, wo Leo mit Tintenstift ein Kreuz hingezeichnet hatte, war das Bassin droben voll. Dann funktionierten die eingebauten Waschtische und übrigen Wasserspülungen wie bei anderen Leuten. Dem Brunnen selbst, der mit einer schweren Steinplatte bedeckt in einer Grundstücksecke lag, wagte ich mich aus Respekt nicht zu nähern. Er schwieg und spendete Wasser. Ganz selten nur ließ er durch das Steigrohr der Pumpe ein kurzes Glucksen hören, es war, als ob Undine rülpste. Sonst pflegten wir keinerlei Beziehungen zu ihm bis zu dem Tage, an dem das Wasser plötzlich nicht mehr hinauf wollte. Aber das ist eine spätere Geschichte.
Das Mädchen Emma, ursprünglich zum Kochen eingeteilt, wurde mit so vielen anderen Arbeiten betraut, daß sie immer erst in die Küche stürzte, wenn es schon viel zu spät war, den Herd anzuheizen. Da sie in der Schule keine Chemie gelernt hatte, war sie der Meinung, man könne die verlorene Zeit durch größere Hitze wettmachen, und stopfte den Herd so voller zerbrochener Schindeln, Tannenzapfen und Holzabfälle, daß seine Platte ins Glühen kam. Um in der kleinen Küche am Leben zu bleiben, mußte sie dann natürlich die Tür, die ins Freie führte, öffnen, und dadurch kamen kolossal viele Fliegen und Bremsen herein. Es war wie in einem Stall. Mama machte die Tür dann wieder zu. Mit dem stummen Kampf um die Küchentür waren Mama und Emma die Mittagszeit über beschäftigt.
Hinter dieser Tür begann jener Teil unseres Anwesens, den Mama als »Hof« bezeichnete. Aus dieser Vokabel sprachen noch die weiten Räume ihrer Kindheit, Stallungen und Wirtschaftsgebäude. Bei uns bestand der Hof aus einem alten Tisch, der den Versuch machte, sich regengeschützt unter das vorhängende Dach zu schmiegen, aus den Betondeckeln der Abwassergruben, einem Stapel Schindeln zum Ausflicken des Daches und dem Eingang zum Schuppen, der unsere Räder enthielt. Der Schuppen ließ sich somit zur Not unter Stallungen einrechnen, denn die Fahrräder waren fast das Wichtigste für Seeham und nähere Umgebung.
Leo, Papa und ich trugen den Aushubhaufen ab und verteilten ihn hübsch auf dem Grundstück. Die Erde wurde davon nicht besser, es blieb saurer alter Torfboden. Im ersten Enthusiasmus des freigelassenen Städters wollte nun jeder etwas anpflanzen. Papa war für Stangenbohnen, der Rest der Familie schwankte zwischen Radieschen Marke Ostergruß und Maréchal-Niel-Rosen. Alle aber waren sich einig über eine Hecke. Wir brauchten eine hohe, dichte Hecke, hinter der wir beim Sonnenbaden schließlich auch einmal die rosa Hemdträger herunterstreifen durften. Die Landesbräuche waren in punkto Sittlichkeit nämlich sehr streng, und wir hatten die Eingeborenen lieb und wollten sie nicht kränken. Damals wäre es niemandem eingefallen, im Badeanzug ohne langen Mantel die fünfzig Schritt von unserer Haustür zum Strand hinunterzugehen. Mir fiel es im ersten Sommer leider einmal ein, und gerüchteweise verlautete, daß die fünf Söhne unseres am See gelegenen Nachbarn im Anschluß an mein Vorüberwandeln beichten gehen mußten.
Dies mochte eine böswillige Verdrehung der Tatsachen sein, eine Hecke jedoch mußte heran. Leo und ich radelten in die Kreisstadt und kauften Ligusterstauden ein. Ein Pferdefuhrwerk, der Bote Seehams, der unter seiner Plane Ofen und Kunstdünger, Matratzen und lebende Hühner transportierte, kam später mit ihnen angezockelt. Die Stauden wurden im Schatten in die Erde geschlagen und sollten am nächsten Tag gepflanzt werden.
Am nächsten Tag regnete es. Mama, die grundsätzlich nur die gute Seite der Dinge sah, meinte, es sei nun so köstlich reine Luft, band entschlossen einen Schal um den Kopf und ging vor uns her ins Nachbardorf. Sie hatte gehört, dort gäbe es einen Wurf junger Wolfshunde. Wir stapften schweigend hinter ihr drein. Nach einer guten Stunde kamen wir zu einem Hof. Die Wolfshündin dort war sehr schön, die Kleinen undefinierbare Wollknäuel.
»Wer ist denn der Vater?« fragte Mama.
»Der Vater«, sagte die Bäuerin vorsichtig, »der ist auch ein recht braver Hund.«
Mama dankte ihr. Wir kehrten um, eine Stunde weit durch den Regen, unverrichteter Dinge. In Fragen der Rassereinheit war Mama nicht gewillt, Kompromisse zu schließen.
Zwei Tage darauf kauften wir einen wirklichen kleinen Schäferhund, so blond wie wir und das Haus. Er saß verloren mitten im Zimmer, kroch manchmal unter die Couch und machte prasselnd einen kleinen See. Er schien darüber selbst so unglücklich, daß er sehr lieb getröstet werden mußte. Seine Hütte kam an die windgeschützteste Stelle der Veranda, und er selbst kam auf Mamas Bettvorleger. Mama meinte, er sei noch zu klein, um allein zu schlafen. Er fand das auch und küßte ihr manchmal nachts dankbar die Hand, die über den Bettrand hinunterhing.
Eine Katze brauchten wir nicht zu kaufen, wir bekamen sie geschenkt. Sie war gelb-weiß getigert, was bei den Hiesigen als »rot« bezeichnet wird. Nun war alles blond, einschließlich des Dienstmädchens. Im Laufe der Jahre dunkelten wir nach – das Haus zuerst.
Das Einpflanzen der Ligusterstauden wurde durch das Vorhandensein der beiden Tiere sehr erschwert. Zwei Mitglieder der Familie fielen ständig aus, weil sie den Hund, beziehungsweise die Katze auf dem Schoß halten mußten. Die beiden waren durch ihre Jugend überaus aufnahmebereit und nach längeren Inspektionstouren im und um das Haus an Nerven und Seele ganz herunter. Sie hatten nach all dem Herzklopfen, Erschrecken und vor Neugier Zittern den Schlaf dringend nötig, schliefen aber nur auf dem Schoß, bei einer Temperatur von 37,3 Grad Menschenwärme, denn sie vermißten ihre Geschwister im heugepolsterten Korb daheim.
Wer nicht mit dem Halten der Haustiere beschäftigt war, half Ligusterstauden einsetzen. Schön gleichmäßig sollten sie eingepflanzt werden, ringsherum um das, was man füglich als Garten bezeichnen durfte. Bruder Leo trat die Pflänzchen fest und betrachtete sie kritisch. Einige Leute hatten ihm gesagt, wir sollten sie tüchtig mit Jauche begießen, andere wieder, wir sollten sie ja nicht düngen, dann schössen sie so ins Holz. Wir lasen im Robinson Crusoe nach, bei dem sie ja so schnell wachsen, daß sie binnen kürzester Zeit zu regelrechten Palisaden werden. Über Düngung stand dort nichts, auch meinte Bruder Leo, es handele sich bestimmt um eine pazifische Abart des Äquatorial-Ligusters. Wir zählten an den Knöpfen ab und begossen die Ostseite der Hecke mit Jauche und die Westseite nicht. Heute sieht man keinen Unterschied mehr. Der Liguster wuchs sowohl im Osten als auch im Westen furchtbar langsam und krümmte sich, ängstlich seine Zweige ineinanderflechtend, vom Winde weg, der vom See gegen ihn anblies.
Obwohl Mama gegen Gemüseanbau stimmte, konnten wir es nicht lassen und legten ein »gemischtes Beet« an. Wir fanden es zu nett, mit dem Zeigefinger die warme, sommerliche Erde am Bauch zu kratzen und irgendwelche Körnchen in Rinnen zu streuen. Es war uns nicht so wichtig, ob und was dann kam. Manchmal jätete ein anderer es auch wieder aus. Die Rettiche, die Leo und ich anbauten, waren einmalig: dünne, verknorpelte, brennend scharfe Gebilde, die man mit viel Salz erst leuchtenden und dann tränenden Auges hinunterwürgte. Wir setzten auch zwei Spalierbirnen ans Haus. Sie trugen innerhalb der ersten 15 Jahre insgesamt 25 Birnen, und Leo rechnete aus, wieviel das in hundert Jahren ausmache. Papa sagte trocken, ihm mache das gar nichts aus, denn sie seien von Anfang an keine Williams Butterbirnen gewesen, sondern höchstens Maiers Mehlbirnen.
An geeigneten Tagen rissen Mama und Leo in den Wäldern und stillen, verschwiegenen Strandbuchten allerlei Gestrüpp aus, das Seehams klimatische Bedingungen von klein auf gewohnt war und daher auch innerhalb unseres Grund und Bodens gedeihen mußte: Weiden, Birken und einen Haselnußstrauch. Während Goldregen, Jasmin und Flieder aus unerfindlichen Gründen immer wieder eingingen, machte uns der Haselnußstrauch viel Freude, weil er so rasch buschig wurde. Schon bald konnte man sich dahinter in die Sonne legen und tief im Grase versteckt die Kommentare gelegentlich an Sommersonntagen Vorüberwandelnder anhören.
»Sengs dös Heisl da? A Ruß hat’s baut! – Na, koa Ruß is er net. – Freili is er a Ruß, hod er ja selm g’sagt, daß er vo Moskau is. – Mei, kennst du denn den net? Der is ja oiwei schon herkemma. Scho vor’n Kriag. – So. A scheens Heisl, ganz aus Hoiz. Aber warm. Hoaßt’s.«
Das Tännchen, von Bruder Leo irgendwo im Staatsforst entwendet, wuchs so langsam, daß einer den anderen beschuldigte, es hohl gesetzt zu haben. Am schnellsten wuchsen der Hund und die Katze, sie wurden zusammen groß. Der Hund, Ulf gerufen, holte sich die Katze zum Spielen und kaute sie liebevoll von vorne bis hinten durch, was sicherlich gut für ihre Verdauung war. Sie legte dabei die Vorderpfoten watschenbereit vor seine Ohren, und wenn er es zu schlimm trieb, wischte sie ihm ein paar. Er nahm sie auch ins Maul und trug sie herum. Als sie beide erwachsen waren, nutzte es ihr nichts mehr, daß er dabei den Kopf recht hoch trug, er trat ihr doch auf Schwanz und Hinterbeine, die am Boden schleiften. Dann gab es vorne an Mieze einen Ruck, und etwaige Augenzeugen riefen aus: »Jessas! Die Katz is hin!«
Kaum hatte sich das Leben im neuen Häuschen einigermaßen eingespielt, da taten Mama und ich ein übriges für die Einrichtung und suchten dazu die kleine Kreisstadt auf. Es war ein süßes Nest mit alten Häusern, vielen Wirtschaften, einer schönen Kirche und affektiert sprechenden Ladenfräuleins. Dort kauften wir freundlich gewürfelte Stöffchen, zu Ehren des Landes meist weiß-blau, für Kissenbezüge, Vorhänge vor Stellagen und Küchenfenster. Wir suchten uns auch auf Ratschläge befreundeter Bäuerinnen einen Weber, der uns Flickenteppiche webte. Die Dielen des Häuschens waren hell und schön. Die Flickenteppiche sollten verhindern, daß sich daran etwas änderte.
Kaum war das Haus fertig eingerichtet, praktisch, schön und nach unseren Maßen, da erinnerten sich viele Leute daran, daß sie uns so lange nicht gesehen hatten. Das Haus quoll über von Besuchern. Wer Gruppenaufnahmen vor den Verandastufen machte, bekam die Anwesenden nur noch mit Querformat auf den Film und ich mußte fünfmal am Tag baden, weil man jeden Gast wieder an den Strand führen mußte. Ulf war recht angetan davon, er apportierte alles aus dem See, was man ihm hineinwarf, und roch bis zum Abend durchdringend nach nasser Wolle. Wenn man ausschließlich am Strande gelebt hätte, wäre es noch gegangen, aber man mußte in seinem eigenen Zimmer jeden Gürtel und jedes Taschentuch hübsch forträumen und die Blumenvase auf den Tintenfleck rücken, weil zu den unsinnigsten Tageszeiten Scharen von entzückten Besuchern das Häusel besichtigen wollten. Leute, die nur flüchtig oder gar nicht mit uns verwandt waren, kamen jodelnd mit Rucksack den Feldweg vom Dorfe her und wollten bei uns übernachten. Das Mädchen Emma wurde von diesem Andrang ins Nachbarhaus gespült, wo sie eine Dachkammer bezog und die Tugend der fünf Söhne auf harte Proben stellte.
Wer nicht zum Übernachten kam, wollte zumindest Tee trinken. Nun bewährte sich der Samowar, der russische Gastlichkeit gewohnt war. Er hielt das Teewasser für etwa 12 Personen eine halbe Stunde lang kochend, und es konnten auch diejenigen noch gelabt werden, die sich beim Wettschwimmen verspätet hatten. Wer so geschickt kam, daß man ihm keinen Tee anzubieten brauchte, wollte sich wenigstens bei uns seine Badesachen anziehen. Die schütteren Weiden des Strandes gaben nicht genügend Sichtschutz. Freundlich stellte derjenige, der gerade die Honneurs des Hauses machte, sein Zimmer zum Umziehen zur Verfügung. Da der Schlosser sich Zeit damit ließ, die Schlüssel zu den Türen zu liefern, stieß man bei jeder Besichtigung auf Leute, die gerade den Badeanzug halb anhatten und »Hoppla!« riefen. Schon damals kamen uns in düsteren Augenblicken Zweifel, ob es nicht doch besser gewesen wäre, etwas weiter weg vom Ufer zu bauen.
Besichtigen aber wollten, wie schon gesagt, alle. Es war nach all der Unruhe und Mühe ja auch wohltuend und befriedigend, die Entzückensschreie über soviel Praktisches zu hören. Ich versäumte nie, blitzgeschwind die Kellerklappe im Küchenfußboden zu öffnen und gewandt die steile Hühnerleiter zu dem noch leeren Regal mit ebenso leeren Weckgläsern hinunterzuturnen.
Als mir die Klappe zum ersten Male auf den Kopf fiel, war gerade kein Gast da, der hätte zuschauen und lachen können. Die Familie umstand mich mitfühlend und Mama meinte, wir sollten vielleicht doch einen Haken dort anbringen, wo die geöffnete Klappe sich an den Rahmen der Außentür lehnte. Wir vergaßen es dann aber wieder. Am nächsten Tag schloß sich mein rechtes Auge, ohne eigentlich weh zu tun, und seine Umgebung färbte sich blaugrün und violett. Papa sah es lange an und meinte, er wolle es doch einmal mit abstrakter Malerei versuchen.
Nein, die Gäste lachten nicht über die Kellerklappe. Sie lachten an einer ganz anderen Stelle, in einem kleinen, verschwiegenen Raum, in dem man sie alleine ließ. Dort hatte Leo Baumscheren, Bohrer, Sägen und Stemmeisen auf gehängt. Daß diese Werkzeuge dem Gast gerade dort zur Verfügung standen, gab unserem Hause eine weitere originelle Note.
Beim Herantreten an die einzelnen Fenster ertönte bei allen Gästen ein langgezogenes »Ah!«, besonders vom oberen Balkon, auf dem ich geläufig herzubeten pflegte: »Von links angefangen sieht man hier die ganze Gebirgskette, und zwar …« Den meisten Menschen gefallen die Berge erst, wenn sie wissen, wie sie heißen. Von Papas Zimmer, das fast unbemerkt den Namen »Atelier« erworben hatte, oder von der Küchentüre aus hätte die Aussicht besonders Chinesen begeistert. Sie war von großer Ruhe und völlig leer. In der Ferne sah man eine Kiesgrube, das war alles. Diese Kiesgrube behielt auch derjenige im Auge, der Eierschnee schlagend an die frische Luft trat, weil das Mädchen Emma den Küchenherd wieder so geheizt hatte, als ob sie einen Ochsen braten wollte.
Es gab weibliche Gäste, die sich schelmisch für den Posten der Köchin vormerken ließen, falls dieser in unserem bezaubernden Häuschen einmal frei werden sollte. Das Mädchen Emma lächelte gequält und zerschlug eine Bremse auf ihrem schweißnassen Nacken. Mama, die immer etwas Tröstliches wußte, erwähnte, daß die Bremsen heute nur deswegen so besonders frech seien, weil ein Gewitter am Himmel stünde.
In dieser unseren ersten Saison gab es noch keine verläßliche Wettervorhersage. Wir haben nie wieder so viel vertrocknete geschmierte Brote essen und bei pfeifendem Regensturm so viele Seltersflaschen mit kaltem Tee am Ecktisch im Wohnzimmer zu uns nehmen müssen wie damals, wo man am Abend eine Tour vorbereitete, um dann anderntags zu Hause zu bleiben. Bei unseren Milchnachbarn gab es einen »Wetterpropheten« an der Wand, einen übertrieben herzigen Buam mit mißfarbenem Höschen, das sich bei nahendem Regen rot und bei schönem Wetter blau zu färben hatte. Dieser Wetterprophet ging jedoch stets nach, und seine Hose färbte sich erst, wenn es zu spät war. War das Regenwetter als Tatsache etabliert und hingenommen, so setzte die Familie sich willig zusammen, steckte drei Stück Torf und einige übriggebliebene Deckenleisten in den Kachelofen und machte es sich gemütlich. Wir fertigten uns auf der Rückseite eines Kartons vom Krämer – er trug das Bildnis Andreas Hofers, des bekannten Erfinders des Feigenkaffees – ein eigenes Mensch-ärgere-dich-nicht, sägten aus Sperrholz ganz verzwickte Puzzles aus und machten selber Silbenrätsel. Leos Rätsel waren am schwersten zu lösen. Einmal saß ich bis Mitternacht, weil ich die drei Worte:
nicht herauskriegte.
Manche der Gäste, die sich für die schönen Stunden in unserem Hause revanchieren wollten, schenkten uns Blödsinniges. So bekamen wir beispielsweise derartige Mengen von Keramikschalen und Vasen, daß über dem obersten Regalfach noch ein unwiderruflich letztes oberstes angebracht werden mußte. Andere waren klug und voller Einfühlungsvermögen. Einer schenkte uns einen Band: »Frag mich was«, der uns über manchen Regentag hinweghalf, und ein anderer einen aufblasbaren Gummiseehund, den wir wegen seiner semitischen Nase »Ephraim« tauften. Er wurde zum Schlager. Niemand wollte mehr ohne ihn an den Strand. Wer sich mit Ephraim fotografieren ließ, war eines gelungenen Bildes fast sicher, und außerdem ersetzte er die Badeschuhe. Mancher, der bislang nur unter wildem Grimassenschneiden über die Ufersteine gewatet war, stützte sich nun auf den prallgefüllten Ephraim, bis das Wasser tief genug wurde, um zu schwimmen. Dagegen allerdings, daß man mit dem freien Arm auf den glitschigen, moosbedeckten Steinen rutschend nicht richtig ausbalancieren konnte, weil man ständig Bremsen auf sich zerklatschen mußte, half auch der Gummiseehund nichts.
An den Regentagen kam niemand zu Besuch, und nachmittags saßen Mama und ich im Wohnzimmer und zerschnitten alte Kleider und löcherige Bettücher zu Streifen, die wir aneinandernähten und zu Knäueln wickelten, damit Flickenteppiche daraus gewebt werden konnten. Es plauderte sich bei nichts traulicher über die Vergangenheit als beim Zerschneiden alter Textilien.
Gegen vier Uhr, wenn der Samowar hereingetragen wurde und einen herrlichen Holzkohlenduft verbreitete, pflegte Mama unweigerlich aus dem Westfenster zu blicken und festzustellen, daß es in der Wetterecke schon ganz hell sei. Sie würde sich nicht wundern, wenn morgen die Sonne schiene.
Wenn es sich zu neuem Wolkenbruch aufgeklärt hatte, kam Bruder Leo, um etwaige Langeweile zu verscheuchen, mit dem Ansinnen heraus, wir sollten alle Neugriechisch lernen oder Sanskrit. Sowas könne man immer brauchen. Sofort hatten alle kolossal viel zu tun und keine Minute übrig.
Irgendwann klärte es sich dann wirklich auf und man konnte über den kleinen Fußweg, der sich in einen Wassergraben verwandelt hatte, wieder an den See vorstoßen. Die Berge sahen aus wie frisch gewaschen, Wolkenschaum lief wie kochende Milch an ihren Flanken herab. Das Wasser des Sees war schmutziggrün und das Ufer viel schmaler geworden. Die kleine Mole, hinter der die Boote des Nachbarn Zuflucht suchten, war überflutet. Wir nahmen diese Phänomene wahr und dachten uns nichts dabei. Nachmittags machten wir den ersten Spaziergang, einen jener gewissen ländlichen Spaziergänge, bei denen man die wichtigsten Argumente des Gesprächs einander zurufen muß, weil die Partner gerade einige Pfützen überspringen oder sich den Lehm an Grasbüscheln von den Schuhen kratzen. Um nun außer dem Dreck an den Schuhen noch etwas Nützliches mit nach Hause zu bringen, kehrten wir in verschiedenen Höfen ein und kauften Eier. Es wurden erfreulich viele, und nun brauchten wir den großen, grauen Steinguttopf, der drunten im Keller stand, um sie einzulegen. Ich öffnete ahnungslos die Kellerklappe und wich mit einem Aufschrei zurück. Das Grundwasser stand unmittelbar unter dem Küchenfußboden. In ihm schwammen die leeren Weckgläser und die zerbrochenen Reste des großen Bowlengefäßes, das Leo mit dem Vermerk Baden verboten! versehen hatte. Der Steinguttopf war ohne Taucherausrüstung nicht herbeizuschaffen.
Wir machten aus einem Teil der Eier ein Omlett, in der richtigen Erkenntnis, daß wir jetzt Kraft nötig hätten. Dann sammelten wir alle Eimer, die das Haus enthielt und machten uns ans Ausschöpfen. Es ging viel langsamer als in Schillers Glocke, wo der Eimer ja nur so fliegt, dafür aber hatten wir alle, außer dem Mädchen Emma, hinterher Ischias, Hexenschuß und Kreuzschmerzen. Krumm, aber stolz wischten wir mit einem Lappen, hierzulande Hadern genannt, die letzten feuchten Reste auf. Dann warfen wir die Scherben weg und stellten die heilgebliebenen Weckgläser wieder in das hölzerne Regal. Beim Abendessen erklärte uns Papa, daß die Höhe des Grundwasserspiegels mit der Höhe des Sees zusammenhinge und die Höhe des Sees mit der Wassermenge der Zuflüsse, und die Wassermenge der Zuflüsse mit dem Regen, der am Alpenrand deswegen immerzu fiele, weil die Wolken nicht weiterkönnten. Wir hörten alle schweigend zu, weil wir so müde waren, und das Einschlafen abends im gemütlichen Bett schmeckte an dem Tag so gut wie ein Stück Torte.
Achtundvierzig Stunden später war wieder ziemlich viel Wasser im Keller, wenn auch diesmal nur bis zur drittuntersten Stufe. Wir ließen den Maurer kommen. Er schob den Hut vorne in die Stirne und kratzte sich vom Nackenhaar bis zum Scheitelbein und wieder zurück. Dann räusperte er sich und sagte, es müsse am Grundwasser liegen. Mama erwiderte kühl, das wüßten wir bereits. Da könne man nun nichts Rechtes machen, sagte der brave Mann, der vorgab, für die Fundamente dieses Hauses nicht allein verantwortlich zu sein, da könne man höchstens eine Vertiefung in den Zement des Kellerbodens ausheben, damit dort das Ausschöpfen leichter ginge. Wir sagten alle »aha«. In Bruder Leos Gesicht glaubte ich Vorbehalte zu erkennen.





























