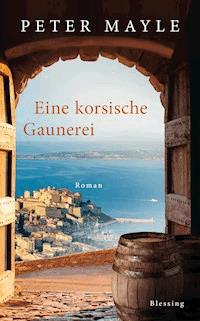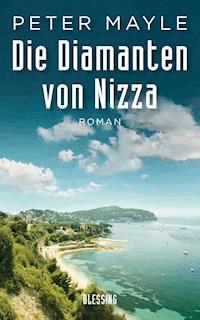Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Karl Blessing Verlag ist ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Copyright 2009 by Escargot Productions, Ltd.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe by Karl Blessing Verlag München 2010 Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenHerstellung: Gabriele Kutscha Werbeagentur, Zürich
ISBN : 978-3-641-04564-7V002
www.blessing-verlag.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Danksagung
Copyright
Originaltitel: The Vintage Caper
Originalverlag: Alfred A. Knopf, New York
Für Jon Segalmit großem Dank
1. Kapitel
Danny Roth nahm einen letzten Klecks Feuchtigkeitscreme und massierte ihn in seine Kopfhaut ein, die bereits wie eine Speckschwarte glänzte. Jeden Zentimeter unterzog er einer akribischen Prüfung, um sich zu vergewissern, dass auch nicht die kleinste Spur eines Haarstoppels zu sehen war. Vor geraumer Zeit, als die Haut die Haare von ihrem angestammten Platz zu verdrängen begann, hatte er erwogen, sich einen Pferdeschwanz zuzulegen – oft die erste Amtshandlung eines Mannes, dessen Haupthaar sich zu lichten droht. Doch Michelle war von dieser Idee alles andere als begeistert gewesen. »Merk dir eines, Danny«, hatte sie gesagt. »Unter einem Pferdeschwanz verbirgt sich meistens ein Arschloch.« Die deutlichen Worte seiner Frau hatten ihn bewogen, sich mit Haut und Haaren dem Billardkugel-Look zu verschreiben, und seither hatte er mit dem größten Vergnügen festgestellt, dass er sich in guter Gesellschaft befand, da diverse Stars, ihre Bodyguards und handverlesene Mitglieder ihres Trosses diesem Trend folgten.
Während er in den Spiegel spähte, nahm er sein linkes Ohrläppchen in Augenschein. Immer noch war er mit sich uneins, ob ein Ohrring angebracht sein könnte: Wenn ja, dann vielleicht ein Dollarzeichen in Gold oder ein Haifischzahn in Platin. Beide wären durchaus angemessen als Markenzeichen seiner beruflichen Aktivitäten, blieb jedoch die Frage, ob sie auch als persönliches Merkmal markant genug waren. Eine schwierige Entscheidung. Sie würde warten müssen.
Er trat vom Spiegel zurück und trottete in sein Ankleidezimmer, um die Garderobe für den heutigen Tag auszuwählen, die ihn formvollendet durch die morgendlichen Besprechungen mit Mandanten, das Mittagessen im Ivy und eine private Filmveranstaltung bringen musste. Am besten etwas Konservatives (immerhin war er ja Rechtsanwalt), aber mit einem Hauch Lässigkeit, der besagte, dass er sich einen Teufel um die Etikette scherte, denn schließlich hatte er sich ja als Anwalt in der Unterhaltungsindustrie einen Namen gemacht.
Ein paar Minuten später, in einem dunkelgrauen Anzug aus feinstem Kammgarn, einem weißen Seidenhemd mit offenem Kragen, Gucci-Slippern und Socken in Butterblumengelb, nahm er sein Blackberry-Smartphone vom Nachttisch, warf seinem schlafenden Ehegespons eine Kusshand zu und stieg in die niederen Gefilde seines Hauses hinab, in das puristische Ambiente seiner aus Granit und Edelstahl bestehenden Küche. Eine Kanne frisch gebrühter Kaffee und Variety, The Hollywood Reporter und die Los Angeles Times warteten bereits an der Frühstücksbar, von der Haushälterin für ihn ausgelegt. Die Morgensonne verhieß einen weiteren glorreichen Tag. Die Welt war so, wie sie ein Angehöriger der professionellen Elite Hollywoods erwarten durfte.
Roth konnte sich kaum über die Karten beklagen, die ihm das Schicksal ausgeteilt hatte. Er hatte eine junge, blonde, modisch magere Frau, eine florierende Kanzlei, eine Zweitwohnung in New York, eine Skihütte in Aspen und das Haus, das er als sein Hauptquartier bezeichnete: einen dreigeschossigen Gebäudekomplex aus Stahl und Glas in einer abgeschirmten und gesicherten Wohnanlage in Hollywood Heights. In dieser Trutzburg bewahrte er seine Schätze auf.
Wie viele seiner Zeitgenossen hatte er eine Anzahl gesellschaftlich beeindruckender Accessoires gesammelt. Dazu zählten Diamanten und Schränke voller Statusroben für seine Frau, drei Warhols und ein Basquiat für seine Wohnzimmerwände, ein versprengter Giacometti für seine Terrasse und ein perfekt restaurierter Gullwing-Sportwagen, ein originaler Flügeltüren-Mercedes für seine Garage. Sein Augapfel jedoch – und in gewisser Hinsicht leider auch Ursache einiger Frustrationen – war seine Weinsammlung.
Es hatte ihn etliche Jahre seines Lebens und eine Stange Geld gekostet, sich einen der besten Privatkeller weit und breit zuzulegen, wie kein Geringerer als Jean-Luc, sein Weinberater, befunden hatte. Vielleicht den besten Privatkeller überhaupt. Er enthielt kalifornische Rotweine bester Qualität und eine breit gefächerte Palette höchst renommierter weißer Burgunder. Er nannte sogar drei Kisten des grandiosen Yquem Jahrgang 1975 sein Eigen, der zu den berühmtesten und teuersten Weißweinen der Welt gehörte. Doch die Kronjuwelen seiner Sammlung – und verständlicherweise eine Quelle unermesslichen Stolzes – waren ungefähr fünfhundert Flaschen Claret Premier Cru aus Bordeaux – ein Prädikat, mit dem sich nur die Crème de la Crème der Weingüter im Médoc schmücken durfte. Sie konnten nicht nur mit der Klassifikation Erste Lage, sondern auch mit erstklassigen Jahrgängen aufwarten. Der 1953er Lafite Rothschild, der 1961er Latour, der 1983er Margaux, der 1982er Figeac, der 1970er Petrus – alle diese Kostbarkeiten wurden in einem Keller unter seinem Haus bei einer gleichbleibenden Temperatur von 13,3 bis 14,4 Grad Celsius und einem Luftfeuchtigkeitsgehalt von 80 Prozent gelagert. Er pflegte seine Bestände dann und wann abzurunden, wenn eine Kiste dieser Raritäten auf den Markt gelangte, nahm aber selten eine der Flaschen mit nach oben, um sie zu trinken. Sie in seinem Besitz zu wissen reichte ihm aus. Oder hatte ihm zumindest ausgereicht, bis vor Kurzem.
In den letzten Wochen hatte seine Freude merklich nachgelassen, wenn er den Inhalt seines Weinkellers begutachtete. Der Grund war, dass, abgesehen von einigen wenigen Privilegierten, niemand die edlen Tropfen von Latour, Margaux oder Petrus zu Gesicht bekam, und diejenigen, denen diese Ehre zuteil wurde, sich oft nicht ausreichend beeindruckt zeigten. Erst gestern Abend hatte er ein zu Besuch weilendes Paar aus Malibu für würdig befunden, im Zuge einer ausgiebigen Besichtigungstour Weine im Wert von sage und schreibe drei Millionen Dollar in Augenschein zu nehmen, doch die beiden hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, ihre Sonnenbrillen abzunehmen. Und noch schlimmer: Sie hatten den Opus One abgelehnt, der zum Dinner gereicht wurde – einen der teuersten und höchstbewerteten heimischen Weine – und stattdessen Eistee verlangt. Keine Spur von Wertschätzung, keine Spur von Ehrerbietung. Ein solcher Abend musste jeden Weinsammler, der etwas auf sich hielt, zur Verzweiflung bringen.
Bei der Erinnerung daran schüttelte Roth unwillkürlich den Kopf, und er blieb auf dem Weg zur Garage einen Augenblick stehen, um sich wenigstens an dem Panorama zu freuen: Im Westen konnte er Beverly Hills, im Osten Thai Town und Little Armenia und im Süden, jenseits des endlosen unbebauten Areals, die schimmernden Flugzeuge in Spielzeuggröße erkennen, die auf dem LAX, dem internationalen Flughafen von Los Angeles, starteten und landeten. Vielleicht nicht der schönste Ausblick, besonders wenn Smog in der Luft lag, aber ein erhebender, weitläufiger Ausblick, ein kostspieliger Ausblick und, vor allem, sein persönlicher Ausblick. Meins, alles meins, dachte er zuweilen heimlich, insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit, wenn sich die Lichter tief unter ihm meilenweit wie ein glänzender Teppich ausbreiteten.
Er zwängte sich mit akrobatischen Verrenkungen in den beengten Innenraum seines Mercedes und atmete tief den Duft von gut genährtem Leder und poliertem Walnussholz ein. Dieses Modell war ein Klassiker, eine Ikone der Automobilindustrie, so alt, dass sie der Erfindung der Getränkedose vorausging, und Rafael, sein mexikanischer Verwalter, hütete sie wie ein Museumsstück. Roth lavierte seine Nobelkarosse behutsam aus der Garage und fuhr in Richtung Wilshire Boulevard, wo sich seine Kanzlei befand, während seine Gedanken zu seinem Keller und dem Pärchen aus Malibu zurückkehrten, Schwachköpfe, die er eigentlich noch nie hatte leiden können. Warum hatte er sie überhaupt eingeladen?
Ehe er sichs versah, verstrickte der Anwalt sich auch schon in eine philosophische Betrachtung der Freuden des Besitzes. Er musste sich eingestehen, dass die Wertschätzung – ja, sogar der Neid anderer – sein eigenes Glücksempfinden steigerte. Worin, fragte er sich, soll die Befriedigung liegen, begehrenswerte Besitztümer zu sammeln, die kaum jemand zu sehen bekommt? Das wäre ähnlich, als würde er seine jugendfrische blonde Frau wegsperren, um sie dem Blick der Öffentlichkeit zu entziehen, oder seinen Mercedes zu lebenslänglicher Verbannung in der Garage verurteilen! Dennoch hortete er die besten Weine der Welt im Wert von mehreren Millionen Dollar in einem Keller, den nicht mehr als ein halbes Dutzend Besucher im Jahr in Augenschein nahmen.
Als er den getönten Glaskäfig erreichte, der seine Kanzlei beherbergte, war Roth zu zwei Schlussfolgerungen gelangt: erstens, dass heimlicher Genuss etwas für Warmduscher war, und zweitens, dass seine Weinsammlung ein breiteres Forum verdiente.
Er trat aus dem Fahrstuhl und strebte seinem Büro zu, ein Eckbüro, wie es sich gehörte; dabei rüstete er sich für den täglichen Nahkampf mit seiner Vorstandssekretärin Cecilia Volpé. Genau genommen wurde sie ihrer Aufgabenstellung nicht ganz gerecht. Ihre Rechtschreibung war beklagenswert, ihr Gedächtnis gelegentlich ziemlich bruchstückhaft und ihre Einstellung gegenüber einem Großteil seiner Mandanten von hoheitsvoller Verachtung geprägt. Dennoch hatte sie auch ihre guten Seiten, sozusagen als Trostpflaster: Sie besaß höchst ansehnliche Beine, lang und permanent gebräunt, die durch den unerschöpflichen Fundus an Schuhen mit zehn Zentimeter hohen Absätzen noch länger wirkten. Und sie war die Tochter von Myron Volpé, dem derzeitigen Oberhaupt der Volpé-Dynastie, die vor zwei Jahren die Filmindustrie aufgemischt hatte und als heimlicher Drahtzieher hinter den Kulissen noch heute über beträchtlichen Einfluss verfügte. Die Volpés waren, wie Cecilia bisweilen verlauten ließ, die Entsprechung einer königlichen Familie in Hollywood.
Und so nahm Roth die Schwächen seiner Sekretärin – endlose persönliche Telefongespräche, ständige Schminkpausen und eine barbarische Rechtschreibung – klaglos in Kauf. Sie verfügte nun einmal über erstklassige Verbindungen. Cecilia selbst sah in der Arbeit wohl eher einen Zeitvertreib zwischen zwei Verabredungen, mit Aufgaben, die weitgehend dekorativer und repräsentativer Natur waren. Roths Kanzlei bot ihr eine gesellschaftlich annehmbare Operationsbasis (sie hatte ihre eigene persönliche Assistentin, die sich der ermüdenden, wenngleich unerlässlichen Einzelheiten annahm) und gelegentlich den Nervenkitzel eines hautnahen Kontakts mit den Berühmten und Berüchtigten, aus denen sich Roths Klientel zusammensetzte.
Die Reibungen zwischen Roth und Cecilia waren gelinde und normalerweise auf einen kurzen verbalen Schlagabtausch wegen der Termine zu Beginn eines jeden Arbeitstages beschränkt. So auch heute Morgen.
»Hören Sie«, sagte Roth, als er einen Blick auf den ersten Namen in seinem Terminkalender warf, ein abgehalfterter Filmschauspieler, der jetzt eine zweite Karriere beim Fernsehen genoss. »Ich weiß, dass er nicht zu Ihren Lieblingsmandanten gehört, aber es würde Sie nicht umbringen, ein wenig netter zu ihm zu sein. Ein Lächeln, das ist alles.«
Cecilia verdrehte schaudernd die Augen.
»Ich verlange ja kein herzliches Lächeln. Nur ein freundliches. Übrigens, was stimmt denn nicht mit ihm?«
»Er nennt mich ›Babe‹ und versucht ständig, mir den Hintern zu tätscheln.«
Roth konnte es ihm nicht verübeln. Seine eigenen Gedanken schweiften ziemlich häufig in diese Richtung ab. »Das ist nichts weiter als kindliche Begeisterung«, erwiderte er. »Jugendlicher Übermut.«
»Danny.« Sie verdrehte abermals die Augen. »Er ist zweiundsechzig, behauptet er.«
»Schon gut, schon gut. Dann muss ich mich eben mit eisiger Höflichkeit abfinden. Übrigens – mir schwebt da ein privates Projekt vor, bei dem ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte, eine Lifestyle-Kampagne mit einem berühmten Zugpferd im Mittelpunkt. Ich denke, das ist der richtige Augenblick, an die Öffentlichkeit zu gehen.«
Cecilias Augenbrauen, zwei perfekt gezupfte Bögen, schnellten in die Höhe. »Wer ist das Zugpferd?«
Roth überhörte die Bemerkung geflissentlich. »Sie wissen ja, dass ich diese sagenhafte Weinsammlung besitze«, fuhr er fort. Er hielt vergebens nach einer Veränderung in Cecilias Gesichtsausdruck Ausschau, einem kaum merklichen Zittern der ungerührten Augenbrauen, das Hochachtung verriet. »Nun, sie befindet sich jedenfalls in meinem Besitz, und ich bin bereit, ein Exklusivinterview in meinem Keller zu geben, einem Journalisten von Rang und Namen, versteht sich. Der springende Punkt ist: Ich bin nicht nur ein Erfolgsmensch, sondern auch ein Connaisseur, ein Mann mit Geschmack, der die erlesenen Dinge des Lebens zu schätzen weiß – Châteaus, Jahrgänge, Bordeaux, den ganzen französischen Bockmist, der wie ein Spinnennetz miteinander verwoben ist. Was halten Sie von der Idee?«
Cecilia zuckte die Schultern. »Da sind Sie nicht der Einzige. In L.A. wimmelt es von Weinfreaks.«
Roth schüttelte den Kopf. »Sie verstehen offenbar nicht. Es handelt sich um eine einzigartige Sammlung. Sie enthält rote Bordeaux-Weine, Erste Lage, erstklassige Jahrgänge – über fünfhundert Flaschen.« Er machte eine Pause, des Effekts wegen. »Der Wert beläuft sich auf mehr als drei Millionen Dollar.«
Drei Millionen Dollar stellten eine Größenordnung dar, die offenbar auch Cecilia Respekt abverlangte. »Cool«, sagte sie. »Jetzt kapiere ich.«
»Ich dachte an ein Exklusivinterview in der Los Angeles Times. Kennen Sie dort jemanden?«
Cecilia betrachtete gedankenverloren ihre Nägel. »Die Besitzer. Genauer gesagt, Daddy ist mit ihnen bekannt. Vermutlich könnte er sie fragen, ob sie jemanden an der Hand haben, der die Geschichte übernimmt.«
Roth lächelte, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und bewunderte seine butterblumengelben Knöchel. »Wunderbar. Damit wäre allen gedient.«
Das Interview war für Samstagmorgen anberaumt, und die Mitglieder des Roth-Haushalts waren instruiert und standen Gewehr bei Fuß. Michelle war gleich zu Beginn der Darbietung eine Nebenrolle zugedacht: Sie sollte die formvollendete Gastgeberin und, wenn man ihren Worten Glauben schenken durfte, (nach der Buchvorlage von Tessa Barclay) die gelegentlich trauernde Weinwitwe spielen. Rafael hatte die Anweisung erhalten, die purpurfarbene Bougainvillea zu stutzen, die sich über die Terrassenmauer ergoss, notfalls immer wieder, ganz nach Bedarf. Der Mercedes, nach der letzten Politur auf Hochglanz gebracht, stand in der Einfahrt, als hätte man ihn dort rein zufällig vergessen. Aus dem Keller drifteten die Klänge eines Klavierkonzerts von Mozart aus den in schattigen Winkeln verborgenen Lautsprechern. So weit das Auge reichte, waren Anzeichen von Wohlstand, Geschmack und Finesse zu erkennen. Roth hatte sogar in Betracht gezogen, eine seiner kostbaren Flaschen zu öffnen, konnte sich aber letztlich doch nicht dazu durchringen, ein solches Opfer zu bringen. Die Journalisten und Fotografen würden sich mit dem Krug begnügen müssen, der in dem Eiskübel aus Kristall auf dem Tisch des Weinkellers kühlte.
Die Ankunft der Los Angeles Times-Reporter wurde durch einen Anruf des Wachpostens am Eingangstor des Anwesens angekündigt. Michelle und Roth nahmen ihre Positionen auf dem obersten Absatz der Außentreppe ein, die zur Auffahrt hinabführte, wo sie warteten, bis die Journalisten aus dem Wagen stiegen, bevor sie hoheitsvoll die Stufen hinunterschritten.
»Mr. Roth? Mrs. Roth? Ich freue mich, Sie kennenzulernen.« Ein beleibter Mann in einem zerknitterten Leinenjackett näherte sich ihnen mit ausgestreckten Händen. »Ich bin Philip Evans, und der Name dieses Fotoladens auf zwei Beinen lautet Dave Griffin.« Er deutete mit einem Kopfnicken auf einen jungen Mann, der mit Ausrüstungsgegenständen beladen war. »Er ist für die Aufnahmen zuständig. Ich für den Text.« Evans drehte sich auf dem Absatz um und blickte gen Süden. »Wow! Das nenne ich eine Aussicht.«
Roth tat das Panorama mit einem lässigen Winken ab, das den Besitzerstolz kaschieren sollte. »Warten Sie, bis Sie erst den Keller gesehen haben.«
Michelle warf einen raschen Blick auf ihre Uhr. »Danny, ich habe noch einige Anrufe zu erledigen. Ich lasse euch Männer jetzt alleine, wenn ihr versprecht, mir ein Glas Champagner übrig zu lassen.« Und mit einem Lächeln und einem Flattern der Hand, das einen Abschiedsgruß andeutete, kehrte sie ins Haus zurück – ein gelungener Abgang.
Roth führte die beiden in den Keller, und während der Fotograf vollauf damit beschäftigt war, die Tücken des Lichtes und der Spiegelung zu erkunden, begann das Interview.
Evans war ein Reporter vom alten Schlag, der mehr Wert auf Fakten als auf Spekulationen legte. Annähernd eine Stunde verbrachte er damit, Roths Biografie von allen Seiten zu beleuchten: seinen Einstieg in die Unterhaltungsindustrie, seine erste Begegnung mit Spitzenweinen, seine erwachende Leidenschaft für das Sammeln grandioser Jahrgänge und die Einrichtung seines technisch perfekten Kellers. Im Hintergrund, die Sphärenklänge Mozarts interpunktierend, war das Klicken und Summen einer Kamera zu vernehmen – der Fotograf drehte seine Runden.
Roth, dessen Berufsleben darin bestand, im Namen seiner Mandanten zu sprechen, stellte fest, dass er es ungemein genoss, einem aufmerksamen Zuhörer zur Abwechslung einmal etwas über sich selbst zu erzählen. Er geriet dabei so in Fahrt, dass sich Evans genötigt sah, ihn mit einer Frage über Jahrgangschampagner daran zu erinnern, den Krug zu öffnen. Dieser weihevolle Akt führte, wie so oft bei einem oder zwei Gläschen Champagner, eine Wende im Gesprächsverlauf herbei: Es wurde nun entspannter, die Atmosphäre war geradezu unbeschwert.
»Mr. Roth«, sagte Evans. »Ich weiß, dass Sie diese wunderbaren Weine aus reinem Vergnügen sammeln, aber geraten Sie nicht manchmal in Versuchung, den einen oder anderen zu veräußern? Ich meine, Sie haben hier unten ja eine beträchtliche Menge Kapital gebunden.«
»Mal sehen«, erwiderte Roth und ließ den Blick über die Stellagen mit Flaschen und akribisch aufgestapelten Lattenkisten schweifen. »Der 1961er Latour würde beispielsweise zwischen 100 000 und 120 000 Dollar pro Kiste einbringen, der 1983er Margaux um die 10 000 Dollar und der 1970er Petrus – nun, Produkte dieses Weinguts sind darauf abonniert, bei einer Auktion Spitzenpreise zu erzielen. Ich schätze, die wären ungefähr 30 000 Dollar wert, sofern man überhaupt an sie herankommt. Jedes Mal, wenn eine Flasche dieses Jahrgangs getrunken wird, treibt die Verknappung des Angebots den Preis in die Höhe, im gleichen Maß wie die Qualität des Weines.« Er füllte die Gläser nach und betrachtete die Blasen, die spiralförmig nach oben stiegen. »Doch um Ihre Frage zu beantworten: Nein, ich gerate nicht in Versuchung zu verkaufen. Für mich gleicht die Weinsammlung einer Kunstsammlung. Flüssige Kunst.«
»Reden wir Klartext. Was glauben Sie, ist Ihre Sammlung wert?«, entgegnete Evans.
»Im Augenblick? Allein der Bordeaux annähernd drei Millionen, würde ich sagen. Mit steigender Tendenz im Laufe der Zeit. Wie ich bereits sagte, die Verknappung des Angebots treibt den Preis in die Höhe.«
Der Fotograf, der die kreativen Möglichkeiten der Weinflaschen und Stellagen erschöpft hatte, näherte sich nun Roth, den Belichtungsmesser in der Hand, um eine Messung der Daten vorzunehmen. »Zeit für ein Porträtfoto, Mr. Roth«, kündigte er an. »Könnten wir Sie drüben an der Tür aufnehmen, vielleicht mit einer Flasche in der Hand?«
Roth dachte einen Moment nach. Dann nahm er, mit unendlicher Behutsamkeit, eine Magnumflasche 1970er Petrus aus ihrer Ruhestätte. »Wie wäre es damit? Zehntausend Mäuse, falls man eine solche Rarität überhaupt noch irgendwo auftreiben kann.«
»Perfekt. Und nun bitte nach links, damit wir Licht auf Ihr Gesicht bringen, und versuchen Sie, die Flasche vor Ihre Schulter zu halten.« Klick, klick. »Fantastisch. Die Flasche ein wenig höher. Ein angedeutetes Lächeln. Fabelhaft. Wunderbar.« Klick, klick, klick. Und so ging es fünf Minuten lang weiter, wobei Roth reichlich Gelegenheit erhielt, seine Mimik zu verändern: Aus dem glücklichen Weinkenner wurde nun ein seriöser Weininvestor.
Roth und Evans überließen es dem Fotografen, die Ausrüstung zusammenzupacken, und warteten draußen vor dem Keller. »Haben Sie alles, was Sie wollten?«, erkundigte sich Roth.
»Absolut«, antwortete der Journalist. »Das wird eine richtig nette Reportage.«
Und genau so kam es. Eine volle Seite in der Wochenendbeilage (unter der vorhersehbaren Überschrift »Roths Rebsaft«) mit einer Großaufnahme des Anwalts, der seine Magnum im Arm wiegte, und mehreren kleinen Fotos vom Keller, begleitet von einem angemessen ausführlichen Text. Er war nicht nur schmeichelhaft, sondern auch mit jenen Details gespickt, die Weinliebhaber erwarten, angefangen von der Anzahl der Flaschen, die für jeden Jahrgang erzeugt wurden, bis hin zu Kommentaren von namhaften Weinexperten wie Broadbent und Parker, die sich zur Qualität äußerten. Darüber hinaus gab es Wissenswertes über die verschiedenen Rebsorten und Informationen, die nur für einen kleinen Kreis Eingeweihter von Interesse waren, wie Daten über den Beginn der Weinlese, die Perioden der Mazeration, die Bodenbeschaffenheit und den Tanningehalt. Und im Text verstreut fanden sich, wie Trüffel in der foie gras, die Preise. Sie wurden normalerweise pro Kiste oder Flasche angegeben, manchmal jedoch in kleineren Maßeinheiten, die erschwinglicher waren, zum Beispiel 250 Dollar pro Glas oder (für den Yquem, der von einem der teuersten Weingüter der Welt stammte) 75 Dollar pro Schluck.
Nachdem Roth den Artikel gelesen hatte, war er mehr als zufrieden. Er fand, dass er der Öffentlichkeit als passionierter und durch und durch seriöser Sammler präsentiert wurde. Nichts Protziges oder Neureiches, solange der geneigte Leser von der flüchtigen Anspielung auf das Wochenendhaus in Aspen und seiner Vorliebe für Privatjets absah. Doch selbst diese waren ein durchaus annehmbares, im Grunde sogar ziemlich normales Zubehör in den oberen Regionen der kalifornischen Society des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Alles in allem konnte er also zuversichtlich sein, dass die Reportage ihren Zweck erfüllt hatte. Die Welt – oder zumindest die Welt, die zählte, seine Welt – war auf die Tatsache aufmerksam gemacht worden, dass er nicht nur ein vermögender und erfolgreicher Geschäftsmann war, sondern auch ein Aficionado grandioser Jahrgänge, ein veritabler Schirmherr des Rebensaftes.
Dieser Eindruck bestätigte sich in den Tagen nach dem Erscheinen des Artikels immer wieder aufs Neue. Die Küchenchefs und Sommeliers seiner bevorzugten Restaurants behandelten Danny Roth mit noch etwas mehr Ehrerbietung als bisher und nickten zustimmend, wenn er ihnen mitteilte, welche edlen Tropfen er auf der Weinkarte ausgesucht hatte. Geschäftsfreunde riefen ihn an, suchten seinen Rat hinsichtlich ihrer eigenen, weniger ruhmreichen Keller. Zeitschriften baten um ein Interview. Die Reportage wurde auch in der International Herald Tribune abgedruckt, die weltweit vertrieben wurde. Über Nacht hatte Danny Roth den Status einer Weinkoryphäe erworben.
2. Kapitel
Es war Heiliger Abend in Los Angeles, und die Metropole geizte nicht mit Weihnachtsschmuck. Nikoläuse mit Sonnenbrille – einige trugen kurze rote Hosen als Zugeständnis an die Hitze – läuteten unentwegt Glöckchen und wackelten mit den falschen Bärten, während sie ihr Lager in den betuchten Vierteln der Stadt aufschlugen. In Beverly Hills waren einige Rasenflächen mit künstlichem, aus China importiertem Schnee eingesprüht worden, um ihnen ein festlicheres Aussehen zu verleihen. Der Rodeo-Drive, die exklusive Einkaufs- und Flaniermeile der Stadt, funkelte im Schein der American-Express-Platinum-Karten. Eine Bar am Wilshire Boulevard bot eine verlängerte Happy Hour mit konkursverdächtig gesenkten Getränkepreisen von elf Uhr morgens bis Mitternacht, mit der zusätzlichen Verführung biologisch kontrollierter Martinis. Und Angehörige des L.A.P.D., der Polizei von Los Angeles, vor dem Fest der Liebe darauf erpicht, den Menschen wohlgefällig zu sein, verteilten mit ungewohnter Großzügigkeit Strafzettel an Falschparker und Einladungen zur Blutentnahme an die armen Sünder, die unter dem Einfluss berauschender Substanzen im Straßenverkehr erwischt wurden.
Als die Nacht hereinbrach, bahnte sich ein Krankenwagen den Weg durch den Feiertagsverkehr auf dem Sunset Boulevard und brauste in Richtung Hügel, bevor er an der Sicherheitsschranke hielt, die den Eingang zum Nobelviertel Hollywood Heights markierte. Der Wachmann, nach den ereignislosen letzten Stunden vor Langeweile gähnend, trat aus seinem klimatisierten Pförtnerhaus heraus und musterte die beiden Männer im Krankenwagen.
»Was ist los?«
Der Fahrer, der in seiner weißen Sanitäterkleidung beinahe festlich wirkte, lehnte sich aus dem Fenster. »Klingt ernst, aber wir können erst Genaueres sagen, wenn wir uns selber ein Bild gemacht haben. Notruf aus der Roth-Residenz.«
Der Wachmann nickte, kehrte in seine Miniatur-Festung zurück und griff zum Telefon, um anzurufen. Der Fahrer sah, wie der Wächter mehrmals nickte, bevor er den Hörer auflegte. Endlich ging die Schranke hoch. Der Wachmann trug den Besuch im Wachbuch ein, warf einen Blick auf seine Uhr und stellte fest, dass seine Schicht in zehn Minuten zu Ende ging. Pech für seinen Nachfolger, der dazu verurteilt war, den Rest des Heiligen Abends im Pförtnerhaus zu verbringen und sich eine der zum x-ten Mal wiederholten Serien im Fernsehen anzuschauen.
Vor dem Château Roth angekommen, wurde der Krankenwagen in der Auffahrt von dem Mann in Empfang genommen, der dem Wachmann grünes Licht gegeben hatte, einem sichtlich erregten Rafael. Man hatte das Anwesen seiner Obhut anvertraut, während die Besitzer das Weihnachtsfest in Aspen verbrachten, und nur der Gedanke, mit 50 000 Dollar in bar über die mexikanische Grenze zu verschwinden, hatte ihn bewogen, sein angenehmes, wenngleich illegales Beschäftigungsverhältnis in den Wind zu schreiben. Er führte den Fahrer und seinen Begleiter zum Keller und sperrte die Tür auf. Ohne übertriebene Eile streiften die beiden Sanitäter Gummihandschuhe über, bevor sie leere Pappkartons mit der Aufschrift einer Weinkellerei in Napa Valley, eine der besten Weinbauregionen der Welt, ausluden. Eine kurze Überprüfung vorab zeigte, dass die Bordeaux-Flaschen einen separaten Teil des Kellers einnahmen, was sich als hilfreich erwies. So mussten sie weniger Zeit darauf verwenden, sämtliche Stellagen zu durchforsten. Sie gingen systematisch nach ihrer Liste vor und begannen die Flaschen in den Kartons zu verstauen, wobei sie mit buchhalterischer Genauigkeit Namen und Jahrgänge abhakten. Rafael hatte alle Hände voll zu tun, die gefüllten Kartons in den hinteren Teil des Krankenwagens zu schaffen. Man hatte ihn eindringlich gewarnt: Jeder durch Bruch entstandene Schaden werde ihn teuer zu stehen kommen.
Die Kartons enthielten entweder ein Dutzend Flaschen normaler Größe oder sechs Magnumflaschen, und als die Männer ihre Arbeit beendet hatten, waren fünfundvierzig Kartons gepackt und verladen. Nach einer letzten Überprüfung und einem flüchtigen, bedauernden Blick auf Roths kalifornische Weine und seine Havanna-Zigarrenschachteln aus der Prä-Castro-Ära schalteten sie das Licht im Keller aus und sperrten die Tür hinter sich zu. Nun war es an der Zeit, einige Anpassungen an der Innenausstattung der Ambulanz vorzunehmen.
Die Kartons wurden fein säuberlich zu beiden Seiten einer Krankentrage gestapelt, bevor sie mit Klinikdecken verhüllt wurden. Rafael, inzwischen so nervös, dass er kurz davor war, tatsächlich zum Notfall zu werden, wurde auf die Trage geschnallt und an einen Tropf gehängt, der vorgeblich Morphium enthielt, um die Schmerzen seines vorgeblichen Blinddarmdurchbruchs zu lindern. Derart gerüstet, fuhren die Männer zum Pförtnerhaus und hielten gerade lange genug an, um dem Wachmann frohe Weihnachten wünschen zu können. Er grüßte zurück und schien nicht den geringsten Argwohn zu hegen. Mit eingeschaltetem Blinklicht verschwand der Wagen in der Nacht.
Der Fahrer rutschte unruhig auf dem Sitz hin und her und blickte nervös in alle Richtungen, als rechne er jeden Augenblick mit einer unliebsamen Überraschung. Aber sie fuhren unbehelligt weiter. Allmählich entspannte der Sanitäter. Er gestattete sich ein Grinsen, als er ein heftiges Rumoren aus dem hinteren Teil des Krankenwagens vernahm. »Alles klar, Rafael, Zeit zum Aufstehen. Wir setzen dich ab, bevor wir auf die Autobahn fahren.« Er holte einen Briefumschlag aus der Tasche und reichte ihn über die Schulter nach hinten. »Besser, du zählst noch mal nach. Es sind ausschließlich Hunderter.«
Fünf Minuten später bog der Krankenwagen in eine dunkle Seitenstraße ein, um den mexikanischen Hausmeister herauszulassen. Der nächste Zwischenstopp wurde in einer Garage eingelegt, die sich in einer noch dunkleren Seitenstraße eines heruntergekommenen Viertels im Westen von L.A. befand; hier wurden die Weinkartons vom Krankenwagen in einen ungekennzeichneten Lieferwagen umgeladen. Nun blieb nur noch, die Nummernschilder der Ambulanz zu entfernen und das Vehikel auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Krankenhauses abzustellen, bevor die beiden Männer im Lieferwagen in Richtung Santa Barbara davonbrausten.
3. Kapitel
Der Aufenthalt in Aspen war für Roth vergnüglicher als jemals zuvor. Jede Menge Prominenz der A-Liste tummelte sich in dem Nobel-Skiort, um sich in ihrer sündteuren Ausrüstung auf der Piste und bei Après-Aktivitäten in Szene zu setzen, und es gelang ihm, die Kontakte zu drei oder vier potenziellen Mandanten zu pflegen. Zu seiner Überraschung trug der Artikel in der Los Angeles Times erheblich dazu bei. Obwohl die Ausgabe bereits im September erschienen war, gab es in diesem Jahr Promis wie Sand am Meer, die den Artikel über Roths Sammlung gelesen und nun nach eigenen Angaben ihr »Faible für Wein« entdeckt hatten. Die althergebrachten Themen in Aspen – Ehebruch, Börsentipps, Schönheitschirurgie, die Diebstähle in den Filmstudios – wurden von Plaudereien über Weinkeller und Spitzenjahrgänge, Bordeaux versus kalifornische Produkte, optimale Alterungszeiten und natürlich über Weinpreise verdrängt.
Roth stellte fest, dass er seine Reden überwiegend vor einem kleinen, aber hingerissenen Zuhörerkreis vom Stapel ließ, hochkarätige Namen, die sich normalerweise ein wenig außerhalb seiner gesellschaftlichen Reichweite befanden, und die daraus resultierenden geschäftlichen Möglichkeiten wusste er zu nutzen; schließlich galt es das Eisen zu schmieden, solange es heiß war. Heute mochte es um Wein gehen, doch morgen konnte durchaus eine skandalträchtige Krise um Vertragsgrundlagen auf der Tagesordnung stehen. Während der verschneiten Weihnachtswoche blieben Roths Ski unangetastet, und Michelle hatte den Privatskilehrer ganz für sich allein.
Die Roths traten gemeinsam mit einem Paar, das sie flüchtig aus L.A. kannten, im Privatjet den Heimweg an. Als sie verrieten, wie sehr es sie beeindruckt hatte, ihn in so illustrer Gesellschaft zu sehen, tat Roth ihre Schmeicheleien mit einer Handbewegung ab und beklagte leutselig, dass er zu beschäftigt gewesen sei, um Ski zu fahren. Daraus folgerten die beiden stillschweigend, dass es dabei nicht um Bordeaux, sondern um berufliche Belange gegangen sein müsse, und Roth ließ es gern dabei bewenden. Die befriedigende Woche hatte damit ein noch befriedigenderes Ende gefunden.
Seine gute Laune hielt bis zum Abend an, als er mit seiner Frau in das Haus in Hollywood Heights zurückkehrte und entdecken musste, dass Rafael nicht da war, um sie zu begrüßen. Und darüber hinaus hatte er nicht einmal eine Nachricht hinterlassen, die seine Abwesenheit erklärte. Das war ungewöhnlich, ja besorgniserregend. Doch als sie von Salon zu Salon schritten, begannen sie sich zu entspannen. Die Warhols hingen an den Wänden, der Giacometti versteckte sich auf der Terrasse, und das Haus schien unberührt. In Rafaels winziger Souterrainwohnung hingen die Kleider ordentlich im Schrank, und das Bett war akkurat gemacht. Nichts deutete auf einen plötzlichen Aufbruch hin. Danny und Michelle Roth gingen früh schlafen, ein wenig verwirrt, irritiert, jedoch nicht über Gebühr beunruhigt.
Erst am folgenden Morgen stieg Roth in den Keller hinab.
»Oh Gott!« Der qualvolle Aufschrei hätte um ein Haar zur Folge gehabt, dass Michelle von ihrem Stairmaster heruntergefallen wäre. Sie eilte aus dem Fitnessraum in den Keller, wo sie Roth vorfand, der wie hypnotisiert auf eine Wand mit gänzlich leeren Stellagen starrte.
»Mein Bordeaux! Jede gottverdammte Flasche! Alles weg.« Der Anwalt begann, hektisch hin und her zu laufen, wobei er in seiner ohnmächtigen Wut immer wieder die Fäuste ballte. Ein Mann mit üppigerem Bewuchs hätte sich die Haare gerauft. »Wenn ich diesen Mistkerl in die Finger kriege, bringe ich ihn um. Ich reiße ihm das Herz aus dem Leibe.« Noch schaurigere Todesdrohungen murmelnd, hastete er nach oben und macht sich auf die Suche nach seinem Blackberry.
In zügiger Abfolge benachrichtigte er den Wachmann im Pförtnerhaus, das zuständige Polizeikommissariat in L.A. und seine Versicherungsgesellschaft.
Der Pförtner erschien als Erster am Schauplatz des Verbrechens. Er umklammerte sein Wachbuch wie ein Ertrinkender den Rettungsring. Inzwischen war Roth wieder in der Lage, Sätze zu formulieren, die man als mehr oder weniger zusammenhängend empfinden konnte. »Okay. Ich will wissen, wer in mein Haus eingedrungen ist und wann, und warum zum Teufel ihn niemand daran gehindert hat.« Sein Zeigefinger bohrte sich in den Brustkorb des Wachmanns. »Und ich will den Namen des Arschlochs wissen, der an besagtem Abend zum Dienst eingeteilt war.«
»Moment, Mr. Roth.« Der Pförtner, der ein stummes Stoßgebet zum Himmel schickte, er möge zu dem Zeitpunkt nicht Dienst gehabt haben, zog das Wachbuch zurate und hob schließlich den Blick, wobei sich Erleichterung in das Gefühl des Triumphs mischte. »Ich hab’s. Heiligabend, ein medizinischer Notfall. Ein Krankenwagen wurde durchgelassen, um 20 Uhr 20, verließ das Anwesen um 22 Uhr 50. Tom hatte Dienst. Ihr Verwalter hat ihm die Genehmigung dazu erteilt.«
»Das kann ich mir lebhaft vorstellen! Diese miese kleine Ratte!« Roth riss dem Wächter das Büchlein aus der Hand und warf einen Blick hinein, als hoffte er auf weitere Enthüllungen. »Das ist alles? Warum fehlt der Name der Klinik? Und was ist mit dem medizinischen Personal? Offenbar mussten sie sich nicht ausweisen. Großer Gott.«
»Wir haben das Autokennzeichen. Vermutlich haben sie behauptet, dass es sich um einen Notfall handelt.«
»Klar, was sonst. Die konnten es gar nicht mehr erwarten, meinen Wein in die Finger zu bekommen.« Roth schüttelte den Kopf und drückte das Notizbuch wieder dem Wächter in die Hand, der sich respektvoll verneigte und erleichtert davonschlich. Er kehrte just in dem Moment ins Pförtnerhaus zurück, als die Polizei eintraf: zwei Detectives mit gelangweilter Miene, zu einem Einsatz abkommandiert, den sie intuitiv bereits als reine Zeitverschwendung eingestuft hatten.
»Also«, sagte Roth, als sie das Haus betraten, »ich unterstütze die Polizeiarbeit mit großzügigen Spenden, deshalb fände ich es zur Abwechslung ganz nett, etwas für mein Geld zu bekommen. Folgen Sie mir, meine Herren.« Die Polizisten nickten wie ein Mann, da beiden die gleichen Gedanken durch den Kopf gingen: wieder eines von diesen großen Tieren, die dem Unterstützungsfonds der Polizei jedes Jahr zu Weihnachten einen Scheck über hundert Dollar zukommen ließen und dafür eine privilegierte Behandlung erwarteten.
Sie waren kaum durch die Kellertür getreten, als Roth wie aus der Pistole geschossen loslegte. »Sehen Sie das?« Er deutete auf die leeren Stellagen. »Wein im Wert von drei Millionen, ich habe zehn Jahre für die Sammlung gebraucht, sie ist unersetzlich. Einfach unersetzlich. Und diese Mistkerle kannten sich aus. Sie haben nur den Bordeaux mitgehen lassen.«
»Mr. Roth.« Der ältere der beiden Polizisten hatte sein Notizbuch gezückt, während der jüngere begann, den Keller zu inspizieren. »Ich brauche ein paar Einzelheiten. Also, wann -«
»Einzelheiten wollen Sie? Heiligabend, wir waren weg, und da kommt dieser Krankenwagen ans Torhaus mit einer schwachsinnigen Geschichte von einem Notfall. Der Wachmann ruft im Haus an, und der Verwalter erteilt ihm grünes Licht.«
»Name des Verwalters?«
»Torres, Rafael Torres.«
»Mexikaner?«
»Klingt das vielleicht schwedisch?«
Der Polizist seufzte. Ein Klugscheißer also obendrein. »Mr. Roth, ich muss Ihnen diese Frage stellen: Befindet sich Ihr Verwalter im Besitz einer Green Card? Und einer Sozialversicherungsnummer? Mit anderen Worten, hat er eine beschränkte Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung?«
Roth zögerte. »Nun, nicht genau. Aber was für einen Unterschied macht das? Er hat dieses Diebesgesindel hereingelassen und sich mit ihnen abgesetzt. Denn als wir gestern Abend aus Aspen zurückkehrten, war er nicht mehr da. Wir haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Es fehlte nichts. Und heute Morgen bin ich endlich dazu gekommen, einen Blick in den Keller zu werfen.« Roth wandte sich den leeren Stellagen zu und spreizte die Finger. »Drei Millionen.«
Der Polizist sah von seinen Notizen auf und schüttelte den Kopf. »Das Problem ist, Mr. Roth, dass wir heute den 31. Dezember haben. Seit dem Raub sind volle sechs Tage vergangen. Die Diebe wussten genau, was sie wollten; sie haben eine Möglichkeit ausgeknobelt, sich Zutritt zu Ihrem Haus zu verschaffen und ihren Weinvorrat auszudünnen. Wir werden den Tatort auf Fingerabdrücke überprüfen, aber ich fürchte …« Er schüttelte abermals den Kopf. »Da scheinen Profis am Werk gewesen zu sein. Die denken nicht daran, ihre Anschrift zu hinterlassen.«
Nun war es an Roth, zu seufzen. Ein Klugscheißer also, dieser Bulle. Das hatte ihm gerade noch gefehlt.
Der Polizist beendete seine Eintragungen und steckte das Notizbuch wieder ein. »Wir werden ihnen nachher unsere Kriminaltechniker vorbeischicken und uns den Wachmann vorknöpfen. Vielleicht ist ihm etwas an dem Krankenwagen aufgefallen, was uns einen Hinweis geben könnte. Wir melden uns wieder bei Ihnen, sobald wir etwas in der Hand haben. Mittlerweile würde ich vorschlagen, dass sie nichts im Keller berühren.«
Roth verbrachte den Rest des Vormittags am Telefon. Sein erster Anruf, der Cecilia Volpé galt, wurde von der Empfangssekretärin entgegengenommen. Sie erinnerte ihn daran, dass er Cecilia netterweise freigegeben hatte, um ihr in Vorbereitung auf die Silvester-Festivitäten eine Haarverlängerung und eine Ganzkörper-Bräunung zu gönnen. Und Michelle verbrachte den Tag damit, den Kopf immer wieder in den Kleiderschrank zu stecken, um ein passendes Outfit für die Party zu finden, die am Abend in Beverly Hills stattfinden sollte. Roth blieb also sich selbst überlassen; er hatte nichts weiter zu tun als im Haus hin und her zu stapfen, den Telefonhörer ans Ohr geklemmt. Jedes Mal, wenn er an seinen Keller dachte, schien die klaffende Lücke größer zu werden. Selbst die Aussicht, die sich ihm von der Terrasse bot, war in dichten Nebel gehüllt. Am frühen Nachmittag, kurz vor der Besprechung mit dem Repräsentanten der Versicherung, war er überzeugt, dass das Schicksal ihm übel mitgespielt hatte. Selbstmitleid und Wut wechselten einander ab, und die Wut siegte.
Elena Morales, Leiterin der Schadensabteilung für Privat- oder nicht gewerbliche Kunden bei Knox Worldwide, traf um Punkt 15 Uhr ein. Unter normalen Umständen hätte Roth sich die Mühe gemacht, sie mit seinem Charme zu umgarnen; Elena war – wie ihre zahlreichen Verehrer bestätigten – viel zu attraktiv für die schnöde Versicherungsbranche. Sie hatte Augen in der Farbe dunkler Schokolade, pechschwarzes Haar und eine Figur, um die sie manche Leinwand-Diva beneidet hätte. Doch heute waren diese Attribute erregender Weiblichkeit bei Roth verschwendet.
Elena blieb gerade noch Zeit, ihm ihre Geschäftskarte zu überreichen, als Roth auch schon die Marschrichtung der Besprechung vorgab. »Ich hoffe, Sie verschonen mich mit dem üblichen Versicherungsschrott.«
Elena hatte sich an die Grobheiten und gelegentlichen Wutanfälle vermögender Klienten gewöhnt. Die Reichen, vom Rest der Sterblichen durch ein dickes finanzielles Polster isoliert und durch Privilegien geschützt, waren von ihrem Wesenskern her nicht gerüstet, mit den harten Realitäten des Lebens umzugehen. Angesichts von Verlusten gleich welcher Art neigten sie dazu, sich wie verzogene Kinder zu gebärden – selbstsüchtig, unverständig, oft geradezu hysterisch. Sie kannte dieses Verhaltensmuster zur Genüge.
»Welchen Versicherungsschrott meinen Sie, Mr. Roth?«
»Das wissen Sie genau. Den ganzen kleingedruckten Mist über mildernde Umstände, Modalitäten und Auflagen, begrenzte Haftbarkeit, Lücken im Versicherungsschutz, höhere Gewalt, Schlupflöcher in den Richtlinien, Schutzklauseln …« Er legte eine Verschnaufpause ein, in der er nach weiteren Beispielen für die unbilligen Gepflogenheiten der Versicherungskonzerne suchte.
Elena schwieg eisern. Die Erfahrung hatte sie gelehrt, der Natur ihren Lauf zu lassen. Früher oder später pflegte den Klienten sowohl die Luft als auch die verbale Munition auszugehen.
»Also?«, fügte Roth hinzu. »Hier geht es nicht um Lappalien, sondern um drei Millionen Dollar.«
Elena warf einen Blick auf die Kopie von Roths Versicherungspolice, die sie mitgebracht hatte. Der Bordeaux war gemäß Roths Anweisung getrennt versichert worden, aber von drei Millionen konnte keine Rede sein. Elena seufzte. »Fakt ist, Mr. Roth, dass sich die Versicherungssumme laut Vertrag auf 2,3 Millionen Dollar beläuft. Doch darüber können wir uns später unterhalten. Ich habe mich bereits mit der zuständigen Dienststelle des Polizeiapparates in Verbindung gesetzt, daher sind mir die meisten Einzelheiten bekannt, obwohl wir in einem solchen Versicherungsfall selbstverständlich unsere eigenen vollumfänglichen Ermittlungen durchführen.«
»Das kann doch Jahre dauern, oder? Der Wein ist verschwunden. Er war bei Ihnen versichert. Was brauchen Sie sonst noch an Informationen?«