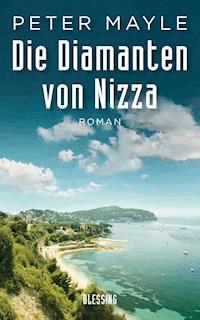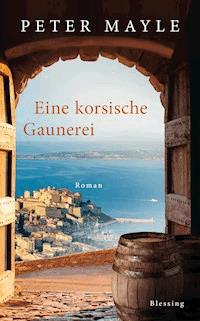
3,99 €
Mehr erfahren.
Die Russen kommen! Doch haben sie eine Chance gegen Peter Mayles Charme?
In seinem luxuriösen Palais auf einem Hügel über der Bucht von Marseille wartet Francis Reboul auf Sam Levitt. Als der Rechtsanwalt mit dem ausgeprägten detektivischen Spürsinn und dem Hang zu unkonventionellen Ermittlungen zusammen mit seiner Freundin Elena Morales aus Kalifornien endlich eintrifft, wartet Arbeit auf ihn. Denn ein Oligarch namens Oleg Vronsky ist in der Bucht mit seiner Luxusjacht vor Anker gegangen und observiert das Palais von Reboul. Immer dreister werden seine Versuche, den Franzosen zum Verkauf des historischen Gebäudes zu bewegen: Er schaltet sogar die korsische Mafia ein. Offenbar würde er auch vor einem Auftragsmord nicht zurückschrecken. Doch Sam Levitt heckt einen Gegenplan aus, der es in sich hat ...
Farbig und charmant beschwört Peter Mayle den Zauber der mediterranen Welt und entführt uns in ein Marseille und ein Korsika zum Erschrecken und zum Verlieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Le Pharo, der Prachtbau auf dem Hügel, der über die Buch von Marseille, ist in Gefahr. Gegen die kriminelle Habgier eines Neureichen mobilisiert Sam Levitt robuste korsische Polizisten. Aber erst nach einem guten Rotwein. In seinem luxuriösen Palais auf einem Hügel über der Bucht von Marseille wartet Francis Reboul auf Sam Levitt. Als der Rechtsanwalt mit dem ausgeprägtem detektivischen Spürsinn und dem Hang zu unkonventionellen Ermittlungen, zusammen mit seiner Freundin Elena Morales aus Kalifornien, endlich eintrifft, wartet Arbeit auf ihn. Denn ein Oligarch namens Oleg Vronsky ist in der Bucht mit seiner Luxusyacht vor Anker gegangen und observiert den Palais von Reboul. Immer dreister werden seine Versuche, den Franzosen zum Verkauf des historischen Gebäudes zu bewegen: Er schaltet sogar die korsische Mafia ein. Offenbar würde er auch vor einem Auftragsmord nicht zurückschrecken. Doch Sam Levitt heckt einen Gegenplan aus, der es in sich hat …
Der Autor
Peter Mayle wurde 1939 in Brighton/England geboren. Er war Kellner, Busfahrer und erfolgreicher Werbetexter, bevor er 1975 dauerhaft in die Provence zog und Schriftsteller wurde. Seine Bücher »Mein Jahr in der Provence«, »Toujours Provence« und Romane wie »Ein guter Jahrgang« (Blessing, 2004) wurde ein Bestseller. Mit »Ein diebisches Vergnügen« (Blessing, 2010) begann Peter Mayle eine neue Serie um den mit detektivischen Fähigkeiten ausgestatteten Anwalt Sam Levitt und seine Freundin Elena Morales, die es beide immer wieder zu einem Freund in Marseille zieht. Überzeugend und sympathisch wie kein anderer Autor verknüpft Peter Mayle Spannung, mediterrane Lebenslust und Noblesse.
P E T E R M A Y L E
Eine korsische Gaunerei
Roman
Aus dem Englischen
von Ursula Bischoff
Blessing
Für Jenny, wieder einmal,
und mit den aufrichtigsten Gefühlen
1. KAPITEL
Francis Reboul saß in der Sonne und war gänzlich in die Betrachtung seines Frühstücks vertieft: einem Schnapsglas mit Olivenöl, nativ und extra vergine, von dem die Franzosen steif und fest behaupten, es sei ein Segen für menschliche Verdauungsprozesse aller Art, gefolgt von einer großen Schale café crème und einem Croissant von so außerordentlicher Leichtigkeit, dass es beim kleinsten Windstoß vom Teller abzuheben drohte. Von der Terrasse aus überblickte er die schimmernde, unendliche Weite des frühmorgendlichen Mittelmeers, das sich ultramarin bis zum Horizont erstreckte.
Das Leben präsentierte sich von seiner Sonnenseite. Sam Levitt und Elena Morales, seine Freunde und Weggefährten bei früheren Abenteuern, würden im Verlauf des Tages aus Kalifornien eintreffen, um einen ausgedehnten Urlaub im Süden Frankreichs zu verbringen. Sie planten, rund um Korsika zu segeln, dann Saint-Tropez anzusteuern, wo sie vor Anker gehen würden, um ein paar Tage auf Rebouls Gestüt in der Camargue auszuspannen. Natürlich wollten sie auch ihre Bekanntschaft mit den Gourmettempeln von Marseille auffrischen. Es war ein Jahr her, seit er seine Freunde das letzte Mal gesehen hatte – ein ereignisreiches Jahr –, und es gab viel zu erzählen und nachzuholen.
Reboul legte die Zeitung beiseite und kniff die Augen zusammen, um sie gegen das grelle, vom Wasser reflektierte Sonnenlicht zu schützen. Eine Reihe kleiner Segelboote nahm gemächlich Kurs auf die Frioul-Inseln, das zerklüftete, Marseille vorgelagerte Archipel aus Kalkfelsen, geformt von dem Mistralwind. Ihr bizarres Relief ließ auch aus der Ferne erahnen, dass diese Insel einst mit dem Festland verbunden gewesen war. Während er sie betrachtete, wurde seine Aufmerksamkeit von einem Schatten abgelenkt, der hinter der Landzunge auftauchte. Allmählich nahm er Konturen an und wurde größer. Erheblich größer. Es war eine Luxusyacht von ungewöhnlichen Dimensionen – an die hundert Meter lang, windschnittig und dunkelblau, mit vier Decks, Radarausrüstung, dem obligatorischen Hubschrauber, auf seinem Landeplatz im Heck festgezurrt. Diese Yacht war nicht etwa mit einem Dingi versehen, sondern hatte, wenn er es richtig sah, zwei superschnelle Riva-Beiboote im Schlepptau. Diese eleganten Sportboote – schon Onassis, Sean Connery oder Brigitte Bardot hatten sich nur mit dieser Marke über die Wellen tragen lassen – hatten Armaturen aus Mahagoni und Sitze aus bestem Leder. Mit ihren Windschutzscheiben, dem vielen Chrom und dem perfekt modellierten Gashebel erinnerten sie an amerikanische Straßenkreuzer.
Jetzt befand sich die Yacht unmittelbar vor Francis Reboul, keine dreihundert bis vierhundert Meter vom Ufer entfernt. Sie drosselte die Fahrt, kam allmählich zum Stillstand. Winzige Gestalten erschienen auf dem Oberdeck, die ihn anzustarren schienen. Im Laufe der Jahre hatte er sich an diese Form der Begutachtung durch vorbeidriftende Seefahrer mehr oder weniger gewöhnt. Sein Wohnsitz, das Palais du Pharo, im 19. Jahrhundert als Sommerresidenz für Napoleon III. erbaut, dann lange als Medizinschule genutzt, war nun einmal das größte private Anwesen in Marseille, und das imposanteste. Früher hatte diese Landzunge Tête de Mare geheißen, und Pharo bezeichnete eigentlich die kleine Bucht weiter westlich. Alles, was auf dem Wasser kreuchte und fleuchte, vom Ein-Mann-Segelboot bis zu den überfüllten lokalen Fähren, hatte irgendwann einmal vor diesem Hügel eine Rast gemacht, um Chez Reboul in Augenschein zu nehmen, ausgiebig, wenngleich aus der Ferne. Teleskope, Ferngläser, Kameras – inzwischen eine feste Größe in seinem Leben. Dennoch hatte er es bisher nie auch nur einen Augenblick bereut, für viel Geld diese Residenz, die lange Zeit als Tagungs- und Kongresszentrum mit Hotel genutzt worden war, erworben zu haben. Schulterzuckend verschanzte er sich hinter seiner Zeitung.
An Bord der Luxusyacht wandte sich der Eigner, Oleg Vronsky – Oli für seine Freunde und sein weitläufiges Gefolge, bei der internationalen Wirtschaftspresse auch als der ›Barracuda‹ bekannt –, einer jungen Schönheit namens Natascha zu, die er für die Dauer der Seereise zu seinem persönlichen Ersten Offizier ernannt hatte. Sie hatte ansehnliche Rundungen, eine honigfarbene Haut und ein Gesicht, das durch die immer leicht geschürzten Lippen sinnlich wirkte. »Damit kommen wir der Sache schon näher«, sagte er. »Sogar um einiges näher.« Er lächelte, sodass die tiefe, dunkelviolette Narbe auf seiner Wange Runzeln bildete. Von dieser Narbe einmal abgesehen, hätte er als gut aussehender Mann gelten können. Obwohl ein wenig kurz geraten, war er schlank, mit vollen grauen Haaren, die en brosse, zum Bürstenhaarschnitt, getrimmt waren, und Augen in einem eisigen Blau, wie man sie oft bei den Bewohnern des frostigen Nordens findet.
Er hatte die letzte Woche damit verbracht, vor dem Küstenabschnitt herumzukreuzen, den man als Riviera bezeichnete, und kurze Zwischenstopps einzulegen, um sich Immobilien in Cap Ferrat, Cap d’Antibes und Saint-Tropez anzuschauen. Sie hatten ihn ausnahmslos enttäuscht. Er war bereit, tief in die Tasche zu greifen, fünfzig Millionen Euro oder mehr auf den Tisch zu blättern, aber er hatte nichts gesehen, was den Wunsch in ihm weckte, seine Brieftasche zu zücken. Zugegeben, es waren ein paar ganz nette Häuser darunter, aber sie standen viel zu eng beisammen. An der Riviera herrschte inzwischen ein schreckliches Gedränge, und genau das war das Problem, denn Vronsky legte großen Wert auf Freiraum und ein Höchstmaß an Privatsphäre – ohne russische Nachbarn weit und breit. Heutzutage wimmelte es auf Cap Ferrat von seinen Landsleuten, sodass die Einheimischen mit Geschäftssinn ein paar Brocken Russisch und den Wodka zu lieben begannen.
Vronsky zog sein Smartphone aus der Tasche und betätigte die Ruftaste, die ihn mit Katja, seiner persönlichen Assistentin, verband. Katja hatte schon vor Erreichen der ersten Milliarde in seinen Diensten gestanden, als er noch in den niederen Millionengefilden weilte, und sie gehörte zu den wenigen handverlesenen Personen, die sein absolutes Vertrauen besaßen.
»Sagen Sie Johnny, er soll auf das Oberdeck kommen, ja? Und richten Sie ihm aus, dass er alles für einen schnellen Abstecher bereit machen soll. Ach ja, liegt schon eine Rückmeldung aus London vor?« Vronsky liebäugelte mit dem Gedanken, ein englisches Footballteam zu kaufen, und stand mit einem arabischen Konsortium in Verhandlung; sie waren nicht gerade die einfachsten Geschäftspartner, und seine Geduld neigte sich langsam dem Ende zu. Vielleicht sollte er das Fußballmäzenatentum doch seinen Landsleuten überlassen, Dmitri Rybolowlew in Monaco, Abramowitsch in London und Kerimow in Machatchkala. In aller Demut hatte ihm das auch schon Katja suggeriert.
Er nahm die Inspektion des Palais du Pharo wieder auf, schob die Sonnenbrille hoch über die Stirn und stellte die Bildschärfe seines Feldstechers ein. Die klassizistische Fassade des dreistöckigen Gebäudes gefiel ihm. Die Kulisse war zweifellos malerisch und, soweit zu erkennen, befand sich das Haus inmitten eines weitläufigen Geländes, mit Sicherheit ausreichend für einen unauffälligen kleinen Hubschrauberlandeplatz. Vronsky verspürte den ersten Anflug eines Kaufinteresses, das sich rasch zu einer ausgeprägten Kauflust entwickeln könnte.
»Wohin, Boss?« Johnny aus Jamaika grinste von einem Ohr zum anderen und verschaffte Vronsky damit den Genuss, einen Blick auf sein schneeweißes Gebiss zu erhaschen, das sein kohlrabenschwarzes Gesicht unterteilte. Während seiner Zeit als Söldner in Libyen hatte er gelernt, Hubschrauber zu fliegen, eine nützliche Ergänzung zu seinen anderen Talenten, die er im Umgang mit Waffen und den Feinheiten des unbewaffneten Kampfes bewiesen hatte. Einen besseren Leibwächter mit größerem Abschreckungseffekt konnte man sich kaum wünschen.
»Ein kurzer Abstecher, Johnny. Ein kleiner Erkundungsflug. Du brauchst eine Kamera und jemanden, der sie zu benutzen versteht.« Vronsky nahm den Mann aus Jamaika am Arm und führte ihn zu einem entlegenen Winkel des Decks.
Reboul tunkte den letzten Bissen des Croissants in seinen Kaffee und hob den Blick von der Zeitung. Die blaue Yacht dümpelte immer noch an der gleichen Stelle. Er konnte zwei Gestalten am Heck erkennen, die sich an der Landevorrichtung des Hubschraubers zu schaffen machten, bevor sie einstiegen und die Rotorblätter sich zu drehen begannen. Einen Moment lang fragte er sich müßig, wohin der Flug wohl gehen mochte, dann kehrte er zu den Tagesnachrichten zurück, die Eingang in La Provence gefunden hatten. Was mochte die Angehörigen der schreibenden Zunft veranlassen, den Fußballspielern und ihren Eskapaden noch lange nach Ende der Saison so viel Raum zu widmen? Der Geschmack der Menschen wurde offenbar immer stromlinienförmiger. Seufzend legte er die Zeitung beiseite und griff nach der Financial Times. Geschäftszahlen, Umsatzentwicklungen und Marktverschiebungen faszinierten ihn nun einmal seit jeher, sich in dieser Hinsicht auf dem Laufenden zu halten, kostete ihn keinerlei Anstrengung.
Das Getöse, das unverhofft die Stille durchbrach, war ohrenbetäubend. Der Helikopter näherte sich im Tiefflug, hielt direkt auf ihn zu. Dann drosselte er das Tempo und schwebte über der Terrasse, bevor er das Palais und die dazugehörigen Gartenanlagen mehrmals umflog. Als er sich schräg legte, um eine Kurve zu fliegen, erspähte Reboul das lange Objektiv einer Kamera, das aus dem Seitenfenster ragte. Das ging entschieden zu weit. Reboul holte sein Handy hervor und tippte die Telefonnummer des Polizeichefs von Marseille ein, der zu seinen Freunden zählte.
»Hervé? Francis hier. Tut mir leid, dass ich dich störe …«
»Du störst nie, mein Guter.«
»Das ist schön zu hören. Ich beschwere mich nur ungern, du weißt, ich bin mir meiner Privilegien, meines unverschämten Glücks in allen Geschäftsdingen wirklich bewusst, aber mir rückt gerade ein Irrer in einem Helikopter zu Leibe. Er fliegt extrem tief und macht Aufnahmen. Besteht die Möglichkeit, einen Mirage-Abfangjäger aufzutreiben, der ihm die Flausen austreibt?«
»So gut sind meine Verbindungen zur Luftwaffe nun auch wieder nicht.« Hervé lachte kurz auf. »Muss es denn unbedingt Überschall sein? Wie wäre es mit einem Polizeihubschrauber an diesem gewöhnlichen Werktag? Der wäre sofort einsatzbereit.«
Der Eindringling drehte erneut eine Runde über der Terrasse, nicht ganz so tief wie die letzte, bevor er den Rückweg zur Yacht antrat. Täuschte Reboul sich, oder hatte der Mann im Cockpit, ein Schwarzer, wie er erkannte, tatsächlich höhnisch zu ihm herabgewunken?
»Vielen Dank für das Angebot, aber die Mühe können wir uns sparen«, erwiderte Reboul. »Jetzt hat er sich endlich verzogen.«
»Konntest du einen Blick auf das Luftfahrzeugkennzeichen werfen?«
»Keine Chance – ich war damit beschäftigt, in Deckung zu gehen. Aber der Helikopter gehört zu einer Yacht, die sich momentan genau gegenüber der Pointe du Pharo befindet, vielleicht mit Kurs auf den Alten Hafen. Ein riesiger dunkelblauer Luxusliner von der Größe eines paquebot, eines Ozeandampfers.
»Der wird nicht schwer zu finden sein. Ich kümmere mich darum und melde mich wieder bei dir.«
»Danke, Hervé. Das nächste gemeinsame Mittagessen geht auf meine Rechnung.«
Vronsky beugte sich über Katja, die gerade die Kamera an ihren Computer anschloss und die ersten Aufnahmen hochlud. Wie bei vielen reichen und mächtigen Männern war sein Wissen um die Möglichkeiten der modernen Technologie äußerst lückenhaft. Sich mit den lästigen Details der stetigen Neuerungen zu befassen, überließ er gern seinem Personal. »Bitte sehr«, sagte Katja. »Für den Bildwechsel müssen Sie nur auf diese Taste drücken.«
Vronsky blickte schweigend auf den Bildschirm, die Schultern vor lauter Konzentration hochgezogen. Während ein Foto dem anderen folgte – von der perfekt proportionierten Architektur, den makellos gepflegten Gartenanlagen und der riesigen freien Fläche bis zum ersten Nachbarn –, begann er zu nicken. Schließlich lehnte er sich zurück und bedachte Katja mit einem Lächeln.
»Das will ich haben. Stellen Sie fest, wem das Haus gehört.«
2. KAPITEL
Francis Reboul würde nie im Leben verkaufen. Jeder zwischen Marseille und Menton wusste schließlich, wie sehr er an seinem Anwesen hing. Und er brauchte das Geld nicht. »Désolé.«Der Mann, der sich untröstlich gab, zuckte die Achseln und zündete sich mit einem goldenen Feuerzeug eine Zigarette an.
Er stand mit Vronsky auf dem Oberdeck der Caspian Queen, die heute den Filmfestspielen in Cannes einen Besuch abstattete. Die Yacht lag in Küstennähe vor Anker, war so positioniert, dass die Crew den Lichterglanz der Croisette, der Flaniermeile der Stadt, aus der Ferne genießen konnte. Der russische Oligarch, alles andere als ein Cineast, hatte es vorgezogen, seine Ankunft in Cannes mit einem Fest an Bord zu begehen, das von seiner PR-Firma organisiert worden war, und keiner der illustren Gäste, die man ins Auge gefasst hatte, war so dreist gewesen, die Einladung auszuschlagen. Es handelte sich dabei um das Rudel der üblichen Verdächtigen, die man bei Filmfestivals antrifft: Frauen, die man in misogyner Laune als unternährt und zu aufdringlich gebräunt empfinden konnte, beleibte Männer mit einer Blässe, die zu vielen Stunden in abgedunkelten Vorführräumen geschuldet war, Starlets und Möchte-gern-Filmsternchen, Journalisten, die ihr Geschmacksurteil über den jeweiligen Film für eminent wichtig und folgenreich hielten, sowie ein oder zwei Sponsoren der Festspiele, die der Veranstaltung einen Hauch Lokalkolorit auf formaler Ebene verleihen sollten. Und nicht zu vergessen der Herr im weißen Seidensmoking, der gerade mit Vronsky ein Gespräch unter vier Augen führte.
Er war, wie man dem Gast aus Russland versichert hatte, der erfolgreichste und am besten vernetzte Immobilienmakler der ganzen Küste. Seine Karriere hatte er unter dem Namen Vincent Schwarz begonnen. Aus beruflichen Gründen hatte er ihn in ›Vicomte de Pertuis‹ abgewandelt – ein Ritterschlag, von dem man nicht wusste, ob er auf reiner Erfindungsgabe beruhte oder doch etwas mit der Herkunft zu tun hatte. Während seiner zwanzigjährigen Laufbahn als selbsternannter Aristokrat war es ihm gelungen, das hochpreisige Ende des Immobilienmarktes an der Küste so unerbittlich in den Griff zu bekommen, dass seinen Konkurrenten die Luft auszugehen drohte. Allerdings stellte Oleg Vronsky selbst für ihn eine gewisse Herausforderung dar. der Oligarch erwies sich als äußerst anspruchsvoller Kunde, der die Nase über alle erstklassigen Immobilien zwischen Monaco und Saint-Tropez rümpfte. Doch der Vicomte, angespornt durch die Aussicht auf die Maklercourtage von fünf Prozent, setzte die Suche unbeirrt fort. Und nun hatte sein Kunde auf eigene Faust ein Haus, nein, einen Palast gefunden, den er zu kaufen beabsichtigte, ohne professionelle Hilfe – ein frustrierender Gedanke, den er jedoch sorgfältig zu kaschieren wusste.
Umstände wie diese erforderten eine beträchtliche Finesse aufseiten des Vicomte. Er konnte schwerlich fünf Prozent des Kaufpreises für die bloße Überwachung einer geschäftlichen Transaktion in Rechnung stellen. Es galt also, für unvorhergesehene Schwierigkeiten und Verzögerungen zu sorgen – Hindernisse, die nur jemand zu überwinden vermochte, der über große Erfahrung und noch größeres Verhandlungsgeschick verfügte. Dieses Prinzip hatte sich in der Vergangenheit schon mehrfach ausgezahlt und ihn bewogen, unverzüglich mit einer negativen Reaktion aufzuwarten, als sich Vronsky bei ihm nach Le Pharo erkundigte.
»Woher wollen Sie wissen, dass er kein Geld braucht?«, entgegnete Vronsky. Nach seiner Erfahrung gab es keine Menschenseele auf Erden, die nicht käuflich war, vorausgesetzt, der Preis stimmte.
»Ah«, erwiderte der Vicomte und senkte seine Stimme, sodass sie kaum mehr als ein Flüstern war. »In meiner Branche braucht man vor allem präzise Informationen, je privater und persönlicher, desto besser.« Er legte eine Pause ein, als würde er seinen eigenen Ausführungen zustimmen. »Ich habe Jahre, viele Jahre damit verbracht, meine Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Fakt ist, dass die meisten Immobilien, die ich vermittle, so exklusiv sind, dass sie den offenen Markt nie erreichen. Ein Wort oder zwei an der richtigen Stelle, et voilà. Transaktionen finden stets unter Wahrung der höchstmöglichen Diskretion statt. Darauf legen meine Kunden großen Wert.«
»Und Sie sind sicher, dass der Eigentümer niemals verkaufen würde?«
Erneutes Achselzucken. »Das ist meine persönliche Einschätzung, in Ermangelung detaillierter Informationen.«
»Und wie kommen wir an die heran?«
Das war genau die Frage, die sich der Vicomte erhofft hatte. »Natürlich müssten Nachforschungen jedweder Art mit Fingerspitzengefühl durchgeführt werden, idealerweise von jemandem mit viel Erfahrung in so heiklen Angelegenheiten. Die Besitzer hochherrschaftlicher Anwesen reagieren nie freimütig, sondern eher verschlossen, bisweilen sogar geradezu unaufrichtig, wenn es gilt, Auskünfte zu erteilen. Um einen Blick hinter die Fassade zu werfen und die Wahrheit zu ergründen, bedarf es eines scharfsinnigen Menschen, der über Adleraugen und Spürnase verfügt.«
Das war genau die Antwort, die Vronsky erwartet hatte. »Jemand wie Sie vielleicht?«
Der Vicomte gab sich bescheiden. »Es wäre mir eine Ehre.«
Und so kamen sie überein, dass sich der Vicomte als Vronskys Spürhund betätigen und Informationen über Le Pharo und seinen Besitzer sammeln sollte. Im Anschluss würden sie gemeinsam einen Aktionsplan ausarbeiten. Nachdem sie in diesem Sinne handelseinig geworden waren, kehrten sie zur Party auf dem Hauptdeck zurück, wo der russische Unternehmer in die Rolle des geselligen Gastgebers schlüpfte und der Vicomte seine Bemühungen fortsetzte, einem angeheiterten Filmproduzenten aus Hollywood den Kauf eines bezaubernden kleinen Penthauses in Cannes schmackhaft zu machen.
Rund hundertsechzig Kilometer östlich an der Küste fand in wesentlich kleinerem Rahmen eine Feier statt, die Francis Reboul organisiert hatte. Damit wollte er Sam und Elena willkommen heißen, die gerade aus Paris eingetroffen waren, wo sie die ersten Urlaubstage verbracht hatten. Le Pharo sollte ihnen als Basislager für die nächsten drei Wochen dienen, und Reboul hatte einige handverlesene Gäste eingeladen, mit denen die beiden im Zuge eines früheren gemeinsamen Abenteuers Freundschaft geschlossen hatten: den Journalisten Philippe Davin und seine Freundin Mimi mit ihren feuerroten Haaren, die Ehrfurcht gebietende Daphne Perkins ohne die Krankenschwesternkluft, mit der sie bei der Vereitelung einer Entführung durchschlagenden Erfolg gehabt hatte; und die Gebrüder Figatelli, Flo und Jo, die eigens für diesen Abend aus Korsika angereist waren, wo sie aufgewachsen und so hervorragend vernetzt waren.
Kaum war dem Ritual der Umarmungen und Küsse zur Auffrischung der freundschaftlichen Bande Genüge getan, brachen sich auch schon die Erinnerungen ihre Bahn. Daphne, den Champagnerkelch in der Hand und den kleinen Finger elegant abgespreizt, hörte Jo aufmerksam zu, der bei der Schilderung der neuesten Entwicklungen in der korsischen Unterwelt in Fahrt geriet. Eine kurze Atempause in der Unterhaltung nutze Daphne sofort aus, um die Frage einzuwerfen: »Was ist eigentlich aus diesem grauenvollen Menschen geworden?«
Obwohl es selbst aus Sicht des größten Philanthropen in und um Marseille gewiss mehr als nur einen grauenvollen Menschen gab, wussten alle Anwesenden sofort, wer gemeint war: Lord Wapping, kein Belgier, nein, ein Brite, ein skrupelloser Tycoon, der vor keiner Schandtat zurückscheute und es beinahe geschafft hätte, Reboul in einer geschäftlichen Transaktion auszustechen, indem er Elena entführen ließ. »Ich bin sicher, Sie haben den Fall weiterverfolgt«, sagte Daphne, an Philippe gewandt. »Befindet er sich denn bereits hinter Gittern? Ist es zu viel verlangt, auf eine lebenslange Freiheitsstrafe zu hoffen?«
»Das wäre ein wenig verfrüht. Im Moment bedient er sich noch eines Schachzugs, den wir als Serbische-Kriegsverbrecher-Strategie bezeichnen – eine plötzliche und völlig unerwartete lebensbedrohliche Krankheit, die ihn vor einem Kreuzverhör bewahrt. Er hat sich noch immer in einer Klinik in Marseille verschanzt und bemüht sich nach besten Kräften, mehr tot als lebendig auszusehen. Man munkelt, dass er einen der Ärzte bestochen hat. Aber am Ende kriegen sie ihn dran, keine Frage.«
Elena schauderte, als sie sich die Ereignisse ins Gedächtnis zurückrief, und Sam legte fürsorglich den Arm um sie. »Immer mit der Ruhe, Schatz. Den Kerl sehen wir nie wieder! Er ist doch hier in Marseille einfach nicht mehr gesellschaftsfähig – und schon gar nicht geschäftsfähig.« Zustimmendes Gemurmel erhob sich von allen Seiten.
Die Stimmung wurde von Mimi aufgeheitert, die auf den ziemlich einfältig grinsenden Philippe deutete. »Schau mal, er hat eine ehrbare Frau aus mir gemacht«, sagte sie zu Elena. Kichernd streckte sie ihr den Mittelfinger der linken Hand entgegen, um ihr den Verlobungsring zu zeigen. Das war das Signal für Glückwünsche und begeisterte Umarmungen. Reboul brachte einen Trinkspruch aus. Sam brachte einen Trinkspruch aus. Die Gebrüder Figatelli brachten jeweils einen etwas derberen Trinkspruch aus. Der Champagner floss in Strömen, und ehe sie sich versahen, wurde das Dinner angekündigt.
Als alle am Tisch Platz genommen hatten, klopfte Reboul mit einem Löffel leicht gegen sein Weinglas, und der Glockenklang ließ sofort alle verstummen. »Willkommen, meine Freunde, willkommen in Marseille. Es ist mir wahrhaft eine Freude, Sie alle wiederzusehen, dieses Mal in einer entspannteren Atmosphäre.« Er ließ seinen Blick über die Tafelrunde schweifen und nickte den lächelnden Gesichtern zu, bevor seine Miene ernst wurde. »Und nun zur Sache. Das Abendessen ist ein frugales Mahl, aber es stehen selbstverständlich Alternativen für jeden zur Verfügung, der allergisch ist gegen Foie gras, butterzartes Sisteron-Lamm mit Rosmarin, eine Auswahl frischer Ziegenkäse und Tarte Tatin.Ansonsten, bon appétit!« Wer Reboul so sah – ein Mann in den reifen Jahren, kräftig, gebräunt, mit leichtem Bauchansatz und Krähenfüßen, doch das schwarze Haar noch dicht und beinahe ungebändigt –, der konnte sich nicht des Eindrucks erwehren, dass ein Hauch von Verachtung in seiner Stimme mitschwang gegenüber all jenen von den modernen Zivilisationskrankheiten und Überempfindlichkeitsreaktionen heimgesuchten Menschen, die nur noch mit Allergie- und Kalorientabellen in der Hand Essen zu sich zu nehmen pflegten.
Und damit erschien, wie aufs Stichwort, Rebouls Haushälterin Claudine mit dem Hausmädchen Nanou aus Martinique auf der Bildfläche, um den ersten Gang aufzutragen.
Das Essen war viel zu gut, um Eile an den Tag zu legen, genau wie die Weine, die Gespräche und am Ende die herzliche Verabschiedung. Als Elena und Sam schließlich die Treppen in den obersten Stock hinaufgingen und ihre Gästesuite betraten, war es fast zwei Uhr morgens.
Während sich Elena im Ankleideraum zu schaffen machte, schlenderte Sam zu dem deckenhohen Fenster hinüber, das einen herrlichen Ausblick auf die sich im Wasser des Alten Hafens spiegelnden Lichter bot. Er fragte sich nicht zum ersten Mal, was Erwachsene mit gesundem Menschenverstand bewog, sich in winzige Nussschalen zu quetschen und sowohl die Unbequemlichkeiten als auch die gelegentlichen Gefahren auf sich zu nehmen, die ihnen auf dem wogenden, unberechenbaren Meer drohten. Abenteuerlust? Das Bedürfnis, den Kümmernissen der Welt zu entfliehen? Oder nur eine verfeinerte Spielart masochistischer Neigungen?
Seine Überlegungen wurden unterbrochen, als Elena wieder auftauchte, die Arme beladen mit teuren Einkaufstüten, denen man ansah, dass sie einen noch teureren Inhalt verbargen.
»Ich möchte dir nur schnell zeigen, was ich in Paris erstanden habe, während du dir bei deinem Hemdenverkäufer im Charvet etwas Gutes gegönnt hast«, sagte sie. Und dann breitete sie sorgfältig eine Auswahl von Dessous auf dem Bett aus, die ausgereicht hätten, um eine kleine Boutique zu bestücken: Seide natürlich, einige in Schwarz, andere in blassem Lavendelton gehalten und alle so hauchzart, dass zu befürchten stand, selbst die leichteste Brise würde sie vom Bett wehen. »In der Rue des Saints-Pères gibt es einen wundervollen kleinen Laden, das Sabbia Rosa. Mimi sagt, das sei ein Damenausstatter.« Sie trat einen Schritt zurück und lächelte Sam an, den Kopf kokett zur Seite geneigt. »Und, wie findest du meine Neuerwerbungen?«
Sam ließ die Finger über die feine Seide eines derart substanzlosen Etwas gleiten, dass er einen Augenblick lang dachte, es handle sich um ein winziges Taschentuch. Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht recht. Ich glaube, ich muss sie angezogen sehen, um mich zu vergewissern, dass sie wirklich passen.«
»Verstehe«, erwiderte Elena, als sie ihre Beute einsammelte und in den Ankleideraum zurückkehrte. Sie blickte über die Schulter und zwinkerte ihm zu. »Rühr dich nicht vom Fleck.«
»Ist das ein Dienstbefehl?«
Elena blickte ihn todernst an: »Mehr noch: ein Stellungsbefehl.«
3. KAPITEL
Der Brief sei am Morgen eigenhändig überbracht worden, erklärte Claudine, von einem gut gekleideten Herrn, der in einem Mercedes der G-Klasse vorgefahren war. Seinen Namen habe er nicht genannt.
Reboul öffnete den Umschlag, der schokoladenbraun gefüttert war, und entnahm ihm ein einzelnes schweres, lohfarbenes Blatt Büttenpapier. Statt einer Adresse als Einleitung verriet ein ebenso schlicht wie erhaben geprägter Briefkopf, dass es sich bei dem Absender um den Vicomte de Pertuis handelte. Seine Mitteilung war kurz und sachlich:
Ich wäre Ihnen höchst dankbar, wenn Sie mir einige Minuten Ihrer kostbaren Zeit widmen würden, um eine Angelegenheit zu erörtern, die auf beidseitigem Interesse und Gewinn beruht. Was Zeit und Ort der Besprechung angeht, so stehe ich ganz zu Ihrer Verfügung. Bitte rufen Sie mich unter der folgenden Nummer an, um eine Zusammenkunft zu vereinbaren.
Es folgte eine Unterschrift, die aus einem einzigen Wort bestand: Pertuis.
Im Laufe der Jahre hatte Reboul, wie so viele wohlhabende Männer, unzählige Zuschriften von Leuten erhalten, die sich erboten, seinen Reichtum mithilfe des einen oder anderen zwielichtigen Mittels zu mehren. Einige Vorschläge waren erheiternd, andere erstaunlich gewesen – dem Einfallsreichtum schienen keine Grenzen gesetzt, wenn es um Möglichkeiten ging, sein Kapital gewinnbringend anzulegen. Dieses Mal war sein Interesse jedoch größer als üblich, wie er feststellte. Vielleicht trug der Adelstitel dazu bei, obwohl ein Adelstitel heutzutage keine Garantie mehr für geschliffene Manieren und gediegenes Auftreten bot. Dennoch, man konnte ja nie wissen. Dieses Angebot war vielleicht ein paar Minuten seiner Zeit wert. Er griff zum Telefon und wählte die Nummer.
»Pertuis.«
»Reboul.«
Die herrische Stimme veränderte sich schlagartig, nahm einen salbungsvollen Klang an: »Monsieur Reboul, wie reizend von Ihnen, dass Sie anrufen! Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören!«
»Offensichtlich. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich könnte heute Nachmittag so gegen fünfzehn Uhr Zeit für Sie erübrigen, sofern es Ihnen passt. Sie wissen ja, wo ich wohne.«
»Natürlich, natürlich. Wir sehen uns dann um drei. Ich freue mich ungeheuer darauf, Sie kennenzulernen.«
Elena und Sam verbrachten den Morgen wie alle Touristen mit Besichtigungen. In Marseille hatten zahlreiche Veränderungen stattgefunden, die dazu beitrugen, dass die Stadt 2013 als Kulturhauptstadt Europas zu glänzen vermochte. Und Elena, eine eifrige Sammlerin von Reisetipps, hatte alles über die Verschönerungsmaßnahmen gelesen, vom tiefgreifenden Wandel der einst heruntergekommenen Docks (Le Grand Lifting) bis hin zu Pagnols Château de ma mère, das zu einem mediterranen Filmzentrum geworden war. Darüber hinaus waren neue Museen und Galerien, neu angelegte Gärten sowohl im Freien als auch im Trockenen, und eine glamouröse gläserne ombrière entstanden, um den Besuchern des Fischmarkts ein wenig Schutz vor den Elementen zu bieten, wenn auch nicht vor dem rauen Umgangston, der hier herrschte. Unter dem Strich bot die Metropole genügend Neuerscheinungen, um selbst Touristen, die erpicht darauf waren, die Sehenswürdigkeiten möglichst schnell abzuklappern, mindestens einen Monat lang auf Trab zu halten.
Sam tat sein Bestes, um bei Elenas Besichtigungsmarathon mitzuhalten, was sich jedoch als Schwerstarbeit erwies. Mit zunehmendem Verlangen beäugte er die Restaurants und Cafés, an denen sie vorübereilten, bis er nicht länger schweigen konnte. »Mittagessen«, gab er mit eiserner Entschlossenheit zu bedenken. »Wir brauchen eine Stärkung.«
Er winkte ein Taxi herbei, verstaute Elena im Wageninnern und wies den Fahrer an, sie nach Vallon des Auffes zu bringen, nur einen Katzensprung von der Corniche entfernt. Elena steckte die Reisenotizen in ihre Handtasche und stieß einen langen bühnenreifen Seufzer aus. »Die Kultur gibt sich geschlagen, die Völlerei siegt, und das ausgerechnet jetzt, wo ich so viel Spaß habe. Wohin fahren wir?«
»In einen kleinen Fischerhafen mit zwei fantastischen Gourmettempeln, Chez Fonfon und Chez Jeannot. Philippe hat mir davon erzählt: Jeannot hat die besten Moules farcies, Fonfon die beste Bouillabaisse.«
Elena musterte ihr blassblaues T-Shirt und den weißen Leinenrock. »Für eine Fischsuppe bin ich nicht richtig angezogen. Wie wär’s mit den Muscheln?«
Vallon des Auffes liegt gar nicht so weit entfernt vom Alten Hafen und ist ein kleiner Fischerhafen im siebten Arrondissement von Marseille, in dem nur die kleinsten, bescheidensten Boote vor Anker gehen können. Einfache Häuschen aus rotem Ziegelstein drängen sich dicht an dicht vor einer steil aufragenden Felslandschaft. Der beste Ort, um die ungemein malerische Aussicht, wenngleich im Miniaturformat zu genießen, ist unbestritten die Terrasse des Chez Jeannot, auf der Elena nun mit einem kleinen zufriedenen Seufzer Platz nahm. »Wie hübsch!«, befand sie. »Vielleicht hast du doch die richtige Entscheidung getroffen.«
»Tut mir leid. Wird nicht wieder vorkommen.« Bevor Elena eine Chance hatte, die Augen zu verdrehen – ihre Standardreaktion auf Sams Versuche, sarkastisch zu sein –, hatte er sich in die Weinkarte vertieft. »Mal sehen: Wie wäre es mit einem spritzigen kleinen Rosé? Oder wäre ein frischer und wunderbar ausgewogener Weißer mit einem Hauch Unverfrorenheit aus den Weingärten von Cassis genehm?«
Im Lauf der Jahre hatte sich Elena an Sams Bon-viveur-Anwandlungen gewöhnt, die kurioserweise immer dann eintraten, sobald er seinen Fuß auf französischen Boden setzte. Sie waren inzwischen zum unverzichtbaren Bestandteil der Reiseerfahrung geworden. Daheim in Kalifornien sprach er nur selten gutem Wein zu und gefiel sich oft in hemdsärmeligem Bierkonsum und sportiven Posen. Es war, als würde das gleißende Licht des Mittelmeers unfehlbar eine andere, kultiviertere Person aus ihm hervorzaubern. Für Elena, die einerseits einen Hang zu romantischer Treue, andrerseits ein pulsierendes Bedürfnis nach Abwechslung in sich spürte, war es geradezu ideal, einen so wandlungsfähigen Liebhaber zu haben. »Denkst du, dass es Pommes zu den Muscheln gibt?«
»Pommes frites, mein Schatz, Pommes frites«, belehrte Sam sie.
»Sam, du klingst wie ein Wörterbuch. Hör auf zu nerven!«
»Nerven? Ich habe Durst, ich habe Hunger, und mir tun die Füße weh, aber abgesehen davon bin ich ein Ausbund an Charme und Humor. Also, was darf’s denn sein? Rosa oder weiß?
Als der Rosé kam, hob Sam sein Glas und prostete Elena zu. »Auf unseren Urlaub! Was ist das für ein Gefühl, wieder hier zu sein?«
Elena kostete den Wein und behielt ihn einen Moment im Mund, bevor sie ihn schluckte. »Gut. Nein – besser als gut. Es ist einfach wunderbar. Ich habe die Provence vermisst. Ich weiß, dass du diese Landschaft genauso gerne magst.« Sie nahm ihre Sonnenbrille ab und beugte sich vor; ihre Miene war mit einem Mal nachdenklich. »Sag mal, was würdest du davon halten, hier ein Feriendomizil zu erwerben? Nur für den Sommer. Ein nettes kleines Häuschen, in dem man die Espadrilles aufbewahren kann.«
Sam runzelte die Stirn. »Würdest du nicht den Sommer in L. A. sehr vermissen, die schönste Jahreszeit, um den Smog zu genießen?«
»Bestimmt, aber wenn du mir beistehst, werde ich den Entzug überleben.« Sie räusperte sich kurz. »Sam, ich meine es ernst.«
»Gut, dann wäre ja alles klar.« Er lächelte angesichts Elenas verblüffter Miene und hob sein Glas. »Du rennst offene Türen ein. Ich wollte dir nämlich gerade den gleichen Vorschlag machen. Ich könnte lernen, Boule zu spielen. Und du könntest kochen lernen.«
Bevor Elena den Seitenhieb mit einer niederschmetternden Erwiderung parieren konnte, kamen die Moules frites, Muscheln mit Kräutern, Knoblauch und, wie der Kellner versicherte, mit viel Liebe zubereitet; die Frites waren zwei Mal in schwimmendem Fett ausgebacken, damit sie außen knusprig und innen butterweich waren. Das Essen ging mit einer leidenschaftlichen, wenngleich ergebnislosen Diskussion über Liegenschaften in der Provence einher: über die Vor- und Nachteile der pittoresken Küstenregion gegenüber dem Landesinneren oder die Vorteile eines Bauernhauses im Luberon gegenüber einer Eigentumswohnung in Marseille. Beim Kaffee kam man überein, mehrere Immobilienmakler einzuschalten, die ihnen helfen sollten, nach einem geeigneten Objekt Ausschau zu halten. Als die Rechnung kam, bestand Elena darauf, zu zahlen. Sie beabsichtigte, diesen Beleg einzurahmen, zur Erinnerung an den Tag, an dem sie einvernehmlich eine wichtige Entscheidung trafen.