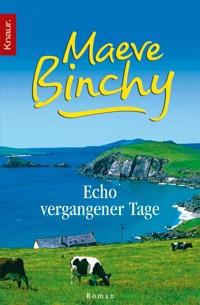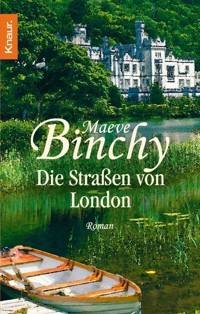Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die perfekte Sommerlektüre Ria Lynch und Marilyn Vine tauschen einen Sommer lang ihre Häuser. Ria zieht in das schicke New-England-Heim der völlig in ihrer Universitätskarriere aufgehenden Marilyn, während sich diese in dem gemütlichen Haus in der Tara Road in Dublin anschickt, das Leben einer irischen Hausfrau zu führen. Am Ende werden beide Frauen erkennen, daß jede das Leben der anderen in diesem Sommer entscheidend verändert hat.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Maeve Binchy
Ein Haus in Irland
Roman
Aus dem Englischen von Christa Prummer-Lehmair, Gerlinde Schermer-Rauwolf, Robert A. Weiß und Thomas Wollermann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ria Lynch und Marilyn Vine sind sich niemals im Leben begegnet, und doch sind ihre beiden Schicksale untrennbar miteinander verbunden: Einen Sommer lang tauschen sie ihre Häuser. Voller Verständnis für die Nöte und Schwächen der Menschen erzählt Maeve Binchy über das Schicksal zweier Frauen, die Ereignisse in einer kleinen Straße in Dublin und die Geschichte einer großen Liebe.
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Für Gordon,
mit all meiner Liebe
Kapitel 1
Rias Mutter hatte schon immer für Filmstars geschwärmt. Es hatte sie sehr bekümmert, daß Clark Gable ausgerechnet an dem Tag gestorben war, an dem Ria geboren wurde. Zwar war Tyrone Power auf den Tag genau zwei Jahre vor Hilarys Geburt gestorben, aber das war lange nicht so schlimm. Ria, nicht Hilary, hatte an dem Tag das Licht der Welt erblickt, an dem der König der Leinwand das Zeitliche segnete. Wenn Ria Vom Winde verweht sah, hatte sie immer ein bißchen ein schlechtes Gewissen.
Das erzählte sie auch Ken Murray, dem Jungen, von dem sie ihren ersten Kuß bekam. Sie sagte es ihm im Kino. Und zwar, während er sie gerade küßte.
»Meine Güte, bist du langweilig«, erwiderte er bloß und versuchte ihr die Bluse aufzuknöpfen.
»Ich bin gar nicht langweilig«, protestierte Ria energisch. »Da vorne auf der Leinwand ist Clark Gable, und es gibt etwas, was mich mit ihm verbindet. Wenn das nicht interessant ist!«
Ken Murray war es peinlich, daß sie so viel Aufmerksamkeit erregten. Die Leute machten »pscht« zu ihnen herüber, manche lachten sogar. Deshalb rückte er von Ria weg und kauerte sich tief in seinen Sitz, als wollte er nicht mit ihr zusammen gesehen werden.
Ria hätte sich ohrfeigen können. Sie war jetzt beinahe sechzehn. Und alle ihre Klassenkameradinnen fanden Küssen klasse, zumindest behaupteten sie das. Aber wollte sie es selbst einmal ausprobieren, vermasselte sie alles. Vorsichtig tastete sie zu ihm hinüber.
»Ich dachte, du wolltest den Film sehen«, brummte er.
»Ich dachte, du wolltest mich vielleicht in den Arm nehmen«, erwiderte Ria hoffnungsvoll.
Er zog eine Tüte Karamelbonbons heraus und nahm sich eines. Doch ihr bot er keines an. Mit der Romantik war es vorbei.
Manchmal konnte man mit Hilary ganz gut reden, hatte Ria festgestellt. Aber nicht an diesem Abend.
»Soll man lieber schweigen, wenn man gerade geküßt wird?« fragte sie ihre Schwester.
»Jesus, Maria und Joseph«, seufzte Hilary, die sich gerade zum Ausgehen schick machte.
»Ich frage ja nur«, meinte Ria. »Weil du so etwas doch bestimmt weißt, nach all der Erfahrung, die du mit Jungs hast.«
Nervös sah Hilary sich um, sie befürchtete, jemand könnte Ria gehört haben. »Halt gefälligst die Klappe!« zischte sie. »Wenn Mam dich hört, können wir uns beide das Ausgehen abschminken, und zwar für alle Zeiten.«
Ihre Mutter hatte ihnen nachdrücklich klargemacht, daß sie in ihrer Familie kein liederliches Betragen dulden werde. Als Witwe mit zwei Töchtern hatte sie schon genug um die Ohren, da wollte sie sich nicht auch noch Sorgen machen müssen, daß ihre Mädchen sich vielleicht wie Flittchen benahmen und niemals unter die Haube kommen würden. Sobald Hilary und Ria nette, anständige Ehemänner und ein eigenes Heim hätten, könne sie glücklich sterben. Natürlich schwebte ihr dabei ein hübsches Haus in einem besseren Viertel von Dublin vor, vielleicht sogar mit Garten. Nora Johnson hegte große Hoffnungen, daß es mit ihnen ein bißchen aufwärtsgehen könnte. Daß sie einmal in einer netteren Umgebung leben würden als in dem großen Sozialwohnungsviertel, wo sie jetzt wohnten. Und man fand nun einmal keinen passablen Mann, wenn man sich jedem dahergelaufenen Lümmel an den Hals warf.
»Entschuldigung, Hilary.« Ria war zerknirscht. »Aber sie hat bestimmt nichts gehört, sie schaut Fernsehen.«
Ihre Mutter tat abends nur selten etwas anderes. Sie sei todmüde, erklärte sie, wenn sie aus der chemischen Reinigung zurückkam, wo sie den ganzen Tag hinter der Theke stand. Da war es schön, wenn man abends gemütlich im Sessel sitzen und in eine andere Welt eintauchen konnte. Mam hatte Rias verfängliche Bemerkung über Erfahrungen mit Jungs bestimmt nicht gehört.
Hilary verzieh ihr – schließlich war sie heute Abend auf Rias Hilfe angewiesen. Nach einem System, das Mam sich ausgedacht hatte, sollte Hilary ihre Handtasche auf dem Treppenabsatz abstellen, sobald sie heimkam. Wenn Mam sich dann aus ihrem Sessel erhob und ins Badezimmer ging, stellte sie auf diese Weise fest, daß Hilary zu Hause war, und konnte beruhigt schlafen. Manchmal fiel es allerdings Ria zu, die Handtasche gegen Mitternacht auf der Treppe zu plazieren, und Hilary, die nur Schlüssel und Lippenstift mitgenommen hatte, konnte sich zu späterer Stunde hereinschleichen.
»Wer wird das für mich tun, wenn es mal soweit ist?« überlegte Ria.
»Dazu wird es nie kommen, wenn du ständig auf die Typen einquasselst, die dich küssen wollen«, erwiderte Hilary. »Dann gibt es keinen Grund, abends wegzugehen, weil du gar nicht wüßtest, wohin.«
»So ein Quatsch«, entgegnete Ria, fühlte sich aber keineswegs so zuversichtlich, wie sie tat. Sie war den Tränen nahe.
Dabei fand sie, daß sie eigentlich nicht schlecht aussah. Ihre Schulfreundinnen sagten, sie könne sich glücklich schätzen mit ihren dunklen Locken und den blauen Augen. Sie war auch nicht dick oder so, und ihre Pickel hielten sich in Grenzen. Trotzdem blieb sie immer zweite Wahl; ihr fehlte eben diese gewisse Ausstrahlung, die manche anderen Mädchen aus ihrer Klasse hatten.
Hilary bemerkte ihre verzagte Miene. »Hör mal, du bist wirklich in Ordnung, du hast Naturlocken, was schon mal ein großer Vorteil ist. Außerdem bist du klein, das mögen die Jungs. Es kommen bald bessere Zeiten. Sechzehn ist das schlimmste Alter, auch wenn dir alle was anderes erzählen.« Manchmal konnte Hilary tatsächlich sehr nett sein. Besonders wenn sie jemanden brauchte, der abends ihre Handtasche auf die Treppe stellte.
Und Hilary sollte recht behalten. Es kamen wirklich bessere Zeiten. Nachdem Ria von der Schule abgegangen war, machte sie wie ihre ältere Schwester eine Sekretärinnenausbildung. Wie sich herausstellte, lernte sie dabei eine Menge Jungs kennen. Keinen bestimmten, aber sie hatte es auch nicht eilig. Möglicherweise, meinte sie, würde sie sich erst einmal die Welt ansehen, bevor sie den Hafen der Ehe ansteuerte.
»Du solltest besser nicht zuviel reisen«, gab ihre Mutter zu bedenken.
Denn nach Nora Johnsons Meinung wurde eine reiselustige Frau von den Männern gern als leichtlebig eingeschätzt. Männer heirateten lieber gesetztere, ruhigere Frauen, die sich nicht in der Weltgeschichte herumtrieben. Es sei nur vernünftig, sich frühzeitig über die Vorlieben der Männer zu informieren, damit man gewappnet in den Kampf gehen könne. Dabei ließ Nora Johnson durchblicken, daß sie selbst vielleicht nicht genügend Ahnung von Männern gehabt habe. Denn der verstorbene Mr. Johnson mit seinem strahlenden Lächeln und seinen flott sitzenden Hüten war leider kein treusorgender Gatte und Vater gewesen. Von Lebensversicherungen hatte er nämlich nichts gehalten und deshalb auch keine abgeschlossen. Ihre Töchter sollten es besser haben, wenn die Zeit gekommen war.
»Wann, meinst du, wird die Zeit kommen?« fragte Ria ihre Schwester.
»Die Zeit für was?« Mißmutig betrachtete Hilary ihr Abbild im Spiegel. Das Problem mit dem Rouge war, daß man es genau dosieren mußte. Erwischte man zuviel, sah man aus wie ein Clown, nahm man zuwenig, wirkte es, als hätte man sich das Gesicht nicht gewaschen.
»Ich meine, wann, glaubst du, wird eine von uns beiden heiraten? Mam redet doch immer davon, daß ›die Zeit einmal kommen wird‹.«
»Na, hoffentlich kommt sie für mich zuerst, ich bin schließlich die Ältere. Laß dir bloß nicht einfallen, vor mir zu heiraten.«
»Nein, ich wüßte auch gar nicht, wen. Ich würde nur zu gern in die Zukunft blicken können und sehen, wo wir in zwei Jahren sein werden. Wäre das nicht klasse?«
»Wenn dich das so brennend interessiert, geh doch zu einer Wahrsagerin.«
»Was wissen die schon«, meinte Ria verächtlich.
»Kommt ganz darauf an. Man muß nur die richtige finden. Einige Mädchen aus der Arbeit waren bei einer Wahrsagerin und haben richtig von ihr geschwärmt. Wenn man hört, was die alles über einen weiß, läuft es einem kalt den Rücken runter.«
»Warst du etwa auch bei ihr?« staunte Ria.
»Ja. Die anderen sind alle hingegangen, da wollte ich keine Spielverderberin sein.«
»Und?«
»Was und?«
»Was hat sie dir gesagt? Komm schon, spann mich nicht auf die Folter.« Rias Augen leuchteten.
»Sie sagte, ich werde binnen zwei Jahren heiraten …«
»Toll! Darf ich deine Brautjungfer sein?«
»… und daß ich in einem von Bäumen umstandenen Haus leben werde, daß sein Name mit M anfängt und daß wir uns lebenslanger Gesundheit erfreuen werden.«
»Michael, Matthew, Maurice, Marcello?« Ria probierte mehrere Namen aus. »Und wie viele Kinder?«
»Keine Kinder, hat sie gesagt«, antwortete Hilary.
»Du glaubst ihr doch nicht etwa, oder?«
»Natürlich glaube ich ihr. Sonst hätte ich doch nicht einen ganzen Wochenlohn dafür ausgegeben.«
»Soviel hast du doch nie und nimmer bezahlt!«
»Sie versteht was davon. Weißt du, sie hat diese Gabe …«
»Hör auf!«
»Nein, wirklich. Sie wird von allen möglichen Prominenten zu Rate gezogen. Das würden die doch nicht tun, wenn sie nicht diese Gabe hätte.«
»Und woraus hat sie das alles gelesen, die Gesundheit, den Mann mit M, daß ihr keine Kinder bekommt? Aus dem Teesatz?«
»Nein, aus meiner Hand. Schau, diese feinen Linien unter dem kleinen Finger an der Handkante. Du hast zwei davon, ich habe keine.«
»Hilary, sei nicht albern. Mam hat drei Linien …«
»Und du erinnerst dich, daß sie noch ein Baby hatte, das gestorben ist. Macht also drei.«
»Du meinst es ernst! Du kaufst ihr das tatsächlich ab!«
»Du hast mich gefragt, und ich habe dir geantwortet.«
»Und alle, die Kinder kriegen werden, haben solche Linien, und die Kinderlosen nicht?«
»Man muß schon wissen, wie man es lesen muß«, meinte Hilary vorsichtig.
»Ich habe eher das Gefühl, man muß wissen, wie man die Leute ausnehmen kann.« Es beunruhigte Ria, daß sich ihre sonst sehr vernünftige Schwester so leicht um den Finger hatte wickeln lassen.
»Es ist gar nicht so teuer, wenn man bedenkt …«, fing Hilary an.
»Ach, Hilary, ich bitte dich. Ein Wochenlohn für diesen Humbug! Wo wohnt sie denn, in einem Penthouse?«
»Nein, zufälligerweise in einem Wohnwagen, auf einem Rastplatz.«
»Willst du mich auf den Arm nehmen?«
»Ehrlich, es geht ihr nicht ums Geld. Das ist kein Schwindel und nicht nur ein Job für sie, sie hat eben diese Gabe.«
»Na klar.«
»Wie es aussieht, kann ich also tun, was ich will, ohne schwanger zu werden.« Hilary klang sehr zuversichtlich.
»Es könnte trotzdem riskant sein, die Pille abzusetzen«, warnte Ria sie. »Ich würde mich nicht so unbedingt auf Madame Fifi oder wie sie heißt verlassen.«
»Mrs. Connor.«
»Mrs. Connor«, wiederholte Ria. »Ist ja entzückend. Als Mam jung war, fragte sie immer die heilige Anna um Rat. Das fanden wir damals reichlich daneben, und jetzt haben wir eine Mrs. Connor vom Landfahrerplatz.«
»Warte nur, bis du mal was wissen willst, dann wirst du auch zu ihr rennen.«
Ob einem eine neue Stelle gefiel, wußte man erst, wenn man sie angetreten hatte. Und dann war es bereits zu spät.
Hilary arbeitete als Bürokraft zuerst in einer Bäckerei, dann in einer Wäscherei, und schließlich entschied sie sich für eine Sekretärinnenstelle in einer Schule. Da habe man zwar kaum eine Chance, den Mann fürs Leben kennenzulernen, meinte sie, aber sie verdiente etwas besser und bekam außerdem einen kostenlosen Mittagstisch, wodurch sie mehr Geld zur Seite legen konnte. Sie wollte nämlich etwas zu einem Haus beisteuern können, wenn die Zeit gekommen war.
Auch Ria sparte, allerdings für eine Weltreise. Zuerst arbeitete sie im Büro eines Haushaltswarenladens, dann in einem Betrieb, der Friseurbedarf herstellte. Schließlich kam sie bei einer großen Immobilienfirma unter, wo sie am Empfang saß und die eingehenden Anrufe entgegennahm. Es war eine völlig neue Welt für sie, und bald stellte sie fest, daß es sich offensichtlich um eine sehr hektische Branche handelte. Die achtziger Jahre hatten Irland einen Aufschwung gebracht, der sich als erstes auf dem Immobilienmarkt widerspiegelte. Obwohl in dieser Branche ein starker Konkurrenzdruck herrschte, fand Ria, daß in ihrer Firma ein echter Teamgeist herrschte.
Gleich am ersten Tag lernte sie Rosemary kennen, eine schlanke, hinreißend schöne Blondine, aber ebenso nett wie die Mädchen, die Ria von der Schule oder der Sekretärinnenausbildung her kannte. Auch Rosemary wohnte mit ihrer Schwester noch zu Hause bei der Mutter, in dieser Hinsicht hatten sie also schon einmal etwas gemeinsam. Rosemary war in allen geschäftlichen Dingen so selbstsicher und gewandt, daß Ria vermutete, sie müsse studiert haben oder sich anderweitig ein fundiertes Wissen über den Immobilienmarkt angeeignet haben. Keineswegs, antwortete Rosemary, sie arbeite hier erst seit einem halben Jahr, und es sei ihre zweite Arbeitsstelle.
»Es bringt nichts, wenn man irgendwo arbeitet, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht«, sagte sie. »Die Arbeit ist doppelt so interessant, wenn man von allem eine Ahnung hat.«
Das machte Rosemary auch doppelt so interessant für ihre männlichen Kollegen. Allerdings hatten sie es ziemlich schwer, wenn sie nähere Bekanntschaft mir ihr schließen wollten. Wie Ria gehört hatte, gab es sogar heimliche Wetten, wer als erster bei Rosemary landen würde. Auch Rosemary hatte davon gehört. Die beiden Mädchen lachten herzlich darüber.
»Es ist nur ein Spiel«, meinte Rosemary. »Im Grunde wollen sie gar nichts von mir.« Ria war sich da nicht so sicher, denn beinahe jeder Mann im Büro wäre stolz darauf gewesen, sich mit Rosemary Ryan an seiner Seite zeigen zu können. Doch sie war unerbittlich: erst die Karriere, dann die Männer. Bei diesen Worten horchte Ria auf. Das klang so ganz anders als das, was sie zu Hause von ihrer Mutter und ihrer Schwester zu hören bekam, die Heirat und Ehe für das Wichtigste überhaupt hielten.
Rias Mutter fand, 1982 sei ein richtiges Trauerjahr für die Filmbranche. Erst der Tod von Ingrid Bergman, Romy Schneider und Henry Fonda, und dann kam auch noch Fürstin Gracia Patricia bei diesem schrecklichen Unfall ums Leben. All die wirklich großen Schauspieler starben wie die Fliegen.
In ebendiesem Jahr verlobte sich Hilary Johnson mit Martin Moran, einem Lehrer an der Schule, wo sie im Sekretariat arbeitete.
Martin war ein blasser, ängstlicher Typ und stammte aus dem Westen Irlands. Sein Vater sei ein kleiner Bauer, pflegte er zu sagen – nicht etwa nur ein Bauer, sondern ein kleiner Bauer. Bei Martins Größe von einem Meter fünfundachtzig konnte man sich das kaum vorstellen. Er hatte gute Manieren und war Hilary offenbar sehr zugetan, aber irgendwie mangelte es ihm an Schwung und Lebendigkeit. Wenn er sonntags zum Essen kam, wirkte er immer etwas bedrückt und neigte grundsätzlich zur Schwarzmalerei.
Überall sah er Probleme. Wenn der Papst England besuchte, würde sicher ein Attentat auf ihn verübt werden, verkündete Martin im Brustton der Überzeugung. Als dann doch nichts passierte, hatte der Papst lediglich Glück gehabt, sein Besuch sei im übrigen auch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Falklandkrieg würde Auswirkungen auf Irland haben, unkte er, die Nahostkrise würde sich verschärfen, und die Bombenanschläge der IRA in London seien nur die Spitze des Eisbergs. Außerdem seien die Lehrergehälter zu niedrig und die Immobilienpreise zu hoch.
Ria betrachtete verwundert den Mann, den ihre Schwester zu heiraten gedachte.
Hilary, die früher bedenkenlos einen ganzen Wochenlohn für eine Wahrsagerin ausgegeben hatte, redete jetzt davon, wie teuer Schuhreparaturen seien und daß es doch völliger Wahnsinn sei, außerhalb der Billigtarifzeiten zu telefonieren.
Schließlich entschieden sich die beiden für ein Objekt und leisteten eine Anzahlung. Das Haus war wirklich ziemlich klein. Und wie die Gegend in Zukunft aussehen würde, konnte man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Gegenwärtig bestimmten Schlammlöcher, Betonmischmaschinen, Bauarbeiter, halbfertige Straßen und ungepflasterte Gehwege das Bild. Trotzdem schien es genau das zu sein, was sich Hilary vom Leben erwartet hatte. Ria hatte ihre ältere Schwester noch nie so glücklich gesehen.
Hilary lächelte unentwegt und hielt Martins Hand, sogar wenn sie über so betrübliche Themen wie Amtsgebühren oder Maklerprovisionen sprachen. Immer wieder betrachtete sie ihren Ring mit dem winzigen Diamanten. Martin hatte ihn sorgsam ausgewählt und bei einem Juwelier gekauft, bei dem sein Vetter arbeitete, so daß er einen Preisnachlaß aushandeln konnte.
Mit froher Erwartung fieberte Hilary ihrer Hochzeit entgegen, die zwei Tage vor ihrem vierundzwanzigsten Geburtstag stattfinden würde. Für Hilary war nun die Zeit gekommen, und sie stimmte sich mit äußerster Sparsamkeit darauf ein. Sie und Martin wetteiferten darum, wer mehr Geld für das gemeinsame Vorhaben beiseite legen konnte.
Im Winter zu heiraten war viel vernünftiger. Hilary würde ein cremefarbenes Kostüm mit Hut tragen, was sie auch später noch anziehen konnte, und wenn man es dunkel einfärbte, hatte man sogar noch länger etwas davon. Zur Feier des Tages würden sie in einem Dubliner Hotel einen kleinen Lunch einnehmen, natürlich nur im engsten Kreis der Familie. Als kleine Bauern konnten es sich Martins Vater und seine Brüder nicht leisten, länger als einen Tag ihrem Hof fernzubleiben. Man mußte sich einfach für Hilary freuen, denn alles war genau so, wie sie es sich wünschte. Aber Ria wußte, daß es ihrer Vorstellung vom Leben überhaupt nicht entsprach.
Zur Hochzeit trug Ria einen scharlachroten Mantel, und ihren schwarzen Lockenkopf hatte sie mit einem rotsamtenen Haarband und einer ebensolchen Schleife geschmückt. Bestimmt war sie eine der farbenfrohesten Brautjungfern bei einer der tristesten Hochzeiten Europas, ging es ihr durch den Sinn.
Am Montag beschloß sie, den scharlachroten Brautjungfernmantel ins Büro anzuziehen. Rosemary war verblüfft. »Hey, du siehst ja phantastisch aus! Ich habe dich noch nie gesehen, wenn du dich schick gemacht hast, Ria. Weißt du, du solltest dich öfter mal in Schale werfen. Schade, daß wir mittags nicht irgendwohin essen gehen können, wo du dich zeigen kannst. Das ist eine richtige Verschwendung.«
»Ach komm, Rosemary, so toll ist das nun auch nicht«, erwiderte Ria verlegen. Sollte das heißen, daß sie sonst immer wie eine Landstreicherin aussah?
»Nein, ich meine es ernst. Du solltest immer diese grellen Farben tragen. Ich wette, damit hast du bei der Hochzeit enorm Eindruck gemacht!«
»Schön wär’s, aber vielleicht war es auch ein bißchen zu schrill und hat sie alle farbenblind gemacht. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie Martins Verwandtschaft so ist.«
»So wie Martin?« vermutete Rosemary.
»Verglichen mit denen ist Martin ein wahres Energiebündel«, meinte Ria.
»Weißt du, ich kann es gar nicht glauben, daß ich dieselbe Ria vor mir habe wie letzte Woche.« Rosemary, perfekt geschminkt und in einem makellosen lilafarbenen Strickkleid, stand vor ihr und starrte sie voller Bewunderung an.
»Ich glaube, du hast mich wirklich überzeugt. Jetzt muß ich mir eine komplette neue Garderobe zulegen.« Ria drehte sich noch einmal im Kreis, ehe sie ihren knallroten Mantel ablegte. Und da bemerkte sie den Neuen im Büro.
Sie hatte bereits gehört, daß ein gewisser Mr. Lynch aus der Filiale in Cork kommen würde. Das mußte er sein. Er war ziemlich klein, etwa von Rias Größe. Und er sah auch nicht umwerfend gut aus, doch er hatte blaue Augen und glattes blondes Haar, das ihm in die Stirn fiel – und ein strahlendes Lächeln, als würde die Sonne aufgehen. »Hallo, ich bin Danny Lynch«, stellte er sich vor. Ria schaute ihn an und genierte sich ein wenig, weil sie in ihrem neuen Mantel vor seinen Augen Pirouetten gedreht hatte. »Sie sehen einfach großartig aus«, sagte er. Ria schnürte es die Kehle zu, als wäre sie einen Berg hinaufgelaufen und außer Atem geraten.
Glücklicherweise ergriff Rosemary die Initiative, denn Ria hätte keinen Ton herausgebracht.
»Ja, hallo, Danny Lynch«, erwiderte sie mit dem Anflug eines Lächelns. »Herzlich willkommen in unserem Büro. Wissen Sie, man hat uns zwar gesagt, daß ein Mr. Lynch zu uns kommen würde, aber irgendwie haben wir gedacht, das wäre ein älterer Herr.«
Plötzlich und zum ersten Mal war Ria auf ihre Freundin eifersüchtig. Warum wußte Rosemary immer genau, was sie sagen mußte, wie schaffte sie es nur, gleichzeitig witzig, charmant und liebenswürdig zu sein?
»Ich heiße Rosemary, und das ist Ria. Wir sind die Truppe, die den Laden hier am Laufen hält. Deshalb müssen Sie sich gut mit uns stellen.«
»Oh, das tue ich bestimmt«, versprach Danny.
Da wußte Ria, daß er wahrscheinlich auch bald zu denen gehören würde, die darum wetteten, wer als erster bei Rosemary landete. Und daß er es wahrscheinlich sogar schaffen würde. Merkwürdig war nur, daß er seine Worte offenbar an sie, Ria, richtete, aber vielleicht bildete sie sich das auch nur ein. Rosemary fuhr fort: »Wir überlegen uns gerade, wohin wir ausgehen könnten, um Rias neuen Mantel zu feiern.«
»Klasse! Nun, damit hätten wir einen Anlaß, jetzt brauchen wir nur noch ein Lokal. Und wir müßten wissen, ob wir lange genug Mittagspause machen können, damit ich nicht schon am ersten Tag unangenehm auffalle.« Er strahlte die beiden abwechselnd mit seinem außerordentlichen Lächeln an, als gäbe es außer ihnen dreien niemanden auf der Welt.
Ria war sprachlos, ihr Mund fühlte sich ganz trocken an.
»Wenn wir nicht länger als eine Stunde weg sind, dürfte das kein Problem sein«, meinte Rosemary.
»Dann ist die Frage nur noch: wo?« sagte Danny Lynch und schaute Ria dabei in die Augen. In diesem Moment schien die Welt nur noch aus ihnen beiden zu bestehen. Sie brachte noch immer keinen Ton heraus.
»Gleich gegenüber ist ein Italiener«, schlug Rosemary vor. »Da würden wir uns lange Wege sparen.«
»Ja, gehen wir doch dorthin«, erwiderte Danny Lynch, ohne den Blick von Ria Johnson abzuwenden.
Danny war dreiundzwanzig. Sein Onkel war Auktionator gewesen. Nun, eigentlich war er in ihrer Kleinstadt alles mögliche gewesen, auch Gastwirt und Leichenbestatter, aber er besaß eine Zulassung als Versteigerer, und Danny hatte bei ihm nach dem Schulabschluß gearbeitet. Sie hatten Getreide, Dünger und Heu wie auch Vieh und kleine Höfe verkauft, aber durch den Aufschwung in Irland war der Immobilienmarkt immer bedeutender geworden. Danach hatte Danny eine Stelle in Cork angetreten, wo es ihm sehr gut gefallen hatte, und nun war er nach Dublin gewechselt.
Er war aufgeregt wie ein Kind an Weihnachten und steckte Rosemary und Ria mit seiner Vorfreude an. Die Büroarbeit, sagte er, könne er nicht leiden, er sei lieber im Außendienst, aber das gehe wohl jedem so. Natürlich sei ihm klar, daß es eine Zeitlang dauern würde, bis er sich hier die entsprechende Position erarbeitet hatte. Er sei schon oft in Dublin gewesen, habe hier aber noch nie gelebt.
Wo er denn jetzt wohne? Solches Interesse hatte Rosemary noch an niemandem gezeigt, dachte Ria bedrückt. Jeder Mann im Büro hätte alles dafür gegeben, wenn sie mit einem solchen Leuchten in den Augen an seinen Lippen gehangen hätte. Noch nie hatte sie einen ihrer Kollegen gefragt, wo er wohnte, es schien ihr völlig gleichgültig zu sein, ob sie überhaupt eine Bleibe hatten. Doch bei Danny war das anders. »Sagen Sie nur nicht, daß Sie irgendwo weit draußen wohnen«, meinte Rosemary, den Kopf zur Seite geneigt. Kein Mann auf Erden konnte widerstehen, wenn Rosemary seine Adresse wissen wollte und er die Möglichkeit hatte, auch die ihre zu erfahren. Aber Danny schien ihre Frage als ganz unverbindlich zu betrachten, als ein völlig alltägliches Gesprächsthema. Während sein Blick von einer zur anderen schweifte, erzählte er, daß er das Große Los gezogen habe. Ja, er habe wirklich unverschämtes Glück gehabt. Er habe da einen Mann kennengelernt, einen etwas verrückten und verwirrten Alten namens Sean O’Brien, einen richtigen Einsiedler, und dieser habe ein großes, prächtiges Haus in der Tara Road geerbt. Eigentlich müsse es dringend renoviert werden, aber Sean sei dazu nicht in der Lage, er scheue den ganzen Aufwand und die endlosen Diskussionen darüber. Nach seinem Wunsch sollten einfach ein paar Männer dort einziehen und wohnen. Denn mit Männern habe man weniger Scherereien als mit Frauen, sie legten nicht so viel Wert auf Luxus, Ordnung und Sauberkeit. Dabei lächelte Danny die beiden entschuldigend an, als wollte er sagen, er wisse ja, daß Männer hoffnungslose Fälle seien.
So wohnte er dort nun mit zwei anderen Burschen. Jeder hatte ein Zimmer zur Miete und kümmerte sich ein bißchen ums Haus, bis der arme alte Sean eine Entscheidung getroffen hatte, was er letztlich damit anfangen wollte. Auf diese Weise war allen gedient.
Was sei das denn für ein Haus, wollten die Mädchen wissen.
Die Häuser in der Tara Road seien völlig unterschiedlich, erklärte Danny. Da gebe es stattliche Villen mit baumbestandenen Gärten und kleine Häuser, die direkt an die Straße grenzten. Die Nummer 16 sei ein großes altes Haus, aber mittlerweile baufällig, feucht und heruntergekommen. Sean O’Briens Onkel habe sich wohl ebensowenig darum gekümmert wie Sean selbst, denn früher müsse es ein herrliches Anwesen gewesen sein. Für Häuser habe er, Danny, ein Gespür, sonst wäre er in dieser Branche ja auch fehl am Platz.
Ria saß da, das Kinn auf die Hände gestützt, hörte ihm verzückt zu und konnte den Blick nicht von ihm abwenden. Wie lebhaft er doch erzählte! Zum Haus gehöre ein großer, verwilderter Garten, fuhr er fort, im hinteren Teil stünden sogar Obstbäume. Ja, es sei eines dieser Häuser, die einen richtiggehend willkommen hießen.
Rosemary, die das Gespräch in Gang gehalten hatte, rief nach der Rechnung. Sie gingen über die Straße zurück zur Firma, und Ria setzte sich an ihren Schreibtisch. Nein, sagte sie sich, im wirklichen Leben gibt es so etwas nicht. Es ist lediglich eine Schwärmerei. Er ist nur ein ganz gewöhnlicher, nicht einmal sonderlich großer junger Mann, der eben gut mit Leuten umgehen kann. Aber warum um alles auf der Welt hatte sie dann das Gefühl, daß er etwas Besonderes war und daß sie zur Mörderin werden könnte, wenn er seine Zukunftspläne und Wünsche mit einer anderen Frau als ihr verwirklichen würde? Das war doch nicht normal. Plötzlich erinnerte sie sich an die Hochzeit ihrer Schwester am Vortag. Nein, das war auch nicht normal.
Kurz vor Büroschluß ging Ria zu Danny Lynchs Schreibtisch. »Morgen werde ich zweiundzwanzig«, sagte sie. »Ich dachte mir …« Auf einmal wußte sie nicht mehr weiter.
»Feiern Sie eine Party?« half er ihr.
»Nein, eigentlich nicht.«
»Aber wir könnten doch trotzdem zusammen feiern. Heute den Mantel, morgen Ihren Geburtstag. Und wer weiß, was es am Mittwoch für einen Anlaß gibt.«
Und da wußte Ria, daß es keine Schwärmerei war, sondern Liebe. Etwas, was sie nur aus Büchern, Erzählungen, Liedern oder Kinofilmen kannte. Und jetzt lernte sie selbst die Liebe kennen, hier in ihrem Büro.
Zunächst wollte sie ihn ganz für sich haben und keinem anderen von ihm erzählen. Beim Abschied klammerte sie sich an ihn, als wollte sie ihn nie wieder loslassen.
»Aus dir werde ich nicht schlau, meine Liebe«, sagte er zu ihr. »Mal willst du mich bei dir haben, dann schickst du mich wieder weg. Oder bin ich nur zu blöd, um das zu verstehen?« Er legte den Kopf schief und schaute sie fragend an.
»Genauso sind eben auch meine Gefühle«, antwortete sie schlicht. »Ich bin ziemlich verwirrt.«
»Nun, wir können das Ganze doch vereinfachen, oder nicht?«
»Ich weiß nicht. Für mich wäre das ein großer Schritt, verstehst du? Ich möchte kein Drama daraus machen, aber ich war noch nie mit einem Mann zusammen. Was aber nicht heißt …« Sie biß sich auf die Unterlippe. Sie wagte nicht auszusprechen, daß sie erst mit ihm schlafen wollte, wenn sie wußte, daß er sie liebte. Damit würde sie ihm die Worte ja regelrecht in den Mund legen.
Danny Lynch nahm ihr Gesicht in beide Hände. »Ich liebe dich, Ria, ich bete dich an.«
»Liebst du mich wirklich?«
»Das weißt du doch.«
Wenn er sie beim nächsten Mal fragte, ob sie mit zu ihm in das große, weitläufige Haus gehen wollte, würde sie nicht nein sagen. Merkwürdigerweise kam er in den darauffolgenden Tagen aber nicht mehr darauf zu sprechen. Statt dessen erzählte er von sich, daß in der Schule immer alle auf ihm herumgehackt hatten, weil er so klein gewesen war, und daß seine älteren Brüder ihm beigebracht hatten, wie er sich wehren konnte. Heute lebten seine Brüder in London, alle beide. Der eine war verheiratet, der andere wohnte mit seiner Freundin zusammen. Sie kamen nicht oft nach Hause. Ihre Urlaube verbrachten sie lieber in Spanien oder Griechenland.
Seine Eltern wohnten seit Jahr und Tag im selben Haus. Sie lebten sehr zurückgezogen und unternahmen gern lange Spaziergänge mit ihrem roten Setter. Ria hatte den Eindruck, daß Danny nicht besonders gut mit seinem Vater auskam, aber obwohl ihr die Frage unter den Nägeln brannte, ließ sie sie unausgesprochen. Männern war es zuwider, über so persönliche Dinge zu sprechen. Das wußten sie und Rosemary aus Zeitschriftenartikeln und auch aus eigener Erfahrung. Männer ließen sich nicht gern über ihre Gefühle ausfragen. Deshalb wollte sie nicht weiter nachhaken, wie denn seine Kindheit gewesen sei, warum er so wenig von seinen Eltern erzählte und sie nur selten besuchte.
Da Danny sich auch nicht nach ihrer Familie erkundigte, wollte sie ihn ebensowenig mit ihren Geschichten behelligen: etwa, daß ihr Vater in ihrem achten Lebensjahr gestorben war, daß ihre Mutter noch immer voller Verbitterung und Enttäuschung von ihm sprach und daß Hilarys und Martins Hochzeit so schrecklich langweilig gewesen war.
In jenen verliebten Tagen mangelte es ihnen nie an Gesprächsstoff. Danny wollte wissen, welche Musik sie mochte, was sie las, wo sie ihre Urlaube verbracht hatte, welche Filme sie gerne anschaute und welche Häuser ihr gefielen. Er zeigte ihr Bücher über Häuser und wies sie auf Dinge hin, die ihr nie aufgefallen wären. Wie schön wäre es, wenn das Haus Nummer 16 in der Tara Road ihm gehören würde, schwärmte er. Er würde es herrichten und hegen und pflegen. Ja, er wollte sich ihm mit einer Liebe widmen, die ihm das Haus tausendfach zurückgeben würde.
Mit Rosemary reden zu können war eine Wohltat. Anfangs hielt Ria sich bedeckt. Sie befürchtete, wenn Rosemary Danny nur noch ein einziges Mal anlächelte, würde er sie verlassen und sich Rosemary an den Hals werfen. Doch im Laufe der Zeit wurde sie sich seiner Liebe sicherer. Und dann erzählte sie Rosemary alles, berichtete über ihre gemeinsamen Unternehmungen, sprach über Dannys Interessen und über seine eigenbrötlerische Familie auf dem Land.
Rosemary hörte teilnahmsvoll zu. »Dich hat es ganz schön erwischt«, meinte sie schließlich.
»Meinst du, daß ich eine Dummheit begehe, daß das nur ein Strohfeuer ist? Du weißt doch über solche Sachen Bescheid.« Ria wünschte sich nichts sehnlicher, als daß sie auch so ein ovales Gesicht mit so hohen Wangenknochen gehabt hätte.
»Ihn scheint es genauso erwischt zu haben«, seufzte Rosemary.
»Natürlich sagt er, daß er mich liebt«, antwortete Ria auf Rosemarys angedeutete Frage.
»Selbstverständlich liebt er dich. Das war schon am ersten Tag nicht zu übersehen«, entgegnete Rosemary, während sie versonnen mit ihrem langen blonden Haar spielte. »So etwas Romantisches habe ich noch nie erlebt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie eifersüchtig wir alle auf euch sind. Eine richtige Liebe auf den ersten Blick, und das ganze Büro weiß es. Was allerdings niemand weiß: Schläfst du mit ihm?«
»Nein«, antwortete Ria entschieden. Und etwas kleinlaut fügte sie hinzu: »Noch nicht.«
Rias Mutter wollte wissen, ob sie diesen jungen Mann jemals zu Gesicht bekommen würde.
»Bald, Mam. Nur nichts übereilen.«
»Ich will ja nicht drängeln, Ria. Ich möchte dich nur darauf hinweisen, daß du seit Wochen jeden Abend mit diesem Burschen ausgehst. Da würde es sich eigentlich gehören, daß du ihn bei Gelegenheit mal zu uns nach Hause einlädst.«
»Das tue ich schon noch, Mam. Bestimmt.«
»Ich meine, Hilary hat uns ihren Martin doch auch vorgestellt, oder nicht?«
»Doch, Mam, das hat sie allerdings.«
»Also?«
»Also bringe ich ihn auch mal mit.«
»Fährst du über Weihnachten nach Hause?« fragte Ria Danny.
»Hier ist mein Zuhause«, erwiderte er mit einer Geste, die ganz Dublin einzuschließen schien.
»Ja, ich weiß. Aber ich meine, heim zu deinen Eltern.«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Erwarten sie das denn nicht von dir?«
»Nein, das überlassen sie ganz mir.«
Zu gerne hätte sie ihn jetzt nach seinen Brüdern drüben in England gefragt, und was das eigentlich für eine Familie sei, wenn sie am Weihnachtstag nicht zum Truthahnessen an einem Tisch zusammenkamen. Aber er sollte nicht den Eindruck bekommen, daß sie ihn aushorchen wollte.
»Aha«, meinte sie nur knapp.
Danny nahm ihre Hände in die seinen.
»Hör mal, Ria, das wird sich ändern, wenn wir beide unser gemeinsames Zuhause haben. Es wird ein richtiges Zuhause sein, wo alle sich wohl fühlen. So stelle ich mir unsere Zukunft vor. Du nicht?«
»O doch, Danny«, antwortete sie und strahlte. Im Grunde seines Herzens war Danny ein liebevoller Mensch, ganz wie sie. Und sie war die glücklichste Frau auf der Welt.
»Lad ihn doch für den Weihnachtstag zu uns ein, damit wir ihn auch mal zu sehen bekommen«, bat ihre Mutter.
»Nein, Mam. Das ist nett von dir, aber es geht nicht.«
»Verbringt er Weihnachten bei seiner Familie auf dem Land?«
»Ich weiß es nicht. Er weiß es selbst noch nicht.«
»Das klingt aber nicht sehr vertrauenswürdig«, meinte ihre Mutter naserümpfend.
»Mam, da tust du ihm unrecht.«
»Aber was soll dann diese Geheimniskrämerei? … Daß er sich nicht mal ein Stündchen Zeit nimmt, sich bei der Familie seiner Freundin vorzustellen!«
»Das macht er schon noch, Mam, wenn die Zeit gekommen ist«, beschwichtigte Ria sie.
Bei der Weihnachtsfeier im Betrieb benahm sich immer irgend jemand daneben.
Dieses Jahr war es Orla King, die schon vor Beginn der Feier eine halbe Flasche Wodka geleert hatte. Dann versuchte sie zu singen: »In the jungle, the mighty jungle the lion sleeps tonight.«
»Bring das Mädchen raus, bevor einer von den Chefs sie sieht«, zischte Danny Ria zu.
Das war leichter gesagt als getan. Ria versuchte Orla zu überreden, mit ihr zur Damentoilette zu gehen.
»Verpiß dich!« lautete die Antwort.
Da kam Danny dazu. »He, mein Schatz, wir haben ja noch gar nicht miteinander getanzt«, meinte er.
Orla beäugte ihn interessiert. »Stimmt«, sagte sie.
»Gehen wir doch raus, da haben wir mehr Platz zum Tanzen.«
In freudiger Erwartung stimmte das Mädchen zu.
Sekunden später hatte Danny sie auf die Straße bugsiert. Ria brachte ihr den Mantel. Orla wurde an der kalten, frischen Luft übel, und sie führten sie in eine ruhige Ecke.
»Ich will heim«, heulte sie los.
»Komm, wir begleiten dich«, schlug Danny vor.
Er und Ria nahmen Orla in ihre Mitte, während sie immer wieder den Refrain von »The lion sleeps tonight« grölte.
Als sie Orla beim Aufsperren ihrer Wohnungstür halfen, musterte sie die beiden erstaunt. »Wie bin ich denn nach Haus gekommen?« fragte sie verdutzt.
»Es ist alles in Ordnung, Schatz«, beruhigte Danny sie.
»Willst du mit reinkommen?« Orla ignorierte Ria völlig.
»Nein, Schatz, wir sehen uns morgen«, erwiderte er, dann gingen sie.
»Wenn du sie nicht weggebracht hättest, hätte sie ihre Stelle verloren«, sagte Ria, während sie zum Bürohaus zurückspazierten. »Wie kann man nur so blöd sein … Hoffentlich weiß sie wenigstens, was sie dir zu verdanken hat.«
»Sie ist nicht blöd, sie ist einfach nur jung und einsam«, entgegnete er.
Da wurde Ria von einer Eifersucht gepackt, die beinahe körperlich weh tat. Orla war achtzehn Jahre jung und hübsch; sogar mit ihrem verheulten Gesicht sah sie noch gut aus. Was, wenn Danny sich zu ihr hingezogen fühlte? Nein, darüber wollte Ria lieber nicht nachdenken.
Als sie zur Feier zurückkehrten, stellten sie fest, daß man sie noch nicht vermißt hatte. »Das hast du geschickt angestellt, Danny«, meinte Rosemary anerkennend. »Und was noch geschickter war: Ihr habt euch vor den Ansprachen gedrückt.«
»Wurde irgendwas Wichtiges gesagt?«
»Ach, nur daß es ein einträgliches Jahr war und daß es Gratifikationen geben wird. Es geht voran, es geht bergauf, und so weiter und so fort.«
Rosemary sah hinreißend aus mit ihrem blonden Haar, das sie mit einem straßbesetzten Kamm hochgesteckt hatte, ihrer weißen Satinbluse und dem engen schwarzen Rock, der ihre langen, schlanken Beine zur Geltung brachte. Zum zweiten Mal an diesem Abend wurde Ria eifersüchtig. Wie konnte sie, ein pummeliger Krauskopf, so einen Traummann wie Danny Lynch halten? Völlig idiotisch, es auch nur zu versuchen!
Da flüsterte er ihr ins Ohr: »Mischen wir uns unter die Leute, plaudern wir ein bißchen mit den großen Tieren, und sehen wir dann zu, daß wir von hier wegkommen.«
Ria beobachtete ihn, wie er unbefangen mit den leitenden Angestellten scherzte, den Herren vom Vorstand respektvoll zunickte und ihren Gattinnen höflich Gehör schenkte. Obwohl Danny erst seit ein paar Wochen hier arbeitete, war er bereits bei allen beliebt, und jedermann sagte ihm eine große Zukunft voraus.
»Ich nehme morgen den Heiligabend-Bus.«
»Es wird bestimmt nett, wenn all die Auswanderer heimkommen«, meinte Ria.
»Ich werde dich vermissen«, sagte er.
»Ich dich auch.«
»Am Tag nach Weihnachten fahre ich zurück – per Anhalter, weil ja keine Busse verkehren.«
»Das ist schön.«
»Ich habe mir gedacht, ich könnte zu dir nach Hause kommen und … na ja, vielleicht auch deine Mutter kennenlernen?«
Er schlug es von sich aus vor, ganz ohne Druck oder Zwang von ihrer Seite.
»Das wäre klasse. Komm doch am Dienstag zum Mittagessen zu uns.« Jetzt mußte sie sich nur noch fest vornehmen, sich nicht für ihre Mutter, ihre Schwester und ihren langweiligen Schwager zu schämen.
Es würde am Dienstag ja kein Bewerbungsgespräch werden. Nur ein einfaches Mittagessen mit Suppe und belegten Broten.
Ria versuchte ihr Heim mit Dannys Augen zu sehen. Ein Eckhaus in einer langen Straße inmitten eines großen Sozialwohnungsviertels. Nein, das entsprach sicherlich nicht seinen Vorstellungen von dem, wie er gerne wohnen würde. Aber schließlich kommt er, um mich zu sehen und nicht das Haus, tröstete sie sich. Ihre Mutter meinte, er werde hoffentlich nicht länger als bis drei Uhr bleiben, dann fange nämlich im Fernsehen ein großartiger Film an. Nein, erwiderte Ria mit zusammengebissenen Zähnen, er würde bestimmt früher gehen.
Hilary sagte, er sei sicher besseres Essen gewohnt, aber er müsse sich eben mit dem zufriedengeben, was bei ihnen auf den Tisch komme. Mit Mühe brachte Ria heraus, daß das überhaupt kein Problem sei. Martin las unterdessen seine Zeitung, ohne auch nur aufzusehen.
Ria fragte sich, ob Danny wohl eine Flasche Wein, eine Schachtel Pralinen oder eine Topfpflanze mitbringen würde. Oder vielleicht auch gar nichts. Dreimal wechselte sie ihre Garderobe. Das eine Kleid war zu schick, das andere zu unmodern. Als sie sich gerade zum dritten Mal umzog, klingelte es an der Tür.
Er war da.
»Hallo, Nora, ich bin Danny«, hörte sie ihn sagen. O Gott, er nannte ihre Mutter beim Vornamen. Martin hingegen sagte immer Mrs. J. zu ihr. Bestimmt fand Mam das ganz unmöglich.
Doch die Antwort ihrer Mutter verriet, daß auch sie sich Dannys Charme nicht entziehen konnte. »Seien Sie uns ganz herzlich willkommen«, begrüßte sie ihn in einem freundlichen Ton, den Ria in diesem Haus seit undenklichen Zeiten nicht mehr gehört hatte.
Und ebenso wirkte dieser Zauber auf Hilary und Martin. Interessiert hörte Danny zu, als sie von ihrer Hochzeit erzählten, erkundigte sich nach der Schule, in der sie arbeiteten, war entspannt und ungezwungen. Ria konnte nur staunend zusehen.
Allerdings hatte er weder Wein noch Pralinen oder Blumen mitgebracht, sondern schenkte ihnen ein Gesellschaftsspiel, Trivial Pursuit. Ria verließ aller Mut, als sie es erblickte. In dieser Familie wurden niemals Spiele gespielt. Doch da hatte sie Danny unterschätzt. Wenig später waren sie alle in die Fragekärtchen vertieft. Nora konnte sämtliche Fragen über Filmstars beantworten, und Martin glänzte mit seiner Allgemeinbildung.
»Gegen einen Lehrer habe ich einfach keine Chance«, seufzte Danny verzweifelt.
Als er ankündigte, daß er nun aufbrechen werde, wollten sie ihn noch lange nicht gehenlassen. »Ria hat mir versprochen, daß sie sich heute das Haus ansieht, in dem ich wohne«, meinte er entschuldigend. »Und ich möchte gerne, daß wir noch bei Tageslicht dort ankommen.«
»Er ist hinreißend«, hauchte Hilary.
»Ein sehr manierlicher junger Mann«, flüsterte ihre Mutter.
Schließlich hatten sie es überstanden.
»Es war nett bei euch«, bemerkte Danny, als sie auf den Bus zur Tara Road warteten. Und mehr hatte er dazu nicht zu sagen. Es kam weder eine Analyse noch eine Bewertung. Männer wie Danny waren eben direkt und unkompliziert.
Und dann waren sie da, Seite an Seite standen sie im verwilderten Vorgarten und blickten an dem Haus in der Tara Road hinauf. »Schau dir nur die Fassade an«, schwärmte Danny. »Siehst du, wie vollkommen die Proportionen sind? Das Haus ist 1870 als Herrschaftssitz gebaut worden.« Die Stufen zur Eingangstür bestanden aus mächtigen Granitblöcken. »Sieh dir an, wie wohlgeformt sie sind, sie passen perfekt.« Die Erkerfenster waren noch im Originalzustand. »Die Fensterläden sind über hundert Jahre alt, und das Bleiglas über der Tür hat nicht mal einen Sprung. Dieses Haus war einst ein Schmuckstück«, schwärmte Danny Lynch.
Und darin wohnte er – oder besser gesagt, er hauste in einem der Zimmer.
»Den heutigen Tag wollen wir in Erinnerung behalten als den Tag, an dem wir zum ersten Mal gemeinsam über die Schwelle dieses Hauses traten«, sagte er mit leuchtenden Augen. Er konnte genauso sentimental und romantisch sein, wie sie es in vielerlei Hinsicht war. Als er gerade im Begriff war, die Tür aufzusperren, von der die Farbe abblätterte, hielt er plötzlich inne und küßte Ria. »Das wird unser Zuhause sein, Ria, was hältst du davon? Sag mir, daß du genauso begeistert davon bist wie ich.« Er meinte es ernst. Er wollte sie heiraten. Danny Lynch, ein Mann, dem alle Frauen zu Füßen lagen. Und er glaubte tatsächlich, eines Tages wäre er Eigentümer dieses herrschaftlichen Anwesens. Ein junger Mann von dreiundzwanzig Jahren, der kein Vermögen besaß. Doch so ein Haus konnten sich nur Reiche leisten, selbst in diesem schlechten Zustand.
Ria wollte ihm nicht seine Träume zerstören, und vor allem wollte sie nicht wie ihre Schwester Hilary klingen, deren Sparsamkeit sich zu einer regelrechten Manie ausgewachsen hatte. Trotzdem waren das Phantastereien. »So ein Haus übersteigt doch unsere Möglichkeiten, oder nicht?« wandte sie ein.
»Wenn du es erst mal von innen siehst, dann wirst du wissen, daß wir hier leben werden. Und wir finden Mittel und Wege, um es zu kaufen.« Während er unbeirrt weiterredete, betraten sie die Eingangsdiele. Dort lenkte er ihre Aufmerksamkeit auf die Originalstuckarbeiten an der hohen Decke und weg von den Fahrrädern, die alles verstellten. Er wies sie auf die formvollendete Treppe hin, allerdings ohne auf die morschen Holzstufen einzugehen. Das große Zimmer mit den Flügeltüren konnten sie nicht besichtigen, denn Sean O’Brien, der schrullige Vermieter, benutzte es als Lagerraum für irgendwelche überdimensionalen Kisten und Behälter.
Sie stiegen die Treppe wieder hinunter und gelangten in die weitläufige Küche mit dem alten schwarzen Eisenherd. Von hier aus führte eine Hintertür in den Garten, und es gab eine Vielzahl von Vorrats- und Abstellkammern, von Wasch- und Spülküchen. Ria schwirrte der Kopf angesichts dieser gewaltigen Dimensionen. Und dieser Bursche mit dem verschmitzten Blick glaubte ernsthaft, er und sie könnten das nötige Geld auftreiben und ein solches Haus instand setzen.
Wenn es ihr Maklerbüro zum Kauf anbieten würde, wäre das Inserat gespickt mit den üblichen warnenden Hinweisen: größere Renovierungsarbeiten erforderlich, bauliche Veränderungen empfohlen, individuelle Gestaltung möglich. Nur ein Bauunternehmer, eine Sanierungsfirma oder jemand mit großem Vermögen würde ein solches Anwesen kaufen.
Der geflieste Küchenboden war uneben. Auf dem alten Herd stand ein kleiner, billiger Gaskocher.
»Ich mache uns einen Kaffee«, bot Danny an. »In späteren Jahren werden wir dann daran zurückdenken, wie wir das erste Mal in der Tara Road zusammen Kaffee getrunken haben …« Und wie auf Befehl war die Küche plötzlich in ein mildes, winterliches Sonnenlicht getaucht, die schräg einfallenden Strahlen durchdrangen das Gestrüpp draußen vor dem Fenster und malten Muster auf den Fliesenboden. Es war wie ein Zeichen.
»Ja, daran werde ich mich immer erinnern – an meinen ersten Kaffee mit dir in der Tara Road«, erwiderte Ria.
»Und wir können später erzählen, daß es ein toller, sonniger Tag war, jener neunundzwanzigste Dezember 1982«, meinte Danny.
Wie es sich ergab, sollte es auch der Tag sein, an dem Ria Johnson sich zum ersten Mal einem Mann hingab. Und als sie neben Danny in dem kleinen, engen Bett lag, wünschte sie sich, sie könnte in die Zukunft schauen. Nur für einen kurzen Augenblick, um zu sehen, ob sie wirklich einmal hier wohnen, Kinder haben und im trauten Heim ihrer Träume leben würden.
Sie fragte sich, ob Hilarys Freundin Mrs. Connor, die Wahrsagerin auf dem Landfahrerplatz, es wohl wissen könnte. Bei der Vorstellung, daß sie dorthin ging und diese Frau zu Rate zog, mußte sie lächeln. Danny, der an ihrer Schulter geschlafen hatte, erwachte und blickte in ihr Gesicht.
»Bist du glücklich?« fragte er.
»So glücklich wie noch nie.«
»Ich liebe dich, Ria. Ich werde dich nie enttäuschen«, versprach er ihr.
Sie war die glücklichste Frau im ganzen Land. Nein, sagte sie sich, warum so bescheiden? Konnte es denn irgendwo einen glücklicheren Menschen geben als sie? Die glücklichste Frau der Welt – ja, das war sie.
Die nächsten Wochen vergingen wie im Flug.
Sie wußten, daß Sean O’Brien sein Haus liebend gern loswerden wollte.
Und sie wußten auch, daß er es am liebsten an sie verkaufen würde, an junge Leute, die nicht viel Aufhebens um die Feuchtigkeit und das schadhafte Dach machten und sich nicht über den schlechten baulichen Zustand des Hauses beklagten. Trotzdem mußten sie ihm einen angemessenen Preis bezahlen. Und woher sollten sie das Geld nehmen?
Das Papier, auf dem sie ihre Kalkulationen anstellten, häufte sich im Lauf der Zeit zu Stapeln an. Vier Zimmermieter im obersten Stockwerk würden genug einbringen, um die Hypothek abzuzahlen. Natürlich mußte das in aller Stille geschehen. Wozu die Baubehörden mit Details behelligen oder gar das Finanzamt auf sich aufmerksam machen? Sie entschieden sich, mit ihrem Vorschlag an die Bank heranzutreten. Ria hatte eintausend Pfund angespart, Danny zweieinhalbtausend. Und jeder von ihnen kannte Paare, die es sogar mit geringerem Startkapital zu eigenen vier Wänden gebracht hatten. Alles hing von der richtigen zeitlichen Abstimmung und der entsprechenden Präsentation ab. Ja, sie wollten es wagen.
Als sie den Hausbesitzer zu einem Gespräch über die Zukunft des Hauses einluden, scheuten sie nicht die Kosten für eine Flasche Whiskey. Wie sich herausstellte, gab es mit Sean O’Brien keine Probleme. Wieder und wieder erzählte er ihnen die Geschichte, die sie bereits kannten. Er hatte vor ein paar Jahren das Haus von seinem verstorbenen Onkel geerbt. Aber er wollte gar nicht hier wohnen, denn er besaß eine kleine Kate an einem See in Wicklow, wo er häufig angelte und mit Gleichgesinnten zechte. Dort halte er sich viel lieber auf. Das Haus in der Tara Road habe er nur für den Fall behalten, daß es einen Immobilienboom gäbe. Und den hätten sie ja jetzt. Heute sei das Haus viel mehr wert als vor zehn Jahren, also habe er doch recht gehabt, nicht wahr? Viele Leute hielten ihn für einen Trottel, aber das sei er ganz und gar nicht. Danny und Ria nickten, lobten ihn für seine Weitsicht und schenkten ihm Whiskey nach.
Sean O’Brien meinte, er habe es nie geschafft, das Haus einigermaßen in Schuß zu halten. Es sei ihm zu mühselig, ihm fehle das handwerkliche Geschick dafür, und so habe er es an Leute vermietet, die sich darum kümmerten. Deshalb habe er es jungen Burschen wie Danny und seinen Mitbewohnern mit Freuden überlassen. Allerdings sah er ein, daß das Haus keine gute Anlage mehr war, wenn es weiterhin so verfiel wie jetzt.
Er sagte, er habe sich umgehört und der übliche Preis in dieser Gegend liege bei siebzigtausend Pfund. Doch bei einem schnellen Verkaufsabschluß wäre er auch mit sechzigtausend zufrieden, und dann wäre er auch endlich die ganzen alten Möbel los und die Behälter und Kisten, die er für Freunde aufbewahrte. Für sechzigtausend könne Danny das Haus haben.
Jemand, der über die entsprechenden Mittel verfügte, hätte sich glücklich schätzen können, so ein Schnäppchen zu machen. Aber für Danny und Ria war es ein Ding der Unmöglichkeit – allein schon, weil sie eine Anzahlung von fünfzehn Prozent des Kaufpreises leisten sollten. Und neuntausend Pfund waren für sie so unerreichbar wie neun Millionen Pfund.
Also würden sie sich von ihrem Wunschtraum verabschieden müssen, dachte Ria. Nicht so Danny. Er jammerte nicht und ärgerte sich nicht, sondern hielt einfach unbeirrbar an seinem Vorhaben fest. Das Haus sei so wunderbar, sie müßten es unbedingt haben, ehe es irgendeinem Bauunternehmer in die Hände falle. Nachdem Sean O’Brien sich nun mit dem Gedanken trug, es zu verkaufen, würde er nicht mehr allzulange damit warten wollen.
Es fiel ihnen schwer, sich auf die Immobiliengeschäfte zu konzentrieren, die in ihrem Büro abgewickelt wurden. Um so mehr, weil sie es tagtäglich mit Leuten zu tun hatten, die sich das Haus in der Tara Road ohne weiteres hätten leisten können.
Beispielsweise mit Leuten wie Barney McCarthy, einem großen Geschäftsmann von rauhem, aber herzlichem Naturell, der in England ein Vermögen als Bauunternehmer verdient hatte und beinahe nur aus Lust und Laune heraus Häuser kaufte und verkaufte. Augenblicklich war ihm daran gelegen, ein großes Landhaus loszuschlagen, das sich als Fehlgriff erwiesen hatte. Obwohl ihm Fehlgriffe nur selten unterliefen.
Barney äußerte sich mit ungewohnter Offenheit über den Grund für den Verkauf. Zeitweilig hatte er sich in der Rolle eines Gutsherrn gefallen, der in einem prächtigen georgianischen Herrschaftssitz mit einer von Bäumen gesäumten Auffahrt residierte. Zweifellos war das Haus sehr elegant, doch stellte sich bald heraus, daß es zu weit von Dublin entfernt lag. Er hatte seine Entscheidung voreilig getroffen und war deshalb bereit, bei den ganzem Geschäft ein bißchen draufzuzahlen, aber nicht zuviel. Diesen Klotz am Bein mußte er unbedingt wieder loswerden.
Mittlerweile besaß er ein großes, solides und komfortables Familiendomizil, das er gleich von Anfang an hätte kaufen sollen. Seine Frau wohnte bereits dort. Barney war am Ankauf von Pubs interessiert und investierte in Golfplätze, doch die vordringliche Aufgabe sah er darin, dieses Gutshaus zu verkaufen, das ihm nun wie ein Denkmal seiner eigenen Dummheit erschien. Und sein Image war ihm sehr wichtig.
So gefiel er sich auch darin, mit den Namen von Prominenten aus seiner Bekanntschaft um sich zu werfen, und im Maklerbüro hatten alle großen Respekt vor ihm. Nichtsdestoweniger erwies es sich als großes Problem, das Haus zu dem von ihm geforderten Preis zu verkaufen. Denn offensichtlich hatte Barney viel zuviel dafür bezahlt, und es gab schlicht keine Interessenten. Daß Barney einen Gewinn machen würde, war ausgeschlossen, und die Aussicht, möglicherweise sogar einen empfindlichen Verlust hinnehmen zu müssen, behagte einem Mann wie ihm ganz und gar nicht. Die Seniorpartner der Firma, verbindliche und beredte Herren, wiesen Barney darauf hin, daß der Unterhalt für ein solches Haus immens hoch sei und daß man die potentiellen Käufer in Irland an einer Hand abzählen könne. Deshalb hätten sie auch im Ausland inseriert, aber ohne Erfolg.
Schließlich wurde in der Firma eine Konferenz zu diesem Fall einberufen. Danny, Ria und ihre Kollegen mußten die betrübliche Mitteilung vernehmen, daß Barney womöglich zu einem anderen Makler wechseln würde. Ria war in Gedanken mehr bei ihren eigenen als bei Barneys Problemen. Aber in Danny arbeitete es. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch dann besann er sich eines anderen.
»Ja, bitte, Danny?« Er war ein beliebter und erfolgreicher Mitarbeiter, dessen Meinung alle interessierte.
»Nein, es ist nichts. Wir sind schon alle Möglichkeiten durchgegangen«, winkte er ab.
Danach wurde noch eine halbe Stunde hin und her überlegt, ohne daß sie auch nur einen Schritt weiterkamen.
Ria wußte, daß Danny irgendeine Idee hatte. Das erkannte sie an seinen leuchtenden Augen. Nach der Besprechung flüsterte er ihr zu, er müsse kurz aus dem Büro verschwinden, sie solle ihn entschuldigen.
»Wenn du jemals betest, dann tu es jetzt«, bat er sie.
»Worum geht es denn, Danny? Erzähl’s mir.«
»Jetzt nicht, ich habe keine Zeit. Sag, ich hätte einen Anruf bekommen … von den Nonnen drüben. Oder laß dir irgendwas anderes einfallen.«
»Ich halte es nicht aus, hier herumzusitzen, ohne zu wissen, was los ist.«
»Ich habe eine Idee, wie Barney sein Haus verkaufen kann.«
»Warum hast du das nicht in der Konferenz gesagt?«
»Ich sage es ihm persönlich. Und auf diese Weise werden wir unsere Anzahlung zusammenbringen. Wenn ich den Bossen davon erzähle, bekommen wir nur einen feuchten Händedruck.«
»O Gott, Danny. Sei vorsichtig, sonst schmeißen sie dich raus.«
»Wenn alles klappt, dann kommt es darauf auch nicht mehr an«, erwiderte er. Und weg war er.
Rosemary trat zu Ria an den Schreibtisch. »Komm mit auf die Damentoilette. Ich habe dir etwas zu erzählen.«
»Ich kann nicht, ich warte auf einen Anruf.« Tatsächlich wollte Ria auf ihrem Posten bleiben, falls Danny anrief oder ihre Hilfe brauchte.
»Das kann doch Orla für dich übernehmen. Komm schon, es ist wichtig«, beharrte Rosemary.
»Nein, erzähl’s mir jetzt gleich, es ist gerade niemand in der Nähe.«
»Das ist aber alles noch streng geheim.«
»Dann sag es mir ganz leise.«
»Ich kündige, ich habe eine neue Stelle.« Rosemary trat einen Schritt zurück, um zu sehen, wie Ria die Nachricht aufnahm. Doch wider Erwarten wirkte sie weder entsetzt noch erstaunt. Es kam praktisch überhaupt keine Reaktion. Vielleicht, dachte Rosemary, hatte sie sich nicht klar genug ausgedrückt.
Also wiederholte sie das Ganze. Gerade eben habe sie die Zusage bekommen. Es sei ja alles so schrecklich aufregend. Heute abend wolle sie es hier in der Firma bekanntgeben. Man hatte ihr eine bessere Stelle in einer Druckerei angeboten, übrigens gar nicht weit von hier, sie könnten also weiterhin zusammen zu Mittag essen. Aber Ria hörte ihr nur mit halbem Ohr zu.
Verständlicherweise war Rosemary gekränkt. »Mensch, du hörst ja gar nicht, was ich sage«, empörte sie sich.
»Entschuldige, Rosemary, tut mir wirklich leid. Es ist nur, weil mir gerade ganz andere Sachen durch den Kopf gehen.«
»Herrgott, Ria, was bist du bloß für eine trübe Tasse! Bei dir heißt es immer nur: Danny hier, Danny da. Als wärst du seine Mutter. Ist dir eigentlich aufgefallen, daß du dich in letzter Zeit für gar nichts anderes mehr interessierst?«
Ria machte ein betroffenes Gesicht. »Weißt du, ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Bitte verzeih mir. Erzähl es mir noch mal.«
»Nein, das kann ich mir sparen. Dir ist es doch egal, ob ich weggehe oder bleibe. Du hörst mir ja nicht mal jetzt zu! Ständig schielst du zur Tür und wartest darauf, daß er zurückkommt. Apropos, wo ist er eigentlich?«
»Bei den Nonnen, sie haben angerufen.«
»Das stimmt nicht, ich habe nämlich vor einer Stunde mit ihnen gesprochen. Das Ganze liegt erst mal auf Eis, bis sie das Plazet aus Rom haben, von ihrer Mutter Oberin oder wie die heißt.«
»Das erkläre ich dir alles später. Bitte erzähl mir jetzt von deiner neuen Stelle, bitte!«
»Meine Güte, Ria, nicht so laut!« zischte Rosemary. »Die anderen wissen noch nichts davon, und du posaunst es schon aus. Ich glaube, du stehst heute wirklich ein bißchen neben dir.«
Da sah Ria ihn hereinkommen, flotten, beschwingten Schrittes, so wie sie ihn kannte. Und aus seiner Miene konnte sie lesen, daß es geklappt hatte. Als er hinter seinem Schreibtisch Platz nahm, streckte er den Daumen nach oben. Sofort wählte sie seinen Anschluß.
»Erzähl bloß niemandem, daß du bei den Nonnen warst. Offenbar geht bei diesem Geschäft momentan nichts voran«, flüsterte sie.
»Danke, du bist große Klasse.«
»Was machen wir jetzt, Danny?«
»Wir verhalten uns eine Woche lang mucksmäuschenstill. Dann geht es volle Kraft voraus.«
Ria legte auf. Der Tag schien ihr endlos lang, die Zeiger der Wanduhr krochen mit nervtötender Langsamkeit voran. Rosemary kam herein, gab ihre Kündigung bekannt und ging wieder. Alles geschah wie in Zeitlupe. Am anderen Ende des Raums saß Danny, und wie er seine Gespräche führte, mit Leuten plauderte, lachte und telefonierte, wirkte er ganz normal. Einzig Ria, die ihn besser kannte als jeder andere, wußte, wie es wirklich in ihm aussah.
Nach Dienstschluß gingen sie in den Pub gegenüber, und ohne Ria nach ihren Wünschen zu fragen, brachte Danny ihnen zwei große Brandys.
»Ich habe Barney empfohlen, ein schalldichtes Tonstudio dort einzubauen, mit Dämmstoff an den Wänden und so. Das kommt für ihn noch mal auf zwanzigtausend.«
»Warum um alles in der Welt …«
»Dann kann er das Haus an einen Popstar verkaufen. Die suchen doch immer so etwas, am besten noch mit einem Hubschrauberlandeplatz.«
»Und darauf ist er eingestiegen?« fragte Ria zweifelnd.
»Er hat mich sogar gefragt, warum ihm das diese ach so tollen Makler, für die ich arbeite, nicht längst vorgeschlagen haben.«
»Und was hast du geantwortet?«
»Daß sie es wohl für die etwas unausgegorene Idee eines jungen Mannes halten würden, weil sie eher konservativ denken. Und, Ria, jetzt kommt’s: Ich habe ihm geradewegs in die Augen gesehen und gesagt: ›Noch was, Mr. McCarthy. Ich dachte mir, wenn ich mit meinem Vorschlag gleich zu Ihnen komme, dann könnte ich doch auch das Haus für Sie verkaufen?‹« Danny nippte an seinem Brandy. »Er fragte mich, ob ich etwa versuchen wolle, meinen Arbeitgebern seine Aufträge wegzuschnappen. Ja, habe ich gesagt, und da meinte er, er würde mir eine Woche Zeit geben.«
»O Gott, Danny.«
»Ria, ist das nicht wunderbar? Natürlich können wir das nicht vom Büro aus machen. Deshalb werde ich eine Grippe vorschützen, sobald ich sämtliche notwendigen Adressen und Unterlagen nach Hause geschafft habe. Ich habe bereits eine Liste angefangen, und dann werde ich mich ans Telefon setzen. Möglicherweise mußt du für mich vom Büro aus ein paar Faxe verschicken.«
»Sie werden uns die Hölle heiß machen!«
»Aber nein, Ria, sei doch nicht albern. So läuft das nun mal im Geschäftsleben.«
»Wieviel werden …?«
»Wenn ich Barneys olles Haus bis nächste Woche verscherbelt habe, bekommen wir die Anzahlung für die Tara Road und sogar noch mehr. Dann können wir zur Bank gehen, mein Zuckerpüppchen. Dann haben wir eine ganz andere Position.«
»Aber sie werden dich rauswerfen, du wirst bald keine Arbeit mehr haben.«
»Wenn ich einen großen Fisch wie Barney McCarthy an der Angel habe, nimmt mich jedes Maklerbüro in Irland mit Handkuß. Wir brauchen nur eine Woche lang Nerven wie Drahtseile, Ria, dann haben wir es geschafft.«
»Nerven wie Drahtseile«, wiederholte Ria und nickte.
»Und diesen Tag mußt du in Erinnerung behalten, mein Schatz. Der fünfundzwanzigste März 1983, der Tag, der für uns den Durchbruch bedeutete.«
»Ist Danny denn wenigstens bei meinem Abschiedsumtrunk wieder da?« fragte Rosemary Ria.
»Ja, ich denke, bis dahin ist seine Grippe bestimmt abgeklungen«, antwortete Ria laut.
»Entschuldige, das ist mir so rausgerutscht. Wie geht es ihm denn?«
»Schon wieder ganz gut, er ruft mich abends an.« Allerdings erwähnte Ria nicht, wie oft er auch tagsüber anrief und Informationen haben wollte.
»Und hat er gefunden, wonach er sucht?« erkundigte sich Rosemary.
Kurz überlegte Ria, dann erwiderte sie: »Er klingt recht zuversichtlich. Ich glaube, er wird wohl bald fündig werden.«
Eine Stunde zuvor hatte Danny angerufen, um ihr mitzuteilen, daß Barneys Leute bereits seinen ehemaligen Weinkeller schallisoliert hatten und heute die Studiogeräte eingebaut würden. Morgen wollte der Manager einer berühmten Popgruppe herfliegen und das Haus besichtigen, und Danny würde ihn begleiten. Die Dinge entwickelten sich prächtig.
Es klappte tatsächlich.
Barney McCarthy erhielt den von ihm geforderten Kaufpreis, Danny bekam seine Provision, und Sean O’Brien kassierte seine sechzigtausend Pfund. Als alles unter Dach und Fach war, unterrichtete Danny die Firmenleitung davon, was er hinter ihrem Rücken getan hatte, und erklärte, er würde die Firma verlassen, sofern es gewünscht werde. Wider Erwarten baten ihn seine Vorgesetzten, zu bleiben und Barneys Aufträge in die Firma einzubringen. Doch Danny lehnte ab mit der Begründung, das würde nur Probleme schaffen, denn man würde ihn ständig im Auge behalten, und das wäre ihm unangenehm.
Man trennte sich in bestem Einvernehmen – wie Danny Lynch es von jeher gewohnt war.
Aufgeregt wie Kinder wanderten sie durchs Haus und schmiedeten Pläne.
»Aus diesem vorderen Zimmer könnte man etwas ganz Besonderes machen«, überlegte Danny. Nachdem nun die Kisten und Behälter, in denen der alte Sean O’Brien und seine Freunde ihre Geheimnisse aufbewahrt hatten, entfernt worden waren, entfaltete der Raum seine ganze Pracht. Erst jetzt sah man die perfekten Proportionen: eine hohe Decke, riesige Fenster und ein großer offener Kamin.
Dabei störte es nicht im geringsten, daß eine nackte Glühbirne an einem alten, verknoteten Kabel von der Decke hing und einige zerbrochene Fensterscheiben mit billigem Glas ausgebessert worden waren.
Die fleckige, abgebröckelte Einfassung des Kamins konnte man erneuern, damit er wieder so wie früher aussah, als das Haus ein Herrschaftssitz gewesen war.
»Hier legen wir einen wunderbaren, weichen indischen Wollteppich hin«, meinte Danny. »Und schau, dort neben dem Kamin, weißt du, was da hinkommt? Eine dieser großen japanischen Imari-Vasen, die sind wie geschaffen für so einen Raum.«
Ria sah ihn voller Bewunderung an.
»Woher weißt du das alles nur, Danny? Man könnte meinen, du hättest Kunstgeschichte studiert.«