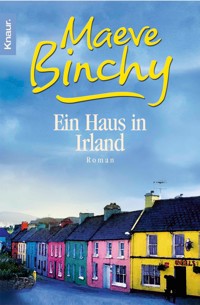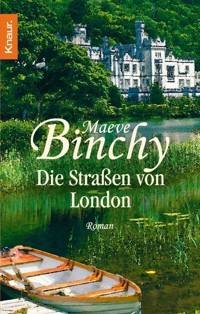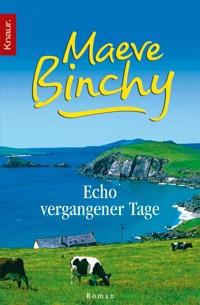
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Irland in den fünfziger Jahren: Drei Kinder aus völlig unterschiedlichen Familien wachsen in dem kleinen Küstenort Castlebay auf. Clare träumt nur davon, durch Lernen dem engen Städtchen zu entfliehen. David will ein berühmter Arzt und Spezialist werden. Und Gerry will einfach nur Erfolg und Ruhm. Im Laufe der Jahre müssen alle drei erkennen, daß sich nicht alle Träume aus Kindertagen erfüllen, doch das Echo ihrer Vergangenheit wird für sie stets allgegenwärtig sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 990
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Maeve Binchy
Echo vergangener Tage
Roman
Aus dem Englischen von Christa Prummer-Lehmair, Barbara Reitz und Gerlinde Schermer-Rauwolf, Kollektiv Druck-Reif
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Irland in den fünfziger Jahren: Drei Kinder aus völlig unterschiedlichen Familien wachsen in dem kleinen Küstenort Castlebay auf. Clare träumt nur davon, durch Lernen dem engen Städtchen zu entfliehen. David will ein berühmter Arzt und Spezialist werden. Und Gerry will einfach nur Erfolg und Ruhm.
Im Laufe der Jahre müssen alle drei erkennen, dass sich nicht alle Träume aus Kindertagen erfüllen, doch das Echo ihrer Vergangenheit wird für sie stets allgegenwärtig sein.
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Teil 1
Sie nannten die Echohöhle [...]
David Power hatte großen...
Teil 2
Clare haßte es, das [...]
Mary Catherine nahm...
Teil 3
Davids Eltern fuhren ihn [...]
»Erzählen Sie mir...
Teil 4
Jeder hatte eine andere [...]
Carolines Vater sagte...
Meinem geliebten Gordon
Prolog
Man mußte es ihnen nicht sagen, die Menschen schienen zu spüren, daß etwas passiert war. Sie kamen aus ihren Häusern und gingen die Hauptstraße hinunter. Das Murmeln wurde lauter, und ohne genau zu wissen, was sie taten, blickten sie sich nach ihren Familienmitgliedern um. Da war die Gestalt eines Menschen, der, das Gesicht nach unten, im Wasser lag. Man konnte nicht genau erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau war.
»Vielleicht ist es ja ein Matrose von einem Schiff«, hieß es. Aber eigentlich war jedem klar, daß es kein Matrose war, der über Bord gegangen war. Kein angenehm anonymer Tod von jemandem, den man nicht kannte. Es war nicht damit abgetan, daß man die Behörden informierte und ein paar Gebete für die Seele des unbekannten Matrosen sprach. Diesmal war es jemand aus Castlebay.
Sie standen schweigend in Grüppchen oben auf den Klippen und sahen zu, wie die ersten zum Strand hinuntergingen: der Junge, der das schreckliche Strandgut, das die Wellen ans Ufer gespült hatten, zuerst erspäht hatte; dann noch andere Männer, Menschen aus den Geschäften in der Nähe und junge Burschen, die rasch den Weg zum Strand hinunterlaufen konnten. Jetzt eilte auf dem anderen Weg, vom Haus des Arztes her, jemand herunter und kniete neben dem reglosen Körper nieder, für den Fall, daß irgend etwas aus der schwarzen Tasche ihn wieder zum Leben erwecken könnte.
Als Father O'Dwyer mit wehender Soutane eintraf, war das Gemurmel einem monotonen Gesang gewichen – die Menschen aus Castlebay beteten einen Rosenkranz, erflehten Frieden für die Seele, welche dem Körper, der mit dem Gesicht nach unten an ihrem Strand lag, entflogen war.
Teil 1
1950–1952
Sie nannten die Echohöhle auch »Brigid's Cave«, und wenn man seine Frage laut genug in die richtige Richtung schrie, erhielt man anstatt eines Echos eine Antwort. Im Sommer drängelten sich dort Mädchen, die ihre Fragen hineinriefen. Mädchen, die ihre Ferien in Castlebay verbrachten und wissen wollten ob sie einen Jungen abkriegen würden oder ob Gerry Doyle dieses Jahr wohl Augen für sie haben würde. Clare fand es verrückt, daß sie der Höhle ihre Geheimnisse anvertrauten. Ganz besonders, da Leute wie ihre Schwester Chrissie und deren Clique oft zur Höhle gingen und nur darauf lauerten, daß jemand intime Fragen stellte. Dann wollten sie sich vor Lachen ausschütten und erzählten es überall herum. Niemals, sagte Clare, auch wenn sie noch so verzweifelt wäre, würde sie dem Echo eine Frage stellen. Weil es dann kein Geheimnis mehr wäre. Aber dann ging sie doch dorthin, denn sie wollte erfahren, wie der Geschichtswettbewerb ausgehen würde. Aber das war etwas anderes.
Es war etwas anderes, weil es Winter war und im Winter kaum Urlauber nach Castlebay kamen. Und es war auch deshalb etwas anderes weil es nicht um Liebe ging. Außerdem war es angenehm, von der Schule über die Cliff Road nach Hause zu gehen; man mußte sich nicht mit jedem, der einem unterwegs begegnete, unterhalten, sondern konnte das Meer betrachten. Und wenn sie schon diesen gewundenen Weg, auf dem all die Warnschilder standen, wählte, dann konnte sie ebensogut in der Höhle rasch ihre Frage stellen und am Strand entlang und über den befestigten Treppenweg wieder zurückgehen. Sie wäre in der gleichen Zeit zu Hause, wie wenn sie auf der Straße ging, wo sie sich mit allen möglichen Leuten unterhalten müßte. Da im Winter in den Geschäften nicht viel los war, wurde man oft hereingewunken und bekam einen Keks oder wurde gebeten, einen Botengang zu machen. Wenn sie also den Weg über Brigid's Cave und den Strand nehmen würde, wäre sie genauso schnell zu Hause.
Es hatte nicht geregnet, deshalb waren die gefährlichen Stellen nicht ganz so gefährlich. Clare glitt ohne Mühe die Klippen hinab zum Strand. Der Sand war fest und hart, die Flut war noch nicht lange zurückgegangen. Der Eingang zur Höhle sah pechschwarz und ein wenig furchterregend aus. Doch sie straffte die Schultern; im Sommer war es dort nicht anders, und trotzdem gingen die Leute in Scharen hinein. Sie schob ihre Schultasche auf den Rücken, damit sie beide Hände frei hatte, um sich hineinzutasten. Wenn man sich erst einmal an das Licht dort gewöhnt hatte, war der schmale Grat, auf dem man stehen mußte, leicht auszumachen.
Clare holte tief Luft: »Wer gewinnt den Geschichtswettbewerb?« schrie sie.
»Erb erb erb erb«, rief das Echo.
»Wenn du ›Clare‹ als Antwort haben willst, mußt du die Frage anders stellen«, hörte sie eine Stimme direkt neben sich sagen. Clare zuckte vor Schreck zusammen. Es war David Power.
»Das macht man nicht, jemanden belauschen. Es ist so, als würde man bei der Beichte zuhören«, sagte Clare verärgert.
»Ich dachte, du hättest mich gesehen«, meinte David bloß. »Ich habe mich nicht versteckt.«
»Wie hätte ich dich sehen können? Ich bin doch aus dem Licht ins Dunkle gekommen, und du hast hier drin gelauert.« Sie war außer sich vor Wut.
»Das hier ist keine Privathöhle. Man muß nicht die ganze Zeit laut ›Höhle besetzt‹ rufen«, gab David laut zurück.
»Etzt etzt etzt etzt«, hallte es zurück.
Die beiden lachten.
David Power war wirklich ein netter Junge, er war genauso alt wie ihr Bruder Ned – fünfzehn. Sie erinnerte sich daran, wie Ned jemandem voller Stolz erzählt hatte, sie seien zusammen in die Grundschule gegangen – um wenigstens etwas mit dem Sohn des Arztes gemein zu haben.
Wenn David vom Internat nach Hause kam, trug er Anzug und Krawatte, und zwar jeden Tag, nicht nur am Sonntag zur Messe. Er war groß und hatte Sommersprossen auf der Nase. Sein Haar war ein wenig struppig, es stand lustig nach allen Seiten ab, und ein Großteil fiel ihm in die Stirn. Er hatte ein hübsches Lächeln und erweckte immer den Eindruck, als würde er liebend gerne plaudern, müßte aber gerade etwas Dringendes erledigen. Gelegentlich trug er eine Klubjacke mit einem Abzeichen, und darin sah er wirklich phantastisch aus. Aber er rümpfte nur die Nase und erklärte, das sehe bloß dann gut aus, wenn man nicht jeden Tag in der Schule hundertachtzig solcher Blazer vor Augen habe. Seit über einem Jahr war er jetzt schon auf dem Internat, das zur Zeit wegen Scharlach geschlossen war. Außer ihm besuchten nur noch die Dillon-Mädchen aus dem Hotel ein Internat – und natürlich die Wests und die Greens, aber die waren Protestanten und mußten, weil sie keine eigene Schule hatten.
»Ich habe nicht erwartet, daß das Echo mir wirklich antworten wird. Ich hab es nur zum Spaß versucht«, sagte Clare.
»Ich weiß. Ich habe es auch schon mal zum Spaß versucht«, gestand David.
»Was hast du es denn zum Spaß gefragt?« wollte sie wissen.
»Weiß ich nicht mehr«, antwortete er.
»Das ist nicht fair! Schließlich hast du meine Frage auch gehört!«
»Nein, das habe ich nicht, ich habe nur ›erb erb erb‹ gehört.« Er rief die drei Worte ganz laut, und das Echo antwortete wieder und wieder.
Clare war zufrieden. »Ich glaube, ich gehe jetzt besser, ich muß noch Hausaufgaben machen. Du hattest bestimmt seit Wochen keine Hausaufgaben mehr auf«, meinte sie neidisch und neugierig.
»Doch. Miss O'Hara gibt mir jeden Tag Unterricht. Sie kommt um … oh, schon bald.« Sie gingen hinaus auf den nassen, harten Sand.
»Miss O'Hara gibt dir Privatunterricht? Das muß herrlich sein.«
»Ja, sie kann Dinge wirklich wundervoll erklären – ich meine, dafür, daß sie eine Frau ist.«
»Na ja, wir haben hier nur Lehrerinnen und Nonnen«, erklärte ihm Clare.
»Das hatte ich vergessen«, meinte David mitfühlend. »Trotzdem, sie ist wirklich großartig, und man kann sich gut mit ihr unterhalten, wie mit einem richtigen Menschen.«
Clare gab ihm recht. Sie gingen einträchtig weiter zu dem Treppenweg, der vom Strand nach oben führte. David wäre auf dem Weg mit den Warnschildern, der fast bis in seinen Garten führte, schneller zu Hause gewesen; aber er meinte, er wolle ohnehin noch im Laden der O'Briens Bonbons kaufen. Sie unterhielten sich über Dinge, von denen der andere noch nie etwas gehört hatte. David berichtete, daß man die Sanitätsstation des Internats nach den beiden Scharlachfällen ausgeräuchert hatte; und Clare nahm an, daß er damit das Sanatorium auf dem Hügel meinte, in das man die Leute brachte, die an Tuberkulose erkrankt waren. Sie wußte nicht, daß es um eine Station in seiner Schule ging. Clare wiederum erzählte David eine lange und verwickelte Geschichte darüber, wie Mutter Immaculata eines der Mädchen gebeten hatte, die Schulhefte an einen bestimmten Ort zu bringen. Das Mädchen hatte sie nicht richtig verstanden und war so aus Versehen in den Teil des Klosters gelangt, der den Nonnen vorbehalten war. David hatte keinen Begriff davon, was das bedeutete – weil er nämlich nicht wußte, daß es allerstrengstens verboten war, diesen Teil des Klosters zu betreten. Aber es kümmerte die beiden nicht weiter, sie gingen einander wenigstens nicht auf die Nerven – und das Leben in Castlebay konnte einem gehörig auf die Nerven gehen. Ihre Unterhaltung war eine nette Abwechslung. David ging in den Laden, und da gerade niemand bediente, zog Clare ihren Mantel aus, hängte ihn auf und suchte das Glas mit den Nelkenbonbons. Sie zählte die sechs Stück für einen Penny, die er kaufen wollte, ab, bot ihm höflich eines an und nahm sich dann selbst eines.
Er sah sie neiderfüllt an. Es mußte ein tolles Gefühl sein, in einem Süßwarenladen auf einen Stuhl klettern zu können, ein Bonbonglas herunterzuholen und, wenn man wollte, dem Kunden eines von den Bonbons anzubieten. David seufzte, als er nach Hause ging. Wie gerne hätte er wie Clare O'Brien einen Laden und Geschwister gehabt. Dann hätte er zur Melkzeit mit einer Kanne zum Milchholen gehen oder Algen sammeln dürfen, um sie dann gebündelt für warme Algenbäder zu verkaufen. Es war ziemlich langweilig, jetzt zu seiner Mutter nach Hause zu gehen, die nur wieder »Ach, David!« seufzen würde. Es war das Aufreizendste, was er je gehört hatte. Und besonders aufreizend daran war, daß es sich anscheinend auf alles und jedes beziehen konnte, doch nie zweimal auf dasselbe. Nun, jedenfalls würde Miss O'Hara diesen Abend kommen, und ihr Unterricht war wesentlich interessanter als der in der Schule, was er dummerweise einmal seiner Mutter gegenüber erwähnt hatte. Er dachte, sie würde sich freuen, aber sie sagte, Miss O'Hara sei für eine Grundschule auf dem Land ganz passabel, doch man könne sie keineswegs mit den Jesuiten vergleichen, die auf einem völlig anderen Niveau wären.
Auch Clare seufzte. Sie dachte daran, wie herrlich es sein mußte, nach Hause zu gehen, wenn man ein Zuhause hatte wie David Power. Dort gab es ganze Regale voller Bücher, und in jenem Raum im vorderen Teil des Hauses brannte ständig ein Feuer, auch wenn niemand darin war. Es lief kein Radio, und niemand machte Lärm. Man konnte stundenlang Hausaufgaben machen und wurde nicht gestört oder aus dem Zimmer vertrieben. Clare konnte sich gut daran erinnern, wie das Haus innen aussah, weil Dr. Power dort einmal ihr Bein genäht hatte, das sie sich an einem rostigen Maschinenteil aufgerissen hatte. Um sie abzulenken, hatte er ihr aufgetragen, die Bände der Enzyklopädie auf dem Regal zu zählen. Clare war völlig verblüfft darüber gewesen, daß eine einzige Familie so viele Bücher besaß, und vergaß ganz, daß sie genäht wurde. Dr. Power hatte ihrer Mutter nachher erzählte, sie sei mutig wie ein Löwe gewesen. Auf dem Heimweg wurde Clare von ihrer Mutter gestützt. Sie machten an der Kirche halt, um der heiligen Anna dafür zu danken, daß sich die Wunde am Bein nicht infiziert hatte. Während ihre Mutter vor der Grotte der heiligen Anna niederkniete, um ein Dankgebet zu sprechen, hatte Clare sich ausgemalt, wie himmlisch es wäre, in so einem großen, ruhigen Haus voller Bücher zu wohnen, anstatt sich gegenseitig auf die Füße zu treten und für nichts Platz zu haben – und auch keine Zeit. Daran mußte sie an jenem Abend wieder denken, als David Power die Straße hinauf nach Hause ging, zu jenem Haus, in dem die Teppiche so groß waren, daß sie den ganzen Raum und nicht nur die Mitte des Zimmers einnahmen. Jemand hätte Feuer gemacht, und es wäre ruhig und friedlich. Seine Mutter wäre vielleicht in der Küche und Dr. Power in der Praxis. Später käme Miss O'Hara und würde David Privatstunden geben, und es wären keine anderen Schüler da, um sie abzulenken. Was konnte es Besseres geben? Einen Augenblick lang wünschte sie, sie wäre seine Schwester, aber dann fühlte sie sich plötzlich schuldig. Das würde ja bedeuten, daß sie ohne Mammy und Daddy, Tommy, Ned, Ben und Jimmy sein wollte. Oh, und ohne Chrissie. Aber auch wenn es nicht recht von ihr war – Chrissie würde sie keinen Tag der Woche vermissen!
Die Ruhe im Laden war nur von kurzer Dauer. Daddy hatte an der Rückseite des Hauses die Fassade getüncht, und nun kam er mit ausgestreckten Händen herein und sagte, jemand solle ihm die Flasche mit Terpentinersatz geben und sie öffnen, und zwar auf der Stelle. Im Winter wurde in Castlebay furchtbar viel gestrichen, weil die Seeluft die Farbschichten immer wieder abblättern ließ und alles sehr schäbig aussah, wenn es nicht regelmäßig gerichtet wurde. Mammy kam im gleichen Augenblick herein; sie war auf dem Postamt gewesen und hatte etwas Schreckliches entdeckt: Chrissie und ihre zwei nichtsnutzigen Freundinnen waren auf das Dach von Miss O'Flahertys Geschäft geklettert und hatten mit einem langen Stück nasser Algen herumgewedelt, um Miss O'Flaherty zu erschrecken. Die arme Frau hätte einen Herzanfall bekommen können; sie hätte, Gott behüte uns, in ihrem eigenen Laden mausetot umfallen können, und dann hätten Chrissie und ihre beiden feinen Freundinnen bis zum Jüngsten Tag und in alle Ewigkeit die Sünde des Tötens auf ihre Seelen geladen! Sie hatte Chrissie an der Schulter, am Zopf und am Ohr gepackt und sie nach Hause gezerrt. Chrissies Gesicht war vor Ärger rot angelaufen. Clare fand es gut, daß sie Miss O'Flaherty erschreckt hatten, denn das war eine gräßliche Person, die Hefte und Schulsachen verkaufte, obwohl sie Schulkinder haßte. Sie fand, es war wirklich großes Pech, daß Mammy gerade in diesem Augenblick vorbeigekommen war. Ihr teilnahmsvolles Lächeln wurde von Chrissie nicht sehr wohlwollend aufgenommen.
»Hör auf, so überlegen zu gucken«, rief Chrissie. »Seht nur, wie schadenfroh Clare ist. Unser Tugendlämmchen, die dumme, langweilige Clare.«
Dafür bekam sie einen Klaps auf den Kopf, was sie bloß noch mehr erzürnte.
»Seht doch nur, wie sie sich freut« machte Chrissie weiter, »sie freut sich darüber, wenn jemand Ärger kriegt. Das ist das einzige, worüber sie sich überhaupt freuen kann – wenn jemand anderer heruntergeputzt wird.«
»Du bekommst heute kein Abendessen, Chrissie O'Brien. Und das ist noch nicht alles. Du gehst sofort auf dein Zimmer, hörst du. Auf der Stelle.« Agnes O'Briens dünne Stimme klang wie ein ärgerliches Pfeifen, als sie gleichzeitig die aufsässige Chrissie in ihr Zimmer verbannte, mit einem in Terpentinersatz getränkten Lappen die meiste Farbe von den Händen ihres Mannes abwischte und es auch noch schaffte, auf Clares Mantel, der am Haken hing, zu deuten.
»Ich bin doch nicht euer Dienstmädchen!« sagte sie. »Nimm deinen Mantel und häng ihn dort auf, wo er hingehört.«
Das war sehr ungerecht und versetzte Clare einen Stich. »Wir hängen unsere Mäntel immer dort auf. Dort gehört er hin.«
»Hast du das gehört?« Agnes sah ihren Mann hilfesuchend an, wartete aber seine Antwort nicht ab, sondern ging zur Treppe. Jetzt war Chrissie wieder an der Reihe.
»Kannst du nicht aufhören, deine Mutter zu quälen, und endlich deinen Mantel wegräumen?« fragte er Clare. »Ist es wirklich zuviel verlangt, wenn man mal seine Ruhe haben will?«
Clare nahm ihren Mantel vom Haken. Sie konnte nicht nach oben in ihr Zimmer gehen, das sie mit Chrissie teilte, denn dann wäre sie mitten in ein Schlachtfeld geraten. Also blieb sie im Laden, obwohl sie dort nichts zu tun hatte.
Vater sah müde aus. Es war so gemein von ihm zu behaupten, sie quäle Mammy, denn es stimmte nicht, aber das konnte man ihm nicht begreiflich machen. Seine Haltung war gebeugt, als hätte er einen Buckel, und er sah sehr alt aus, eher wie ein Großvater als ein Vater. Alles an ihm war grau, sein Haar, sein Gesicht und sogar seine Strickjacke, nur seine Hände waren weiß von der Farbe. Clare fand, daß sich seine gebückte Haltung seit ihrer Erstkommunion vor drei Jahren noch verstärkt hatte; damals war er ihr sehr groß erschienen. Und jetzt war auch sein Gesicht voller Haare – aus der Nase und den Ohren wuchsen Haarbüschel. Immer wirkte er irgendwie besorgt, so als ob er nicht genügend Zeit oder Platz oder Geld hätte, was normalerweise auch der Fall war. Der Haushalt der O'Briens lebte von den Einnahmen der Sommersaison, die kurz und außerdem unberechenbar war. Eine verregnete Saison, ein beliebter neuer Ferienort oder überhöhte Mieten für die Häuser an der Cliff Road konnten sie völlig zunichte machen. Und von den Einnahmen in den Wintermonaten konnte man nicht leben, sie reichten gerade, um sich über Wasser zu halten.
Wenn man den Laden betrat, machte er einen verwinkelten Eindruck. Es wäre vorteilhafter gewesen, in die Ecken und Winkel Regale zu stellen oder sie abzuteilen, aber bisher war niemand dazu gekommen. Die Decke war sehr niedrig, und daher wirkte der Raum bereits überfüllt, wenn sich nur drei Kunden darin befanden. In den Regalen war kein System erkennbar, und nur die O'Briens wußten, wo jeder einzelne Artikel stand. Weil sie befürchteten, sie würden sonst nichts mehr finden, änderten sie nichts an dieser Anordnung. Dabei hätte man die Waren in dem kleinen Lebensmittel- und Süßwarenladen viel übersichtlicher ordnen können. Alles wirkte sehr beengt und unpraktisch. Die Kunden konnten nicht durch die Tür in die Wohnräume sehen, aber dort war es keinen Deut anders. In der Küche stand ein Herd mit einer Wäscheleine darüber, der Eßtisch nahm den größten Teil des Raumes ein. Die kleine Spüle im hinteren Teil des Raumes war so winzig und dunkel, daß man das Geschirr, das man spülte, kaum erkennen konnte. Es gab nur eine Lampe in der Mitte des Raumes, deren gelber Schirm einen Sprung hatte. In letzter Zeit hielt Tom O'Brien seine Zeitung zum Lesen näher an die Lampe hin.
Agnes kam die Treppe herunter. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hatte sie soeben eine unangenehme Pflicht zu ihrer Zufriedenheit erledigt. »Das Mädchen wird noch am Galgen enden«, stellte sie fest.
Sie war eine kleine, dünne Frau, die früher viel gelächelt hatte; jetzt aber schien der kalte Wind in Castlebay tiefe Falten in ihr Gesicht eingegraben zu haben, und selbst wenn sie im Haus war, erweckten die zusammengekniffenen Augen und der strenge Mund den Eindruck, als verzöge sie im eisigen Wind das Gesicht. Im Geschäft trug sie einen gelben Kittel, angeblich zum Schutz ihrer Kleidung – aber eigentlich besaß sie kaum etwas, das es zu schützen galt. Für den Kirchenbesuch hatte sie vier gute Kleider, und ansonsten trug sie schon seit Jahren dieselben alten Strickjacken, Kleider und Röcke. An ihrer Strickjacke steckten immer Abzeichen und Anstecker mit Heiligenbildern darauf. Man mußte sie vor dem Waschen abnehmen, aber einmal hatte sie es vergessen, und ein Anstecker mit einem Bild der Kleinen Theresia, der auf einer Unterlage aus rotem Satin befestigt war, war ganz rosarot geworden, und auch die blaßblaue Strickjacke hatte sich rosa verfärbt. Agnes O'Brien trug ihr Haar in einem Dutt: Dazu zog sie es durch ein weiches, rundes Etwas, das wie ein Schmalzkringel aussah, und steckte es anschließend ringsherum fest. Sie hatten ihr nie bei dieser Prozedur zugesehen, aber einmal hatten sie den Dutt allein liegen sehen, und Clare war darüber sehr erschrocken, weil sie nicht wußte, was es war.
Agnes O'Briens finsterer und sehr verärgerter Blick fiel auf Clare. »Hast du dich endlich entschlossen, auch zu dieser Familie zu gehören und zu tun, was man von dir verlangt? Könntest du also bitte diesen Mantel da wegräumen, bevor ich ihn in den Ofen stecke und verbrenne, oder ist das zuviel verlangt?«
Clare wußte, daß sie das niemals tun würde. Sie hatte gehofft, ihre Mutter hätte die Sache vergessen, während sie oben war. Aber der Mantel war immer noch ein Streitpunkt.
»Ich hab' es ihr gesagt, Agnes, wirklich, das habe ich, aber diese Kinder heutzutage …«, beteuerte Tom. Er klang niedergeschlagen und kleinlaut.
Clare stopfte ihren Schulmantel in einen überquellenden Schrank unter der Treppe und nahm ein paar Kartoffeln aus dem großen Sack, der auf dem Boden stand. Zu ihrer und Chrissies täglichen Pflichten gehörte es, die Kartoffeln für das Abendessen zu kochen, und da Chrissie in Ungnade gefallen war, war sie an diesem Abend offenbar allein dafür zuständig. Ihre beiden kleinen Brüder Ben und Jim saßen in der Küche und lasen einen Comic. Tommy und Ned, die beiden Älteren, würden bald von der Schule nach Hause kommen, aber keiner der Jungs würde ihr helfen. Jungen mußten nicht beim Kochen oder Abwaschen helfen, das wußte jeder.
Nach dem Abendessen hatte Clare viel zu tun. Sie wollte ihre gelben Haarbänder bügeln. Falls sie den Geschichtswettbewerb wirklich gewonnen hatte, wollte sie auf jeden Fall hübsch aussehen. Sie wollte ihre Hausschuhe säubern, die sie extra mit nach Hause genommen hatte, und noch einmal versuchen, die beiden Flecken von ihrem Schulkittel zu entfernen. Mutter Immaculata könnte vielleicht eine Bemerkung darüber machen, wie wichtig es für den guten Ruf der Schule war, daß die Schülerinnen ordentlich gekleidet waren. Sie durfte sie auf keinen Fall enttäuschen. Miss O'Hara hatte zu ihr gesagt, sie sei in all den Jahren als Lehrerin noch nie so zufrieden gewesen wie beim Lesen von Clares Aufsatz; es gebe ihr die Kraft weiterzumachen. Das genau waren ihre Worte gewesen. Sie hätte Clare doch wohl nicht auf dem Flur angehalten, um ihr das zu sagen, wenn sie nicht den Geschichtswettbewerb gewonnen hätte. Allein die Vorstellung, daß sie all die fünfzehn anderen geschlagen hatte! All diese Bernie Conways und Anna Murphys. Von nun an würden sie wohl für Clare etwas mehr Interesse aufbringen. Und auch zu Hause mußte man sie jetzt mit anderen Augen sehen. Nur allzu gerne hätte sie es ihnen noch an diesem Abend erzählt, aber sie beschloß, daß es besser war, noch zu warten. Heute abend gab es schon genug Aufregung, und außerdem würde Chrissie dann eine noch schlechtere Figur machen; schließlich war sie zweieinhalb Jahre älter als Clare. Chrissie würde sie umbringen, wenn sie an diesem Abend die Katze aus dem Sack ließe. Sie nahm ein dickes Käsesandwich, ein wenig gekochten Schinken und eine Tasse Kakao mit nach oben.
Chrissie saß auf dem Bett und betrachtete prüfend ihr Gesicht in einem Spiegel. Sie hatte ihr Haar zu zwei dicken Zöpfen geflochten; die Zopfenden waren buschig und hingen nicht wie bei anderen Leuten einfach so herunter, sondern wirkten, als wollten sie sich von ihren Fesseln befreien. Sie trug einen Pony, den sie selbst schnitt, aber das erledigte sie so schlecht, daß ein Friseur ihn ordentlich nachschneiden mußte. Über Nacht wickelte sie die Ponyfransen um Pfeifenreiniger, damit sie sich richtig kräuselten.
Sie war viel kräftiger als Clare und hatte schon einen Busen, der sich sogar unter ihrem Schulkittel deutlich abzeichnete.
Chrissie beschäftigte sich sehr stark mit ihrer Nase – Clare begriff nicht, weshalb, aber sie nahm sie ständig unter die Lupe. Sogar jetzt, trotz des ganzen Ärgers und ohne Abendessen und trotz der heillosen Aufregung darüber, was sie Miss O'Flaherty angetan hatte, beäugte sie ihre Nase auf der Suche nach reifen Pickeln. Auf ihrem runden Gesicht lag immer ein überraschter Ausdruck – doch wirkte sie nicht angenehm überrascht, nicht einmal dann, wenn ihr jemand unerwartet ein Abendessen brachte.
»Ich will nichts«, sagte sie.
»Dann laß es«, gab Clare nicht ohne Schärfe zurück.
Sie ging wieder nach unten und versuchte, ein Plätzchen zu finden, wo sie das Gedicht für morgen auswendig lernen konnte. Außerdem mußte sie noch vier Rechenaufgaben machen. Sie fragte sich oft, wie es nur möglich war, daß von sechs Personen, die in diesem Haus wohnten und zur Schule gingen, sie immer als einzige Hausaufgaben machen mußte!
Gerry Doyle kam herein, als sie gerade dabei war, ihre gelben Haarbänder zu bügeln.
»Wo ist Chrissie?« fragte er flüsternd.
»Sie ist oben. Hier war der Teufel los, weil sie Miss O'Flaherty mit einem Bündel Algen zu Tode erschreckt hat. Frag nicht nach ihr, die spielen alle verrückt, wenn du ihren Namen auch nur erwähnst.«
»Hör mal, könntest du ihr ausrichten …« Er hielt inne und besann sich anders. »Nein, du bist noch zu jung.«
»Ich bin nicht zu jung«, sagte Clare – es war unfair von ihm, so etwas zu sagen, und es verletzte sie. »Aber ob ich nun jung oder alt bin, es interessiert mich sowieso nicht. Ich werde deine schmachtenden Botschaften nicht an Chrissie weitergeben, denn sie wird böse sein, und Mammy wird mich windelweich prügeln. Es wäre mir also lieber, wenn du sie für dich behalten würdest.« Sie wandte sich wieder entschlossen ihren Haarbändern zu, die mittlerweile ganz glatt waren und glänzten. Morgen würden sie sich herrlich bauschen. Sie konnte sich nicht mit Chrissies Angelegenheiten belasten, weil das garantiert Schwierigkeiten geben würde. Nein, sie mußte sich hübsch ruhig verhalten und sich auf morgen vorbereiten, auf den überraschten Gesichtsausdruck von Mutter Immaculata und auf das Entsetzen in Bernie Conways und Anna Murphys Gesichtern.
Gerry Doyle lachte gutmütig. »Du hast ganz recht. Jeder soll seine Dreckarbeit selbst erledigen«, sagte er.
Der Ausdruck »Dreckarbeit« drang auf irgendeine Weise durch alle anderen Geräusche in der Küche zu Agnes O'Brien, die gerade den gesamten Inhalt des Unterschränkchens der Anrichte auf den Boden leerte. Tom hatte behauptet, sie hätte das Stück Kabel weggeworfen, das er dazu benutzen wollte, um außen an der Hintertür eine Lampe anzubringen. Sie war sich aber sicher, daß sie es irgendwo gesehen hatte, und wollte auf keinen Fall, daß dieses Vorhaben aufgeschoben wurde.
Tommy und Ned sahen wie jede Woche die Zeitung nach Stellenanzeigen durch und markierten mit einem Rotstiftstummel verschiedene Inserate; Ben und Jimmy spielten ein Spiel, das alle paar Minuten ruhig begann und dann zu einer Balgerei ausartete, bei der einer von beiden schließlich zu weinen anfing. Tom war damit beschäftigt, das Radio zu reparieren, das das ganze Treiben mit seinem Knistern begleitete.
»Was für eine Dreckarbeit?« rief Agnes. Dieser Gerry Doyle war ein großartiger Bursche, aber man mußte wie ein Luchs aufpassen. Bei jedem Unfug, der im Gange war, hatte er bestimmt seine Finger im Spiel!
»Ich habe gerade zu Clare gesagt, daß ich kein Talent für Hausarbeit habe oder überhaupt für Arbeiten, bei denen man aufpassen muß. Ich tauge nur zu Dreckarbeit.« Er lächelte zu ihr hinüber, und die Frau, die vor einem Haufen von Dosen, Schachteln, Papiertüten, Wolle, Röstgabeln und verrosteten Backblechen kniete, erwiderte sein Lächeln.
Clare sah ihn verwundert an. Wie leicht und flüssig ihm diese Lüge über die Lippen gekommen war! Und wegen nichts und wieder nichts!
Gerry war zu den Jungs hinübergegangen, die die Zeitung nach einem Job durchforsteten, und erzählte ihnen, daß seines Wissens jemand von einer großen Stellenvermittlung in England nach Castlebay kommen würde und im Hotel Vorstellungsgespräche führen wollte.
»Gilt das denn nicht nur für die besseren Jobs, für Leute mit einer Ausbildung?« fragte Ned. Er wollte nicht glauben, daß jemand nach Castlebay kommen würde, um sich ausgerechnet für jemanden wie ihn zu interessieren.
»Denk mal nach, Ned: Gibt es hier irgend jemanden, der eine Ausbildung hat? Du kannst dir bestimmt viel Lauferei und Portokosten ersparen, wenn du nicht auf all die Stellenanzeigen antwortest, sondern einfach wartest, bis der Mann hierherkommt und alles Nötige erklärt.«
»Du hast leicht reden.« Tommy, der Älteste, war bekümmert. »Du mußt nicht weggehen, um Arbeit zu finden. Du hast dein Geschäft.«
»Das hast du auch«, sagte Gerry und deutete auf den Laden.
Aber das war nicht das gleiche. Gerrys Vater hatte das Fotogeschäft am Ort; im Winter lebte er von den Tanzabenden und der einen oder anderen Veranstaltung, die dann stattfand. Im Sommer klapperte er dreimal am Tag den ganzen Strand ab und machte Familienfotos, und am Abend ging er zum Tanzsaal, wo sich gut Geschäfte machen ließen, denn die Nachfrage nach Schnappschüssen von den Liebespaaren war groß. Seine besten Kunden waren Mädchen – sie liebten es, ihre Ferienerinnerungen in Form von Fotos mit nach Hause zu nehmen, die sie im Büro herumzeigen und bei deren Betrachtung sie noch seufzen konnten, wenn der Tanz schon lange zurücklag. Gerrys Mutter und seine Schwester entwickelten die Aufnahmen und fertigten die Abzüge an, oder, wie es in der Familie hieß, sie »halfen mit«. Gerrys Vater erwartete, daß sein einziger Sohn aktiv mitarbeitete, und so war Gerry seit seiner Kindheit hinter ihm hergetrottet und hatte sich die Psychologie und Technik des Fotografierens angeeignet.
Du darfst die Leute nie verärgern, hatte sein Vater ihm beigebracht. Sei höflich zu ihnen und ruhig ein bißchen distanziert; solange sie noch ganz ungezwungen dastehen und unvorbereitet sind, drückst du zum ersten Mal auf den Auslöser, und wenn sie dann interessiert sind und sich richtig in Positur stellen, machst du das eigentliche Foto. Das erste Mal hast du nur so getan als ob, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Erinnere sie ganz dezent daran, daß sie die Fotos nicht kaufen müssen und daß die Probeabzüge am nächsten Tag zur Besichtigung fertig sind. Geh dann gleich weiter und verliere keine Zeit mit Plaudereien, wenn du das Foto erst einmal im Kasten hast. Lächle ihnen freundlich zu, aber nicht schmierig. Du darfst nie jemanden auffordern, sich in Pose zu stellen, und wenn Horden junger Mädchen sechs oder sieben Aufnahmen von sich haben wollen, mußt du daran denken, daß sie höchstens eine davon kaufen werden. In diesem Fall ist es besser, den Großteil der Aufnahmen nur vorzutäuschen.
Gerrys Schwester Fiona war eine Schönheit mit schwarzen Ringellocken; wenn sie nicht gerade zu Hause in der Dunkelkammer arbeitete, saß sie den Sommer über in der Holzhütte oben auf den Klippen und verkaufte die Schnappschüsse. Gerrys Vater war der Ansicht, daß es in einem so kleinen Ort wie Castlebay keinen Sinn habe, das Geschäft zu vergrößern und jemanden einzustellen. Wenn er es im kleinen Rahmen betreiben würde, nur als Familienbetrieb, dann würde Gerard Anthony Doyle eine gute Erbschaft machen.
Aber Gerry hatte nie den Eindruck eines Jungen erweckt, der eine gesicherte Zukunft vor sich hat. Er ging die Zeitung genauso eifrig nach Stellenanzeigen durch wie die O'Brien-Jungs, ganz so, als müßte er mit ihnen zusammen das Schiff nach England nehmen.
Es gab keine Garantie dafür, daß er hier seinen Lebensunterhalt würde verdienen können. Eine clevere Firma, die sich den Sommer über hier breitmacht, könnte schon genügen, um uns zu ruinieren, sagte sein Vater immer. Wer wußte, was die Zukunft bringen würde? Vielleicht wollten die Leute in Zukunft Farbfotos, oder vielleicht gab es irgendwann neuartige Kameras. Sein Vater sagte immer, sie lebten am Rand eines Abgrunds. Die O'Briens konnten sich zumindest darauf verlassen, daß die Leute immer Brot, Butter und Milch brauchen würden. Daran würde sich bis zum Jüngsten Tag nichts ändern, und solange Feriengäste hierherkamen, würden die O'Briens auch sicher bis zum Jüngsten Tag Eiscreme, Süßigkeiten und Orangen verkaufen, oder?
Gerry stellte alles immer aufregender dar, als es in Wirklichkeit war. So auch Tommys und Neds Zukunft: Sie würden in England arbeiten, und wenn sich die Engländer dann darüber Gedanken machten, wo und wie sie ihren Sommerurlaub verbringen sollten, würden Tommy und Ned nach Casdebay zurückkehren, ein bißchen im Laden mithelfen und nebenbei auch noch großartige Ferien verleben. Und beim Tanz wären sie begehrte Partner, weil sie durch ihre Erfahrungen in England in allen Dingen so bewandert wären. Tommy wandte ein, daß sie von den Ferien nicht viel hätten, wenn sie zu Hause im Geschäft schufteten, gerade in der harten Sommersaison, in der der Laden von acht Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet war. Aber Gerry lachte nur und meinte, das müßten sie in Kauf nehmen, denn es war ganz einfach die einzige Zeit im Jahr, in der es für alle genügend Arbeit gab. Außerhalb der Sommersaison traten sie sich im Geschäft gegenseitig auf die Füße, denn da war niemand, den sie hätten bedienen können; aber im Sommer sollte die ganze Familie zusammenhelfen, damit jeder ein wenig Schlaf abbekam und das Geschäft lief. Es war in allen Badeorten das gleiche.
Gerry klang sehr überzeugend. Tommy und Ned sahen eine rosige Zukunft vor sich: Eigentlich hatte Gerry ja recht! Warum sollten sie nicht einfach warten, bis der Mann hier ankam und ihnen seine Liste mit den freien Stellen zeigte, anstatt all die Anzeigen durchzusehen, aus denen sie letztendlich doch nicht schlau wurden?
Clare hatte das Bügeleisen hochkant neben den Herd gestellt; sie faltete die Decke und das Bügeltuch und fragte sich, wo sie beides verstauen sollte, da anscheinend der gesamte Inhalt der Anrichte auf dem Fußboden lag. Gerry Doyle hockte auf dem Tisch und ließ seine Beine baumeln, und plötzlich durchzuckte sie das Gefühl, daß er ihren Brüdern einen schlechten Rat gegeben hatte. Sie waren nicht so begabt und selbstsicher wie er; sie waren Menschen, die sich leicht von anderen beeinflussen ließen.
»Hat der Mann, der ins Hotel kommt, Stellen anzubieten, bei denen man vorwärtskommen kann, oder nur Jobs, bei denen man sehr hart arbeiten muß?«
Alle waren überrascht, daß sie etwas sagte. Ihr Vater hob seinen Kopf aus dem Gehäuse des Radios.
»Das ist doch das gleiche, Kind. Man kommt doch nur durch harte Arbeit vorwärts.«
»Ich meine, so etwas wie eine Ausbildung«, sagte Clare. »Erinnerst du dich noch an die Leute von diesem Orden, die einmal nach Castlebay kamen? Die Mädchen sollten in den Orden eintreten und Postulantinnen werden, um dann dort ihr Abschlußzeugnis und eine Ausbildung zu machen.«
Ned brach in höhnisches Gelächter aus. »Eine Postulantin! Willst du etwa, daß wir Postulantinnen werden? In Habit und Schleier würden wir uns bestimmt gut machen!«
»So habe ich das doch nicht gemeint …«, fing sie an.
»Ich glaube nicht, daß die Ehrwürdige Mutter uns nehmen würde«, sagte Tommy.
»Schwester Thomas, ich glaube, wir müssen wirklich etwas wegen Ihrer Stimme im Chor unternehmen«, sagte Ned geziert.
»Oh, ich tue schon mein Bestes, Schwester Edward, aber was fangen wir bloß mit Ihren Nagelschuhen an?«
»Sie müssen gerade reden, Schwester Thomas, Sie mit Ihren behaarten Beinen!« machte Ned weiter.
Ben und Jimmy waren aufmerksam geworden. »Und Sie müssen aufhören, im Konvent Fußball zu spielen«, sagte Ben.
»Nonnen, die Fußball spielen«, schrie Jimmy begeistert. Sogar Mammy, die am Boden kniete und endlich triumphierend das gefundene Stück Kabel in der Hand hielt, lachte. Und auch Dad lächelte. Aber Clare erhielt unerwartete Unterstützung.
»Ha, ha, sehr witzig«, meinte Gerry Doyle. »Mutter Thomas und Mutter Edward, das ist wirklich komisch! Trotzdem hat Clare recht. Es hat keinen Sinn, auf einer Baustelle zu arbeiten, wenn man nicht wenigstens als Maurer oder Zimmerer ausgebildet wird. Was man diesen Herrn eigentlich fragen muß, ist nicht, wieviel die Stelle einbringt, sondern um was für eine Arbeit es sich handelt.«
Clare errötete vor Freude. Alle nickten jetzt zustimmend.
»Ich habe fast vergessen, warum ich eigentlich hergekommen bin«, sagte Gerry. »Vater hat mich gebeten, von verschiedenen Plätzen aus die Aussicht zu begutachten; er spielt mit dem Gedanken, eine Ansichtskarte von Castlebay zu machen und überlegt, welche Perspektive wohl die beste für ein solches Foto wär. Dabei ist ihm eingefallen, daß die Aussicht von Ihrem oberen Stockwerk aus vielleicht genau richtig wäre. Ob ich wohl mal nach oben gehen könnte, um es mir anzusehen?«
»Nachts?« fragte Clares Vater.
»In der Dunkelheit kann man die Silhouette besonders gut erkennen«, entgegnete Gerry, der schon mit einem Fuß auf der Treppe stand.
»Na, dann geh schon.«
Sie nahmen alle ihre Arbeit wieder auf, und nur Clare wußte, daß Gerry Doyle mit seinen fünfzehneinhalb Jahren nach oben gegangen war, um die dreizehnjährige Chrissie O'Brien zu besuchen.
Als David hereinkam, kniete Nellie mit dem Blasebalg in der Hand auf dem Boden. »Ich mache gerade ein schönes Feuer für deinen Unterricht«, sagte sie zu ihm.
Von der Anstrengung war ihr Gesicht gerötet, und ein paar Haarsträhnen hatten sich aus dem Häubchen gelöst. Sie schien sich mit dieser Kopfbedeckung nicht wohlzufühlen, sie saß nie gerade, und außerdem sah es stets so aus, als steckte ihr ganzer Kopf voller Haarnadeln. Nellie war schon alt, zwar nicht so alt wie Mammy, aber immerhin schon fast dreißig, und sie war fröhlich und dick und schon immer hier. Sie hatte eine Menge verheirateter Brüder und einen alten Vater. Als David noch klein war, hatte sie ihm oft erzählt, daß sie es besser hatte als alle ihre Brüder, weil sie in einem schönen, sauberen Haus wohnen konnte, in dem alles so komfortabel war, und weil es hier immer genügend zu essen gab. David dachte oft, daß sie sich, wenn die ganze Familie zu Hause war, in ihrer Küche sehr einsam fühlen mußte. Aber ihr rundes Gesicht verzog sich zu einem Lächeln, und sie versicherte ihm, ihr ginge es mindestens so gut, als wenn sie gut geheiratet hätte – und im Grunde genommen ging es ihr sogar noch besser, weil sie ihr eigenes Geld verdiente, von allem nur das Feinste bekam und jeden Donnerstagnachmittag und jeden zweiten Sonntagnachmittag Ausgang hatte.
David wollte ihr beim Feuermachen helfen, aber Nellie stand kreischend auf und meinte, dies sei nicht nötig, und außerdem käme gerade seine Lehrerin zum Tor herein.
Tatsächlich erschien Angela O'Haras rotes Fahrrad auf dem Kiesweg. Sie war groß und schlank und hielt ihren Mantel immer mit einem Gürtel zusammen, als ob sie ihn sonst verlieren würde. Andere Leute benutzten dazu Knöpfe, aber natürlich sausten die nicht so viel mit dem Fahrrad durch die Gegend. Ihr rotbraunes Haar band sie mit einem Band oder einer Kordel so locker zusammen, daß es wirkte, als trüge sie es lose. Sie hatte große, grünliche Augen und warf stets den Kopf nach hinten, wenn sie lachte.
Miss O'Hara war ganz anders als andere Erwachsene. Sie fragte David zum Beispiel, ob die Schulgebühren zurückerstattet wurden, da die Schule doch jetzt wegen Scharlach geschlossen war. David wußte es nicht und versprach, sich zu erkundigen. Aber das wollte Miss O'Hara nicht, es sei nicht so wichtig und außerdem könnte der Eindruck entstehen, sie wolle ein höheres Honorar, was nicht der Fall sei. David hatte ganz vergessen, daß sie für die Privatstunden Geld bekam. An so etwas dachte man bei ihr einfach nicht! Irgendwie hatte er angenommen, sie täte es rein aus Interesse. Das hatte sie sehr witzig gefunden und gesagt, in vielerlei Hinsicht tue sie es auch aus Interesse, aber schließlich stünde schon irgendwo im Evangelium, daß jede Arbeit ihren Lohn wert sei. Und wenn sie um Gotteslohn arbeiten sollte, wie sähe es denn damit bei diesem ach so großartigen Priesterorden aus, wo er zur Schule ging – dort unterrichte man ihn doch bestimmt auch nicht umsonst. David sagte, seines Wissens sei der größte Teil der Schulgebühren für Verpflegung und Unterkunft bestimmt, er könne sich nicht vorstellen, daß der Unterricht selbst etwas koste.
Sie kam jeden Abend für eine Stunde, wenn sie mit ihrer Arbeit an der Schule fertig war und nach ihrer Mutter gesehen hatte. Mrs. O'Hara war von ihrer Arthritis ganz krumm und schief, und David fand, daß sie wie ein alter Baum auf einer Abbildung in einem seiner Kinderbücher aussah. Ein Buch, das seine Mutter wahrscheinlich säuberlich aufbewahrt hatte, für die Zeit, wenn es wieder gebraucht würde. Miss O'Hara hatte zwei Schwestern, die in England verheiratet waren, und einen Bruder, der im Fernen Osten Priester war. Sie habe als einzige Irland nie verlassen, erzählte sie David. Er wollte wissen, was denn geschehen wäre, wenn sie auch weggegangen wäre und ihre Mutter sich wegen ihrer Krankheit nicht mehr hätte allein versorgen können?
»Dann wäre ich zurückgekommen«, entgegnete Miss O'Hara leichthin. Mit zwei verheirateten Schwestern und einem Priester als Bruder wäre es ohnehin ihre Aufgabe gewesen, ihre Mutter zu versorgen.
Das Haus der O'Haras lag ein wenig außerhalb, an der Straße, die zum Golfplatz führte. Miss O'Hara benutzte für alle Wege, die sie zu machen hatte, ihr großes rotes Fahrrad, an dem vorne ein Korb für die Schulhefte angebracht war. Sie hatte immer Schulhefte zu befördern, die sie bei Regen wasserdicht einpackte. Im Winter hüllte sie sich in einen langen Schal, und wenn es stürmisch war, stand ihr Haar manchmal nach hinten ab. Davids Mutter hatte einmal gemeint, daß sie aussehe wie eine Hexe, die auf die Cliff Road zusteuere, und daß man sich nicht wundern würde, wenn sie sich mit ihrem Fahrrad über dem Meer in die Lüfte erheben würde. Aber Davids Vater hatte sich jeden Tadel an ihr verbeten. Niemand könne sich vorstellen, wie aufopfernd sie sich rund um die Uhr um ihre Mutter kümmere, die von ihrer Arthritis praktisch gelähmt sei. Was man schon daran sehen könne, daß drei Pflegepersonen, die teilweise sogar im Hause wohnten, nötig waren, um die kranke Frau zu versorgen, wenn die arme Angela einmal im Jahr für zwei Wochen verreiste – und trotz dieses Aufwands sei das Ergebnis nicht zufriedenstellend! Davids Mutter mochte Miss O'Hara nicht, was wohl damit zusammenhing, daß diese gewissen Dingen nicht die gebührende Bewunderung zollte und es nicht schrecklich aufregend fand, wenn seine Mutter gelegentlich zum Bummeln nach Dublin fuhr. Sie hatte es nie ausgesprochen, er hatte nur so ein Gefühl.
Man hatte den Tisch mit seinen Büchern näher zum Kamin gerückt, und Nellie würde Tee und ein Stück Kuchen oder Apfeltörtchen servieren.
Miss O'Hara unterhielt sich mit Nellie viel öfter als mit Davids Mutter. Sie erkundigte sich nach Nellies altem Vater, der auf dem Land wohnte, danach, ob sie noch immer Krach mit ihren Brüdern hatte und ob sie etwas von ihrer Schwester in Kanada gehört hätten. Sie kicherte mit Nellie über eine Bemerkung von Father O'Dwyers Haushälterin, die eigentlich Miss McCormack hieß, aber von jedem »Sergeant McCormack« genannt wurde, weil sie nicht nur über Father O'Dwyer und die Kirche das Kommando führen wollte, sondern über ganz Castlebay.
Miss O'Hara kam nun herein und hielt ihre vom Fahrtwind kalt gewordenen Hände ans Feuer.
»Ach, Nellie, es ist doch eine Sünde, daß dieses große Feuer extra für David und mich angezündet wird. Wir könnten doch ebensogut in der Küche neben dem Herd arbeiten.«
»Aber nein, das geht auf keinen Fall!« rief Nelly entsetzt.
»David, würde es dir etwas ausmachen?« begann sie … und besann sich dann doch anders. »Nein, hört gar nicht auf mich, ich will nur immer die Welt verändern – das ist mein Problem. Wir haben es hier in diesem herrlichen Zimmer doch so gut und sollten es genießen. Nellie, was für ein Ungetüm wird denn da neben dem Hotel gebaut?«
»Soviel ich weiß, soll das eine Glasveranda werden«, sagte Nellie wichtig. »Sie wollen da im Sommer Stühle und Kartentische aufstellen und auch Tee servieren.«
»Wenn der Sommer so ausfällt wie letztes Jahr, werden sie dazu auch noch Wolldecken und Wärmflaschen verteilen müssen. Fangen wir an, kleiner Studiosus. Hol dein Geographiebuch heraus, dann machen wir aus dir einen weltberühmten Experten für die Passate. Wenn du erst wieder in deiner hochherrschaftlichen Schule zurück bist, werden die anderen grün und gelb vor Neid. Wir werden ihnen schon zeigen, wie man in Castlebay einen richtigen Gelehrten heranzieht.«
Paddy Power war ein großer, gedrungener Mann mit einem wettergegerbten Gesicht. Sein Gesicht war allen möglichen Witterungen ausgesetzt, aber vor allem dem schneidenden Wind, der immer vom Meer her wehte, wenn er seine Hausbesuche zu Fuß machen mußte, weil er mit seinem großen, verbeulten Auto auf den Straßen nicht weiterkam. Sein Haarschopf wuchs wild in alle Himmelsrichtungen, so als hätte er drei Wirbel. Früher war sein Haar braun gewesen, dann graumeliert, aber jetzt war es fast völlig grau. Wegen seiner massigen Gestalt und seinem wirren Haar wirkte er zuweilen grimmig, aber nur auf Menschen, die ihn noch nicht kannten. Er hatte eine wunderbare Art, mit seinen Patienten zu sprechen. Während er sie untersuchte, führte er mit ihnen harmlose, scherzhafte Gespräche. Das Geplauder diente jedoch nur zur Ablenkung des Patienten, bis er das Körnchen im Auge, den Splitter in der Hand oder die Glasscherbe in der Fußsohle gefunden hatte; oder wenn er den Unterleib nach der schmerzenden Stelle abtastete und verhindern wollte, daß sich der Patient dabei verkrampfte und aufregte.
Er war kräftig gebaut, weshalb er nie gutsitzende Kleider fand, was ihn aber nicht sonderlich störte. Das Leben, so sagte er, sei viel zu kurz, um seine Zeit bei einem Schneider zu verbringen, der nur lauter Unsinn über Schnittmuster, Futter und Aufschläge erzählte. Doch trotz seines massigen Körperbaus, und obwohl er seiner äußeren Erscheinung nur wenig Aufmerksamkeit widmete, war er ein kerngesunder Mann, der beinahe sechs Monate im Jahr von seinem Garten aus zum Meer ging, um zu schwimmen, und außerdem einmal die Woche Golf spielte. Aber heute war Paddy Power müde; er hatte einen langen Tag hinter sich, war siebenundzwanzig Kilometer gefahren, um nach einer jungen Frau zu sehen, die wohl bis Weihnachten sterben würde, aber zuversichtlich hoffte, daß es ihr besser gehen würde, wenn erst wieder gutes Wetter käme. Ihre fünf Kinder hatten lärmend und unbesorgt zu Füßen des Arztes gespielt, und ihr bleicher, junger Ehemann war nur dagesessen und hatte mit stumpfem Blick ins Feuer gestarrt. Er hatte auch ein unerquickliches Gespräch mit einem der Dillon-Brüder vom Hotel geführt, dem er wegen eines drohenden Leberschadens ins Gewissen reden mußte. Obwohl er sich so vorsichtig wie möglich ausgedrückt hatte, war er doch nur auf Unverständnis und Ablehnung gestoßen. Schließlich hatte ihm Dick Dillon erwidert, er solle sich bitte schön um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Und er, Paddy Power, sei ja wohl gerade der richtige, ihm Vorhaltungen zu machen, wo doch jeder wisse, daß er vor drei Jahren beim Rennen sternhagelvoll gewesen sei. Man solle nicht Steine werfen, wenn man im Glashaus säße. Außerdem hatte es zwei schwere Grippefälle gegeben, und das bei älteren Leuten, die schon vorher recht schwach gewesen waren. Bei beiden war die Lungenentzündung nur noch eine Frage der Zeit. Die Leute sprachen immer von der guten Seeluft und der kräftigenden Meeresbrise. Die sollten einmal im Winter hierherkommen, in seine Arztpraxis, dachte Paddy Power düster, dann würde ihnen solches Gerede bald vergehen.
Molly erzählte ihm, daß David mit dem Lernen prächtig vorankäme und daß er sogar jeden Morgen zwei Stunden allein arbeiten würde.
»Angela ist wirklich eine gute Lehrerin. Zu schade, daß sie dafür nie die verdiente Anerkennung bekommen hat«, sagte Paddy, während er müde seine Stiefel auszog und in seine Hausschuhe schlüpfte.
»Keine Anerkennung? Sie ist Lehrerin an der hiesigen Schule und bekommt dafür ein gutes Gehalt, hat alle nötigen Zeugnisse … Für Dinny O'Haras Tochter ist das doch eine ganze Menge«, meinte Molly spitz.
»Du begreifst nicht, worauf ich hinauswill, Molly. Sie ist ein intelligentes Mädchen und sitzt hier in Castlebay fest, wo sie Kinder unterrichtet, die später einmal Kellnerinnen oder Verkäuferinnen werden. Und was ist das für ein Leben bei ihr zu Hause? Ich meine, die Little Sisters würden für ihre Schäfchen nicht so viel tun wie Angela für ihre Mutter.«
»Ja, das weiß ich doch.« Molly hätte jetzt liebend gerne das Thema gewechselt.
»Aber vielleicht kommt ja eines Tages ein Mann auf einem weißen Pferd und holt sie.« Er lächelte bei dem Gedanken daran. »Über dieses Alter dürfte sie mittlerweile hinaus sein«, sagte Molly.
»Angela ist erst achtundzwanzig, ein Jahr älter als du warst, als wir geheiratet haben.«
Molly haßte es, wenn er in Nellies Gegenwart von solchen Dingen sprach. Sie war nicht von hier, sondern in einer großen Stadt aufgewachsen und in Dublin zur Schule gegangen. Es paßte ihr nicht, daß jemand über ihre Privatangelegenheiten Bescheid wußte, und erst recht galt das für ihr Alter.
Sie betrachtete sich im Spiegel: Sie war nicht mehr jung, hatte sich aber gut gehalten. Seit sie sich einen Einkäufer in einem Dubliner Geschäft zum Freund gemacht hatte, war es für sie kein Problem mehr, an gute Kleidung heranzukommen. Flotte Wollkostüme, die weit genug waren, um darunter ein warmes Unterhemd oder sogar einen dünnen Pullover zu tragen. In Castlebay mußte man sich dick einpacken. Paddy hatte ihr im Lauf der Jahre einige hübsche Broschen geschenkt, mit denen sie immer elegant aussah. Wer auch immer in ihr Haus kam, Molly empfing jeden Besucher adrett gekleidet; ihre Frisur war stets tadellos und gepflegt (sie ließ sich alle drei Monate in der Stadt eine Dauerwelle machen); außerdem schminkte sie sich dezent.
Sie betrachtete prüfend ihr Gesicht. Ihre Befürchtung, das Klima hier könnte ihre Haut frühzeitig altern lassen, was bei den meisten Frauen in Castlebay der Fall war, hatte sich nicht bewahrheitet. Aber diese Frauen benutzten wahrscheinlich nicht einmal eine Gesichtscreme.
Sie lächelte ihrem Spiegelbild zu, wobei sie den Kopf leicht zur Seite neigte, damit sie die hübschen Ohrclips sehen konnte, die sie vor kurzem passend zu der grünen Brosche auf dem grüngrauen Wollkostüm geschenkt bekommen hatte. Paddy sah, wie sie lächelte. Er kam auf sie zu, stellte sich hinter sie und legte ihr die Hände auf die Schultern.
»Du hast ganz recht, du bist umwerfend«, sagte er.
»Das habe ich jetzt gar nicht gedacht«, entgegnete Molly entrüstet. »Das solltest du aber«, meinte Paddy. »Du bist eine bezaubernde Frau und siehst überhaupt nicht wie eine Mutter und Ehefrau aus.«
Molly dachte einen Augenblick lang daran, daß sie Mutter war. Sie hatte gedacht, sie könnte keine Kinder bekommen – es hatte so viele Fehlschläge gegeben. Nach den ersten Wochen, in denen sie voller Vorfreude gewesen war, war es im dritten Monat zu einem Abgang gekommen, dreimal. Dann hatte sie zwei Totgeburten. Und dann, als sie kaum noch daran glaubte, kam David. Genau das Kind, das sie sich gewünscht hatte.
David war ein großartiger kleiner Bursche, fand Angela. Mit seinen abstehenden Haaren, den losen Schuhbändern und der schiefsitzenden Krawatte sah er aus wie die Jungen in den Büchern von Just William. Wenn er lernte, löste sich seine tadellose Erscheinung gewissermaßen auf.
Wäre es nicht herrlich, wenn sie immer intelligente Schüler unterrichten könnte und nicht ständig Rücksicht auf die schlechteren Schüler nehmen müßte? Sie beobachtete ihn, während er eine Karte von den Passatwinden zeichnete und sie ihr dann triumphierend reichte.
»Warum lächeln Sie?« fragte er mißtrauisch.
»Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich ein bißchen verrückt. Ich ertappe mich in letzter Zeit hin und wieder dabei, daß ich immer dann lächle, wenn ein Schüler etwas richtig macht. Es ist so eine Überraschung, weißt du.«
David lachte. »Gibt es an unserer Schule denn nur hoffnungslose Fälle?«
»Nein, nicht nur, manche sind sogar blitzgescheit. Aber was hilft es ihnen? Was können sie damit groß anfangen?«
»Sie werden ihren Abschluß schaffen.«
»Ja, das werden sie.« Sie stand auf, ein wenig wie ein Erwachsener, der das Gespräch mit ihm nicht länger fortsetzen wollte. Er war enttäuscht.
Angela fuhr bei Wind und Wetter mit ihrem Fahrrad von Dr. Power nach Hause. Die Böen peitschten ihr ins Gesicht, und die salzige Seeluft brannte in ihren Augen. Im Winter erschien ihr jede Fahrt wie eine Exkursion zum Südpol. Wie schon so oft dachte sie darüber nach, ob es nicht besser wäre, wenn sie mit ihrer Mutter in einer Stadt leben würde. Der feuchte Wind, der durch jede Ritze des Hauses drang, setzte ihr sicher hart zu, und zweifellos war es nicht das gesündeste für sie, an einem Ort zu leben, der drei Viertel des Jahres nur für Robben und Möwen geeignet war. Aber sie brauchte sich nichts vorzumachen: Wenn sie umzögen, dann um ihretwillen, damit sie etwas vom Leben hätte, und nicht ihrer armen Mutter und ihren alten, schwachen Knochen zuliebe. Und was hätte sie schon davon, in einer Stadt zu leben? Sie wäre nichts weiter als eine kleine Lehrerin mit einer kranken Mutter, falls sie überhaupt eine Stelle bekäme. Eine Lehrerin, die auf die Dreißig zuging – nicht gerade umwerfend. Hör auf zu träumen, Angela, zieh den Kopf ein, und tritt in die Pedale, es sind nur noch ein paar Minuten. Das Schlimmste ist schon vorbei, den Wind, der durch die Felsspalte pfeift, hast du hinter dir. Du kannst doch schon das erleuchtete Fenster erkennen.
Die Leute nannten ihr Haus Kate, weil es von vorn betrachtet so klein wirkte; tatsächlich gab es aber noch ein oberes Stockwerk. Es war weiß getüncht und hatte den obligatorischen kleinen, von einer Hecke umzäunten Garten. Ein schmaler Pfad führte zur Haustür.
Sie fragte sich, wie sie alle in diesem Haus Platz gefunden hatten, als ihr Vater noch lebte und sie noch klein war. Es mußte sehr beengt gewesen sein. Damals hatten ihre Eltern in einem Zimmer im ersten Stock geschlafen, die drei Mädchen in einem zweiten Zimmer und Sean, der einzige Junge, im dritten. Der Raum unten, den sie jetzt als Schlafzimmer für ihre Mutter eingerichtet hatte, war wohl so etwas wie ein Wohnzimmer gewesen. Damals hatte es im Haus noch keine Bücher gegeben, keinen glänzenden Messingzierat, keine kleinen Blumensträuße oder Schalen mit Heidekraut und Stechginster, wie Angela sie jetzt hatte. Aber natürlich war das Häuschen damals das Heim von einem Trunkenbold, einer überarbeiteten und ausgelaugten Mutter und vier Kindern gewesen, die alle so schnell wie möglich das Weite suchen wollten. Damals war keine Zeit gewesen für den Luxus von Büchern und Blumen.
Ihre Mutter saß auf dem Nachtstuhl, in den Angela sie gesetzt hatte, bevor sie zu den Powers gefahren war. Sie hatte ihren Stock fallen lassen, und der andere Stuhl stand zu weit weg, so daß sie sich nirgends aufstützen und deshalb nicht aufstehen konnte. Aber sie beklagte sich nicht, es tat ihr eher leid, daß Angela so viel Mühe mit ihr hatte. Angela leerte den Nachttopf und schüttete etwas Dettol hinein. Dann holte sie eine Schüssel mit Seifenwasser und einen Waschlappen für ihre Mutter und half ihr dabei, sich zu waschen und zu pudern. Sie zog das Flanellnachthemd, das sie am Kamingitter angewärmt hatte, über den kleinen, gebeugten Kopf ihrer Mutter und brachte sie in dem Zimmer neben der Küche zu Bett. Sie gab ihr den Rosenkranz, ihr Glas Wasser und stellte die Uhr so auf, daß ihre Mutter sie sehen konnte. Angela gab ihrer Mutter keinen Kuß – das war in ihrer Familie nie üblich gewesen. Statt dessen tätschelte sie ihre gefalteten Hände. Anschließend ging sie in die Küche und nahm die Aufsätze heraus, die sie morgen ihren Schülerinnen zurückgeben würde. Die Gewinnerin stand schon lange fest, aber sie wollte unter alle Aufsätze eine kleine Bemerkung schreiben. Schließlich hatten die Schülerinnen die Aufsätze in ihrer Freizeit geschrieben, um an dem von ihr ausgeschriebenen Wettbewerb teilzunehmen. Angela wollte sie damit ermutigen und ihnen zeigen, daß sie alle gelesen hatte, auch die schlechten.
Mit einer Kanne Tee machte sie sich an die Arbeit. Draußen heulte der Wind, und bald konnte sie ihre Mutter, die nur ein paar Meter entfernt schlief, leise schnarchen hören.
Clare O'Brien war schon sehr zeitig in der Schule. Sie hatte sich den Hals beinahe wundgewaschen, so energisch hatte sie ihn geschrubbt. Der Fleck auf ihrem Schulkittel war kaum noch zu sehen, sie war ihm mit einer Nagelbürste zu Leibe gerückt. Ihre Hausschuhe glänzten vor Sauberkeit, sie hatte sogar die Sohlen geputzt, und die gelben Haarbänder waren eine wahre Augenweide. Um sie im spiegelnden Schulfenster betrachten zu können, drehte sie mehrmals den Kopf hin und her. Sie sah genauso gut aus wie all die anderen – die Bauerntöchter, die eine Menge Geld hatten und jedesmal, wenn sie aus ihrem Schulkittel herausgewachsen waren, einen neuen bekamen, während sie und Chrissie sich damit begnügen mußten, aus dem alten Kittel die Nähte auszulassen oder falsche Säume anzubringen.
Ungeduldig erwartete sie die erste Unterrichtsstunde. Wie aufregend würde es sein, vor der ganzen Schule nach vorne zu treten. Die anderen würden vor Überraschung nach Luft schnappen, weil sie noch so jung war, einige Jahre jünger als manche andere, die beim Wettbewerb mitgemacht hatten!
Chrissie würde natürlich toben, aber was machte das schon, sie regte sich schließlich über alles mögliche auf und würde sicher darüber hinwegkommen.
Clare ging zum Ende des Korridors, um am Schwarzen Brett nach Neuigkeiten zu schauen, aber es gab nichts Neues. Vielleicht würde mittags eine Notiz über den Geschichtswettbewerb dort stehen. Jetzt hing da nur der Stundenplan, eine Liste mit den verbindlichen Feiertagen, nähere Informationen zu dem Schulausflug nach Dublin – und auch sein Preis, was Clare jegliche Hoffnung raubte. Außerdem war da noch ein Brief von Father O'Hara, Miss O'Haras Bruder, der als Missionar tätig war. Er dankte darin der Schule für das Silberpapier und die Briefmarkenkollekte. Er sei sehr stolz darauf, schrieb er, daß die Mädchen seines Heimatortes so tatkräftig mitgeholfen hätten, das Wort des Herrn all jenen Armen zu verkünden, die es noch nie vernommen hatten.
Clare konnte sich an Father O'Hara nicht mehr erinnern, aber jeder sagte, er sei einfach fabelhaft. Er war wohl sehr groß, größer als Miss O'Hara, und sah sehr gut aus. Clares Mutter hatte gesagt, daß es einem warm ums Herz wurde, wenn Father O'Hara kam, um in der Kirche eine Messe zu lesen, und außerdem sei er ein wundervoller Sohn. Er schrieb seiner Mutter von den Missionsstationen, sie zeigte seine Briefe oft herum – wenigstens hatte sie das früher getan, als sie das Haus noch hin und wieder verlassen konnte.
Nach Father O'Haras Beschreibung zu urteilen war das Leben als Missionar das reinste Vergnügen. Clare wünschte, er würde jede Woche einen Brief schreiben. Sie fragte sich, was ihm Miss O'Hara wohl zurückschrieb. Würde sie ihm diese Woche vom Geschichtswettbewerb erzählen?
Gerade eben rauschte sie auf ihrem Fahrrad durch die Toreinfahrt.
Mutter Immaculatas Gesicht war spitz wie eine Feder.
»Ich hätte Sie gerne gesprochen, Miss O'Hara. Nur für einen Augenblick, das heißt, wenn Sie eine Minute erübrigen können.«
Eines Tages, schwor sich Angela, würde sie Mutter Immaculata antworten, daß es im Moment ungünstig sei, sie habe keine Zeit, weil sie den Älteren noch dabei helfen müsse, Kartoffelschnaps zu brennen, und die Drittkläßler auf ihr zukünftiges Dasein in den Klauen von Mädchenhändlern vorbereiten müsse. Doch jetzt war noch nicht der richtige Zeitpunkt, nicht, solange sie noch auf die Arbeit hier angewiesen war. Sie stellte ihr Fahrrad im Schuppen ab und schnappte sich den Packen Aufsätze, den sie zum Schutz vor den Elementen eingepackt hatte.
»Selbstverständlich, Mutter«, antwortete sie mit einem falschen Lächeln.
Mutter Immaculata sprach erst, als sie in ihrem Büro waren. Sie schloß die Tür hinter sich und setzte sich an ihren Schreibtisch; da sich auf dem einzigen Stuhl, der sich sonst noch im Raum befand, haufenweise Bücher stapelten, mußte Angela stehen.
Sie beschloß, sich diesmal nichts gefallen zu lassen. Wenn diese Schwester sie wegen irgendeiner völlig belanglosen, ihr noch unbekannten Sache wie ein ungezogenes Kind behandeln und sie in angstvoller Erwartung hier stehen lassen wollte, würde sie sich eben zu ihrer vollen Größe aufrichten, so daß Mutter Immaculata einen steifen Nacken bekäme, weil sie so weit nach oben schauen mußte. Angela stellte sich unauffällig auf die Zehenspitzen und reckte ihren Hals wie eine Giraffe. Es wirkte. Mutter Immaculata mußte ebenfalls aufstehen.
»Miss O'Hara, stimmt es, daß Sie bei diesem Aufsatzwettbewerb einen Geldpreis ausgesetzt haben? Können Sie mir erklären, wie es dazu kam und wann Sie mit mir darüber gesprochen haben?«
»Oh, ich habe den Kindern einen Aufsatz aufgegeben, und für den besten gibt es einen Preis.« Angela lächelte ziemlich einfältig.
»Aber wann wurde das besprochen?« Mutter Immaculatas hageres, spitzes Gesicht bebte ob der Respektlosigkeit, die ihr hier entgegenschlug – oder vor Ärger über die Entdeckung der Missetat.
»Aber, Mutter, wir müssen doch nicht alles, was wir im Unterricht machen, vorher mit Ihnen besprechen, oder? Ich meine, Sie würden ja zu gar nichts mehr kommen, wenn wir ständig zu Ihnen rennen würden, bloß um zu besprechen, welche Hausaufgaben wir aufgeben sollen.«
»Das habe ich auch nicht gemeint. Ich finde allerdings, daß hier eine Erklärung notwendig ist, Miss O'Hara. Seit wann bezahlen wir die Kinder dafür, daß sie lernen?«