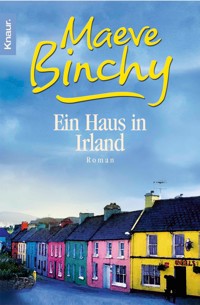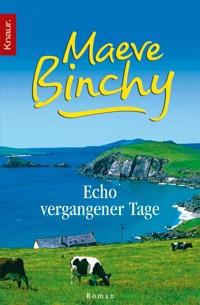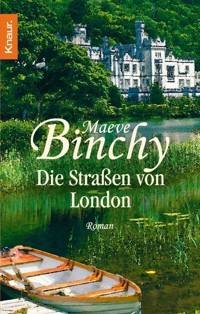6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Grüne Insel-Reihe
- Sprache: Deutsch
21 warmherzige Erzählungen aus dem Nachlass der beliebten irischen Bestseller-Autorin. Erzählungen aus Irland – über Frauen, ihre Liebe, ihre Freundschaften und etwas, das wohl jede von ihnen kennt: Sehnsucht. Sara braucht einen Wegweiser im Leben und findet unerwartete Hilfe bei ihrer kreativen Tante Miriam – bis diese einen ihrer eigenen Ratschläge etwas zu gut befolgt. Rory verliebt sich in Fiona, doch die scheint unerreichbar – schließlich ist sie Radiosprecherin und er nur ein aufmerksamer Zuhörer. Und eine alleinerziehende Mutter stellt fest, dass die neue, ungeliebte Freundin ihrer Tochter unter der aufmüpfigen Schale ein sehnsuchtsvolles Herz versteckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Maeve Binchy
Irische Sehnsucht
Erzählungen von der Grünen Insel
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
21 warmherzige Erzählungen aus dem Nachlass der beliebten irischen Bestseller-Autorin. Mit ihren berührenden und gefühlvollen Kurzgeschichten lässt Maeve Binchy die Leserinnen am Leben und Alltag verschiedener Frauen in Irland teilhaben und erzählt von etwas, das wohl jeder von uns kennt: Sehnsucht.
Das ist zum Beispiel Moggie, die erst Jahre nach ihrem Collegeabschluss den Mut findet, aus dem Schatten ihrer Konkurrentin von damals herauszutreten.
Sara braucht einen Wegweiser im Leben und findet unerwartete Hilfe bei ihrer kreativen Tante Miriam – bis diese einen ihrer eigenen Ratschläge etwas zu gut befolgt.
Rory verliebt sich in Fiona, doch die scheint unerreichbar – schließlich ist sie Radiosprecherin und er nur ein aufmerksamer Zuhörer.
Und eine alleinerziehende Mutter stellt fest, dass die neue, ungeliebte Freundin ihrer Tochter unter der aufmüpfigen Schale ein sehnsuchtsvolles Herz versteckt.
Inhaltsübersicht
Einführung
Georgia Hall
Der Nachzügler
Der Spiegel
Erstens kommt es anders
Guter Rat ist teuer
Klare Worte
Wer kennt Grace?
Da haben wir den Salat
Vorwarnungen
Entscheidung an Weihnachten
Vergeben und vergessen
Picknick bei St Pauls
Küss mich, Kate
Mr Mangan
Abschied von den Männern
Talk am Nachmittag
Eine positive Bilanz
Jemand muss es ihr sagen
Die Hälfte von neunzig
Die Schlechtwetterfreundin
Entscheidung auf hoher See
Einführung
Maeves Kopf war stets voller Geschichten. In all den Jahren, in denen wir uns an dem langen Schreibtisch vor dem Fenster in unserem Arbeitszimmer gegenübersaßen, habe ich nicht ein Mal erlebt, dass sie auf den leeren Bildschirm gestarrt und sich gefragt hätte, wie sie anfangen solle.
Sie stürzte sich auf die Tastatur wie ein Schwimmer ins Meer, und ihre Finger flitzten mit halsbrecherischer Geschwindigkeit über die Tasten, ohne auch nur ein einziges Mal innezuhalten, um einen Interpunktions- oder Schreibfehler zu korrigieren. Sollte die hinterhältige Maschine doch hin und wieder eine Seite oder zwei plötzlich verschluckt haben, hielt sie sich nicht lange mit technischen Tüfteleien auf. Schneller ginge es, wie sie sagte, wenn sie den ganzen Absatz sofort wieder in den Computer tippe.
So entstand eine Vielzahl von Geschichten und Charakteren, denen sie in ihrem unangestrengten, geradlinigen und feinfühligen Stil Gestalt und Sprache verlieh. Fast mühelos schien dies‚ so als setzte sie sich neben einen guten Freund und unterhielte sich mit ihm im Plauderton.
Sie würde kein bisschen besser schreiben, wenn sie langsamer schriebe, sagte Maeve immer – und genauso redete sie auch. Die Wörter sprudelten aus ihrem Mund, so eilig hatten sie es, ausgesprochen zu werden. Geschichten erzählen war ihr ureigenstes, magisches Talent, und neben ihren Romanen und Sammlungen mit Kurzgeschichten verfasste sie zahllose weitere Erzählungen für Zeitschriften und Magazine. Ich wusste, ihre treuen Leser würden sich freuen, viele dieser für sie noch unbekannten Geschichten in Buchform in Händen halten zu können.
Und deshalb liegen sie nun alle in diesem neuen Band Irische Sehnsucht vor, ausgewählt und zusammengestellt von ihrer Agentin Christine Green und den Lektorinnen Juliet Ewers, Carole Baron und Pauline Proctor. Als Ausdruck ihrer immensen schöpferischen Leistung sind diese Erzählungen ebenso Beweis für Maeves Einfallsreichtum, den sie stets mitfühlend und opulent zu gestalten wusste, wie für ihr einzigartiges Talent, Geschichten zu erzählen – ihr Vermächtnis, das sie uns allen hinterlassen hat.
Gordon Snell
Georgia Hall
Georgia war schon immer die geborene Anführerin gewesen.
Früher in der Schule kopierte jeder ihren Stil. Als Georgia die Idee hatte, ihre Schulbücher mit einem roten Band zusammenzuschnüren, ließen alle ihre Schultaschen und Rucksäcke zu Hause und benutzten ebenfalls Bänder.
An der Universität war es nicht viel anders. Sie schien sich nicht einmal darum zu bemühen, aber jeder wollte alles so machen wie sie. Sie studierte Kunstgeschichte, laut ihrer Aussage ein nicht besonders anspruchsvolles Fach, aber sie war immer unter den Besten. Sie wohnte in einem kleinen Einzimmerapartment, das ihren eigenen Worten nach so furchtbar war, dass sie sich nicht vorstellen könne, jemand wolle freiwillig einen Fuß hineinsetzen. Und dennoch fand dort jeden Freitag eine kleine Party mit reichlich Alkohol statt, und die Leute taten alles, um dabei zu sein.
Auch Georgias Frisur saß immer perfekt. Im Vergleich zu all den anderen jungen Frauen, die praktisch jeden Tag einen Bad Hair Day hatten, sah Georgia aus, als käme sie geradewegs von einem teuren Coiffeur. Das stimmte allerdings auch. Jeden Freitag, wenn am meisten los war, arbeitete sie in einem Luxussalon und bekam dafür − außer einem guten Trinkgeld − ein Mal im Monat einen Super-Haarschnitt und ein Mal in der Woche Waschen und Föhnen.
Sie musste viel Zeit und Arbeit auf ihr Studium verwendet haben, weil sie unter der Woche abends nie ausging; dafür bewirtete sie am Freitagabend die Crème de la Crème ihrer Mitstudenten. Samstags zur Mittagszeit konnte man sie oft in einem Lokal am Fluss antreffen, umringt von College-Stars, und ihre Verabredungen an den Samstagabenden fanden nur in den besten Restaurants statt.
Schwer zu sagen, ob die Leute sie wirklich mochten. Schon damals hatte sie etwas Berechnendes an sich. Georgia war nie unbeherrscht oder vertraulich: Mit ihren großen grauen Augen sah sie einen abwägend an, als wollte sie ihr Gegenüber durchschauen und herausfinden, ob bei der Begegnung für sie selbst etwas heraussprang.
Zumindest war das meine Meinung. Aber es war offensichtlich, dass ich mich nicht für Miss Georgia Hall erwärmen konnte.
Schließlich hatte sie mir James weggeschnappt, meinen Freund.
Man könnte natürlich sagen – und einige taten das wohl –, dass man ihn nicht gezwungen hatte, mich zu verlassen, dass ihm niemand eine Schlinge um den Hals gelegt oder die Pistole auf die Brust gesetzt hatte. James lief in jenem Herbst vollkommen freiwillig zu Georgia über.
Gerade noch waren er und ich spazieren gewesen und hatten fallende Blätter als Glücksbringer aufgefangen, und schon eine Woche darauf führte er sie – ausstaffiert mit einem neuen Sakko – in dieses teure Grillrestaurant aus, in dem wir noch nie gewesen waren, weil wir es uns nicht leisten konnten (und das er immer wieder als ziemlich protzig bezeichnet hatte).
Er verhielt sich in der ganzen Sache nicht besonders rühmlich. »Ich vermute mal, du hast es schon gehört«, sagte er betreten zu mir. Natürlich hatte ich es gehört. Am College lebte man wie auf einem Präsentierteller: Jeder erfuhr alles. Aber ich wollte ihm nicht die Genugtuung geben, zu erfahren, dass man es mir bereits gesteckt hatte.
»Was gehört?«, fragte ich. Das mit der Schauspielerei sollte ich besser lassen. Für einen Oscar hätte es bei mir nie gereicht.
»Ich weiß doch, dass es dir jemand erzählt hat«, sagte er. »Ich sehe Georgia.«
»Natürlich siehst du Georgia.« Ich spielte die Ahnungslose, damit er gezwungen war, das auszusprechen, was ich bereits wusste.
»Nein, ich meine sehen im Sinne von – von miteinander gehen.«
»Oh …«, sagte ich. Eine eher verhaltene Reaktion, nachdem ich ihn bis hierher ganz schön manipuliert hatte.
»Tut mir leid«, sagte James kleinlaut.
»Also, wenn es dir leidtut, mit ihr auszugehen – mit ihr zusammen zu sein –, warum machst du es dann?«, fragte ich.
»Nein, es tut mir nicht leid, mit ihr zusammen zu sein«, blaffte er zurück.
»Was genau tut dir dann leid?«, fragte ich, was natürlich kindisch war, aber ich war nun mal sehr verletzt. Ein wenig Rache stand mir schon zu.
»Dass ich dich enttäuscht habe, Moggie, das tut mir leid«, sagte er.
Ich muss auch noch mit diesem blöden Namen leben: Moggie. Ein Kosename für Margaret soll das sein. Erst viel später wurde mir klar, dass er ja nicht für alle Zeiten an mir kleben bleiben musste. Ich hätte mich zum Beispiel auch Georgia nennen können, aber als mir dieses Licht aufging, war es schon zu spät.
»Ich? Ich bin doch nicht enttäuscht.«
»Nicht?« Er sah ungeheuer erleichtert aus. Männer sind manchmal so simpel gestrickt.
»Nein, überhaupt nicht.«
Er schaute mich an, als hätte er mich noch nie im Leben gesehen.
Ich fragte mich, was er da eigentlich sah. Ich bin nicht hochgewachsen und grazil wie Georgia, ich bin eher pummelig, klein und robust. Meine Augen liegen meiner Ansicht nach zu eng beieinander, wodurch ich ein wenig finster wirke, vielleicht sogar kriminell, auch wenn James immer meinte, es sei albern, mich selbst so herabzusetzen. Meine Haare sahen nie aus, als wären sie auch nur in die Nähe eines Luxusfriseurs gekommen, selbst wenn ich tatsächlich einmal zu einem gegangen wäre. Sie schienen ein Eigenleben zu führen und standen in alle Richtungen ab, wie es ihnen passte.
Im Gegensatz zu Georgia besaß ich auch keinerlei elegante Kleidung: Weder hauchdünne Schals noch schwingende Röcke. Immer nur den ewig gleichen Blazer und eine kleine Auswahl an Röcken und Hosen. Schließlich hatte ich mich für das langweilige BWL-Studium entschieden, nicht für die entrückte Welt der Kunstgeschichte.
Keiner, der seine fünf Sinne beisammen hatte, konnte James seine Wahl übel nehmen.
»Du bist unglaublich, Moggie, wirklich unglaublich«, sagte er bewundernd.
Und da hatte er wohl recht. Ich war unglaublich wütend.
Georgia schnurrte wie eine Katze, als wir uns das nächste Mal trafen, draußen vor dem Milchladen, wo sie den Käse für ihre freitägliche Abendgesellschaft kaufte.
»James hat mir erzählt, dass du absolut super reagiert hast«, sagte sie langsam und bedächtig. Liebend gern hätte ich die große Holzkiste neben uns hochgehoben und ihr über den Schädel gezogen. Es war mir ein echtes Bedürfnis, nicht nur eine momentane Laune. Aber ich hielt mich zurück.
Diese Romanze hat keine Zukunft, sagte ich mir, und dann kommt er auf Knien wieder zu seiner Moggie zurückgekrochen. Und ich werde ihn ein bisschen schmoren lassen, bevor ich ihn zurücknehme. Der Gedanke ließ mich schmunzeln.
»Wenn du lächelst, siehst du richtig nett aus, Moggie«, sagte Königin Georgia gönnerhaft.
Der Satz hing in der Luft, als sollte noch etwas folgen, etwas in der Art wie: Wenn du dir nur die Zähne richten lassen würdest, oder: Wenn du nur nicht so mollig wärst … Es war an mir, die Lücke selbst auszufüllen.
Sie wird nicht ewig die Siegerin bleiben können, sagte ich mir und lächelte wieder.
Doch wie es aussah, sollte sie noch eine elend lange Zeit auf der Gewinnerstraße verweilen. Natürlich ließ sie James irgendwann fallen, der postwendend zu seiner Moggie zurückkam und sie anflehte, ob sie ihrem Herzen nicht einen Stoß geben und ihm verzeihen könne. Aber ich konnte es nicht. Ich wollte nichts mehr von ihm wissen.
Für mich war er nicht länger der großartige James, der gemeinsam mit mir die Welt verändern würde. Er war nur noch ein lächerlicher, eitler Kerl, dem es gefiel, dass die Ballkönigin ihm zugelächelt und vorübergehend eine Machtposition in ihrem Hofstaat eingeräumt hatte.
Und das Leben ging für uns alle weiter. Ich machte meinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und arbeitete für ein Forschungsinstitut, wo wir gute Arbeit leisteten. Ich will zwar nicht behaupten, dass wir die Welt veränderten, aber auf jeden Fall gingen wir den Dingen auf den Grund und erstellten Fakten und Statistiken, mit deren Hilfe andere es versuchen konnten. Und James trat in eine ziemlich weit rechts beheimatete Anwaltskanzlei ein, die eine ganze Reihe von Großkonzernen vertrat, genau die Leute, die für uns früher die Bösen gewesen waren.
Und Georgia Hall?
Nun, Georgia wurde berühmt.
Mit ihrem guten Aussehen war sie praktisch wie geschaffen fürs Fernsehen, und so lud man sie immer wieder ein, um über den Ankauf eines Kunstwerks, über eine Neuentdeckung oder über das vielfältige Engagement eines Kunstmäzens zu sprechen. Dabei drückte sie sich stets klar und verständlich aus und schickte allem den Satz voraus: »Das ist jetzt aber nur meine Meinung«, was sie im Fall eines Fehlurteils absicherte und ihr andererseits alles Lob zusicherte, wenn sie richtiglag.
Sie war auch an der Herausgabe von Kunstbänden beteiligt. Zwar munkelte man, jemand, der mit ihr zusammenarbeitete, wolle sie verklagen, weil sie, ohne eigentlich etwas beizutragen, alle Lorbeeren geerntet habe, doch das wurde alles vertuscht. Oder vielleicht war es nur Klatsch – ich war mit Sicherheit nicht die Einzige, die unter Georgia Hall gelitten hatte.
Manchmal erwähnte ich, dass ich sie aus der Schule und von der Universität kannte, aber bald hörte ich damit wieder auf. Jedes Mal wollte man Details über sie wissen, und mir wurde klar, wie wenig wir alle sie eigentlich wirklich gekannt hatten.
Hatte sie Geschwister? Keine Ahnung. Mit wem war sie wirklich befreundet? Schwer zu sagen, vielleicht mit Menschen, die etwas darstellten. Das war immer ihr Thema gewesen. Statt der großen Nummern im Debattier-Klub, der Theatergruppe, dem Ruder- oder Rugby-Klub fand Georgia ihre Freunde nun im Kunstbetrieb, in der Politik, unter Industriellen und sogar beim Adel.
Ihr kleines Einzimmerapartment hatte sie schon lange hinter sich gelassen, und irgendwo hörte oder las ich, dass sie eine äußerst elegante Wohnung in London besaß. Hätte ich mir denken können.
Wo immer man sie sah, fiel sie als äußerst elegante Erscheinung auf: auf der Rennbahn, in der Oper, bei der Biennale in Venedig, bei einer Benefiz-Veranstaltung für ein Kunstwerk, das auf keinen Fall ins Ausland verkauft werden durfte.
Fast könnte man meinen, ich sei über die Jahre von ihr besessen gewesen und hätte ihren kometenhaften Aufstieg verbittert und mit Argusaugen verfolgt. Doch das stimmt nicht. Ich war sehr beschäftigt und hatte wenig Zeit, an die Frau zu denken oder sie gar zu beneiden, die damals zu den allergrößten Hoffnungen Anlass gegeben hatte. Ich hatte mein eigenes Leben.
Die Stiftung, für die ich arbeitete, erregte großes Interesse in den Kreisen, mit denen ich sympathisierte und deren Wertschätzung und Anerkennung mir wichtig waren. Dann wurde ich von einer kleinen, Erfolg versprechenden Organisation abgeworben, wo wir – auch wenn es nach Eigenlob klingt – Großartiges darin leisteten, Chancenungleichheit und Benachteiligung aufzudecken. Wir beschäftigten uns mit Klassenunterschieden, Bildung, Rasse, Religion, Vorurteilen und schlichter Ignoranz. Schon bald waren unsere Forschungsergebnisse sehr gefragt bei Universitäten, Enthüllungsjournalisten und der örtlichen Verwaltung bis hin zu Aktivisten, Geistlichen und Politikern. Und in dieser Organisation lernte ich Bob kennen.
Danach änderte sich alles für mich. Er hatte die gleichen Träume wie ich, war wie ich überzeugt, dass das Leben kurz war und man sofort handeln musste, wenn man die Welt verbessern wollte. Bob war ein tatkräftiger, begeisterungsfähiger Mann, der an das Gute in den Menschen glaubte. Man musste sie nur ein wenig ermutigen.
Er schien mich ziemlich gernzuhaben. Nein! Hör auf, dich selbst herabzusetzen. Er liebte mich.
Bob liebte mich.
Wenn er zu mir sagte, ich sei wunderschön, fragte ich ihn immer, ob er vielleicht ein Augenproblem habe. Ich rechnete nicht damit, für schön gehalten zu werden. Dass man mich für schwer in Ordnung, hart arbeitend und engagiert hielt, für jemanden mit dem Herz am rechten Fleck – akzeptiert. Aber schön? Nein, das ging zu weit.
Bob wurde dann immer ziemlich ärgerlich. »Margaret, noch ein Wort, und ich verdonnere dich dazu, mit einem Eimer über dem Kopf herumzulaufen, das verspreche ich dir. Du hast wunderschöne, samtbraune, gefühlvolle Augen – könntest du also bitte aufhören, daran herumzukritteln?« Und das tat ich dann auch, weil es für das große Ganze ziemlich unerheblich war, ob meine Augen zu eng beieinanderstanden oder nicht.
Und das Leben meinte es weiterhin gut mit uns. Anlässlich verschiedener Projekte war oft ein Foto von mir in der Zeitung, und meine Eltern waren stolz auf mich. Sie mochten Bob, und nachdem ich sie oft genug mit Blicken durchbohrt hatte, hörten sie sogar auf, mich mit Fragen nach einem Verlobungsring zu löchern.
Bob und ich wohnten in einer kleinen Souterrainwohnung ganz in der Nähe unseres Arbeitsplatzes. Oft trafen wir uns zu Arbeitsbesprechungen in unserem Wohnzimmer, und genau dort kam uns die Idee für ein großartiges Projekt, das wunderbar funktionieren könnte. Architekten, Raumplaner und Bauunternehmer sollten mit ihrem Know-how Freiwillige dabei unterstützen, in Afrika Häuser zu bauen. Wir bekamen Fördergelder von allen möglichen Leuten, und viele Schulen kooperierten mit uns. Das Ganze beflügelte die Fantasie der Menschen.
Sogar die Kunstwelt zeigte Interesse und erklärte sich bereit, landesübliches Design und volkstümliche Wandmalereien zu fördern, um den einzelnen Projekten ein weniger funktionales Aussehen zu geben. Was uns jetzt noch fehlte, war jemand, der bei der Suche nach Sponsoren als öffentliches Gesicht der Kampagne fungierte.
»Eigentlich bräuchten wir jemanden wie Georgia Hall«, meinte Bob. »Wenn wir nur jemanden wüssten, der den Kontakt zu ihr herstellen kann.«
Ich dachte kurz nach, um dann laut zu fragen, ob sie sich überhaupt darauf einlassen würde.
»Das würde sie bestimmt«, erwiderte Bob überzeugt. »Da gehe ich jede Wette ein.«
Na, toll. Ich zögerte unverhältnismäßig lange, doch dann regte sich mein Gewissen.
Ich durfte Georgia Hall dieser Aktion nicht vorenthalten, bloß weil ich sie fürchtete, sie nicht ausstehen konnte und wir eine gemeinsame Vergangenheit hatten. Nein, ich war geradezu verpflichtet, Bob zu sagen, dass ich sie schon lange kannte.
»Du hast nie was gesagt!« Er war verblüfft.
»Du hast nie gefragt«, erwiderte ich lahm.
»Mein Leben ist ein offenes Buch für dich, aber du scheinst ja alle möglichen Geheimnisse vor mir zu haben«, beschwerte er sich. »Gibt es da noch mehr, was du mir verschwiegen hast? Bist du womöglich verheiratet? Bist du Millionärin, dealst du mit Drogen?«
»Okay, Bob, ich schreibe ihr einen Brief«, sagte ich.
Sie antwortete postwendend. Untröstlich, aber bereits zu viele Verpflichtungen … leider absagen … äußerst ehrenwerte Sache … alle guten Wünsche. Dazu ein kurzes, handgeschriebenes PS.
Dass du das bist, Moggie! Ich habe den Namen Margaret nicht gleich erkannt, ich hielt dich für jemand anderen. Aber wenn ich mir die Fotos anschaue, hätte ich es natürlich bemerken müssen.
Dass sie mich immer und überall erkannt hätte, stand nicht da, aber das meinte sie vermutlich.
Zum Teil war ich erleichtert. Na ja, gut, seien wir ehrlich, ich war total erleichtert, dass sie es nicht machen wollte.
Bob blieb unbeeindruckt. »Keine Sorge, ich überrede sie schon«, sagte er zuversichtlich.
Während er sich anschickte, Georgia Hall zu kontaktieren, hatte ich das Gefühl, einen Bleiklumpen im Magen zu haben. All die Kompetenz und Entschlossenheit, die ich an Bob so bewunderte, waren mir nun zuwider, nachdem er eine fünfzehnminütige Besprechung mit ihr in einem Fernsehstudio durchgesetzt hatte. Mehr sei nicht drin für ihn, hieß es. Mehr würde er auch nicht brauchen, behauptete Bob.
Und der Erfolg gab ihm recht: Sie hatte zugestimmt.
»Sie ist sehr intelligent«, sagte er voller Bewunderung, als er heimkam. »Ganz schön aufgeweckt, diese Georgia.«
Ich sah ihn schweigend an, unfähig, zu sprechen. Das Blei aus meinem Magen war in meine Stimmbänder gewandert. Ich fragte mich, was Georgia wohl sah, wenn sie sich meinen Bob anschaute.
Bob war groß, hatte rotblondes Haar und Sommersprossen auf der Nase. Er hatte eine lockere, lässige Art, trug eine Cordjacke und ein gelbes Hemd mit offenem Kragen: Ganz und gar nicht der Typ Mann, mit dem sie sich sonst immer sehen ließ – weder war er weltmännisch noch raffiniert oder aalglatt.
Aber vielleicht war Bobs offensichtliche Redlichkeit neuerdings Mode; möglicherweise sah Georgia – die schon immer jeden Trend gerochen hatte – in ihm die Zukunft. Ein vertrautes Gefühl der Furcht beschlich mich, das jeden vernünftigen Gedanken blockierte. Würde ich mich wieder genauso verhalten? So tun, als wäre es mir egal, als sei ich nicht betroffen?
Hatte es letztes Mal funktioniert?
Nun ja, in gewisser Weise schon: James war zu mir zurückgekommen. Aber da wollte ich ihn nicht mehr. Bei Bob würde das nicht passieren. War James eine Studentenliebe gewesen, hatte ich mir Bob als erwachsene Frau für den Rest meines Lebens ausgesucht. Ich brauchte keinen Verlobungsring oder ein Reihenhaus, die meine Mutter als Garanten einer sicheren Verbindung ansah. Alles, was ich wollte, waren Bobs Liebe und unsere gemeinsamen Zukunftsvisionen.
Und jetzt passierte wieder genau dasselbe. Bei seiner Rückkehr hatte er gesagt, Georgia sei intelligent – ganz schön aufgeweckt, was immer das heißen sollte. Jedenfalls war es der Beweis, dass letztlich nur das Äußere zählte. Wie hatte ich all die Jahre über nur so blind sein können?
An diesem Tag ließ ich mir in einem teuren Laden die Haare schneiden. Der Stylist war ein angenehmer Zeitgenosse, der mir erzählte, dass er und ein paar Freunde als ehrenamtliche Mitarbeiter nach Afrika gehen wollten, um dort Unterkünfte zu bauen. Er hatte ein Zeitungsinterview mit mir gelesen und mich wiedererkannt.
Nach dem Haarschnitt ging es mir besser. Ich erwähnte dem Friseur gegenüber, dass ich meiner Ansicht nach nun weniger schrecklich aussähe als vorher, woraufhin er verunsichert lachte, als hätte ich einen Witz gemacht. Als ich ihn fragte, was er tun würde, wenn er meine kleinen Augen hätte, erwiderte er, seiner Meinung nach seien bei mir sowohl Augen als auch Herz riesengroß und hätten schon ganz viel Gutes bewirkt – was mich so rührte, dass mir dicke Tränen in meine kleinen Augen stiegen und er mir ein Taschentuch geben musste.
Bob traf sich mit Georgia bei ihr zu Hause, um die Details der Aktion zu besprechen.
Den ganzen Tag über versuchte ich, mich auf die Arbeit zu konzentrieren, aber es fiel mir unheimlich schwer. Und später, als er anrief, um mich wissen zu lassen, dass Georgia für sie beide bei sich zu Hause kochen wollte, fiel mir sogar das Atmen schwer.
Als er nach Hause kam, bewunderte er als Erstes meine Frisur.
»Sieht sehr schön aus«, sagte er, weiter nichts.
Vermutlich aus schlechtem Gewissen. Aber ich lächelte matt und hörte mir an, wie er mir von ihrem Scharfsinn, ihrer Raffinesse und tausend anderen guten Eigenschaften vorschwärmte, die er anscheinend an ihr entdeckt hatte.
Tags darauf wollte sie zu uns ins Büro kommen und das Team kennenlernen und nächste Woche nach Afrika reisen.
»Das wird uns einiges kosten, wenn man bedenkt, welche Ansprüche sie hat«, sagte ich säuerlich.
»Aber nein, sie besteht darauf, alles selbst zu bezahlen«, erwiderte er. Er war ihr also bereits verfallen, genau wie alle anderen. Plötzlich verstand ich, warum es Heiler in allen möglichen Gestalten gab und immer noch gibt – als Kummerkastentanten, Berater, Lifestyle-Gurus, alles Menschen die einem dabei helfen sollten, einen noch besseren, noch stärkeren Zauber zu finden, um den Konkurrenten aus dem Feld zu jagen.
Bob redete immer noch über Georgia. Er schien ihre häusliche Umgebung überhaupt nicht wahrgenommen zu haben, nur sie und jedes ihrer Worte.
»Sie hat nur Gutes über dich gesagt«, meinte er dann.
Wie konnte sie es wagen, über mich zu reden, bevor sie meinen Platz einnahm! Ich ertappte mich bei Mordgedanken – gleich morgen, wenn sie ins Büro kam, würde ich sie umbringen. Ich könnte sie ans Fenster locken und hinausstoßen. Oder sie einfach die Treppe hinunterwerfen. Besser ging es mir damit nicht, aber wenigstens wurde ich müde und war im Handumdrehen eingeschlafen.
Am nächsten Tag zog ich mich schick an und legte dickes Make-up auf – aber wie immer blieb Georgia Hall unberechenbar. Sie trug ausnahmsweise Jeans und einen schlichten Pullover und hatte ihr glänzendes blondes Haar mit einem Gummiband zusammengefasst. Geduldig hörte sie zu, als die einzelnen Mitarbeiter unseres Teams beschrieben, welche Arbeit in einer afrikanischen Township geleistet wurde, und ihre grauen Augen wurden dabei immer größer.
Als ich hereinkam, taxierte sie mich von oben bis unten und gab mir das Gefühl, ein wertloser Kunstgegenstand zu sein, den sie sogleich als Fälschung entlarven würde.
»Wirklich, Moggie, was für einen wunderbaren Arbeitsplatz du doch hier hast«, sagte sie.
Die anderen sandten mir neidische Blicke zu. Für sie war diese Frau ein Zauberwesen … ihnen war entgangen, dass der zweite Teil des Satzes noch irgendwo in der Luft hing und ungefähr folgendermaßen lautete: wenn man bedenkt, was für ein hoffnungsloser Fall du bist, dumm und dick …
Und wie ich bereits vorher wusste, war Bob für sie das Wunderbarste an diesem wunderbaren Ort.
»Was für ein Macher!«, sagte sie am Ende seiner Rede über die Arbeit mit den afrikanischen Dorfgemeinden. »Er sollte eine eigene Fernsehsendung bekommen«, säuselte sie. »Bei der Ausstrahlung.«
Mir war schwindlig. Es würde direkt vor meinen Augen geschehen, und ich würde tatenlos zusehen müssen. Bob war kein Macher, er war überzeugt von dem, was er sagte. Doch unter ihrem schlechten Einfluss würde er bald zu einem Selbstdarsteller mutieren, und alles, wofür er gekämpft hatte, wäre verloren.
Ich habe sie natürlich nicht umgebracht; dafür war ich zu müde und zu traurig. Wahrscheinlich brachte ich den Tag – der sich eher wie achtzehn Monate anfühlte – wie auf Autopilot hinter mich. Er schien einfach kein Ende zu nehmen. Und wie ich mir schon gedacht hatte, begleitete Bob sie nach Hause, um noch einmal alle Informationen mit ihr durchzugehen, damit sie für das Interview am Flughafen gerüstet wäre; ihr Flug nach Afrika ging gleich am nächsten Morgen.
Ich wartete auf seinen Anruf, darauf, dass er mir mitteilen würde, er wolle sie begleiten, alles organisieren und beaufsichtigen. Natürlich würde er nicht sagen, dass er dabei sein müsse, um ihre Hand zu halten, doch genau darauf lief es schließlich hinaus.
Als das Telefon klingelte, war ich vorbereitet.
Aber Georgia war dran. Er hatte doch tatsächlich Georgia Hall gebeten, mich anzurufen. Er brachte es nicht einmal fertig, es mir selbst zu sagen. Er wusste, wie schwer es mich treffen würde, also musste sie es für ihn tun.
»Ach, Moggie« – eine Stimme weich wie Samt –, »du hast sooo ein Glück, Moggie, aber ich habe dich ja schon immer beneidet. Immer schon, von Anfang an.«
»Tja, mag sein.« Offensichtlich rechnete sie mit heftigem Widerspruch, nach dem Motto: Unsinn, Georgia, du warst es doch, die wir alle beneidet haben, damals wie heute. Also beschloss ich, das Spiel mitzumachen, so verrückt es auch sein mochte, und das Objekt der Bewunderung zu mimen.
»Du hattest immer alles: Eltern, die sich um dich kümmerten und zu den Schulaufführungen kamen, die sich dafür interessierten, welche Fortschritte du machtest, kleine Brüder, die zu dir aufschauten. Und an der Uni hattest du einen tollen Freundeskreis – echte Menschen, nicht nur Wichtigtuer. Jetzt hast du eine Arbeit, die etwas zählt, die einen Wert hat, statt immer nur Äußerlichkeiten zu bedienen, wie es mein Job ist.«
Daher also pfiff der Wind: Weil mein Leben ein einziges Zuckerschlecken gewesen war, sollte ich zugunsten der armen Georgia, die nie etwas hatte, ohne Murren auf Bob verzichten.
»Ja, und?« Eiseskälte lag in meiner Stimme.
»Bob bat mich, dir auszurichten, dass er auf dem Heimweg ist, von unterwegs aber noch was zum Essen mitbringt. Das nenne ich wahre Liebe.«
Was für eine Heuchlerin! Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich fast geglaubt, dass sie mich tatsächlich beneidete. So aber war mir klar, dass er bald mit dem Essen hier sein, mir aber kaum, dass wir den Wein geöffnet hätten, sagen würde, dass er sie begleiten müsse.
Als er dann kam, sprudelte er nur so über vor Ideen für die morgige Pressekonferenz am Flughafen und fügte hinzu, er hoffe nur, dass Georgia dabei nicht so einen Riesenzirkus veranstalten würde.
»Vielleicht liegt es an mir, womöglich bringe ich das Schlimmste in ihr zum Vorschein. Aber mal im Ernst, sie ist doch wirklich ein schwieriger Fall, oder?«, meinte er.
Ich hatte nicht die geringste Ahnung, worauf er hinauswollte.
»Ich weiß, eigentlich sollten wir Mitleid mit ihr haben«, argumentierte er. »Aber sie führt so ein oberflächliches Dasein und denkt immer nur an sich selbst. Immer muss sie im Mittelpunkt stehen: Was die Leute von ihr halten, was sie anziehen soll, wie sie den Anschein erwecken könnte, sich mit afrikanischer Volkskunst auszukennen – von der sie übrigens nicht die geringste Ahnung hat. Ob sie wohl je mit einem Orden oder einem Ehrenzeichen ausgezeichnet wird? Fragen über Fragen! So etwas macht einen doch wahnsinnig! Kein Wunder, dass du mir nie von ihr erzählt hast.«
Er hatte den Wein inzwischen entkorkt, aber noch nicht verlauten lassen, ob er morgen mit ihr abreisen würde. Doch das käme sicher noch; er wollte mich erst einmal besänftigen, indem er mir erklärte, wie schwach und kraftlos sie war, viel zu schwach, um allein dorthin zu fahren.
Doch er sprach es immer noch nicht aus, und bis zum Ende der Mahlzeit redeten wir weiter über die mediale Aufmerksamkeit, die das Projekt durch sie bekommen werde, und wie traurig es doch sei, zu solchen Tricks greifen zu müssen, um gute Menschen zu guten Taten anzustiften.
Und dann sagte er auf einmal: »Den ganzen Abend über, bei dem einzig und allein ihr Ego und ihr Selbstmitleid im Mittelpunkt standen, sagte sie nur ein einziges Mal etwas wirklich Interessantes, und zwar, dass sie dich immer darum beneidet hätte, wie sicher du dir in allem warst – was du einmal werden wolltest, dass deine Familie und Freunde immer für dich da wären, in deinem Glaube, dass man die Welt verbessern könne. Sie gab zu, immer nur auf Äußerlichkeiten bedacht gewesen zu sein, und dass das nicht unbedingt die richtige Art zu leben war.«
»Das alles hat sie dir anvertraut? Sie muss wirklich eine hohe Meinung von dir haben!« Ich wunderte mich sehr.
»Nun ja, ich habe sie natürlich von Anfang an durchschaut. Ich habe sofort gesehen, dass ihr Image das Wichtigste für sie ist. Damit habe ich sie überzeugen können. Ich habe ihr nämlich klargemacht, dass ihr Stern im Sinken begriffen ist, dass sie zu abgehoben und unbeteiligt wirkt, weil sie nur noch auf der Rennbahn, bei Premieren und auf Partys zu sehen ist. Es sei an der Zeit, sich mit substanzielleren Dingen zu befassen, habe ich ihr erklärt, sie müsse sich für etwas engagieren – und sie hat es mir abgekauft.«
Er lächelte vergnügt.
»Wir kriegen jetzt viel mehr Unterstützung, es werden mehr Häuser gebaut, und generell steht unser Projekt viel besser da, aber, du meine Güte, zu welchem Preis. Komm her und drück mich, das wird mich aufmuntern.«
Als ich ihn umarmte, konnte ich über seine Schulter hinweg mein Spiegelbild erkennen. Vielleicht lag es am Licht, aber möglicherweise hatte ich ja doch schöne samtbraune, gefühlvolle Augen …
Der Nachzügler
Wenn die Kinder alt genug wären, würden sie mit ihm fortgehen, sagte sie. Wie alt ist alt genug?, hatte er wissen wollen. Alt genug, um zu verstehen, hatte sie geantwortet, doch das machte ihn sehr traurig. Sie wären niemals alt genug, um zu verstehen, dachte er, nicht einmal, wenn sie alt wie Methusalem würden. Es ist schlicht nicht zu begreifen, wenn die eigene Mutter mit dem besten Freund der Familie davonläuft. So etwas liegt außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Und so blieben die Dinge eine lange Zeit, wie sie waren.
Die Situation war wirklich sehr außergewöhnlich. Sommers wie winters nahm er jeden Sonntag den mittäglichen Lunch bei der Familie ein, bis auf die drei Sonntage im Jahr, die sie während der Sommerferien im Westen verbrachten. Und zwischendurch sahen sie ihn mindestens ein Mal in der Woche, entweder bei einem seiner Nachtessen, wie er sie nannte, oder sie gingen zusammen ins Theater oder in die National Concert Hall. Und im Sommer bekam er sie sogar noch öfter zu Gesicht, denn sie hatten einen Garten und er nur eine Wohnung, sodass es sich geradezu anbot für ihn, auf einen Drink vorbeizuschauen und zu bewundern, was Rita an diesem Tag wieder im Blumenbeet vollbracht hatte. Früher hatte ihn Gartenarbeit nicht sonderlich interessiert, aber dann hatte er sich ein Buch für Gartenanfänger gekauft und Rita zu ihrer größten Freude bald kluge Fragen gestellt. Meistens war er bereits da, bevor Alec aus dem Büro nach Hause kam. Es lief immer nach demselben Schema ab: Alec parkte den Wagen, sah ihn und freute sich. Manchmal verspürte Frank dabei ein schuldbewusstes Ziehen in der Brust, aber es fiel ihm nicht schwer, dieses Gefühl im Zaum zu halten. Es hatte schließlich keinen Sinn, jemanden zu lieben, wiedergeliebt zu werden und diesem Menschen ein neues Leben in Aussicht zu stellen, wenn man alles mit Schuldgefühlen überschattete und damit zerstörte. Nein, Glück und Zufall hatten hier ihre Hand im Spiel gehabt. Alec hatte Glück gehabt und Rita aus purem Zufall vor Frank kennengelernt, sonst wäre alles anders gekommen, und er hätte Rita geheiratet. Das hatte nichts mit Treulosigkeit zu tun, reiner Zufall war das. Man musste das positiv sehen.
Selbstverständlich traf er sich mit Rita auch am Dienstag zum Mittagessen und donnerstags am Abend. Am Dienstag unternahm Rita immer ihren – wie es offiziell hieß – kleinen Streifzug durch die Geschäfte und musste, wenn sie schon unterwegs war, immer auch die eine oder andere Besorgung für zu Hause erledigen. Dieser Einkaufsbummel hatte bereits eine lange Tradition, ehe Frank einen kleinen Umweg über seine Wohnung einführte. Alles völlig harmlos und unschuldig, das perfekte Alibi, denn sollten sie jemals miteinander gesehen werden, welche Erklärung wäre natürlicher, als dass sie sich zufälligerweise getroffen hatten und in seine Wohnung gegangen waren, um die Neuerwerbungen zu bewundern? Dasselbe galt für den chaotischen Bridge-Unterricht am Donnerstagabend. Frank hatte Rita ausreichend Wissen in diesem Kartenspiel vermittelt, sodass sie nur kurz den vollkommen überfüllten Raum betreten und flüchtig ein paar Leuten, die sie kannte, zunicken musste, ehe sie gleich darauf wieder gehen konnte. Die anderen Spieler waren alle viel zu sehr damit beschäftigt, stirnrunzelnd über ihren Karten zu brüten, um zu bemerken, welchem Tisch, wenn überhaupt, Rita zugeteilt worden war. Die Angelegenheit war narrensicher, um nicht zu sagen, frustrierend, und ging nun schon seit drei Jahren so.
Manchmal, wenn Frank im Büro saß, gab er sich folgendem Tagtraum hin: Bleich im Gesicht tauchte Alec in seiner Wohnung auf und erzählte ihm, dass ihm etwas Schreckliches widerfahren sei. Er, Alec, habe sich hoffnungslos in diese Frau aus Brasilien verliebt und würde in der kommenden Woche mit ihr zusammen das Land verlassen und als Partner in eine Anwaltskanzlei im Zentrum von Rio de Janeiro eintreten. Doch, ja, er spreche ziemlich gut Portugiesisch. Der Haken an der Sache sei lediglich der, dass diese Frau von ihm verlange, jeglichen Kontakt zu seinen Kindern aufzugeben. Und nun überlege er hin und her, ob er Frank wohl bitten könne, ein Auge auf seine Familie zu haben; ob es ihm unter Umständen eventuell sogar möglich wäre, bei ihnen einzuziehen, um sich besser um sie kümmern zu können. Als krönenden Abschluss würde Alec schließlich anmerken, er habe eben erst realisiert, dass er und Rita eigentlich nie rechtmäßig verheiratet gewesen waren, da zum damaligen Zeitpunkt ein Ehehindernis vorgelegen habe.
Frank sah sich bereits in der Rolle des edlen Ritters: ein männlicher Handschlag, gegenseitige Solidaritätsbekundungen, schließlich eine diskrete Hochzeit mit Rita. Und den Kindern gegenüber in der Rolle des starken, väterlichen Freundes: Solche Dinge passieren nun mal, kein Grund, zu harsch mit eurem Vater ins Gericht zu gehen. Schreibt ihm stattdessen lieber ein Mal im Monat einen fröhlichen Brief und berichtet ihm, wie es euch so geht. Ich weiß, ich kann euch den Vater nie ersetzen, würde er sagen, aber ich bin euer Freund. Das bin ich immer gewesen.
Allmählich wird sich so etwas wie Routine einschleichen, von allen akzeptiert, und bald denkt kein Mensch mehr an jene längst vergangenen Dienstage und Donnerstage, Relikte einer kindlichen Vergangenheit. Behutsam wird sich das eine oder andere verändern. Bald würde die Art von Bildern an den Wänden hängen, die ihm und Rita gefielen, und sie würden einen Mann dafür bezahlen, dass er zwei Mal die Woche kam, um die grobe Gartenarbeit zu erledigen, damit Ritas Hände geschont wurden. Statt nach Galway zu fahren, würden sie mit dem Auto auf der Fähre nach Frankreich übersetzen. Es würde Knoblauchbrot und Vinaigrette statt Mayonnaise geben. Und falls das Immobilienbüro ein für sie passendes Haus angeboten bekäme, würde er es eventuell kaufen und ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen. Doch das Haus war nicht wichtig, auch nicht das Essen oder der Urlaub im Ausland. Es waren die Kinder, die zählten – oder zumindest das jüngste, Eoin.
Eoin war schon immer ein ernsthafter, zarter Junge mit großen Augen gewesen. Er sah aus wie diese italienischen Kinder, die in den untertitelten Filmen aus den Fünfzigern reihenweise Herzen und Kassenrekorde brachen. Inzwischen war er neun Jahre alt und sehr einsam. Die anderen beiden waren zwei stämmige Teenager von sechzehn und siebzehn Jahren. Sie hatten keine Zeit für Eoin, der einen Großteil des Sommers im Garten bei seiner Mutter verbrachte, ab dem späten Nachmittag immer in Gesellschaft von Frank. Eoin hatte von sich aus darauf verzichtet, ihn »Onkel« zu nennen. Sein großer Bruder Jim und seine große Schwester Orla fanden das altklug, aber Frank war begeistert. Eine großartige Idee sei das, bei der Anrede käme er sich immer vor wie der Weihnachtsmann persönlich, aber wenn junge Leute ihn Frank nannten, fühle er sich gleich wieder wie ein flotter Jüngling.
Bei der Vorstellung, er könne einmal ein flotter junger Mann gewesen sein, hatten sich die beiden gebogen vor Lachen − eine in seinen Augen völlig überflüssige Reaktion −, aber von da an war er Frank, und das war viel besser. Wenn man vorhat, mit der Mutter eines Kindes davonzulaufen, ist es besser, wenn dieses Kind einen nicht Onkel nennt.
Eoin schien sich immer darüber zu freuen, wenn Frank zu Besuch kam. Dann stellte er ihm bohrende Fragen zu seiner Arbeit bei dem Auktionator. Soll das heißen, da will jemand ein Haus verkaufen und ein anderer will es kaufen, und du bekommst auch noch einen Anteil daran? Das ist ja genial, Frank. Irgendwie hatte Frank das Gefühl, Eoin die Arbeit eines Immobilienmaklers nur unzureichend erklärt zu haben. Aber seinem Vater erging es offensichtlich ähnlich. Alec musste gestehen, dass Eoins Rechtsverständnis der Anwaltskammer den kalten Schweiß auf die Stirn treiben würde. Rita lachte über sie beide. Sie sollten sich mal anhören, wie Eoin mit ihr redete, meinte sie. Er fand es offensichtlich sehr clever von ihr, seinen Daddy geheiratet zu haben, sodass sie jetzt nie mehr arbeiten musste.
Trotzdem waren sie alle drei vernarrt in den Jungen, und Frank und Rita genossen es immer sehr, ihn um sich zu haben, wenn sie sich im Sommer am Nachmittag trafen. Dabei flüsterten sie nie oder steckten verschwörerisch die Köpfe zusammen; sie plauderten wie enge Freunde und lachten wie gute Kumpel. Manchmal blickte Eoin von seinem Buch auf und stimmte in ihr Lachen mit ein.
Von sich selbst erzählte Eoin nicht viel. In der Schule schien er sich recht wohlzufühlen, und es gab ein paar Freunde, die ihn zu Hause besuchten, wenn auch nicht viele. Zumindest nicht genügend, um ihn zu trösten, dachte Frank; nicht genügend, um ihm eine Stütze zu sein, wenn seine Mummy fort wäre. Eoin las für sein Leben gern und wollte zwei Berufe ausüben, wenn er groß war: Er würde Kinderbücher schreiben, die von echten Kindern handelten und nicht von diesen Hampelmännern wie in so vielen Büchern, und in seinem Zweitberuf würde er Schwerverbrechern das Lesen beibringen. Höchstwahrscheinlich in Kalifornien.
Einmal erzählte er allerdings, dass sie ihn in der Schule immer ET nannten. Er klang traurig.
»Das ist wegen deiner Initialen, Eoin Treacy.«
»Nein, ich glaube, das ist wegen meiner Augen«, erwiderte er sachlich. »Als Augen sind sie ein bisschen zu groß geraten, wisst ihr«, erklärte er.
Die drei Erwachsenen, die sich ihre sommerlichen Getränke schmecken ließen, beugten sich zu ihm vor, winkten entrüstet ab und widersprachen heftig. Er lächelte und akzeptierte gnädig ihre Beteuerung, dass seine Augen von großer Schönheit wären.
»Mit diesen Augen könntest du ein Filmstar werden, ein echter Valentino.«
»Ja, aber ist das denn ein richtiger Beruf?«, wollte Eoin wissen.
Bisweilen stellte er gefährliche Fragen. Warum musste Mummy eigentlich immer am Dienstag zum Einkaufen gehen, wenn sie am Freitag ohnehin alle ihre Einkäufe im Supermarkt erledigten? Warum heiratete Frank nicht und bekam seinen eigenen Garten, wo er doch jetzt alles über das Gärtnern wusste? Warum lernte Mummy Bridge bei diesen schrecklichen Leuten in diesem Saal, wo es ihr nicht gefiel, wenn sie nie Bridge spielte? Er schien sich immer zufriedenzugeben mit ihren Antworten. Und plapperte unschuldig weiter. Selbst wenn der Junge nicht Ritas Sohn gewesen wäre, hatte Frank das Gefühl, sich stundenlang mit ihm unterhalten zu können. Er vergaß sogar oft, in welcher Beziehung sie zueinander standen, während der Junge unbekümmert weitersprach.
Es sei nicht leicht für ihn, gestand er Frank, niemanden in seinem Alter zu haben, dass er sich aber glücklich schätze, überhaupt auf der Welt zu sein. Er sei eben ein Nachzügler. Frank hatte gelacht und über die erwachsene Ausdrucksweise des Jungen geschmunzelt, der seiner Ansicht nach bestimmt nicht die geringste Ahnung hatte, was das Wort bedeutete. Doch er sollte sich täuschen. »Als Orla und Jim so sechs, sieben Jahre alt waren, da hatten Daddy und Mummy einen fürchterlichen Streit. Es hieß, entweder sie würden sich trennen oder mich bekommen.«
»So ein Unsinn!« Frank war zutiefst schockiert. Wie konnte ein neunjähriges Kind solche Dinge wissen oder zu wissen glauben. Und außerdem stritten sich Rita und Alec nie. In ihrem gesamten Eheleben hatte es zwar weder viel Liebe noch viel Frohsinn gegeben, das hatte Rita ihm anvertraut, aber viel Streit eben auch nicht. Aus diesem Grund fiel es ihr so schwer, Alec zu verlassen.
»O doch, ehrlich.« Eoin sah ihn aus großen Augen ernsthaft an.
»Aber woher willst du das wissen, selbst wenn es stimmen sollte? Wer hat dir das erzählt?«