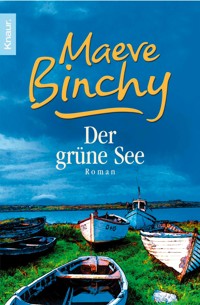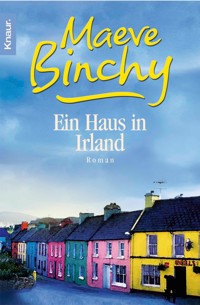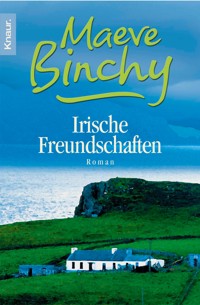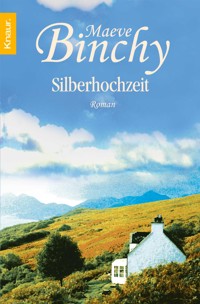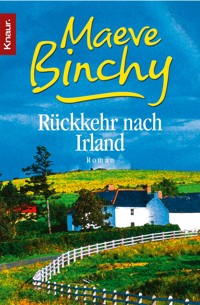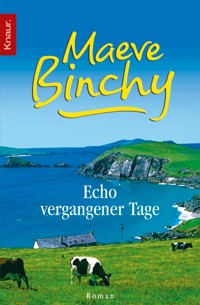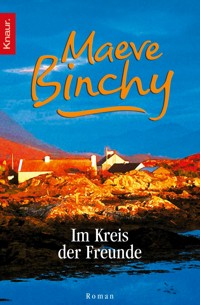6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeden Freitagabend verlässt der fliederfarbene Minibus des jungen Tom Fitzgerald Dublin und bringt sieben Passagiere in die kleine Stadt Rathdoon zurück. Jeder von ihnen - von dem fröhlichen Portier Mikey Burns, der den Clown spielt, während sein Bruder ein Vermögen macht, bis zu Dee Burke, der Tochter des reichen Arztes - hat seinen besonderen Grund, diese kleine Reise zu machen. Rathdoon ist die Art von Stadt, in der die Geschichte jeder Familie bekannt ist und in der Geheimnisse nicht lange geheim bleiben. Als an diesem Freitagabend der kleine Bus in die Stadt hineinfährt, ahnen die Insassen noch nicht, dass dies kein Wochenende wie alle anderen werden wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Maeve Binchy
Jeden Freitagabend
Roman
Aus dem Englischen von Peter Hrabak und Robert A. Weiß, Kollektiv Druck-Reif
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für meinen innig geliebten Gordon
Nancy
Nancy war wie immer überpünktlich, aber sie wollte nicht, daß jemand sie vor der vereinbarten Zeit sah. Es erweckte den Eindruck, als hätte man nichts Besseres zu tun, wenn man viel zu früh dran war und auf den Bus wartete, der einen nach Hause brachte. Die anderen kamen immer atemlos und abgehetzt an, voller Angst, der Bus wäre ohne sie abgefahren. Denn dann hätten sie buchstäblich ihre Chance verpaßt. Punkt achtzehn Uhr fünfundvierzig ließ Tom den Motor des lila Busses an und fuhr los. So konnte er sie alle bis zehn Uhr abends zu Hause absetzen, wie er es versprochen hatte. Wozu am Wochenende heimfahren, wenn man nicht um zehn im Pub ist, lautete seine Devise. Nancy sah das zwar anders, doch sie war immer zwanghaft pünktlich. Es war einfach ihre Art. Sie betrat ein Geschäft, in dem Zeitschriften und Postkarten verkauft wurden. Einen Teil der Karten kannte sie von ihren freitäglichen Besuchen schon auswendig. Auf der großen mit den Tränen darauf stand: »Entschuldige, ich habe Deinen Geburtstag vergessen.« In diesem Laden wurden auch die Zeitungen aus der Provinz angeboten, doch Nancy kaufte niemals eine. Ihre Mutter hatte eine zu Hause, da konnte Nancy sich dann informieren.
Sie begutachtete ihre neue Dauerwelle in dem großen runden Spiegel, der wohl weniger zu diesem Zweck, sondern als Abschreckung für Ladendiebe gedacht war. Er hing hoch oben an der Wand, und zwar in einem ziemlich komischen Winkel. Zumindest hoffte Nancy das; denn andernfalls sah ihre Frisur tatsächlich merkwürdig aus. Ängstlich starrte sie zu ihrem Spiegelbild hinauf. Nein, sie sah doch nicht aus wie ein kleines scheues Tier mit struppigem Haar und schreckgeweiteten Augen! Das wirkte zwar in dem Spiegel so, aber die Leute auf Augenhöhe hatten doch gewiß einen anderen Eindruck von ihr, oder? Aus dieser Perspektive sah jeder lächerlich aus. Als sie sich über das Haar strich, kamen ihr wieder Bedenken wegen der Dauerwelle. Sie erinnerte sie fatal an jene altmodischen Frisuren, die Leute wie ihre Mutter in Rathdoon trugen. Eine Dauerwelle im Sommer, eine zu Weihnachten. Erst krauselig, dann ausgefranst … die hübschen Locken wuchsen im Lauf der Wochen heraus, so daß sie wie ein Wirrwarr von Blitzen oder wie nach einem Stromschlag aussahen. Die Mädchen vom Friseursalon hatten gemeint, ihre Sorgen seien ganz unbegründet. Sie habe eine modische Dauerwelle, das Neueste, was derzeit angeboten werde. Was sie dafür hätte bezahlen müssen! Nancy lächelte grimmig. Dafür bezahlen! So viel Geld! Nancy Morris hätte sich die Dauerwelle nicht für die Hälfte, ja nicht einmal für ein Viertel des Preises legen lassen. Nancy Morris war durch halb Dublin zu einem Friseursalon gefahren, von dem sie gehört hatte, daß Leute zum Üben für die Lehrlinge gesucht wurden. Modelle hatten sie es genannt, aber Nancy sah das nüchterner: Im Grunde brauchten sie lediglich Leute mit Haaren auf dem Kopf. Und findige Leute – wie Nancy – wußten, welche die großen Salons mit vielen Lehrlingen waren und an welchen Abenden sie Unterricht hatten und ihr Können demonstrieren mußten. Seit ihrem Umzug nach Dublin vor sechs Jahren hatte sie nur zweimal für eine Frisur bezahlt. Damit fuhr sie nicht schlecht, dachte sie und lächelte stolz. Und jetzt hatte sie sie eben, diese Dauerwelle, wozu also noch weiter in den Spiegel gucken und sich Sorgen machen? Sie sollte lieber zum Bus hinübergehen. Bestimmt waren jetzt auch ein paar von den anderen angekommen, und es war bereits nach halb sieben.
Tom saß zeitunglesend da. Er blickte auf und lächelte. »Guten Abend, Miss Mouse«, begrüßte er sie freundlich und hob ihren großen Koffer mühelos auf den Dachgepäckträger. Ärgerlich stieg sie ein. Sie konnte es auf den Tod nicht ausstehen, wenn er sie mit »Miss Mouse« anredete, aber es war ihre eigene Schuld. Als sie Tom angerufen hatte, um sich nach einem Platz in seinem Kleinbus zu erkundigen, hatte sie sich als Miss Morris vorgestellt. Nun ja, sie war es eben gewohnt, am Telefon förmlich zu sein – meine Güte, das brachte ihr Beruf mit sich! Wie konnte sie ahnen, daß sie ihren Vornamen hätte sagen sollen und daß er sich bei ihrem Nachnamen schlicht verhört hatte? Aber es störte sie, daß er sie noch immer nicht mit Nancy anredete. Dabei nannte er sogar die alte Mrs. Hickey Judy, obwohl sie seine Mutter hätte sein können.
»Er ist recht leicht dafür, daß er so groß ist«, meinte er heiter. Nancy nickte nur. Sie hatte keine Lust, ihm zu erzählen, daß es ihr einziger Koffer war und sie nicht einsah, warum sie für irgendeine Nylonreisetasche, wie sie die anderen hatten, mindestens fünf Pfund ausgeben sollte. Außerdem brauchte sie einen großen Koffer. Es gab schließlich immer irgend etwas, was sie nach Dublin mitnehmen konnte – zum Beispiel Kartoffeln, das eine oder andere Gemüse oder was sie sonst brauchen konnte. So hatte neulich Mrs. Casey, die Freundin ihrer Mutter, ihre alten Vorhänge ausrangiert; Nancy nahm sie mit nach Dublin, und sie machten sich wunderbar in der Wohnung.
Sie setzte sich in die mittlere Sitzreihe, strich ihren Rock glatt, damit er keine Falten bekam, und holte ihre Traubenzuckerbonbons heraus. Davon standen im Krankenhaus ganze Krüge herum, und man forderte sie immer auf, sich einfach zu bedienen. Normalerweise aß sie sie nicht, aber für die Busfahrt kamen sie ganz gelegen. Die anderen kauften manchmal Gerstenzucker oder Sahnebonbons, aber wozu Geld für Süßigkeiten ausgeben, die man ohnehin nur verschenkte? Sie schlug die Zeitung auf, die ein Patient im Wartezimmer liegengelassen hatte. Auf diese Weise kam sie zu einem großen Teil ihres Lesestoffs – Patienten, die auf ihren Facharzt warteten, neigten dazu, ihre Zeitungen und Zeitschriften zu vergessen. So gab es kaum einen Abend, an dem Nancy nichts zu lesen hatte. Und es war schön, verschiedene Zeitschriften zur Auswahl zu haben, fand sie, immer wieder eine kleine Überraschung. Mairead begriff das nicht. Nancys Miene verfinsterte sich, als sie an Mairead dachte. Da mußte einiges geklärt werden. Es hatte sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen, und es war einfach ungerecht.
Während sie die Zeitung vors Gesicht hielt, damit Tom glaubte, sie lese, vergegenwärtigte sie sich noch einmal, was passiert war. Am Mittwoch war Mairead hereingekommen und nervös in der Wohnung hin und her gelaufen. Sie hatte mal dies, mal jenes angefaßt und es dann wieder hingestellt. Man mußte kein besonderer Menschenkenner sein, um zu bemerken, daß irgend etwas in ihr vorging. Nancy vermutete, sie wollte wieder das Thema mit dem Fernseher aufs Tapet bringen. Sie besaßen einen tadellosen Schwarzweißfernseher, der einen hervorragenden Empfang hatte, auch wenn das Bild manchmal wie bei einem Schneesturm aussah. Warum um alles in der Welt sollte man ein Vermögen ausgeben und ein Farbgerät mieten? Oder gar einen Videorecorder? Mairead hatte einmal eine solche Bemerkung gemacht – als ob sie Krösusse wären! Sie hatte vom Fernseher aufgesehen, der zugegebenermaßen gerade einen schlechten Tag hatte, so daß man einiges nur durch den Ton erraten konnte. Doch Mairead wollte etwas viel Wichtigeres besprechen.
»Ich habe die ganze Woche bei der Arbeit überlegt, wie ich’s dir sagen soll, Nancy. Aber mir fallen nicht die passenden Worte ein, darum sage ich es einfach geradeheraus. Ich will mit jemandem anderen zusammenwohnen, und ich möchte dich bitten, auszuziehen. Natürlich dann, wann es dir paßt, ich will dich nicht auf die Straße setzen …« Sie gab ein kurzes, nervöses Lachen von sich, doch Nancy war zu verblüfft, um darauf zu reagieren. »Schau«, fuhr Mairead fort, »es war ja nicht auf ewig gedacht. Wir wollten es einfach ausprobieren und dann weitersehen … so haben wir’s ausgemacht. So haben wir’s besprochen …« Sie verstummte schuldbewußt.
»Aber wir wohnen seit drei Jahren zusammen«, erwiderte Nancy.
»Ich weiß«, erwiderte Mairead kleinlaut.
»Warum denn auf einmal? Zahle ich nicht immer pünktlich die Miete und den Strom? Ich leiste meinen Beitrag zum Essen mit dem, was ich von zu Hause mitbringe, ich habe Vorhänge für die Flurfenster besorgt, ich …«
»Ja doch, Nancy, das bestreitet ja auch niemand.«
»Aber warum dann?«
»Es ist einfach nur … nein, es gibt keinen bestimmten Grund. Können wir es nicht ruhig und vernünftig hinter uns bringen, ohne Streit und Diskussionen? Kannst du dir nicht einfach eine andere Wohnung suchen, wir treffen uns gelegentlich, gehen ins Kino und besuchen uns gegenseitig? Komm, Nancy, laß uns wie vernünftige erwachsene Leute damit umgehen.«
Nancy hatte vor Zorn gebebt. Mairead, die in einem Blumenladen arbeitete, wollte ihr erzählen, wie sich vernünftige erwachsene Leute verhielten! Mairead mit ihrem mittelmäßigen Abschlußzeugnis warf sie aus ihrer Wohnung hinaus. Maireads Wohnung. Es stimmte, sie hatte die Wohnung gefunden, und als sie eine Mitbewohnerin suchte, hatte ihre Tante – Mrs. Casey, mit der Nancys Mutter befreundet war – Nancy vorgeschlagen. Wer hatte Mairead nur auf diesen verrückten Gedanken gebracht? Und vor allem, warum? Mit wem wollte sie zusammenziehen?
Das Schlimmste war, daß Mairead es weder wußte noch sich darum scherte. Sie meinte nur, sie wolle eine Veränderung. Da schaltete Nancy den flimmernden Fernseher aus, denn sie dachte, Mairead würde ihr nun ihr Herz ausschütten und von irgendeiner unglücklichen Liebe erzählen. Weit gefehlt. Maireads Augenmerk galt dem Kalender. Wie wär’s in einem guten Monat, etwa Mitte Oktober? Bis dahin hätte Nancy doch genug Zeit, sich etwas anderes zu suchen.
»Aber mit wem soll ich denn zusammenziehen?« jammerte Nancy.
Mairead meinte achselzuckend, sie habe keine Ahnung, aber vielleicht fände Nancy ja ein möbliertes Zimmer oder ein kleines Apartment. Da sie nicht oft kochte oder Leute einlud, würde ihr ein Zimmer doch genügen. Aber die kosteten ein Vermögen! Mairead zuckte abermals mit den Achseln, als ginge sie das nichts an.
Am nächsten Morgen trank Nancy in der Küche ihren Tee – sie hielt sich nie mit Frühstücken auf, denn im Krankenhaus gab es immer etwas zu essen. Und wozu arbeitete sie als Empfangsdame für all diese Ärzte, wenn es nicht ein paar Sonderleistungen wie eine Kantine und Traubenzuckerbonbons gab? Als Mairead, die wie immer spät dran war, in die Küche stürmte, fragte Nancy, ob sie ihr verziehen habe.
»Dir verziehen? Was denn? Wovon um Himmels willen redest du?«
»Na, ja, ich muß dir doch irgendwas getan haben, sonst hättest du mich nicht gebeten, aus unserer Wohnung auszuziehen.«
»Es ist meine Wohnung. Stell dich doch nicht so an. Schließlich sind wir nicht miteinander verheiratet, Nancy. Du bist eingezogen, damit wir uns die Miete teilen können. Und das ist jetzt eben vorbei, okay? Punktum.« Sie schlang eine Schüssel Cornflakes hinunter und versuchte gleichzeitig, ihre Stiefel anzuziehen. Mairead liebte diese Stiefel; mit Entsetzen dachte Nancy daran, daß Mairead dafür einen ganzen Wochenlohn ausgegeben hatte – für ein Paar Stiefel!
»Was soll ich denn den Leuten in Rathdoon sagen?« fragte Nancy in ernstem Ton. Mairead sah sie verwundert an.
»Wegen was?« fragte sie verblüfft.
»Warum wir uns trennen.«
»Wen interessiert das schon? Wer weiß denn überhaupt, daß wir zusammen wohnen?«
»Jeder: deine Mutter, meine Mutter, deine Tante Mrs. Casey. Alle.«
»Ja, aber was meinst du damit, was du ihnen sagen sollst?« Mairead war wirklich erstaunt.
»Na, was wird denn deine Mutter denken? Was soll ich ihr sagen?«
Da verlor Mairead mit einem Mal die Geduld. Nancy dachte immer noch mit Schrecken daran zurück.
»Meine Mutter ist eine ganz normale Frau – und eine Mutter wie jede andere auch, einschließlich deiner. Sie wird sich überhaupt nichts denken! Alles, was ihr am Herzen liegt, ist, daß ich nicht schwanger bin, keine Drogen nehme und weiterhin in die Kirche gehe. Das ist alles, was Mütter wissen wollen, Herrgott, nur diese drei Dinge. In Rußland genauso wie in Indien oder sonstwo, und wenn nicht Kirche, dann eben irgendwas anderes. Einer Mutter ist es piepegal, ob ihre Tochter mit jemandem zusammenwohnt und ob sie gut miteinander auskommen oder sich gegenseitig auf die Palme bringen wie in unserem Fall. Sie möchte nur über das Wesentliche Bescheid wissen.«
»Wir bringen uns nicht gegenseitig auf die Palme«, erwiderte Nancy ruhig.
»Na schön, wir gehen uns gegenseitig auf die Nerven. Wo ist da der Unterschied? Warum zerbrichst du dir den Kopf über Erklärungen und Entschuldigungen, als ob du jemandem Rechenschaft schuldig wärst? Es interessiert sie nicht die Bohne!«
»Gehe ich dir auf die Nerven?«
»Ja.«
»Warum?«
»Ach Nancy, bitte!« Mairead rang um Fassung. »Gestern abend haben wir uns doch darauf geeinigt, daß wir wie erwachsene Leute damit umgehen wollen, ohne endlose Streitereien und gegenseitige Vorhaltungen. So haben wir’s ausgemacht, nicht? Und jetzt fängst du damit an. Natürlich geht man sich mitunter auf die Nerven. Ich raube dir wahrscheinlich den letzten Nerv. Aber ich muß jetzt weg.«
Nancy hatte einen furchtbaren Tag hinter sich: Sie hatte sich nach den Preisen für Zimmer und Apartments erkundigt, und sie waren schwindelerregend hoch. Weiter draußen zahlte man natürlich ein bißchen weniger, aber das Krankenhaus mußte für sie mit dem Fahrrad erreichbar sein. Keinesfalls wollte sie ihr sauer verdientes Geld für Busfahrten ausgeben müssen. Sie hatte auch über Maireads Worte nachgedacht. Ihr war einfach unbegreiflich, was Mairead an ihr störte. Sie rauchte nicht, sie lud im Gegensatz zu Mairead nie ungehobelte Kerle ein, die jeder mit einer Flasche Wein ankamen und sich dann später Hühnchen und Pommes frites von der Imbißbude holten. Sie drehte den Plattenspieler nie laut auf – sie besaß nicht einmal Platten! Und immer war sie hilfsbereit. Oft schnitt sie Sonderangebote aus den Zeitungen aus und sammelte Bons für Putz- oder Lebensmittel. Schon mehrmals hatte sie Mairead den Tip gegeben, daß es billiger wäre, die Wochenenden in Rathdoon zu verbringen, denn am Wochenende gab man in Dublin ein Vermögen aus, während man zu Hause umsonst leben konnte. Was fand Mairead nur so ärgerlich an ihr?
Noch an diesem Morgen hatte sie Mairead gefragt, ob ihre Entscheidung endgültig sei, und Mairead hatte wortlos genickt. Nancy hatte ihr das Wochenende als Bedenkzeit angeboten. Doch anders als bei ihrer Tirade am Vortag hatte Mairead mit ruhiger, leiser Stimme geantwortet, es gebe nichts mehr zu bedenken, und sie verlasse sich darauf, daß Nancy kooperativ sein und sich gleich nach einer neuen Wohnung umsehen würde.
Als sie Stimmen hörte, sah Nancy auf. Dee Burke war gekommen; sie trug ihren College-Schal, obwohl sie schon vor zwei Jahren vom University College of Dublin abgegangen war. Die Reisetasche, die sie dabeihatte, schleuderte sie schwungvoll aufs Autodach. Tom lachte.
»Du wirst noch mal Meisterin im Diskuswerfen«, meinte er.
»Nein, damit will ich dir nur zeigen, daß die Frauen heutzutage emanzipiert sind, weiter nichts. Außerdem sind bloß ein paar Höschen und verschiedene Jura-Bücher drin, die ich durchackern muß.«
Nancy staunte, daß Dee, die Tochter von Dr. Burke, die in einem großen, efeubewachsenen Haus wohnte, mit Tom so unbefangen über Höschen reden konnte. Dabei klang ihr Ton nicht einmal derb. Aber Dee hatte immer schon getan, was ihr paßte. Man hätte annehmen können, daß sie ein eigenes Auto besaß, doch sie meinte, als Anwaltslehrling verdiene sie nicht viel. Trotzdem, in Nancys Augen mußten die Burkes diesen Kleinbus eigentlich als unter ihrer Würde empfinden. Sie genossen so hohes Ansehen in Rathdoon, sie mußten es doch merkwürdig finden, daß ihre Tochter mit x-beliebigen Leuten reiste. Dee schien daran nichts zu finden. Sie war zu jedem freundlich, sogar zu Kev Kennedy, diesem schrägen Vogel, bei dessen Anblick man lieber die Straßenseite wechselte. Und auch zu dem unmöglichen Mikey Burns mit seinen schmutzigen Witzen. Aber zu Nancy war Dee immer besonders nett; auch diesmal setzte sie sich neben sie und erkundigte sich, wie so oft, nach Nancys Arbeit.
Daß Dee sich an die Namen der Ärzte, für die Nancy arbeitete, erinnern konnte, war außergewöhnlich. Sie wußte, daß einer Augenarzt, einer orthopädischer Chirurg und einer Hals-Nasen-Ohren-Arzt war. Und sie kannte sogar ihre Namen: Dr. Barry, Dr. White und Dr. Charles. Nicht einmal Nancys Mutter hätte das gewußt, und was Mairead betraf, sie konnte sich kaum die Namen ihrer eigenen Chefs merken, ganz zu schweigen von Nancys Chefs.
Aber Dee war eben nett und wohlerzogen. Höflichkeit war solchen Menschen schon in die Wiege gelegt worden, dachte sich Nancy immer, und es gehörte zu ihren Umgangsformen, sich für andere zu interessieren.
Als nächster erschien Rupert Green. In einer todschicken Lederjacke.
»Allmächtiger, ist die aus Italien, Rupert? Eine echt italienische?« staunte Dee und befühlte den Ärmel, als Rupert einstieg.
»Ja, genau.« Der sonst so blasse Rupert errötete geschmeichelt. »Woran hast du das erkannt?«
»Ich schaue sie mir doch immer sehnsüchtig in den Zeitschriften an! Sie ist phantastisch.«
»Ja, sie ist zwar nur zweite Wahl oder so, aber ein Freund hat sie mir besorgt.« Rupert strahlte, weil er soviel Aufsehen damit erregte.
»Na, wenn es nicht zweite Wahl oder so wäre, müßte dein Vater ja die Kanzlei verkaufen, um es bezahlen zu können«, lachte Dee. Ruperts Vater war der Anwalt von Rathdoon, und über Mr. Green hatte Dee ihre Lehrstelle in Dublin bekommen. Nancy sah die beiden neidisch an. Es mußte wunderbar sein, so ungezwungen miteinander umgehen zu können. Wie eine Art Kurzschrift, in der sich Akademikerfamilien miteinander verständigten; der geringste Anlaß genügte ihnen, um ein Gespräch in Gang zu bringen. Mit einem leichten Anflug von Ärger dachte sie daran, daß ihr lang verstorbener Vater nur Briefträger und nicht Anwalt gewesen war. Doch ihre Verdrossenheit wich sofort Schuldgefühlen. Ihr Vater hatte lang und hart gearbeitet. Und er war froh gewesen, daß seine Kinder in der Schule vorankamen und eine Sekretärinnen- und Angestelltenlaufbahn einschlugen.
Rupert nahm in der hintersten Sitzreihe Platz, und beinahe wie auf ein Stichwort tauchte Mrs. Hickey auf. Braungebrannt im Sommer wie im Winter, wirkte sie gesund und kräftig. Und alterslos. Zwar wußte Nancy, daß sie Ende Fünfzig sein mußte – aber nur, weil sie andere gefragt und sich selbst einiges zusammengereimt hatte. Judy Hickey arbeitete in irgendeinem verrückten Laden, wo Heilkräuter, Körner und Nüsse verkauft wurden. Manches davon baute sie sogar selbst an, deshalb fuhr sie jedes Wochenende nach Hause und brachte ihren Ertrag in diesen Laden in Dublin mit. Nancy war nie dort gewesen; Dee hatte davon geschwärmt und gemeint, jeder sollte ihn sich – nur spaßeshalber – einmal ansehen. Aber Nancy nahm ihre Stellung als Empfangsdame für drei führende Dubliner Fachärzte sehr ernst. Was würde man denn von ihr denken, wenn man sie in irgendeinem Quacksalberladen ein und aus gehen sah?
Judy setzte sich neben Rupert auf die hintere Bank, während Mikey Burns sich in die vordere Sitzreihe zwängte. Lachend und händereibend erzählte er ihnen einen Witz über haarige Tennisbälle. Als alle lächelten, schien er sich zu entspannen, da er immerhin einen seiner anzüglichen Witze losgeworden war. Neugierig schaute er hinaus.
»Habe ich heute Glück und kriege ich die schöne Celia als Nachbarin oder Mr. Kennedy? Ach Gott, was bin ich für ein Glückspilz, da kommt Mr. Kennedy!«
Kev schlich in den Bus und sah sich dabei verstohlen um, als rechnete er damit, daß ihm ein Polizist die Hand auf die Schulter legte und Augenblick mal sagte, wie man es aus Filmen kannte. Nancy dachte, sie hätte noch nie jemanden getroffen, der so ein Heimlichtuer war. Wenn man Kev Kennedy ansprach, erschrak er immer fast zu Tode, und er antwortete recht einsilbig, so daß man ihn lieber in Ruhe ließ.
Zuletzt kam auch Celia. Sie war groß und in gewisser Weise hübsch, aber Nancy gefiel es nicht, wie sie sich zurechtmachte. Sie trug gern enge Gürtel. Da sie diese auch als Krankenschwester bei der Arbeit anhatte, war sie wahrscheinlich daran gewöhnt. Jedenfalls wurde ihre Figur dadurch ziemlich betont. Nicht, daß es sexy wirkte, aber es unterteilte den Körper auf sehr auffällige Weise: in eine obere Hälfte mit herausragender Vorderfront und in eine untere Hälfte mit einem vorspringenden Hinterteil. Sie täte besser daran, etwas Weiteres anzuziehen, dachte Nancy.
Celia setzte sich neben Tom; wer zuletzt kam, nahm immer neben dem Fahrer Platz. Da es erst zwanzig vor sieben war, konnten sie diesmal schon fünf Minuten früher losfahren.
»Ich habe euch gut erzogen«, meinte Tom lachend, als er sich mit dem Kleinbus in den freitagabendlichen Verkehrsstrom einreihte.
»Allerdings. Keine Pinkelpause, bis wir über den Shannon sind«, sagte Mikey und sah sich beifallheischend um. Und da keine Reaktion kam, wiederholte er den Satz. Daraufhin lächelte der eine oder andere.
Nancy erzählte Dee von Dr. Charles, Dr. White und Dr. Barry: daß sie bestimmte Wochentage für Privatpatienten reserviert hätten, daß Nancy die Termine für die Sprechstunden vereinbare und mitunter jemanden einschieben müsse und daß sie von den dankbaren Patienten oft kleine Geschenke zu Weihnachten erhielte. Dee wollte wissen, ob die Ärzte einen guten Ruf genossen und ob die Leute anerkennend von ihnen sprachen. Doch vergeblich suchte Nancy nach Beispielen. Sie sei mehr für das Verwaltungstechnische zuständig, beteuerte sie immer wieder. Als Dee fragte, ob sie mit den Ärzten auch privat Umgang habe, mußte Nancy lachen. In was für eine heile Welt wurde man doch als Arzttochter geboren, wenn einem die Vorstellung fremd war, daß es Standesunterschiede gab! Nein, natürlich hatte sie privat nichts mit ihren Chefs zu tun. Dr. Barry hatte eine kanadische Frau und zwei Kinder, Dr. White hatte mit seiner Gattin, einer Lehrerin, vier Kinder, und Dr. Charles war ebenfalls verheiratet, aber kinderlos. Ja, manchmal telefonierte sie mit den Ehefrauen; sie machten alle einen recht netten Eindruck und kannten auch Nancys Namen. »Hallo, Miss Morris«, begrüßten sie sie immer.
Als Nancy ausführlich von der Telefonzentrale des Krankenhauses berichtete, die ein richtiges Ärgernis sei – schon seit Ewigkeiten wollten sie eine eigene Schaltung für die Fachärzte haben, aber vielleicht würde sich das nach der geplanten Umstrukturierung der Schaltzentrale ändern … da schlief Dee ein. Nancy fand das etwas peinlich. Vielleicht quasselte sie zuviel, vielleicht ging sie anderen auf die Nerven, weil sie zuviel über Belangloses redete. Manchmal stand sogar ihre eigene Mutter mitten im Gespräch mit ihr auf und ging zu Bett. Womöglich hatte Mairead doch recht. Aber nein, das konnte nicht sein – Dee hatte sie ja über ihr Arbeitsleben förmlich ausgequetscht, hatte ihr Löcher in den Bauch gefragt. Nein, diesmal war es nicht Nancys Schuld, wenn sie andere langweilte. Diesmal nicht. Seufzend blickte sie auf die vorbeiziehenden Felder hinaus.
Bald darauf nickte sie ebenfalls ein. Hinter ihr unterhielten sich Judy Hickey und Rupert Green über einen Bekannten, der nach Indien in einen Ashram gegangen war, wo jeder gelbe oder safranfarbene Kleidung tragen mußte. Vor ihr hörte Kev Kennedy mit halbem Ohr zu, wie Mikey Burns einen Kartentrick mit einem Wasserglas erklärte. Mikey meinte, beim Zuschauen könnte man ihn leichter begreifen, aber es ginge auch so, wenn man sich konzentriere.
Ganz vorne sagte Tom gerade irgend etwas zu Celia, und sie nickte zustimmend. Es war recht bequem und warm hier drin, fand Nancy, und falls sie im Schlaf zur Seite kippte und auf Dee landete, na, das wäre halb so schlimm. Sie hätte sich zusammengerissen, wenn sie neben einem der Männer gesessen hätte. Oder gar neben Judy Hickey: diese Frau hatte etwas höchst Sonderbares an sich.
Und dann schlief Nancy ein.
Ihre Mutter saß noch am Küchentisch, als sie hereinkam. Sie schrieb gerade einen Brief an ihre Tochter in Amerika.
»Na, schon da?« meinte sie.
»Gesund und munter«, erwiderte Nancy.
Dafür, daß Nancy eine Fahrt durchs ganze Land hinter sich hatte, fiel die Begrüßung zwischen Mutter und Tochter ziemlich reserviert aus. Doch in ihrer Familie waren Gefühle nie sehr offen gezeigt worden. Man umarmte oder küßte sich nicht, hakte sich nicht vertraulich unter.
»Wie war die Fahrt?« fragte ihre Mutter.
»Ach, das Übliche. Ich habe ein bißchen geschlafen, und jetzt habe ich einen steifen Nacken.« Nachdenklich massierte sie ihr Genick.
»Ist ja prima, wenn man da schlafen kann, während Verrückte in allen Richtungen an einem vorbeirasen.«
»Na, so schlimm ist es nicht.« Nancy sah sich um. »Und, was gibt es Neues?«
Ihre Mutter war nicht gerade das, was man klatschfreudig nennt. Nancy hätte sich gewünscht, sie würde aufstehen, eine Kanne Tee machen und ihr lang und ausführlich von den Ereignissen der Woche erzählen: wer nach Hause gekommen war, von wem man was gehört hatte, wer was über wen zu tratschen wußte. Doch irgendwie kam es immer anders.
»Was soll es Neues geben? Es gibt nichts – du warst doch bis Sonntag abend selbst noch da.« Ihre Mutter widmete sich wieder dem Brief und seufzte: »Schreibst du eigentlich nie an Deirdre? Sollte ein Christenmensch nicht mal an seine Schwester in Amerika schreiben und ihr mitteilen, was so geschehen ist? Sie freut sich über diese Kleinigkeiten, weißt du.«
»Das würde ich auch, aber dir fällt ja überhaupt nichts ein, was du mir erzählen könntest!« rief Nancy vorwurfsvoll.
»Ach, hör doch auf mit dem Unsinn! Bist du denn nicht die ganze Zeit hier? Du fährst doch nur für ein paar Tage die Woche nach Dublin. Aber die arme Deirdre ist auf der anderen Seite des Atlantiks.«
»Die arme Deirdre hat einen Mann und drei Kinder, einen Kühlschrank, eine Gefriertruhe und einen Rasensprenger. Arme Deirdre, kann ich da nur sagen.«
»Das alles könntest du doch selbst haben, wenn du nur wolltest. Du wirst doch nicht neidisch auf deine Schwester sein! Warum bist du nicht mal ein bißchen nett?«
»Bin ich doch.« Nancys Unterlippe zitterte.
»Na, dann hör auf, so häßlich über Deirdre zu reden. Setz dich her und nimm dir ein Blatt Papier, das kannst du dann in meinen Umschlag stecken. So sparst du dir das Porto.«
Ihre Mutter schob ihr einen Schreibblock über den Tisch. Nancy hatte sich noch nicht einmal gesetzt. Draußen auf dem Flur stand noch immer der große Koffer mit den verstärkten Ecken. Was für ein erbärmlicher Empfang zu Hause, ärgerte sie sich insgeheim, doch sie dachte auch praktisch. Wenn sie rasch eine Seite an Deirdre herunterschrieb, dann brauchte sie es ein andermal nicht zu tun; und ihre Mutter würde sich darüber freuen und vielleicht, wenn sie gut gelaunt war, Soda Bread und Apfelkuchen auf den Tisch stellen. Nancy schrieb ein paar Zeilen: Hoffentlich gehe es allen gut, Deirdre und Sean, Shane, April und Erin; sie würde gerne hinüberkommen, um sie alle mal zu sehen, aber die Flugpreise seien reiner Wahnsinn, und es wäre viel einfacher, wenn Deirdres Familie statt dessen hierher käme, wegen dem Kurs zwischen Pfund und Dollar. Sie erzählte Deirdre von Dr. Whites neuem Wagen, daß Dr. Charles seine Ferien in Rußland verbrachte und Dr. Barrys Frau eine neue Handtasche aus Babykrokodil hatte, die sündhaft teuer gewesen war. Dann bemerkte sie, wie schön es sei, an den Wochenenden nach Rathdoon heimzukommen, denn … An dieser Stelle hielt sie inne. Es war schön, nach Rathdoon zu kommen, weil … Sie blickte zu ihrer Mutter, die am Tisch saß und über ihrem Brief brütete. Nein, deshalb fuhr sie nicht nach Hause. Die Freude ihrer Mutter hielt sich in Grenzen, und wenn Nancy nicht da war, hatte sie das Fernsehen, Mrs. Casey, Bingo und soundsoviel anderes. Manchmal, an den langen Sommerabenden, kam Nancy heim, und das Haus war leer, weil ihre Mutter um zehn noch unterwegs war. Im Unterschied zu Celia, Kev oder Mikey fuhr Nancy nicht mit dem Bus nach Hause, um tanzen zu gehen. Sie hatte in Rathdoon nicht das, was man Freunde nennt.
Sie beendete ihren Brief mit den Worten: »Es ist schön, an den Wochenenden nach Rathdoon heimzukommen, denn der lila Bus ist wirklich recht preiswert, und in Dublin gibt man ja am Wochenende ein kleines Vermögen aus, ohne es auch nur zu merken.«
Ihre Mutter packte die Schreibsachen weg, um schlafen zu gehen. Kein Tee, kein Apfelkuchen.
»Ich glaube, ich mache mir noch ein belegtes Brot«, meinte Nancy.
»Hast du denn nichts zum Tee gegessen? Für eine gutbezahlte Sekretärin bist du aber ziemlich schlecht organisiert«, erwiderte ihre Mutter und ging grußlos zu Bett.
Es war ein sonniger Samstag im September. Die Touristen waren größtenteils abgereist, aber ein paar Golfspieler traf man hier immer an. Ziellos schlenderte Nancy die Straße entlang. Sie hätte sich eine Zeitung kaufen und auf einen Kaffee ins Hotel gehen können, aber abgesehen davon, was das wieder gekostet hätte, wollte sie es auch nicht. Es war anmaßend, sich ins Hotel zu setzen – als ob man etwas Besseres wäre. Nein. Da sah sie Celias Mutter, die die Türschwelle des Pub schrubbte. Sie wirkte älter, als sie war, und hatte ein ebenso faltiges Gesicht wie diese zigeunerhafte Judy Hickey. Nancy rief ihr einen Gruß zu, aber Celias Mutter hörte ihn nicht und putzte unbeirrt weiter. Ob Celia wohl noch im Bett lag oder drinnen gerade saubermachte, fragte sich Nancy. Celia arbeitete an den Wochenenden im Pub, deshalb kam sie immer nach Hause. Dafür bezahlte ihr ihre Mutter bestimmt einen ordentlichen Lohn, denn es war hart, wenn man als Krankenschwester die Woche über auf den Beinen war und dann noch das ganze Wochenende hier. Doch bei Celia wußte man nie, woran man war, sie gab nie etwas von sich preis. Merkwürdig, daß sie sich gestern abend im Bus so angeregt mit Tom unterhalten hatte; sonst schaute sie immer nur gedankenverloren aus dem Fenster. Im Unterschied zu der lebhaften Dee, die sich an allem interessiert zeigte. Oft wünschte sich Nancy, es wäre alles anders und sie könnte Dee am Wochenende besuchen oder etwas mit ihr unternehmen. Aber nicht im Traum dachte sie daran, zu den Burkes zu gehen. Nie im Leben käme ihr so etwas in den Sinn. Mit der Praxis war das etwas anderes, das war normal.
Als sie an Judy Hickeys Häuschen vorbeikam, bemerkte sie im Garten dahinter lebhaftes Treiben. Überall lagen große Packkisten herum, und Judy trug eine alte Hose und ein Kopftuch, das ihr hochgestecktes Haar verbarg. Das Haus selbst sah heruntergekommen aus und hätte einen neuen Anstrich gebraucht, doch der Garten war tadellos gepflegt. Zu Nancys Verwunderung gab es immer eine Menge Leute, die für Judy Hickey den Garten gossen, Unkraut jäteten und die Vögel verscheuchten; dabei gehörte sie gar nicht zu der Sorte Frauen, die man sympathisch nennen würde. Sie ging nur jeden vierten Sonntag zur Messe, wenn überhaupt. Und niemals sprach sie von ihrem Mann und ihren Kindern. Sie waren vor Jahren fortgegangen, als der Junge noch ein Baby war; Nancy konnte sich kaum noch an die Zeit erinnern, als in diesem Haus Kinder gelebt hatten. Jedenfalls war der Vater mit den Kindern von einem Tag auf den anderen verschwunden, und die Mutter verlor kein Wort darüber. Sie hatte nie auf gerichtlichem Wege versucht, ihre Kinder zurückzubekommen. Man munkelte, es seien irgendwelche dunklen Geheimnisse im Spiel, an denen sie nicht rühren wollte; sonst wäre sie gewiß vor Gericht gegangen. Und seit Jahren arbeitete sie in diesem Laden, wo man Dinge bekam, die die Gurus im Fernen Osten benutzten und die überhaupt höchst suspekt waren – Ginseng und so etwas. Dennoch schien Judy Hickey mehr als nur ein paar Freunde zu haben. Momentan gingen ihr zwei von Kev Kennedys Brüdern zur Hand, und letzte Woche hatte sich Mikey Burns mit seiner Schaufel nützlich gemacht. Wahrscheinlich wäre auch der junge Rupert dabeigewesen, wenn sein Vater nicht so krank wäre; seinetwegen fuhr er jedes Wochenende nach Hause.
Nancy seufzte und ging weiter. Kurzzeitig kam es ihr in den Sinn, daß sie auch helfen könnte, doch sie verwarf den Gedanken sofort wieder. Warum sollte sie unentgeltlich in Judy Hickeys Garten buddeln und sich dreckig machen? Sie hatte Besseres zu tun. Als sie aber nach Hause kam und eine Nachricht auf dem Küchentisch vorfand, fragte sie sich, ob sie tatsächlich Besseres zu tun hatte. Ihre Mutter hatte geschrieben, Mrs. Casey habe sie zu einem Ausflug abgeholt. Mrs. Casey hatte erst in ihren späteren Lebensjahren den Führerschein gemacht und besaß einen alten, wenig vertrauenswürdig wirkenden Wagen, an dem ihr ganzes Herz hing. Er war für so manche Leute eine Bereicherung ihres Lebens, einschließlich Nancys Mutter; ein paar von ihnen wollten mit diesem Oldtimer sogar die ganze Strecke nach Dublin zurücklegen. Es war geplant, daß Mrs. Casey und Mrs. Morris dort in der Wohnung übernachten würden. Schließlich war Mrs. Casey Maireads Tante. Doch jetzt war es vorbei mit der Wohnung und mit Mairead. Als Nancy daran dachte, gab es ihr einen Stich.
Und nichts zum Mittagessen, kein Hinweis, wann die beiden von ihrem Ausflug zurückkommen würden, kaum etwas in der Vorratskammer oder in dem kleinen Kühlschrank, nichts zu essen im Haus. Nancy setzte einen Topf mit zwei Kartoffeln auf und ging zu Kennedys Laden gegenüber.
»Kann ich bitte zwei kleine Speckscheiben haben?«
»Zwei Pfund haben Sie gesagt?« Kev Kennedys Vater nahm immer nur die Hälfte von dem wahr, was man ihm sagte, denn er hörte in seinem Geschäft unentwegt Radio.
»Nein, nur zwei einzelne.«
»Hm«, meinte er, während er zwei Scheiben nahm und abwog.
»Wissen Sie, meine Mutter hat ihre Einkäufe noch nicht erledigt, und ich weiß nicht genau, was sie will.«
»Mit zwei Scheiben können Sie nicht allzuviel falsch machen«, gab Mr. Kennedy mürrisch zurück, wickelte den Speck in Wachspapier und steckte ihn in eine Tüte. »Jedenfalls kann sie Ihnen nicht vorwerfen, daß Sie die Familie in den Ruin getrieben haben.«
Da hörte Nancy hinter sich jemanden lachen und stellte zu ihrem Verdruß fest, daß Tom Fitzgerald den Laden betreten hatte. Aus irgendeinem Grund konnte sie es nicht leiden, wenn er hörte, wie sich jemand über sie lustig machte. So wie jetzt.
»Oh, Miss Mouse lebt gern auf großem Fuß«, bemerkte er.
Nancy zwang sich zu einem Lächeln und ging.
Der Nachmittag zog sich hin. Im Radio lief nichts, und zu lesen hatte sie auch nichts. Sie wusch zwei Blusen und hängte sie zum Trocknen draußen auf die Leine. Als ihr einfiel, daß niemand, nicht einmal ihre Mutter, eine Bemerkung zu ihrer Dauerwelle gemacht hatte, ärgerte sie sich. Wozu ließ man sich denn eine Dauerwelle legen, wenn es keiner merkte? Da gab man gutes Geld für eine der modischsten Frisuren aus … na, wenn man dafür bezahlen mußte, aber das hatte sie ja glücklicherweise nicht. Um sechs hörte sie das Schlagen von Autotüren und Stimmen.
»Ach, da bist du ja, Nancy.« Ihre Mutter schien immer überrascht, sie zu sehen. »Mrs. Casey und ich haben einen ganz wunderbaren Ausflug gemacht.«
»Hallo, Mrs. Casey. Das ist ja schön«, erwiderte Nancy mißmutig.
»Hast du uns was zum Abendessen gekocht?« Ihre Mutter sah sie erwartungsvoll an.
»Nein. Du hast doch auch gar nichts gesagt. Es war nichts da«, stammelte Nancy verwirrt.
»Ach, komm, Maura, sie macht nur Witze. Du hast deiner Mutter doch bestimmt was gekocht, stimmt’s, Nancy?«
Nancy fand es unerträglich, wenn Mrs. Casey sie in ihrem schelmischen Tonfall wie eine begriffsstutzige Fünfjährige anredete.
»Nein, wie denn auch? Es war nichts zu essen da. Ich habe gedacht, meine Mutter würde sich etwas besorgen.«
Schweigen.
»Und zum Mittagessen war auch nichts da«, beklagte sie sich. »Ich mußte in Kennedys Laden gehen und mir Speckscheiben kaufen.«
»Na, dann essen wir eben Speck zu abend.« Mrs. Morris’ Miene hellte sich auf.
»Ich habe sie alle selbst gegessen«, erklärte Nancy.
»Alle?« Mrs. Casey starrte sie ungläubig an.
»Es waren nur zwei.«
Wieder Schweigen.
»Na gut«, meinte Mrs. Casey. »Damit ist alles klar. Ich wollte deine Mutter überreden, mit zu mir zu kommen, aber sie wollte nicht, weil sie meinte, du hättest bestimmt für uns alle etwas zum Tee zubereitet, und da wollte sie dich nicht enttäuschen. Ich habe ihr gleich gesagt, daß ich das für ziemlich unwahrscheinlich halte, nach allem, was ich gehört habe. Aber sie wollte unbedingt zurück und ließ sich nicht umstimmen.« Sie trat zur Tür. »Komm, Maura, lassen wir die jungen Leute allein … sie haben Besseres zu tun, als unsereins eine kleine Teemahlzeit vorzusetzen.« Nancy sah ihre Mutter an, in deren Gesicht sich Enttäuschung und Scham spiegelten.
»Einen schönen Abend noch, Nancy«, sagte sie. Und schon waren sie zur Tür hinaus. Ächzend und stotternd setzte sich das Auto in Bewegung.
Was hatte Mrs. Casey denn gehört, was meinte sie damit? Die einzigen, von denen sie etwas erfahren haben konnte, waren Mairead oder Maireads Mutter. Was mochten sie ihr erzählt haben – daß Nancy den Leuten auf die Nerven ging? War es das?
Sie wollte nicht zu Hause sein, wenn die beiden heimkamen, aber wohin sollte sie gehen? Sie hatte sich nicht um eine Mitfahrgelegenheit zum Tanzen gekümmert; um nichts auf der Welt würde sie sich an die Straße stellen und die ganze Strecke zur Diskothek per Anhalter fahren. Und wohl fühlen würde sie sich dort sowieso nicht. Immerhin könnte sie in Ryan’s Pub gehen, überlegte sie. Dort würde sie zwangsläufig Bekannte treffen, denn es war ja ihre Heimatstadt, und sie war fünfundzwanzig Jahre alt und konnte tun und lassen, was sie wollte. Also zog sie eine ihrer frisch gewaschenen Blusen an, nachdem sie sie mit großer Sorgfalt gebügelt hatte. Die Dauerwelle stand ihr phantastisch, fand sie. Schließlich besprühte sie sich noch ein wenig mit dem Parfüm, das sie ihrer Mutter zu Weihnachten gekauft hatte, und machte sich auf den Weg.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: