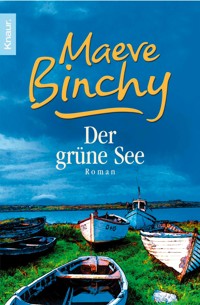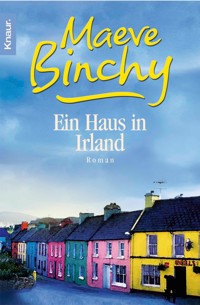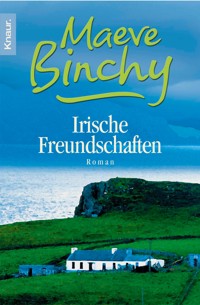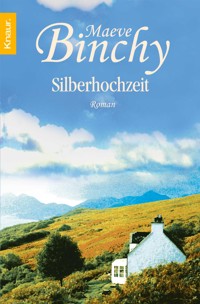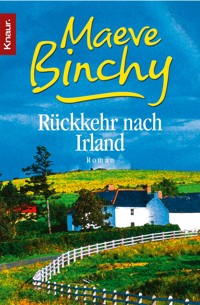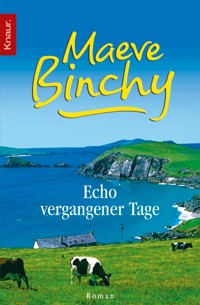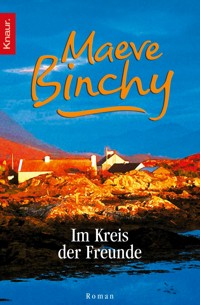6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das irische Städtchen Rossmore scheint am Ende der Welt zu liegen – und doch beherbergt es einen Schatz, zu dem viele Menschen pilgern: die Quelle der Heiligen Anna, die angeblich Wunder wirkt und durch die schon so mancher Wunsch in Erfüllung ging. Doch nun ist eine neue Straße geplant – und die Quelle soll verschwinden. Die Einwohner von Rossmore sind gespalten: Die einen glauben an die wundertätigen Kräfte der Quelle, die anderen halten das für puren Aberglauben. Selbst der junge Kaplan Brian Flynn weiß nicht, wen er unterstützen soll: die Familie von Neddy Nolan etwa, auf dessen Land die Straße verlaufen soll und dem man viel Geld als Entschädigung angeboten hat? Kaplan Brian lernt seine Schäfchen von einer völlig neuen Seite kennen, und Neddy Nolan, im Ort eher als unbedarft und bescheiden bekannt, entwickelt ungeahnte Geisteskräfte – dank der Liebe …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Maeve Binchy
Straße ins Glück
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für meinen geliebten Gordon, den Allerbesten.
Danke für das glückliche Leben an deiner Seite.
Kapitel 1
Die Straße, der Wald und die Quelle
Teil I
Kaplan Brian Flynn, der Vikar von St.Augustine in Rossmore, verabscheute den Festtag der heiligen Anna mit einer Inbrunst, die ungewöhnlich war für einen katholischen Priester. Aber schließlich war er – soweit er wusste – auch der einzige Pfarrer auf der Welt, der mit der munter sprudelnden Quelle der heiligen Anna ein Heiligtum dubiosen Ursprungs in seiner Pfarrei hatte. Hier versammelten sich seine Schäfchen, um die Mutter der Jungfrau Maria zum Eingreifen in vielerlei Angelegenheiten zu bewegen, die größtenteils sehr intimer und persönlicher Natur waren. Einen Verlobten zu finden, gar einen Ehemann, und als Krönung dieser Verbindung noch dazu mit einem Kind gesegnet zu werden, das waren Gebiete, auf die sich ein unbedarfter Priester besser nicht vorwagte.
Rom hüllte sich in der Frage der Quelle wie immer in wenig hilfreiches Schweigen.
Wahrscheinlich hielt Rom sich mit Absicht bedeckt, dachte Kaplan Flynn grimmig. Dort war man sicher froh, dass es in einem zunehmend säkularen Irland überhaupt noch fromme Regungen gab, und wollte diese nicht im Keim ersticken. Doch war man in Rom nicht auch schnell mit der Bemerkung bei der Hand gewesen, heidnische Rituale und Aberglauben hätten in der Kirche nichts zu suchen? Auf diesem Gebiet schien größte Verwirrung zu herrschen, wie Jimmy, der nette junge Arzt aus dem Dorf Doon, einige Meilen entfernt, zu sagen pflegte. Genauso wie in der Medizin: Hier bekam man nie eine Entscheidung, wenn man sie benötigte, nur, wenn man partout keine gebrauchen konnte.
Jedes Jahr am sechsundzwanzigsten Juli strömten die Menschen aus nah und fern herbei, um zu beten und die Quelle mit Girlanden und Blumen zu schmücken. Und so sicher wie das Amen in der Kirche wurde Kaplan Flynn jedes Jahr wieder gebeten, ein paar Worte zu sagen, was ihm stets größtes Kopfzerbrechen bereitete. Er konnte diesen Leuten schlecht erklären, dass es an Götzenverehrung grenzte, wenn sich Hunderte von Gläubigen zu einer Heiligenstatue durchschlugen, von der bereits die Farbe abblätterte und die in einer feuchten Grotte neben einer alten Quelle mitten im Forst von Whitethorn lag.
Seinen Recherchen nach verlor sich die Erinnerung an die heilige Anna und ihren Mann, den heiligen Joachim, weit im Dunkel der Geschichte. Höchstwahrscheinlich verwoben sich ihre Gestalten mit den Erzählungen über Hannah aus dem Alten Testament, die nach langer Kinderlosigkeit den Knaben Samuel gebar. Was immer die heilige Anna zu ihren Lebzeiten vor rund zweitausend Jahren auch getan haben mochte, eines sicher nicht: Sie war nie bis nach Rossmore in Irland gekommen und hatte nie im Wald eine heilige Quelle gesucht und gefunden, die seitdem nie mehr versiegt war.
So viel zumindest war gesichert.
Aber versuchte man, das den Menschen in Rossmore klarzumachen, handelte man sich größten Ärger ein. Und so stand der Pfarrer jedes Jahr wieder da, leierte einen unverfänglichen Absatz des Rosenkranzes herunter und hielt eine kleine Moralpredigt über guten Willen, Toleranz und freundlichen Umgang mit seinen Nachbarn, die zumeist auf taube Ohren stieß.
Auch ohne sich mit der heiligen Anna und ihrer Glaubwürdigkeit befassen zu müssen, hatte Kaplan Flynn seiner Ansicht nach schon genügend Sorgen. Die Gesundheit seiner Mutter ließ zusehends zu wünschen übrig, und der Tag rückte rapide näher, an dem sie nicht länger allein würde leben können. Seine Schwester Judy hatte ihm geschrieben und mitgeteilt, dass er – Brian – sich durchaus für ein eheloses Leben entschieden haben mochte, sie jedoch nicht. Alle ihre Arbeitskollegen seien entweder verheiratet oder schwul; Partnervermittlungen hätten ihrer Erfahrung nach nichts als Psychopathen im Angebot, und bei Abendkursen lernte man nur depressive Versager kennen. Also werde auch sie zu der Quelle bei Rossmore pilgern, hatte sie angekündigt, und die heilige Anna bitten, sich für sie einzusetzen.
Dann war da noch sein Bruder Eddie, der seine Frau Kitty und die vier Kinder verlassen hatte, um sich selbst zu finden. Brian hatte Eddie – der sich mittlerweile bei Naomi, zwanzig Jahre jünger als seine Frau, eingenistet hatte – besucht und dafür nur wenig Dank geerntet.
»Nur weil du kein normaler Mann bist, heißt das noch lange nicht, dass alle anderen ein Keuschheitsgelübde ablegen müssen«, hatte Eddie gehöhnt und ihm ins Gesicht gelacht.
Brian Flynn hatte einen unendlichen Überdruss verspürt. Seiner Ansicht nach war er ein normaler Mann. Natürlich hatte er Frauen begehrt, aber er hatte eine Abmachung getroffen, die im Moment noch besagte, dass er, wenn er Priester sein wollte, auf Ehe, Kinder und ein normales Familienleben verzichten müsse.
Doch eines Tages würde sich diese Regel ändern, wie Kaplan Flynn sich selbst immer wieder gut zuredete. Nicht einmal der Vatikan konnte tatenlos zusehen, wenn so viele seiner Kollegen das Priesteramt wegen einer Vorschrift niederlegten, die von den Menschen und nicht von Gott gemacht war. Zu Jesus’ Lebzeiten waren alle Apostel verheiratet gewesen; erst viel später hatte man die Spielregeln verändert.
Außerdem würden die vielen Skandale in der katholischen Kirche sicher auch den restriktiven konservativen Kardinälen zu Bewusstsein bringen, dass im einundzwanzigsten Jahrhundert Reformen unausweichlich waren.
Die Menschen respektierten die Kirche und ihre Geistlichen nicht mehr zwangsläufig.
Im Gegenteil.
Heutzutage fühlten sich nur noch wenige junge Männer zum Priesteramt berufen. Als Einzige in ihrer Diözese hatten Brian Flynn und James O’Connor acht Jahre zuvor die Priesterweihe empfangen. Und James O’Connor hatte die Kirche mittlerweile wieder verlassen, aus Empörung darüber, dass man einen älteren Priester, der sich an Kindern vergangen hatte, nicht nur geschützt, sondern auch zugelassen hatte, dass er sich durch Vertuschung seiner Taten einer Therapie oder einer Strafe entzog.
Noch war Brian Flynn der Kirche treu, wenn auch nur halbherzig.
Seine Mutter hatte vergessen, wer er war, sein Bruder verachtete ihn, und jetzt machte sich seine Schwester Judy aus London auch noch auf den Weg zu dieser heidnischen Quelle und beabsichtigte, sicherheitshalber am Namenstag der Heiligen zu kommen.
Der für Kaplan Flynns Pfarrei zuständige Stadtpfarrer war ein sanfter, älterer Herr, Kanonikus Cassidy, der den jungen Vikar immer sehr für seine harte Arbeit lobte.
»Ich halte durch, solange ich kann, Brian, bis man dich für alt genug hält, dass sie dir die Gemeinde anvertrauen«, sagte Kanonikus Cassidy oft. Er meinte es gut mit ihm und wollte Kaplan Flynn die Demütigung ersparen, einen arroganten und schwierigen Stadtpfarrer vor die Nase gesetzt zu bekommen. Manchmal fragte sich Brian Flynn jedoch, ob es nicht besser wäre, der Natur ihren Lauf zu lassen und Kanonikus Cassidy in einem Heim für ältere Geistliche unterzubringen und sich irgendjemanden, ganz gleich, wen, zu holen, der ihn bei seinen seelsorgerischen Pflichten unterstützte.
In den letzten Jahren hatte der Zulauf zum Gottesdienst zugegebenermaßen merklich nachgelassen. Aber die Leute mussten immer noch das Sakrament der Taufe und der Kommunion empfangen; sie wollten die Beichte ablegen, wollten heiraten und mussten beerdigt werden.
Doch manchmal – so wie letzten Sommer, als ihm ein polnischer Priester zur Seite gestellt worden war – konnte sich Brian Flynn des Gedankens nicht erwehren, dass er allein doch besser zurechtkam. Der polnische Priester hatte Wochen damit zugebracht, Kränze für die heilige Anna und ihre Quelle zu flechten.
Es war noch nicht lange her, da hatte Flynn die Schülerinnen der St.-Ita-Grundschule gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, Nonne zu werden, wenn sie erwachsen waren. Keine unvernünftige Frage an einer katholischen Mädchenschule. Die Schülerinnen hatten ihn nur verdutzt angesehen; keine schien zu wissen, was er damit meinte.
Schließlich hatte eine von ihnen begriffen. »Sie meinen, wie in dem Film Sister Act?«
Kaplan Flynn hatte das Gefühl, dass sich die Welt definitiv am Abgrund befand.
So manches Mal, wenn er morgens erwachte, erstreckte sich wiederum ein neuer Tag sinnlos lang und verwirrend vor ihm. Trotzdem durfte er nicht nachlassen. Und so duschte er und versuchte, den roten Haarschopf zu bändigen, der ihm stets wirr vom Kopf abstand. Danach brachte er Kanonikus Cassidy eine Tasse Tee mit etwas Milch und eine Scheibe Toastbrot mit Honig.
Der alte Mann bedankte sich jedes Mal so überschwenglich bei ihm, dass Kaplan Flynn sich reich beschenkt fühlte. Er schob die Vorhänge beiseite, schüttelte die Kissen auf und machte eine launige Bemerkung darüber, wie es draußen in der Welt aussah. Anschließend ging er in die Kirche und hielt die tägliche Messe für eine immer kleiner werdende Schar von Gläubigen ab. Das Herz klopfte ihm bis zum Hals, wenn er hinterher bei seiner Mutter vorbeischaute, in banger Erwartung, wie es ihr dieses Mal gehen würde.
Wie immer saß sie am Küchentisch und machte einen verlorenen, desorientierten Eindruck. Und wie immer musste er zunächst erklären, dass er ihr Sohn und Pfarrer in ihrer Gemeinde war, ehe er ihr das Frühstück bereitete, das aus Haferbrei und einem gekochten Ei bestand. Mit schwerem Herzen und schwerem Schritt ging er dann die Castle Street hinunter bis zu Skunk Slatterys Zeitungsladen, wo er zwei Tageszeitungen kaufte: eine für den Gemeindepfarrer und eine für sich. Für gewöhnlich schloss sich daran eine intellektuelle Diskussion mit Skunk an über Themen wie den freien Willen, die Vorherbestimmung oder die Frage, wie ein liebender Gott den Tsunami oder eine Hungersnot zulassen konnte. Im Pfarrhaus war mittlerweile auch Josef, der lettische Pfleger, eingetroffen und hatte Kanonikus Cassidy aus dem Bett gehievt, ihn gewaschen, angezogen und die Kissen aufgeschüttelt. Jetzt saß der Pfarrer bereits im Lehnstuhl und wartete auf seine Tageszeitung.
Später würde Josef mit dem alten Mann langsam bis zur St.-Augustine-Kirche spazieren, wo der Greis mit geschlossenen Augen sein Gebet sprach.
Kanonikus Cassidy verzehrte zum Mittagessen am liebsten eine Suppe, und manchmal ging Josef mit ihm in ein Café; aber meistens nahm er die zerbrechliche kleine Gestalt mit zu sich nach Hause, wo seine Frau Anna dem alten Pfarrer einen Teller mit Hausmannskost servierte. Im Gegenzug revanchierte sich der Gemeindepfarrer mit einer Englischlektion und brachte Anna neue Wörter und Redewendungen bei.
Sein Interesse an Josefs und Annas Heimat war groß; was sei Riga doch für eine schöne Stadt, staunte er jedes Mal, wenn er Bilder davon sah. Josef, der Lette, hatte noch drei weitere Jobs: Er putzte im Zeitungsladen von Skunk Slattery, er holte die Handtücher bei Fabian’s, dem Friseur, brachte sie in den Waschsalon und lieferte sie schrankfertig wieder ab, und zusätzlich fuhr er dreimal die Woche zu den Nolans und half Neddy Nolan dabei, dessen Vater zu versorgen.
Auch seine Frau Anna hatte mehrere Jobs: Sie polierte die Messingteile an den Eingangstüren der Bank und anderen Bürogebäuden mit großen, wichtig aussehenden Türschildern; zur Frühstückszeit erledigte sie in diversen Hotelküchen den Abwasch, und sie packte die Blumen aus, die vom Markt in die Blumenläden geliefert wurden, und stellte sie in große, mit Wasser gefüllte Eimer. Josef und Anna wurden nicht müde, über den Reichtum und die vielen Möglichkeiten zum Geldverdienen in Irland zu staunen. Ein Paar wie sie konnte sich hier ein Vermögen zusammensparen.
Sie hätten einen Fünfjahresplan, wie Josef Kanonikus Cassidy einmal erklärte, und sparten auf einen kleinen Laden außerhalb von Riga.
»Vielleicht kommen Sie uns ja mal besuchen«, schlug Josef vor.
»Ich werde von oben auf Sie herabschauen und Ihre Arbeit segnen«, erwiderte der Gemeindepfarrer nüchtern, der offensichtlich fest mit einem gesicherten Platz im Jenseits rechnete.
Manchmal beneidete ihn Kaplan Flynn.
Der alte Mann lebte in einer Welt der Gewissheiten, in der ein Priester noch wichtig und eine Respektsperson war und in der es auf jede Frage eine Antwort gab. Zu Kanonikus Cassidys Zeiten hatte ein Geistlicher täglich hunderterlei Aufgaben zu erledigen gehabt, und vierundzwanzig Stunden hatten nie ausgereicht.
Zu allen Anlässen im Leben seiner Gemeindemitglieder war der Pfarrer erwünscht gewesen, herbeigesehnt und gebraucht worden. Heutzutage musste man lange warten, ehe man gerufen wurde. Früher hatte Cassidy unaufgefordert und unangemeldet Zutritt zu jedem Haus in seiner Gemeinde gehabt. Kaplan Flynn hatte gelernt, zurückhaltender zu sein. Im modernen Irland gab es sogar in einer Stadt wie Rossmore viele, denen der Anblick eines katholischen Priesterkragens vor der Tür nicht willkommen war.
Als Brian Flynn auf die Castle Street hinaustrat, hatte er gerade mal ein halbes Dutzend Termine vor sich. Eine polnische Familie wartete auf ihn, um die Taufe ihrer Zwillinge am kommenden Sonntag zu besprechen. Ob er die Zeremonie draußen an der Quelle abhalten könne, wollten sie wissen. Kaplan Flynn versuchte, seine Verstimmung zu verbergen. Nein, die Taufe würde wie üblich am Taufbecken in der Kirche von St. Augustine stattfinden.
Von dort aus fuhr er ins Gefängnis, da ein Insasse um einen Besuch gebeten hatte. Aidan Ryan war ein gewalttätiger Schläger, dessen Frau nach langen Jahren endlich ihr Schweigen gebrochen hatte. Der Gefangene zeigte weder Reue noch Bedauern, sondern wollte nur eine verworrene Geschichte loswerden, dass alles ihre Schuld gewesen sei, da sie vor vielen Jahren ihr Kind an irgendeinen Passanten verkauft habe.
Anschließend brachte Kaplan Flynn das heilige Sakrament in eine Seniorenresidenz außerhalb von Rossmore, die den lächerlichen Namen »Farn & Heidekraut« trug. Die Leiterin war der Ansicht, in einem multikulturellen Irland würde es sich besser anhören, wenn nicht alles nach einem Heiligen benannt war. Die Bewohner schienen erfreut, den Pfarrer zu sehen, und zeigten ihm stolz die Resultate ihrer Gartenarbeit. Früher waren alle Altenheime von Nonnen geleitet worden, aber diese Poppy, wie die jetzige Leiterin hieß, schien in jeder Hinsicht ein gutes Händchen zu haben.
Kaplan Flynn besaß ein altes, verrostetes Auto, das ihn noch überallhin brachte. Da der Verkehr meist stark und Parkplätze eine Rarität waren, benutzte er es innerhalb von Rossmore jedoch nur selten. Es gab Gerüchte von einer breiten Umgehungsstraße für die schweren Lastwagen, und bereits im Vorfeld war die Bevölkerung in zwei verfeindete Lager gespalten. Die einen waren der Meinung, die geplante Straße würde alles Leben aus dem Ort verbannen, die anderen erhofften sich, dass Rossmore dadurch wieder etwas von seinem ursprünglichen Charakter zurückbekäme.
Kaplan Flynns nächster Besuch galt den Nolans, einer Familie, die er sehr mochte. Der Alte, Marty, war lebhaft und umtriebig und hatte viele Geschichten über die Vergangenheit auf Lager. Von seiner verstorbenen Frau sprach er, als sei sie noch am Leben, und oft erzählte er Kaplan Flynn von der Wunderheilung an der Quelle der heiligen Anna, die ihr noch weitere vierundzwanzig gute Jahre geschenkt hätte. Auch sein Sohn war ein anständiger Kerl, und er und seine Frau Clare schienen ihn immer gern zu sehen. Kaplan Flynn hatte bei ihrer Hochzeit vor einigen Jahren dem Kanonikus assistiert.
Clare arbeitete als Lehrerin in St. Ita und erzählte dem Priester, dass in der Schule Gerüchte über die neue Straße um Rossmore die Runde machten. Sie beabsichtige sogar, in ihrer Klasse eine Projektarbeit darüber anfertigen zu lassen. Außergewöhnlich daran sei, wie man so munkeln hörte, dass die Straße genau durch ihr Grundstück verlaufen solle.
»Ja, aber dann bekommen Sie doch eine hohe Entschädigung, wenn sie durch Ihr Land verläuft, oder?«, meinte Kaplan Flynn. Wie erfreulich, dass auch einmal gute Menschen noch in diesem Leben belohnt werden sollten.
»Aber, Herr Kaplan, wir werden nie zulassen, dass sie über unser Land führt«, sagte Marty Nolan. »Nicht in einer Million Jahren.«
Kaplan Flynn staunte nicht schlecht. Normalerweise beteten kleine Farmer geradezu um einen warmen Regen wie diesen, um ein kleines Vermögen, das ihnen einfach in den Schoß fiel.
»Wenn die Straße hier verläuft, bedeutet das, dass sie eine Schneise durch die Whitethorn Woods schlagen müssen«, erklärte Neddy Nolan.
»Und das heißt, dass auch die Quelle der heiligen Anna verschwinden muss«, fügte Clare hinzu. Sie musste nicht extra betonen, dass diese Quelle ihrer Schwiegermutter fast ein viertel Jahrhundert zusätzliche Lebenszeit geschenkt hatte. Die Tatsache hing unausgesprochen in der Luft.
Mit schwerem Herzen stieg Kaplan Flynn in sein kleines Auto. Diese verrückte Quelle würde erneut die Stadt in zwei Lager spalten. Bald wäre sie wieder in aller Munde, und man würde ihren Nutzen diskutieren, alles, was für und was gegen sie sprach. Wären doch nur die Bulldozer gekommen und hätten die Quelle über Nacht einfach zugeschüttet, wünschte er sich mit einem tiefen Seufzer. Das würde ihnen eine Menge Probleme ersparen.
Er fuhr weiter zu seiner Schwägerin Kitty. Wenigstens einmal in der Woche versuchte er, diesen Besuch einzuschieben, um ihr zu zeigen, dass nur Eddie, nicht die ganze Familie, sie im Stich gelassen hatte.
Kitty war in keiner guten Verfassung.
»Ich nehme an, du willst was zu essen«, sagte sie unfreundlich. Brian Flynn sah sich in der unordentlichen Küche mit dem schmutzigen Frühstücksgeschirr, den Stapeln Kinderkleidung auf den Stühlen und jeder Menge anderem Krimskrams um. Keine sehr einladende Umgebung.
»Nein, lass mal«, erwiderte er und suchte sich einen Stuhl.
»Tut dir wahrscheinlich ganz gut, wenn du nichts mehr isst. Die füttern dich sicher überall, wo du hinkommst, als ob du am Verhungern wärst. Kein Wunder, dass du zulegst.«
Brian Flynn fragte sich, ob Kitty immer schon so griesgrämig gewesen war. Er konnte sich nicht erinnern. Vielleicht hatte sie Eddies Hinwendung zu der sexy jungen Naomi so verändert.
»Ich war vorhin bei Mutter«, begann er zaghaft.
»Hat sie den Mund aufbekommen?«
»Wenig, und die paar Worte haben auch kaum einen Sinn ergeben.« Er klang müde.
Aber Kitty hatte kein Mitgefühl für ihn übrig. »Na, du kannst keine Krokodilstränen von mir erwarten, Brian. Als sie noch alle beisammen hatte, war ich ihr nie gut genug für ihren fabelhaften Sohn Eddie. Und jetzt kann sie von mir aus allein mit allem fertig werden. So sehe ich das.« Kittys Gesicht war hart. Ihre Strickjacke hatte Flecken, und ihr Haar war stumpf.
Einen flüchtigen Moment lang empfand Kaplan Flynn fast so etwas wie Mitgefühl für seinen Bruder. Wenn man die Wahl hatte wie Eddie, war Naomi allemal die bessere und unterhaltsamere Alternative. Aber als in seinem Kopf Begriffe wie »Pflicht«, »Kinder« und »Ehegelübde« aufleuchteten, verbannte er diesen Gedanken ganz schnell wieder.
»Lange kommt Mutter nicht mehr allein zurecht, Kitty. Ich überlege mir, ihr Haus zu verkaufen und sie in ein Heim zu bringen.«
»Nur zu, von mir aus kannst du machen, was du willst. Ich habe mir ohnehin nie was von dem Haus erwartet.«
»Ich werde mit Eddie und Judy darüber reden. Mal hören, was sie davon halten«, sagte er.
»Judy? Oh, hat sich ihre Ladyschaft drüben in London vielleicht doch mal ans Telefon bequemt?«
»Sie kommt in ein paar Wochen nach Rossmore«, erklärte Kaplan Flynn.
»Sie braucht nicht glauben, dass sie hier wohnen kann.« Kitty schaute sich besitzergreifend um. »Das ist mein Haus, alles, was ich habe. Eddies Familie hat kein Recht, sich hier breitzumachen.«
»Nein, sie hat sicher nicht einen Moment daran gedacht, dich hier … äh … dich von hier zu vertreiben.« Er hoffte, sein Tonfall würde nicht darauf schließen lassen, dass Judy nie an einem solchen Ort bleiben würde.
»Wo will sie dann hin? Bei dir und dem Kanonikus geht es auf keinen Fall.«
»Nein, in eines der Hotels, nehme ich an.«
»Tja, Lady Judy kann sich das ja leisten. Unsereins natürlich nicht«, fügte Kitty schniefend hinzu.
»Wegen Mutter, da habe ich an ›Farn & Heidekraut‹ gedacht. Ich war heute dort, die Leute kommen mir recht zufrieden vor.«
»Aber das ist doch ein protestantisches Heim, Brian. Der Pfarrer kann doch seine eigene Mutter nicht zu Protestanten geben. Was werden die Leute sagen?«
»Das ist kein protestantisches Heim, Kitty«, erwiderte Flynn nachsichtig. »Es ist für Menschen jeglicher Konfession, auch für solche ohne.«
»Das kommt auf dasselbe raus«, schnauzte Kitty.
»Ganz und gar nicht. Ich habe den Heimbewohnern heute erst die heilige Kommunion gebracht. Nächste Woche soll dort eine Abteilung für Alzheimer-Patienten eröffnet werden. Ich dachte mir, wenn vielleicht du oder sonst jemand sich das mal anschauen möchte …« Er klang genauso müde, wie er sich fühlte.
Kittys Miene wurde weicher.
»Du bist kein schlechter Kerl, Brian, nicht du als Mensch. Dein Leben ist nur ziemlich beschissen, da keiner mehr Respekt vor Priestern hat.« Sie meinte es nur gut, er wusste es.
»Manche Leute respektieren uns schon noch ein bisschen«, erwiderte er mit einem dünnen Lächeln und stand auf, um zu gehen.
»Wieso bleibst du überhaupt noch bei dem Verein?«, fragte sie, während sie ihn zur Tür begleitete.
»Weil ich ihm mal beigetreten bin, weil ich mich verpflichtet habe. Und weil ich manchmal, wenn auch sehr selten, Gutes bewirken kann.« Er schaute zerknirscht zu Boden.
»Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich dich sehe«, tröstete ihn Kitty Flynn hölzern, und ihren Worten war unschwer zu entnehmen, dass sie wahrscheinlich die Einzige in Rossmore war, die auch nur im Entferntesten so etwas wie Freude bei seinem Anblick empfand.
Kaplan Flynn hatte Lilly Ryan versprochen, im Anschluss an den Besuch im Gefängnis bei ihr vorbeizuschauen und ihr zu erzählen, wie es ihrem Mann Aidan erging. Sie liebte ihn immer noch und hatte es oft bereut, gegen ihn ausgesagt zu haben. Aber es war das einzig Vernünftige gewesen, denn irgendwann waren die Schläge immer brutaler geworden, und sie war im Krankenhaus gelandet. Und schließlich hatte sie drei Kinder zu ernähren.
Flynn fühlte sich nicht in der Stimmung, mit ihr zu reden. Doch seit wann hätte seine Stimmung je eine Rolle gespielt, dachte er, als er in die kleine Straße einbog.
Der jüngste Sohn, Donal, besuchte im letzten Jahr die Brothers School und war sicher nicht zu Hause.
»Auf Sie kann man sich wirklich verlassen, Herr Pfarrer.«
Auch Lilly war hocherfreut, ihn zu sehen. Wenigstens ein Trost, als verlässlich zu gelten, auch wenn er keine guten Nachrichten für sie hatte.
Die Küche in diesem Haus unterschied sich sehr von der, die er eben verlassen hatte. Hier standen Blumen auf dem Fensterbrett und glänzende Kupferpfannen und Töpfe in den Regalen; in einer Ecke befand sich ein kleiner Schreibtisch, an dem Lilly Kreuzworträtsel entwarf, eine Arbeit, mit der sie sich ihren kargen Lebensunterhalt verdiente. Alles war penibel aufgeräumt.
Auf dem Tisch stand ein Teller mit Gebäck.
»Darauf verzichte ich besser«, lehnte der Priester bedauernd ab. »Ich musste mir gerade anhören, dass ich zu dick bin.«
»Ach, das stimmt doch nicht.« Sie achtete nicht auf seinen Einwand. »Außerdem könnten Sie sich das bisschen doch oben im Wald ablaufen, oder nicht? Aber sagen Sie mir lieber, wie ging es ihm heute?«
Mit aller Diplomatie, zu der er fähig war, versuchte Kaplan Flynn, aus seiner vormittäglichen Begegnung mit Aidan Ryan eine Unterhaltung zu konstruieren, die der Frau, die er geschlagen hatte und die zu sehen er sich jetzt weigerte, zumindest ein wenig Trost spenden würde. Seine Frau, von der er allen Ernstes glaubte, sie habe ihr ältestes Kind an einen Passanten verkauft.
Kaplan Flynn hatte sich alle über den Fall erschienenen Zeitungsberichte angesehen. Damals vor zwanzig Jahren war das kleine Mädchen der Ryans mitten in der Stadt aus dem Kinderwagen verschwunden, der vor einem Geschäft abgestellt gewesen war.
Man hatte das Baby nie gefunden, weder lebend noch tot.
Ein Klischee nach dem anderen bemühend, schaffte es Flynn immerhin, dem Gespräch eine optimistische Wendung zu geben: Der Herr sei gütig, man wisse nie, was noch käme, jeder Tag wolle aufs Neue gelebt werden.
»Glauben Sie eigentlich an die heilige Anna?«, fragte Lilly plötzlich und brachte ihn aus dem Konzept.
»Äh, ja, ich meine, natürlich glaube ich, dass die heilige Anna existiert hat und all das …«, stammelte er und fragte sich, wohin das noch führen sollte.
»Aber glauben Sie wirklich, dass sie dort an der Quelle sitzt und unsere Bitten erhört?« Lilly ließ nicht locker.
»Alles ist relativ, Lilly. Die Quelle ist seit Jahrhunderten ein Ort großer Frömmigkeit, und das allein erzeugt bereits eine gewisse spirituelle Aufladung. Und natürlich ist die heilige Anna im Himmel und, wie alle Heiligen, die sich für uns einsetzen …«
»Ich weiß, Herr Pfarrer, ich glaube auch nicht an die Quelle«, fiel Lilly ihm ins Wort. »Aber ich war vorige Woche oben, und ehrlich gesagt, es ist schon erstaunlich, dass heutzutage so viele Leute dorthin pilgern. Sie würden es nicht für möglich halten.«
Kaplan Flynn bemühte sich, einen Ausdruck freudigen Erstaunens auf sein Gesicht zu zaubern. Mit wenig Erfolg.
»Ich weiß, Herr Pfarrer, mir ging es früher wie Ihnen. Ich bin jedes Jahr zu Teresas Geburtstag hinaufgegangen. Sie wissen, mein kleines Mädchen, das lange, bevor Sie zu uns in die Pfarrei kamen, spurlos verschwunden ist. Normalerweise würde ich mir nicht viel dabei denken, aber irgendwie habe ich letzte Woche die Sache plötzlich anders erlebt. So als ob mir die heilige Anna wirklich zuhören würde. Ich habe ihr von den vielen Problemen erzählt, die wir haben, und dass der arme Aidan seit damals nicht mehr richtig im Kopf ist. Aber in erster Linie habe ich sie darum gebeten, mir ein Zeichen zu geben, dass es meiner Teresa gut geht, wo immer sie auch ist. Wenn ich wüsste, dass sie irgendwo glücklich ist, könnte ich alles ertragen.«
Stumm und unfähig zu irgendeiner hilfreichen Bemerkung, sah Kaplan Flynn die Frau an.
»Ich weiß, Herr Pfarrer, ich weiß, dass manche Leute behaupten, sie hätten erlebt, dass Heiligenbilder sprechen und Statuen sich bewegen und solchen Unsinn, aber da war was, Herr Pfarrer, da war wirklich was.«
Wortlos nickte er, um sie zum Weiterreden zu ermutigen.
»Es waren ungefähr zwanzig Leute da und haben ihr Anliegen vorgebracht. Eine Frau hat so laut gesprochen, dass alle sie gehört haben: ›Oh, heilige Anna, mach bitte, dass er mir nicht weiter die kalte Schulter zeigt und mich nicht links liegen lässt …‹ Jeder konnte sie hören und alles über sie erfahren. Aber keiner hat auf den anderen geachtet. Wir waren alle mit uns selbst beschäftigt. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass es Teresa gut geht, dass sie vor ein paar Jahren groß ihren einundzwanzigsten Geburtstag gefeiert hat und wohlauf und glücklich ist. So, als würde mir die heilige Anna zu verstehen geben, dass ich mir keine Sorgen mehr zu machen bräuchte. Ja, ich weiß, es klingt lächerlich. Aber es hat mir wahnsinnig gutgetan, und was ist schon dabei?«
»Wäre doch nur der arme Aidan dabei gewesen«, fuhr sie fort, »als die Heilige mir ein Zeichen gegeben hat. Es hätte ihm Frieden geschenkt.«
Unter vielen Beteuerungen, dass die Wege des Herrn unergründlich seien, und mit einem Zitat von Shakespeare, dass es – laut Horatio – mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gebe, als man sich träumen ließe, suchte Kaplan Flynn das Weite. Er verließ das kleine Haus und fuhr hinauf an den Waldrand der Whitethorn Woods.
Auf seinem Weg durch den Wald kamen ihm Spaziergänger mit Hunden entgegen und grüßten ihn, auch Jogger in Trainingsanzügen, die sich die Bewegung verschafften, die er laut seiner Schwägerin offensichtlich so dringend nötig hatte. Frauen schoben Kinderwagen vor sich her, und er blieb stehen, um ihren Nachwuchs zu bewundern. Wie der Kanonikus immer zu sagen pflegte: Sah man sich unverhofft einem fremden Kleinkind gegenüber, bot die launige Frage: »Na, wen haben wir denn da?«, stets einen hervorragenden Ausweg aus dem Dilemma. Man legte sich nicht fest, was das Geschlecht des Kindes betraf, und kaschierte gleichzeitig ein schlechtes Namensgedächtnis. Die Mütter gaben meist bereitwillig Auskunft, und von da an konnte man improvisieren nach dem Motto: Prachtvoller Bursche, oder: Ist sie nicht ein richtiger kleiner Schatz?
Unter den Leuten, die dem Pfarrer begegneten, war auch Cathal Chambers, der Leiter der örtlichen Bankfiliale, der mit der Absicht in den Wald gekommen war, seine Gedanken zu sortieren.
Offensichtlich rannten ihm die Leute regelrecht die Filiale ein. Alle wollten sich Geld leihen, um im Wald Land zu kaufen, das sie dann mit großem Profit wieder weiterverkaufen könnten, sobald die neue Straße genehmigt wurde. Schwer zu sagen, wie er vorgehen sollte. Die Zentrale seiner Bank gab Chambers zu verstehen, dass er der Verantwortliche sei und ein Gespür für die Vorgänge vor Ort haben müsse. Aber wie konnte man für so etwas ein Gespür haben?
Myles Barry, der Anwalt, habe das gleiche Problem, erzählte er. Bereits drei verschiedene Parteien seien an ihn herangetreten und hätten ihn gebeten, den Nolans ein Angebot für ihre kleine Landwirtschaft zu unterbreiten. Aus reiner Habgier. Gewinnsucht und Spekulation, mehr stecke nicht dahinter.
Kaplan Flynn bescheinigte Chambers, wie erfrischend es sei, einem Bankmenschen zu begegnen, der so dachte, aber Cathal erwiderte bedauernd, dass man in der Zentrale leider völlig anderer Ansicht sei.
Auch Skunk Slattery war mit seinen beiden Windhunden unterwegs und trat mit spöttischem Grinsen auf Kaplan Flynn zu.
»Na, so was, Herr Pfarrer, jetzt pilgern auch Sie schon zu der heidnischen Quelle, in der Hoffnung, dass die alten Götter das zustande bringen, wozu die heutige Kirche nicht mehr fähig ist«, zog er den Priester auf, während seine beiden knochigen Windhunde vor Empörung – wie es schien – zitterten.
»Ganz recht, Skunk, ich hab’s mir immer schon gern einfach gemacht«, stieß Kaplan Flynn hervor und setzte ein starres Lächeln auf, bis Skunk sich wieder beruhigt hatte und ein paar Minuten später mit den zitternden Hunden weitergegangen war.
Danach eilte Flynn mit düsterer Miene weiter; es war das erste Mal, dass er sich aus eigenem Antrieb auf den Weg zur Quelle machte. Bisher war er immer nur mit seiner Gemeinde hier gewesen, eher widerwillig und zerstreut und ohne je seine eigene Meinung zu äußern.
Mehrere Holzschilder, die im Lauf der Jahre von frommen Pilgern angebracht worden waren, wiesen den Weg zu der Quelle, die sich in einer hohen, höhlenartigen Grotte befand. Hier drinnen war es feucht und kalt; Wasser strömte die rückwärtige Felswand herab, und dort, wo die Gläubigen mit einer alten, eisernen Kelle Wasser aus der Quelle geschöpft hatten, war der Boden schlammig und voller Spritzer.
Es war mitten unter der Woche, und Flynn rechnete nur mit wenigen Bittstellern.
Die Weißdornbüsche vor der Grotte waren mit Stofffetzen, Zetteln und Bändern geschmückt. Ja, geschmückt war das einzige Wort, das dem Anblick gerecht wurde, dachte der Kaplan. Daneben entdeckte er Medaillen und Wundermittel, von denen einige in Plastik oder Zellophan eingeschweißt waren.
Das waren die Fürbitten an die Heilige, die Wünsche, die in Erfüllung gehen sollten. Hier und da hingen auch Dankesschreiben für einen gewährten Gefallen.
»Er ist jetzt seit drei Monaten trocken, heilige Anna. Ich danke Dir und bitte Dich, gib ihm die Kraft, dass er durchhält…«
Oder:
»Der Mann von meiner Tochter will die Ehe annullieren lassen, wenn sie nicht bald schwanger wird…«
Oder:
»Ich fürchte mich davor, zum Arzt zu gehen, weil ich blutigen Auswurf habe. Bitte, heilige Anna, setz Dich bei unserem Herrn dafür ein, dass ich wieder gesund werde. Dass es nur eine Infektion ist, die wieder vergeht …«
Eine immer stärker werdende Röte überzog Kaplan Flynns Gesicht, während er dastand und das alles las.
Man schrieb das einundzwanzigste Jahrhundert in einem Land, das immer schneller verweltlichte. Wo kam all der Aberglaube nur her? Waren es lediglich die Alten, die hierher pilgerten? Wünschten sie sich zurück in einfachere Zeiten? Aber viele, die er unterwegs getroffen hatte, waren noch jung und überzeugt davon, dass die Quelle übernatürliche Kräfte hatte. Seine eigene Schwester kam aus England zurück, um sich einen Ehemann zu erflehen; das junge polnische Paar wollte, dass seine Kinder hier getauft wurden. Lilly Ryan war erst Anfang vierzig, aber auch sie glaubte, gehört zu haben, wie die Statue ihr versicherte, dass es ihrer seit langem verschwundenen Tochter gut gehe.
Das alles überstieg sein Fassungsvermögen.
Flynn trat in die Grotte, wo als Symbol der Hoffnung, geheilt zu werden und eines Tages ohne Hilfsmittel auszukommen, Krücken, Gehstöcke und sogar Brillen deponiert worden waren. Auch Babyschuhe und winzige Söckchen, die alles Mögliche bedeuten konnten, hatte man zurückgelassen. Den Wunsch nach einem Kind? Die Bitte, dass ein krankes Kind geheilt werden möge?
Und darüber im Schatten stand die riesige Statue der heiligen Anna.
Im Lauf der Jahre war sie immer wieder neu gestrichen und aufpoliert worden: Die Apfelbäckchen erstrahlten rosiger, der braune Umhang noch brauner, die Haarsträhne unter dem cremefarbenen Schleier noch blonder.
Hätte die heilige Anna existiert, wäre sie eine kleine, dunkelhaarige Frau aus dem heutigen Palästina oder Israel gewesen. Und ganz sicher hätte sie nicht wie eine irische Reklame für Käseaufstrich ausgesehen.
Und trotzdem waren es vollkommen normale Menschen, die hier vor der Quelle knieten. Der Andrang war größer, als es je in der St.-Augustine-Kirche in Rossmore der Fall war.
Ein ernüchternder und deprimierender Gedanke.
Die Statue blickte mit glasigen Augen auf den Kaplan herab, was Flynn ein wenig erleichterte. Hätte er jetzt auch noch angefangen, sich vorzustellen, dass die Statue ihn persönlich ansprach, hätte er aufgegeben.
Doch merkwürdigerweise verspürte Kaplan Flynn den dringenden Wunsch, mit der Heiligen Zwiesprache zu halten, auch wenn sie von sich aus stumm blieb. Er betrachtete das junge, sorgenvolle Gesicht von Myles Barrys Tochter, die es zum größten Kummer ihres Vaters nicht geschafft hatte, an der juristischen Fakultät aufgenommen zu werden. Worum betete sie wohl mit geschlossenen Augen und konzentrierter Miene?
Daneben sah er Jane, die stets elegant gekleidete Schwester von Poppy, die das Seniorenheim leitete. Jane, die sogar für das ungeübte Auge von Kaplan Flynn hochmodische Designerkleidung zu tragen schien, betete leise murmelnd zu der Statue. Auch der junge Mann, der den Stand mit Biogemüse auf dem Marktplatz betrieb, bewegte stumm die Lippen.
Der Pfarrer warf einen letzten Blick auf die in seinen Augen vollkommen unzulängliche Darstellung der Mutter der Muttergottes. Wenn er die Heilige in Gestalt der Statue doch nur fragen könnte, ob die Gebete überhaupt Gehör fanden oder gar erhört wurden. Und zu gerne hätte er gewusst, was die Heilige tat, wenn zwei Menschen sie um einander widersprechende Gefallen baten.
Aber wenn er weiter seiner Phantasie freien Lauf ließ, würde er verrückt werden. Und er wollte nichts damit zu tun haben.
Als er die Grotte verließ, strich er über die gewölbten Wände, den feuchten Fels, in den Fürbitten gemeißelt waren. Keiner hatte sich die Mühe gemacht, die Weißdornbüsche zu stutzen, um den Zugang zur Grotte zu erleichtern – waren doch alle Hoffnungen, Gebete und Fürbitten so vieler Menschen daran befestigt.
Sogar an den alten Holzgattern hing ein Zettel:
»Heilige Anna, erhöre mein Flehen.«
Fast glaubte Kaplan Flynn, die Stimmen ringsum zu hören, Stimmen, die über die Jahre hinweg gerufen und gefleht hatten. Er ertappte sich dabei, dass er selbst ein kleines Gebet zum Himmel schickte.
»Bitte, lass mich die Stimmen hören, die Dich erreichen, und wissen, wer diese Menschen sind. Wenn ich hier auf Erden etwas Gutes bewirken soll, dann lass mich wissen, was diese Stimmen sagen und was diese Menschen wollen, dass wir für sie tun …«
Kapitel 2
Messerscharf
1. Teil – Neddy
IIch hab schon mitbekommen, was die Leute über mich gesagt haben. »Oh, Neddy Nolan! Der hat ja nicht gerade einen messerscharfen Verstand …« Aber wissen Sie, ich wollte auch nie messerscharf im Kopf sein. Es ist schon ein paar Jahre her, da hatten wir in der Küche ein wirklich scharfes Messer, das allen Angst zu machen schien, so wie sie darüber geredet haben.
»Leg doch das scharfe Messer lieber hinauf aufs Regal, bevor sich noch eines der Kinder damit in die Hand schneidet«, sagte meine Mam. Und mein Dad: »Und sieh zu, dass die Klinge zur Wand zeigt und der Griff nach außen. Wir wollen doch nicht, dass sich jemand daran verletzt.« Alle lebten in der Angst vor einem schrecklichen Unfall und befürchteten, dass in der Küche Blut fließen könnte.
Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, mir tat das scharfe Messer leid. Es konnte doch nichts dafür und machte den Leuten nicht mit Absicht Angst, es war einfach scharf. Aber ich hab niemandem erzählt, was ich dachte, sonst hätten sie nur wieder gespottet, wie zart besaitet ich bin.
Neddy, den Träumer, so haben sie mich genannt.
Weil ich es nämlich nicht ertragen hab, wie die kleine Maus in der Falle gequietscht hat, und weil ich geweint hab, als die Jäger bei uns vorbeikamen und den Fuchs hetzten, der mich flehend ansah. Da hab ich das Tier in die Whitethorn Woods gescheucht. Ja, ich schätze, die anderen Jungs haben mich für einen Weichling gehalten. Aber so wie ich das sehe, hat die Maus nicht darum gebeten, in der Spülküche zur Welt zu kommen statt draußen auf einem Feld, wo sie friedlich bis an ihre alten Tage als glückliche Maus hätte leben können. Und der prachtvolle rote Fuchs hatte sicher nichts getan, um sich den Unmut der Jagdhunde, der Pferde und all der rot gekleidete Menschen zuzuziehen, die so wütend hinter ihm hergaloppierten.
Aber weil ich nicht so schnell und geschickt im Erklären bin, lasse ich es oft einfach bleiben. Und da keiner von dem Träumer Neddy viel erwartet, lässt man mich mit meinen Ansichten meistens in Ruhe.
Ich dachte, das würde anders werden, wenn ich erwachsen bin. Erwachsene regen sich schließlich nicht wegen jeder Kleinigkeit auf und zerfließen vor Mitleid. Ich war sicher, irgendwann würde auch ich so werden. Aber das schien wirklich lang zu dauern.
Als ich siebzehn war, sind ein paar von uns – mein Bruder Kit, seine Kumpel und ich – von Rossmore aus in einem Lieferwagen zum Tanzen gefahren, weit hinüber auf die andere Seite der Seen, und da war dieses Mädchen. Sie sah ganz anders aus als die anderen, die Kleider mit dünnen Trägern trugen, nur sie hatte einen dicken Rolli und einen Rock an. Sie hatte eine Brille und krauses Haar, und keiner schien mit ihr tanzen zu wollen.
Also hab ich sie gefragt, und als der Tanz zu Ende war, hat sie die Schultern gezuckt und gemeint: »Na, wenigstens einmal hab ich heute Abend getanzt.«
Da hab ich sie ein zweites Mal aufgefordert, und dann noch einmal, und am Schluss hab ich gesagt: »Jetzt hast du heute Abend gleich vierzehnmal getanzt, Nora.«
Und sie hat gesagt: »Jetzt willst du sicher was von mir.«
»Was soll ich von dir wollen?«, hab ich gefragt.
»Na, wenn du mit mir tanzt, muss ich mit dir schlafen«, hat Nora geantwortet, aber nicht sehr froh geklungen. Das sei nun mal der Preis dafür, dass ich sie vierzehnmal aufgefordert hatte.
Ich hab ihr erklärt, dass wir von der anderen Seite der Seen kommen, aus der Gegend um Rossmore, und dass ich mit den anderen im Lieferwagen wieder heimfahren muss.
Ich kam nicht ganz dahinter, ob sie erleichtert oder enttäuscht war.
Im Auto zogen mich die anderen auf.
»Neddy ist verliebt«, haben sie auf dem ganzen Weg nach Hause gesungen.
Vier Monate später, als Nora und ihr Dad bei uns auftauchten und sagten, ich sei der Vater von dem Kind, das sie erwartete, hat keiner mehr gesungen.
Ich war wie vor den Kopf gestoßen.
Nora hat mich nicht angesehen, sondern auf den Boden gestarrt. Ich konnte nur ihren Kopf sehen, ihre traurige, krause Dauerwelle. Sie tat mir so leid, und noch mehr, als Kit und meine anderen Brüder über Nora und ihren Dad herfielen.
Vollkommen unmöglich, dass ihr Neddy auch nur zehn Sekunden allein mit Nora verbracht haben soll, sagten sie. Dafür gebe es Hunderte von Zeugen. Sie würden sogar Kanonikus Cassidy holen, damit er Zeugnis ablegt über meinen Charakter. Hochrot im Gesicht gingen sie auf Noras Dad los und schworen, dass ich das Mädchen zum Abschied, als sie mich in den Wagen verfrachtet haben, nicht einmal geküsst hätte. Das sei die übelste Masche, von der sie jemals gehört hätten.
»Ich hab noch nie mit einer geschlafen«, sagte ich zu Noras Dad. »Aber wenn ich es getan hätte und dabei ein Kind entstanden wäre, würde ich ganz gewiss zu meiner Verantwortung stehen und mich geehrt fühlen, Ihre Tochter zur Frau zu nehmen, aber wissen Sie … so ist es nicht gewesen.« Und aus irgendeinem Grund glaubten mir alle. Alle. Und die Situation entspannte sich.
Die arme Nora hob ihr rotes, tränenverschmiertes Gesicht und sah mich durch ihre dicken Brillengläser an.
»Tut mir leid, Neddy«, sagte sie.
Ich hab nie erfahren, was aus ihr geworden ist.
Irgendwann hieß es mal, ihr Großvater habe seine Finger im Spiel gehabt, aber weil er in der Familie der mit dem Geld war, hat man ihn in Ruhe gelassen. Ich hab auch nie erfahren, ob das Kind zur Welt kam und ob sie es aufgezogen hat. Ihre Familie lebte so weit weg von Rossmore, dass ich nie jemanden fragen konnte. Und unsere Familie hat mich auch nicht ermutigt nachzufragen.
Im Gegenteil, sie sind alle über sie hergezogen.
»So ein frecher Rotschopf«, sagte meine Mam.
»Unserem Neddy den Bastard von einem anderen Kerl unterschieben zu wollen«, schimpfte meine Oma.
»Das arme Luder. Nicht einmal unser Neddy hat was von ihr wissen wollen«, meinte mein Dad.
Und ich spürte einen Kloß im Hals aus Mitleid mit der armen jungen Frau, die so stolz darauf gewesen war, an dem Abend wenigstens einmal getanzt zu haben, und die sich mir als Dank für den ungeheuren Luxus von gleich vierzehn Tänzen praktisch an den Hals geworfen hatte.
Das war alles so traurig.
Nicht lange danach bin ich weg von Rossmore, nach London in England, um dort mit meinem ältesten Bruder Kit auf dem Bau zu arbeiten. Über einem Laden hatte er eine Wohnung gefunden; sie waren bereits zu dritt, und ich zog als Vierter mit ein. Die Wohnung war dreckig und unaufgeräumt, lag aber nah an der U-Bahn, und das ist in London das Wichtigste.
Am Anfang hab ich nur Tee gekocht und alle möglichen Materialien für die Leute auf die Baustelle geschleppt. Sie hatten nur alte, angeschlagene Becher, so dass ich an dem Tag, als ich meinen ersten Lohn bekam, in einen Laden bin und ein Dutzend schöne neue Becher gekauft hab. Was haben die für Augen gemacht, als sie gesehen haben, dass ich die Becher immer sauber ausgewaschen und sogar noch ein Kännchen für die Milch und eine Zuckerdose besorgt hab.
»Neddy ist ja ein richtiger feiner Pinkel«, haben sie gesagt.
Ich bin nie sicher, ob die Leute Gutes über mich sagen oder nicht. Ich glaube, eher nicht. Aber das ist nicht so wichtig.
Dann war da noch etwas anderes, das mir auf der Baustelle auffiel. So haben sie dort jeden sechsten Eimer, den ich ausleeren sollte, nicht mit Bauschutt gefüllt, sondern mit Zementsäcken, mit Ziegeln und mit Werkzeug. Offensichtlich irgendein System, irgendeine Abmachung, aber mich hat niemand eingeweiht, und so bin ich natürlich zum Polier und hab ihm gesagt, dass Sachen weggeworfen werden, die eigentlich noch brauchbar sind. Ich dachte, alle würden sich freuen.
Haben sie sich aber nicht.
Im Gegenteil.
Und am meisten wütend war Kit. Am nächsten Tag hat er mich dazu verdonnert, in der Wohnung zu bleiben.
»Aber die werfen mich raus, wenn ich nicht zur Arbeit komme«, hab ich ihn angefleht.
»Und wenn du hingehst, dann ziehen dir die anderen bei lebendigem Leib die Haut ab.« Kit war richtig angefressen. Besser, wenn ich ihm nicht widersprach.
»Aber was soll ich den ganzen Tag hier machen?«, wollte ich wissen.
Kit wusste normalerweise immer, was zu tun war, nur dieses Mal nicht.
»Mann, was weiß ich, Neddy, mach irgendwas, putz die Wohnung. Räum auf. Aber bleib weg von der Baustelle.«
Die anderen Burschen haben kein Wort mehr mit mir gesprochen, was mir gezeigt hat, wie ernst die Sache mit den Bauschutteimern war. Also hab ich mich hingesetzt und nachgedacht. Irgendwie lief die Sache nicht annähernd so gut, wie ich mir das ausgemalt hatte.
Eigentlich hatte ich vorgehabt, in London eine Menge Geld auf die Seite zu legen, damit ich meiner Mam einen Urlaub und meinem Dad einen anständigen Mantel mit Lederbesatz kaufen könnte. Aber jetzt saß ich da und durfte nicht zur Arbeit gehen.
Putz die Wohnung, hatten sie gesagt. Aber womit? Wir hatten kein Putzzeug, kein Scheuerpulver für das Spülbecken oder das Bad, keine Politur für die Möbel. Auch kein Waschmittel für die Bettlaken. Und ich hatte nur noch neun englische Pfund übrig.
Da kam mir eine Idee, und ich ging hinunter in den Laden, wo die Patels Tag und Nacht hart arbeiteten.
Ich suchte mir aus dem Regal das Putzzeug raus, holte einen Eimer mit weißer Farbe und stellte alles in eine Schachtel. Zusammen machte das ungefähr zehn Pfund aus. Dann ging ich zu Mr. Patel an die Kasse.
»Wenn ich Ihren Hof aufräume, fege, alle Kartons zusammenlege und die Kisten aufeinanderstaple, krieg ich dann das hier als Lohn?«
Er betrachtete mich nachdenklich, als würde er die Kosten und den Nutzen meiner Arbeit gegeneinander aufrechnen.
»Würdest du dafür auch noch das Schaufenster putzen?«, fing er daraufhin zu handeln an.
»Klar doch, Mr. Patel«, erwiderte ich mit einem breiten Lächeln.
Und Mr. Patel lächelte zu meiner großen Überraschung ebenfalls, wenn auch zaghaft.
Danach ging ich in den Waschsalon und fragte, ob ich dort die Tür streichen könne, die ein bisschen zerschrammt aussah.
»Wie viel willst du dafür?« Mrs. Price, die den Waschsalon führte und die, wie es hieß, viele Herrenbekanntschaften hatte, war nicht auf den Kopf gefallen.
»Zwei Ladungen Kochwäsche und einmal extra trocknen«, sagte ich.
Wir kamen ins Geschäft.
Als Kit und die Kumpel von der Baustelle heimkamen, wollten sie ihren Augen nicht trauen.
Sie hatten saubere Betten, der abgetretene Linoleumbelag auf dem Fußboden glänzte, und das Spülbecken aus Stahl war auf Hochglanz poliert. Ich hatte sogar die Schränke in Küche und Bad neu gestrichen.
Ich erzählte ihnen, dass die Patels am nächsten Tag noch mehr für mich zu tun hätten und mir als Bezahlung was geben würden, mit dem ich unsere Emaillebadewanne ausbessern konnte. Und im Waschsalon warteten weitere Malerarbeiten auf mich, was bedeutete, dass wir dort in Zukunft alle unsere Sachen waschen konnten – die Hemden und Jeans, alles. Ich würde die Tüten mit der Schmutzwäsche hinbringen und wieder heimtragen, da ich ja nicht mehr zur Baustelle konnte.
Und weil sich alle wieder einigermaßen eingekriegt hatten und die schöne, neue, saubere Wohnung bewunderten, traute ich mich, sie zu fragen, ob sich der Polier inzwischen auch wieder beruhigt hatte.
»Ja doch, hat er«, sagte Kit. »Er konnte nicht glauben, dass du deinen eigenen Bruder verpfeifen würdest! Ich hab ihm erklärt, dass keiner von uns so was machen würde, auch nicht die Kumpel, mit denen du zusammenwohnst, und dass er woanders nach den Schuldigen suchen muss. Also sucht er jetzt woanders.«
»Und glaubst du, dass er sie findet?«, fragte ich besorgt.
Ich kam mir vor wie in einem Krimi.
Die anderen schauten sich verdutzt an, aber keiner sagte etwas.
»Wahrscheinlich nicht«, meinte Kit nach einer Weile.
»Kann ich dann nächste Woche wieder zur Arbeit gehen?«, fragte ich.
Wieder Schweigen.
»Weißt du, Neddy, du machst das hier so toll, das ist wirklich eine schöne Wohnung geworden. Vielleicht solltest du dabei bleiben. Was meinst du?«
Ich war sehr enttäuscht. Ich dachte, ich würde wieder jeden Tag mit den anderen zur Arbeit gehen, wie Kumpel das eben so machen.
»Aber wie soll ich denn Geld verdienen und eine Anzahlung auf ein Haus zusammensparen, wenn ich keine Arbeit hab?«, fragte ich leise.
Kit beugte sich zu mir vor und redete mit mir von Mann zu Mann.
»Weißt du, Neddy, ich seh das so: Wir sind doch eine Firma, und du könntest unser Manager sein.«
»Euer Manager?«, wiederholte ich ehrfürchtig.
»Ja, mal angenommen, du machst uns das Frühstück, packst uns ein paar Stullen für die Pause ein und kümmerst dich darum, dass die Wohnung immer picobello ist. Und für unsere Finanzen bist du natürlich auch zuständig. Du zahlst für jeden von uns das Geld auf der Post ein. Damit würdest du uns eine große Last abnehmen, und wir würden auch alle zusammenlegen und dir eine Art Lohn zahlen. Was meint ihr, Leute? Was haltet ihr von einer netten, sauberen Wohnung, wo wir auch mal jemanden mitbringen können, wenn Neddy erst mal so richtig losgelegt hat?«
Die Jungs hielten das für eine tolle Idee, und Kit ging Fish & Chips für alle holen, um den Tag zu feiern, an dem ich ihr Manager wurde.
Es war wirklich ein toller Job und viel besser überschaubar als die Arbeit auf dem Bau, weil ich mir die Arbeit selber einteilen konnte und ja auch schon Erfahrung darin hatte. Das alles hab ich in meinem wöchentlichen Brief nach Hause geschrieben, und ich hab gedacht, Dad und meine Mam würden sich freuen. Aber sie haben mich gewarnt, ich solle ja aufpassen, dass Kit und die anderen mich nicht ausnutzen und nur schuften lassen.
»Du bist so ein lieber, anständiger Junge, Neddy«, hat meine Mam geschrieben, »du musst in diesem Leben immer gut auf dich achtgeben. Versprich mir das, ja?«
Aber eigentlich war die Arbeit halb so schlimm; alle waren nett zu mir, und ich hab immer alles erledigt. Erst hab ich den Jungs ein warmes Frühstück gemacht und danach die Patel-Kinder in die Schule gebracht. Dann hab ich den Waschsalon aufgesperrt, weil Mrs. Price, die ja so viele Freunde hatte, ganz in der Früh noch nicht so recht auf dem Damm war.
Dann bin ich zu den Patels zurück und hab geholfen, die Regale aufzufüllen und den Müll wegzubringen. Anschließend hab ich mich in der Wohnung an die Arbeit gemacht und aufgeräumt. Und jeden Tag hab ich versucht, irgendwas Neues zu organisieren; ich hab neue Regale aufgehängt oder hab in dem Elektrogeschäft, wo sie auch Fernseher reparierten, sauber gemacht, als Gegenleistung für einen gebrauchten Apparat. Kit hat irgendwann einen Videofilm auf der Straße gefunden; der war von einem Lastwagen gefallen, ist aber nicht kaputtgegangen, und so hatten wir quasi ein eigenes Kino in unserer Wohnküche.
Nach der Schule hab ich die Patel-Kinder wieder abgeholt und für eine ältere Dame namens Christina, die aus Griechenland stammte, eingekauft. Sie hat uns dafür Vorhänge genäht.
Und jedes Jahr hab ich die Fahrkarten nach Irland besorgt, damit Kit und ich auf unseren kleinen Hof außerhalb von Rossmore heimfahren und die Familie besuchen konnten.
Jedes Mal war dort irgendetwas anders; die Stadt wuchs und wucherte wie ein Pilz. Jetzt gab es sogar einen Bus, der bis zu unserer Straßengabelung fuhr. Von der armen Nora und ihren Problemen hab ich übrigens nie mehr was gehört. Kit meinte, es ist klüger, wenn ich nicht frage.
In den zwei Wochen daheim hab ich immer am Haus gearbeitet. Na ja, Kit war natürlich ständig unterwegs, von einem Tanzvergnügen zum anderen, und hat gar nicht mitbekommen, dass das Haus immer mehr herunterkam und dringend einen Anstrich oder ein paar neue Balken brauchte. Dad war draußen beim Vieh und hatte nicht die Zeit und die Energie dafür.
Einmal hab ich Kit vorgeschlagen, dass wir den Eltern doch einen modernen Fernsehapparat oder vielleicht sogar eine Waschmaschine kaufen könnten, aber Kit hat nur gemeint, dass wir nicht mit unserem Geld um uns werfen könnten und außerdem aufhören sollten, die zurückgekehrten Millionäre zu spielen. Das würde bei den anderen gar nicht gut ankommen.
Ich hab mir ständig Sorgen um unsere Mam gemacht, die noch nie recht gesund war. Aber sie hat immer gesagt, dass die heilige Anna ihr diese Extrajahre geschenkt hat, damit sie sehen kann, wie aus ihren Kindern erwachsene Leute werden. Und dafür war sie dankbar. In einem Sommer sah sie besonders schlecht aus, aber sie hat nur gemeint, ich solle mir keine Gedanken machen, alles sei in Ordnung. Jetzt, da Dad ein Feld verkauft hatte und weniger Vieh zu versorgen war, hätten sie es außerdem viel bequemer, weil er öfter zu Hause war und ihr eine Tasse Tee kochen konnte. Mam machte sich eigentlich nur darum Sorgen, ob Dad allein zurechtkäme, wenn sie mal nicht mehr war.
Als Kit und ich das nächste Mal zurückkamen, war es zur Beerdigung von unserer Mam.
Alle unsere Freunde aus London, denen ich von Mam erzählt hatte, schickten Blumen. Drüben in London schien man ja viel von Kit zu halten, wenn er so viele Freunde hatte, hieß es. Eigentlich waren es ja meine Freunde, aber das spielte keine Rolle.
Der arme Dad sah aus wie ein Bluthund. Tiefe Falten durchzogen sein trauriges Gesicht, als er sich von uns verabschiedete.
»Jetzt musst du dich um den kleinen Neddy kümmern«, legte er Kit auf dem Bahnhof ans Herz. War schon komisch, weil es eigentlich umgekehrt war.
»Der Alte hätte uns wirklich das Fahrgeld spendieren können«, schimpfte Kit. Aber ich hatte ja das Geld für die Fahrt, und so war das egal.
Und dann haben uns die Patels ein zusätzliches Zimmer überlassen, ohne uns die Miete zu erhöhen. Ich hatte für Mr. Patel die Nebengebäude renoviert, damit er mehr Lagerraum hatte. Und dann ist einer der Jungs mit seiner Freundin zusammengezogen, und wir waren nur noch zu dritt in der Wohnung, und jeder hatte sein eigenes Zimmer.
Manchmal brachten die anderen Mädchen mit. Hübsche Mädchen waren das, die zum Frühstück blieben und auch zu mir sehr nett waren.
Ehrlich gesagt, ich hatte immer so viel zu tun, dass die Zeit wie im Flug verging, und plötzlich war ich siebenunddreißig Jahre alt. Aber weil ich fast zwanzig Jahre lang eisern gespart hatte, hatte ich ein kleines Vermögen auf der Bausparkasse liegen. Ich meine, wenn man am Anfang jede Woche zwanzig Pfund, dann dreißig und später fünfzig auf die Seite legt, kommt ein ganz schönes Sümmchen zusammen.
Ich hab’s auch hingekriegt, dass Kit jedes Jahr mit mir nach Hause gefahren ist, aber das war nicht immer einfach. In Rossmore käme er sich immer wie lebendig begraben vor, hat er gemeint.
Als wir wieder einmal daheim waren, ging es unserem Dad überhaupt nicht gut. Er hatte es nicht mehr geschafft, den Zaun um den Hühnerauslauf zu flicken, und der Fuchs hatte sich alle Hühner geholt. Auf den Markt konnte er auch nicht mehr gehen und war deshalb darauf angewiesen, dass die Leute zu ihm kamen und ihm Angebote für sein Vieh machten, was ihm fast das Herz brach.
Er wurde immer eigenbrötlerischer und vernachlässigte das Haus. Der alte Mann kann nicht mehr allein leben, sagte ich zu Kit. Kit wollte ihn gleich ins Altersheim schicken. Als ob ich unseren Dad in ein Heim geschickt hätte!
Nein, sagte ich, ich geh zurück nach Irland und sorge für ihn, so gut ich kann.
»Und reißt dir die ganze Erbschaft unter den Nagel, wie?«, sagte Kit böse.
»O nein, Kit, ich lass jemanden kommen, der soll das Haus schätzen, vielleicht Myles Barry, der ist doch Anwalt in der Stadt, und dann zahl ich dir und den anderen euren Anteil.«
»Und du willst wirklich hier bei Dad wohnen?« Kit bekam den Mund vor Staunen nicht mehr zu.
»Irgendeiner muss es doch tun«, erklärte ich, »und außerdem heirate ich ja vielleicht bald, wenn ich ein nettes Mädchen finde.«
»Du willst das Haus kaufen? Uns auszahlen? Du träumst wohl«, lachte Kit mich aus.
Aber ich hatte genug Geld und kaufte das Haus, gleich am nächsten Tag, und mein Dad freute sich sehr, nur Kit war nicht zufrieden.
Wie das möglich war, wollte er wissen. Er hätte keine Ersparnisse, aber ich, der nie im Leben auch nur einen Tag gearbeitet hatte, war in der Lage, einfach in die Tasche zu greifen und bar eine kleine Farm mit einem passablen Wohnhaus zu kaufen. Das ging doch nicht mit rechten Dingen zu.
»Was meinst du damit, dass ich nie im Leben auch nur einen Tag gearbeitet hätte? War ich nicht euer Manager?«, rief ich, wütend über die Unterstellung.
Das mit dem Manager schien ihm nicht ins Konzept zu passen.
»Und ob ich euer Manager war«, wiederholte ich. Ich war’s wirklich. Ich war sogar ein hervorragender Manager und hab den Jungs ein gemütliches Heim geschaffen. Und hätten sie es mir gegeben, hätte ich auch ihr Geld jede Woche auf die Post getragen, wie ich es mit meinem gemacht hab. Ich hätte es dort unter verschiedenen Namen auf mehrere Konten einzahlen müssen, offenbar wegen der Buchhaltung. Aber am Freitag, wenn sie durch die Clubs in Westlondon gezogen sind, ihre Mädchen ausgeführt oder sich teure Klamotten gekauft haben, hab ich es nicht geschafft, ihnen ihren Lohn abzunehmen.
Ich konnte auch deswegen was auf die hohe Kante legen, weil ich nicht getrunken hab. Meine Hosen und Hemden hab ich bei Oxfam billig gekauft und außerdem immer so lange gearbeitet, dass ich überhaupt keine Zeit zum Ausgehen und zum Geldausgeben hatte – also hab ich auf ein Haus gespart.
Und all das hab ich Kit ganz geduldig und langsam erklärt, für den Fall, dass er es nicht verstanden hatte. Ich hab sein Gesicht dabei beobachtet, und irgendwann hat er aufgehört, wütend zu sein. Man hat es ihm angesehen. Sein Gesicht wurde ganz weich und freundlich wie an dem Abend, an dem er mich zum Manager gemacht und für alle Fish & Chips geholt hat. Und dann hat er seine große Hand ausgestreckt und auf die meine gelegt.
»Tut mir leid, Neddy, ich hab Blödsinn geredet. Natürlich warst du unser Manager, und noch dazu ein guter. Und ich weiß gar nicht, wie wir dich ersetzen sollen, wenn du hierher zurückgehst. Aber dafür kriegen wir unseren Anteil am Haus ausbezahlt und wissen, dass Dad in guten Händen ist, und das ist eine große Erleichterung.«
Ich lächelte froh. Alles würde wieder gut werden.
»Nur, weißt du, das mit dem Heiraten wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden, Neddy. Aber mach dir bloß keinen Kopf, wenn dir das nicht so leichtfällt wie alles andere. Es ist verdammt schwierig, Frauen zu verstehen. Echt harte Arbeit. Du bist ein großartiger Kumpel, aber nicht unbedingt der Hellste im Oberstübchen, und das, was Frauen heutzutage wollen, wirst du ihnen wahrscheinlich kaum bieten können.«
Kit war freundlich zu mir, also hab ich ihm gedankt, wie ich es immer mache, wenn Leute mir einen Rat geben – ob ich ihn verstehe oder nicht. Und dann hab ich mich darangemacht, ein Mädchen zum Heiraten zu finden.
Es hast sieben Monate gedauert, dann hab ich Clare getroffen.
Sie war Lehrerin. Ich hab sie in unserer Pfarrkirche außerhalb von Rossmore kennengelernt, als sie zur Beerdigung von ihrem Vater heimkam. Sie hat mir sofort sehr gefallen.
»Die ist zu clever für dich«, haben alle gesagt.
Na ja, nicht alle, mein Dad nicht. Er freute sich, dass ich bei ihm wohnte, und er wollte nichts sagen, das mich verärgert hätte. Jeden Morgen kochte ich Haferbrei für ihn und stellte sogar jemanden ein, der die paar Kühe versorgte, die wir noch hatten. Ich kümmerte mich um die Hühner und die Enten. Damit seine Beine nicht steif wurden, hab ich mit Dad lange Spaziergänge in den Wald gemacht. Manchmal ging er zu der Quelle, um der heiligen Anna für all die Extrajahre zu danken, die er noch mit meiner Mam gehabt hatte. Und jeden Tag hab ich ihn ins Pub geführt, damit er dort seine Freunde auf ein Bier treffen konnte und was Warmes in den Magen bekam.
Dad hat immer über mich gesagt: »Neddy ist nicht so doof, wie ihr alle denkt …«
Dad fand, dass Clare zu mir passt, und deswegen hat er mir geraten, ein wenig Geld für ein paar nette Hemden auszugeben und mir in dem Frisiersalon in Rossmore einen anständigen Haarschnitt verpassen zu lassen. Kaum zu glauben, dass Dad ein Wort wie »Frisiersalon« überhaupt kannte.
Clare war ehrgeizig, das hat sie mir von Anfang an klargemacht. Sie wollte vorwärtskommen als Lehrerin und vielleicht eines Tages Schulleiterin werden. Kein Problem, hab ich zu ihr gesagt, weil ich ja als Manager daheim alles erledigen konnte, bis sie wieder nach Hause kam. Und nur mal angenommen, wir würden ein kleines Baby bekommen, dann konnte ich es ja wickeln und füttern, während Clare zur Arbeit ging. Und zu meiner großen Freude hat sie geantwortet, dass sich das alles sehr gut und sehr beruhigend anhört und dass sie sich geehrt fühlen würde, meine Frau zu werden.