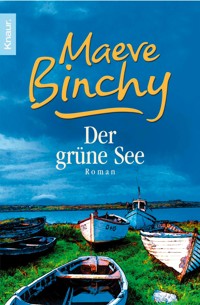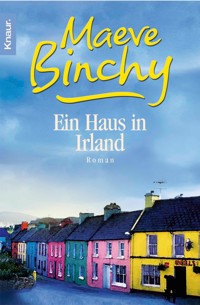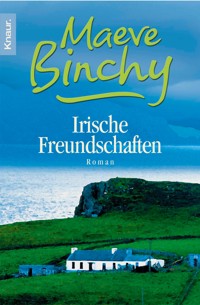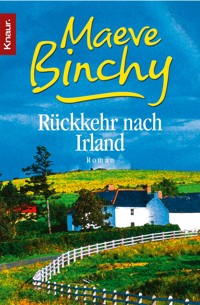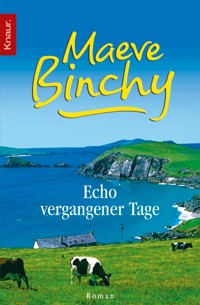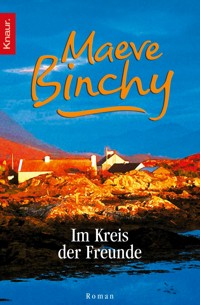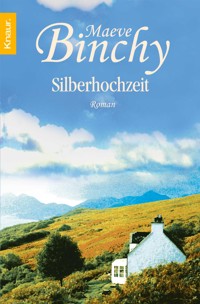
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Silberhochzeit ist immer ein Anlaß für ein Familienfest und das ist auch im günstigsten Fall oft mit Schwierigkeiten verbunden. Doch für die Doyles - Deirdre, Desmond und ihre Kinder Anna, Helen und Brendan - bringt es noch mehr Probleme mit sich als für die meisten Familien. Denn jeder von ihnen spielt Theater; jeder von ihnen verbirgt vor den anderen, daß er einmal tief verletzt wurde oder unter einem heimlichen Treuebruch zu leiden hat. Während das Familienfest näherrückt, wächst die Spannung, bis die Gäste schließlich bei der Party zur Silberhochzeit zusammenkommen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Maeve Binchy
Silberhochzeit
Roman
Aus dem Englischen von Monika Wallner und Sonja Schuhmacher
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für Gordon Snell,
der mein Geliebter
und gleichzeitig
mein bester Freund ist.
1 Anna
Anna wußte, wie sehr er sich bemühte, interessiert zu wirken. Sein Gesicht war ein offenes Buch für sie. Es war der gleiche Blick, den sie beobachtete, wenn manchmal ältere Schauspieler heraufkamen, um sie im Club zu treffen und Anekdoten von längst vergessenen Leuten zu erzählen. Auch dafür versuchte Joe Interesse aufzubringen. Es war ein freundlicher, höflicher, aufmerksamer Blick, von dem er hoffte, man würde ihn als wirklich interessiert durchgehen lassen und das Gespräch würde nicht zu lange dauern.
»Tut mir leid, daß ich immer noch nicht davon aufhöre«, entschuldigte sie sich. Sie schnitt eine lustige Grimasse. Außer einem Hemd von ihm hatte sie nichts an, und zwischen ihnen lagen nur die Zeitungen und ein Frühstückstablett.
Joe lächelte zurück, diesmal war es ein aufrichtiges Lächeln.
»Nein, ich find’s nett, daß dich das so in Aufregung versetzt. Es ist gut, wenn man sich um seine Familie kümmert.«
Sie wußte, er meinte es ehrlich. Im tiefsten Innern war ihm klar, daß es richtig war, sich für seine Familie zu interessieren, so wie man kleine Kätzchen vom Baum rettet. Oder wie ein schöner Sonnenaufgang und große Collie-Hunde. Im Prinzip war Joe schon dafür, sich Gedanken über das Familienleben zu machen, nur bei seiner eigenen Familie tat er, als ginge sie ihn nichts an. Er hätte nicht gewußt, wie lange seine Eltern verheiratet waren. Wahrscheinlich hätte er noch nicht einmal gewußt, wie lange seine eigene Ehe gedauert hatte. So etwas wie eine silberne Hochzeit hätte Joe Ashe nicht im geringsten interessiert.
Anna beobachtete ihn mit einer wohlbekannten Mischung aus Zärtlichkeit und Angst. Zärtlich und fürsorglich. Wie er so gegen die großen Kissen gelehnt dalag, sah er sehr schön aus, das blonde Haar fiel ihm ins Gesicht, und seine Schultern wirkten entspannt und locker. Sie hatte Angst davor, daß sie ihn verlieren könnte, daß er genauso sachte und mühelos aus ihrem Leben wieder verschwinden könnte, wie er hineingeraten war.
Joe Ashe kämpfte nie mit jemandem, erzählte er Anna mit seinem strahlenden jungenhaften Lächeln; für so etwas sei das Leben viel zu kurz. Und das stimmte ja auch.
Wenn er mal eine Rolle nicht bekam oder die Kritiken schlecht ausfielen, reagierte er nur mit einem Achselzucken. Na ja, es hätte besser sein können, aber es lohnt sich doch nicht, deshalb eine große Szene zu machen.
Wie seine Ehe mit Janet. Es war vorbei, warum sollte er sich dann weiter etwas vormachen? Er packte einfach einen kleinen Koffer und verschwand.
Anna fürchtete, er werde eines Tages, in eben diesem Zimmer, wieder einen kleinen Koffer packen und verschwinden. Sie würde ihn beschimpfen und anflehen, so wie Janet es getan hatte, aber es würde nichts nützen. Janet war sogar vorbeigekommen und hatte Anna Geld angeboten, damit sie ihn freigab. Sie hatte sich ausgeheult, wie glücklich sie mit Joe gewesen war, und ihr Bilder von den beiden kleinen Söhnen gezeigt. Alles wäre wieder in Ordnung, wenn nur Anna endlich ginge.
»Aber er hat Sie doch gar nicht meinetwegen verlassen. Er hatte schon ein Jahr allein gelebt, bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben«, hatte Anna erklärt.
»Ja, und die ganze Zeit über dachte ich, er würde zurückkommen.«
Anna erinnerte sich äußerst ungern an Janets tränenüberströmtes Gesicht und daran, wie sie dann Tee für Janet gekocht hatte. Und noch unangenehmer war es ihr, sich vorzustellen, wie ihr eigenes Gesicht eines Tages tränenüberströmt sein würde, genauso unerwartet, wie es Janet getroffen hatte. Sie zitterte ein wenig, als sie diesen hübschen, sorglosen Jungen in ihrem Bett betrachtete. Denn trotz seiner achtundzwanzig Jahre war er immer noch ein Junge. Ein sanftes, grausames Kind.
»Woran denkst du?« fragte er.
Sie sagte es ihm nicht. Sie erzählte ihm nie, wieviel sie über ihn nachdachte und wie sehr sie den Tag fürchtete, an dem er sie verlassen würde.
»Ich habe gerade überlegt, daß es mal wieder an der Zeit wäre, eine neue Filmversion von Romeo und Julia zu drehen. Du siehst so toll aus, da wäre es doch unfair, der Welt deinen Anblick vorzuenthalten«, sagte sie lachend.
Er nahm das Frühstückstablett und stellte es auf den Boden. Die Sonntagszeitung rutschte hinterher.
»Komm her zu mir«, sagte Joe. »Ich habe gerade genau dasselbe gedacht. Ganz und gar, wie ihr Iren sagt.«
»Was für eine hervorragende Imitation«, kommentierte Anna trocken. Trotzdem kuschelte sie sich an ihn. »Kein Wunder, daß du der beste Schauspieler der Welt bist und auf dem ganzen Erdball berühmt dafür, wie gut du Akzente nachmachen kannst.«
Sie lag in seinen Armen und erzählte ihm nichts von ihrer Besorgnis wegen der silbernen Hochzeit. Sie war sowieso schon zu weit gegangen mit dem Thema, das konnte sie an seinem Gesicht ablesen.
Um nichts in der Welt hätte man Joe begreiflich machen können, was das in Annas Familie bedeutete: Mutters und Vaters fünfundzwanzigster Hochzeitstag! Im Doyleschen Haushalt wurde alles gefeiert. Da gab es Alben mit Erinnerungsfotos, Schachteln, in denen Bilder von früheren Feiern chronologisch geordnet aufbewahrt wurden. Eine Galerie der wichtigsten Feste hing an der Wohnzimmerwand: der Hochzeitstag selbst, die drei Taufen, Oma O’Hagans sechzigster Geburtstag und Opa Doyles Besuch in London, wie alle beim Buckingham Palast neben einem Wachposten stehen – einem feierlichen jungen Mann mit Bärenmütze, der die Wichtigkeit von Opa Doyles Besuch erkannt zu haben schien.
Da hingen die drei Erstkommunionen und die drei Firmungen, es gab eine kleine Sportabteilung von Brendans Schulteam, in dem Jahr, als sie in der Oberliga spielten, eine noch kleinere akademische Abteilung mit einer Aufnahme von Annas Schulabschluß, auf der sie sehr gestellt posiert und ihr Zeugnis hält, als wäre es eine Tonne schwer.
Spaßeshalber sagten Mutter und Vater immer, die Wand sei die wertvollste Sammlung der Welt. Wozu brauchten sie alte Meister und berühmte Gemälde, wo sie doch etwas viel Kostbareres hatten: eine lebende Wand, die der Welt alles über ihr Leben erzählte.
Anna zuckte jedesmal zusammen, wenn Besucher diesen Spruch zu hören bekamen. Beim Gedanken daran zuckte sie sogar jetzt in Joes Armen zusammen.
»Zitterst du meinetwegen, oder ist das Leidenschaft?« fragte er.
»Ungezügelte Leidenschaft«, erwiderte sie und fragte sich, ob es wohl normal war, neben dem attraktivsten Mann von ganz London zu liegen und nicht an ihn, sondern an die Wand im Wohnzimmer ihrer Eltern zu denken.
Das Haus der Eltern würde zur Silberhochzeit geschmückt werden müssen. Mengen von Papierglöckchen würde es geben, silberne Schleifen und mit Silberfarbe besprühte Blumen, und man würde die Kassette mit dem Hochzeitswalzer spielen. Auf den Fensterbänken würden sich die Glückwunschkarten häufen. Wenn es so viele waren wie damals an Weihnachten, würde sie wahrscheinlich wieder eine Papierschlange daraus machen. Die Kuchen würden die üblichen traditionellen Verzierungen und die Einladungen silberne Ecken haben. Zu was genau lud man überhaupt ein? Das alles schwirrte in Annas Kopf herum. Die Kinder mußten das für ihre Eltern organisieren. Also Anna, ihre Schwester Helen und ihr Bruder Brendan.
Aber in Wirklichkeit bedeutete es, daß Anna die Verantwortung trug.
Sie würde das alles alleine erledigen müssen.
Anna drehte sich zu Joe um und küßte ihn. Sie wollte jetzt nicht mehr an diesen Hochzeitstag denken. Lieber zerbrach sie sich morgen den Kopf darüber, wenn sie dafür bezahlt wurde, in einer Buchhandlung zu stehen.
In diesem Augenblick, wo es weit bessere Dinge zu überlegen gab, wollte sie sich nicht damit beschäftigen.
»Das gefällt mir schon besser! Ich habe schon befürchtet, du schläfst auf mir ein«, sagte Joe Ashe und drückte sie dabei ganz fest an sich.
Anna Doyle arbeitete im »Bücher für Leute«, einer kleinen Buchhandlung, die von Autoren, Publizisten und allen möglichen Medien gefördert wurde. Unermüdlich behaupteten sie, dies sei ein Buchladen mit Charakter, anders als die großen, seelenlosen Bücherketten. Insgeheim konnte Anna dem nicht ganz zustimmen.
Viel zu oft mußte sie während der Arbeit Leute abwimmeln, die mit völlig normalen Anfragen daherkamen, wie nach den neuesten Bestsellern, Zugfahrplänen oder einem Spezialkochbuch über Tiefkühlkost. Jedesmal mußte sie sie an einen anderen Laden verweisen. Anna war der Meinung, daß eine Buchhandlung, die diesen Namen verdiente, auch tatsächlich solche alltäglichen Dinge anbieten sollte, anstatt sich gegenüber seinen Kunden ausschließlich auf eine wuchtige psychologische Abteilung, Reisebücher, Gedichtbände, Soziologie und zeitgenössische Satire zu berufen.
Eine ausgesprochene Fachbuchhandlung war der Laden aber auch nicht gerade. Sie hatte schon vor einem Jahr gehen wollen, aber das war genau zu der Zeit, als sie Joe traf. Und als er dann bei ihr blieb, war er zufällig gerade ohne Arbeit.
Joe jobbte ein bißchen herum, und er war nie pleite. Es reichte immer, um Anna einmal einen hübschen indischen Schal oder eine Papierblume zu schenken oder um die umwerfendsten wilden Pilze in einem Sohoer Feinkostgeschäft aufzutreiben.
Für Miete, Fernseher, Telefon oder Strom war nie Geld da. Es wäre dumm von Anna gewesen, einen festen Job aufzugeben, solange sie nichts Besseres gefunden hatte. Sie blieb also im »Bücher für Leute«, obwohl sie den Namen haßte, und glaubte fest daran, daß wohl die meisten Buchkäufer »Leute« waren. Die anderen Mitarbeiter waren alle völlig unkompliziert. Nach der Arbeit unternahmen sie nichts miteinander, aber ab und zu gab es Autogrammstunden, Dichterlesungen und sogar einmal einen Abend bei Käse und Wein zugunsten eines nahe gelegenen kleinen Theaters. Bei dieser Gelegenheit hatte sie Joe Ashe kennengelernt.
Am Montag morgen war Anna schon sehr früh im Laden. Wenn sie Zeit zum Nachdenken oder zum Briefeschreiben brauchte, mußte sie vor den anderen dasein. Es gab nur vier Angestellte, und jeder von ihnen hatte einen Schlüssel. Anna schaltete die Alarmanlagen aus, trug den Karton mit Milch hinein und nahm die Post vom Fußabtreter. Nur Flugblätter und Reklamezettel. Der Postbote war noch nicht dagewesen. Als Anna den elektrischen Wasserkessel einschaltete, um Kaffee zu kochen, sah sie sich kurz in dem kleinen Spiegel, der an der Wand hing. Sie fand, ihre Augen hätten einen großen und ängstlichen Ausdruck. Gedankenvoll strich sie sich über das Gesicht. Es wirkte blaß, und zweifellos waren da Ringe unter den großen braunen Augen. Ihre Haare waren mit einem hellrosa Band hochgebunden, das genau zur Farbe ihres T-Shirts paßte. Sie überlegte, ob sie ein wenig Make-up auflegen sollte, um den anderen keinen Schrecken einzujagen.
Sie wünschte, sie wäre damals bei dem Entschluß geblieben, sich die Haare schneiden zu lassen. Es war so seltsam gewesen: Sie hatte sich in einem piek- feinen Laden einen Termin geben lassen, in dem auch ein paar Mitglieder der Königsfamilie ein und aus gingen. Eines der Mädchen, die dort als Hairstylistinen arbeiteten, war in die Buchhandlung gekommen, und sie hatten sich miteinander unterhalten. Sie sagte, für Anna würde sie es billiger machen. Aber dann an jenem Abend, bei der Benefiz-Veranstaltung für das Theater, als sie Joe traf, hatte er ihr erklärt, ihr dichtes braunes Haar sei wunderbar, so wie es war.
Wie seither so oft, hatte er sie gefragt: »Was denkst du?« Und damals ganz am Anfang hatte sie ihm noch die Wahrheit gesagt. Daß sie vorhatte, sich am nächsten Tag die Haare schneiden zu lassen.
»Das darfst du auf keinen Fall tun«, hatte Joe gesagt, und dann schlug er vor, griechisch essen zu gehen und die Sache noch mal gründlich durchzudiskutieren.
Als sie in jener warmen Frühlingsnacht zusammensaßen, hatte er ihr von seiner Schauspielerei erzählt und sie ihm von ihrer Familie. Daß sie von zu Hause weggezogen war, weil sie nicht von ihrer Familie abhängig sein wollte und fürchtete, zu sehr hineingezogen zu werden in alles, was sie taten. Natürlich ging sie jeden Sonntag und an einem weiteren Abend pro Woche nach Hause. Joe hatte sie fasziniert betrachtet. Niemals hatte er Erwachsene gekannt, die ständig wieder in ihr Nest zurückkehrten.
Damals besuchte sie ihn immer in seiner Wohnung. Später kam er dann zu ihr, weil es dort gemütlicher war. Kurz und sachlich berichtete er Anna von Janet und den beiden kleinen Jungen. Anna erzählte Joe von dem College-Dozenten, den sie törichterweise während der letzten Jahre an der Uni geliebt hatte, was ihr einen drittklassigen Abschluß und großen Liebeskummer eingebracht hatte. Joe wunderte sich, daß sie das mit dem Dozenten erwähnte. Zwischen ihnen gab es schließlich keine Auseinandersetzungen wegen Gütertrennung oder gemeinsamen Kindern. Er hatte ihr lediglich von Janet erzählt, weil er immer noch mit ihr verheiratet war. Anna hatte über alles reden wollen, aber Joe wollte nie so recht zuhören.
Es war nur logisch, daß er bei ihr einzog. Die Idee kam nicht von ihm, und eine Zeitlang fragte sich Anna, wie sie wohl reagieren würde, wenn er ihr vorschlug, bei ihm zu wohnen. Es wäre ihr schwergefallen, das Mutter und Vater zu erklären. Aber nach einem langen, wunderschönen Wochenende mit ihm beschloß sie, Joe zu fragen, ob er nicht ganz in ihre kleine Wohnung in Shepherd’s Bush einziehen wollte.
»Na gut, wenn du möchtest«, hatte er geantwortet, freudig, aber nicht überrascht, willig, aber nicht übermäßig dankbar. Er war zu sich nach Hause gegangen, hatte eine Vereinbarung wegen der Miete getroffen und war mit zwei Handkoffern und einer Lederjacke über dem Arm zurückgekommen, um mit Anna Doyle zusammenzuleben.
Anna Doyle, die es tatsächlich schaffte, seine Ankunft ihrer Mutter und ihrem Vater zu verheimlichen, die in Pinner lebten und damit in einer Welt, wo Töchter mit verheirateten Männern noch nicht mal einen Abend verbringen würden, geschweige denn ein ganzes Leben.
Seit jenem Montag im April vergangenen Jahres lebte er bei ihr. Jetzt war es Mai 1985, und durch eine Reihe komplizierter Manöver war es Anna gelungen, die Welten von Shepherd’s Bush und Pinner weit genug auseinanderzuhalten, während sie mit zunehmendem Schuldbewußtsein zwischen beiden hin- und herpendelte.
Joes Mutter war sechsundfünfzig, sah aber um Jahre jünger aus. Sie arbeitete an der Essensausgabe einer Bar, wo sich viele Schauspieler trafen, und ein-, zweimal die Woche sahen sie sich dort. Sie wirkte geistesabwesend, aber freundlich und winkte ihnen zu, als seien sie einfach gute Kunden. Etwa sechs Monate lang hatte sie von ihrem Zusammenleben nichts gewußt. Joe fand es einfach nicht der Mühe wert, es ihr zu erzählen. Als sie es hörte, sagte sie zu Anna nur: »Wie nett, Liebes!«, und zwar in demselben Tonfall wie gegenüber einem Fremden, der eine Scheibe Kalbfleisch und Schinkenpfannkuchen bei ihr bestellte.
Anna hatte sie eingeladen, sie in ihrer Wohnung zu besuchen.
»Weshalb?« hatte Joe sie mit aufrichtiger Überraschung gefragt.
Als sie das nächste Mal im Pub war, ging Anna zur Theke und sprach selber mit Joes Mutter:
»Hättest du nicht Lust, uns mal bei uns zu Hause zu besuchen?«
»Weshalb?« hatte sie interessiert zurückgefragt.
Anna ließ nicht locker: »Ich weiß nicht, vielleicht trinken wir etwas zusammen?«
»Herrgott, Liebes, ich trinke niemals. Von dem Zeug siehst du hier drin so viel, daß dir glatt die Lust darauf vergeht, glaub mir!«
»Na, dann einfach, um deinen Sohn zu besuchen«, beharrte Anna.
»Aber ich sehe ihn doch hier. Er ist jetzt erwachsen, Liebes, er will sich nicht tagaus, tagein seine alte Mutter angucken.«
Seitdem hatte Anna die beiden mit einer Faszination beobachtet, die halb aus Entsetzen und halb aus Neid bestand. Sie waren zwei Menschen, die in derselben Stadt wohnten und die sich über Belanglosigkeiten unterhielten, wenn sie sich zufällig trafen.
Sie sprachen nie von anderen Familienmitgliedern. Weder von Joes Schwester, die wegen Drogen in einem Rehabilitationszentrum gewesen war, noch vom ältesten Bruder, der so einer Art Söldnertruppe in Afrika angehörte, noch vom jüngeren Bruder, einem Kameramann beim Fernsehen.
Joes Mutter fragte auch nie nach ihren Enkelkindern.
Joe hatte Anna erzählt, daß Janet die Kinder manchmal mit zu ihr brachte, und gelegentlich hatte er sie in einen Park mitgenommen, der in der Nähe der Wohnung seiner Mutter lag. Für eine Weile schaute sie dann dort vorbei. Aber zu ihr nach Hause nahm er die Kinder niemals mit.
»Sie hat da, glaub’ ich, einen Kerl, einen jungen Verehrer, deshalb will sie nicht, daß ein Haufen Enkelkinder bei ihr herumschwirrt.« Für Joe war alles ganz klar und einfach.
Für Anna klang das wie eine Geschichte von einem anderen Stern.
Gäbe es Enkelkinder, wären sie in Pinner der Dreh- und Angelpunkt des Hauses, wie es zuvor fast ein Vierteljahrhundert lang die Kinder gewesen waren. Anna seufzte wieder, als sie an die Feierlichkeiten dachte, die vor ihr lagen und die sie zu bewältigen hatte, wie so viele andere Dinge, mit denen sie ganz alleine fertig werden mußte.
Es hatte keinen Sinn, in einem leeren Buchladen herumzusitzen, Kaffee zu trinken und darüber enttäuscht zu sein, daß Joe nicht so war wie andere Männer, daß er ihr nicht den Rücken stärkte und bereit war, solche Dinge mit ihr zu teilen. Seit ihrem ersten gemeinsamen Abend hatte sie gewußt, daß er niemals so sein würde.
Jetzt mußte sie sich erst einmal überlegen, wie sie die silberne Hochzeit im Oktober organisieren sollte, ohne dabei alle verrückt zu machen.
Helen war auch keine Hilfe, soviel stand fest. Sie würde eine reichverzierte, von allen Schwestern unterschriebene Karte schicken und Mutter und Vater zu einer besonderen Messe mit der Gemeinschaft einladen. Sie würde sich für den Tag freinehmen und in ihrem langweiligen grauen Rock und dem dazu passenden Pullover nach Pinner kommen, mit mattem und glanzlosem Haar, und ununterbrochen mit dem großen Kreuz an ihrer Halskette herumspielen. Dabei sah Helen noch nicht einmal aus wie eine Nonne. Eher wie jemand, der ein bißchen dämlich und schlecht gekleidet ist und sich hinter einem großen Kruzifix versteckt. Und in vieler Hinsicht war sie das auch. Helen würde genau rechtzeitig auftauchen, wenn alles organisiert war, und das übriggebliebene Essen in ihre große Leinentasche packen, weil eine Nonne Pfefferkuchen liebte und eine andere eine Schwäche für Lachsgerichte aller Art hatte.
Mit einem Gefühl der Verzweiflung konnte Anna um Monate voraussehen, wie sich ihre jüngere Schwester Helen, Mitglied einer religiösen Gemeinschaft in Südlondon, wie ein Lumpensammler ihren Weg durchs Essen pickte und eine Keksdose mit Leckerbissen füllte, die sie zuvor sorgfältig in Alufolie verpackte.
Aber Helen würde wenigstens dasein. Bei Brendan war sie nicht sicher. Würde er überhaupt kommen? Das war ihre Hauptsorge, am liebsten wollte sie gar nicht daran denken. Wenn Brendan Doyle es nicht schaffen sollte, den Zug und die Fähre und dann wieder den Zug nach Pinner zu bekommen, um beim fünfundzwanzigsten Hochzeitstag seiner Eltern dabeizusein, konnte sie das Ganze ebensogut gleich abblasen. Diese Schande konnte man niemals verheimlichen, diese Leere niemals vergessen.
Ein unvollständiges Familienfoto an der Wand!
Wahrscheinlich würden sie lügen und sagen, er sei in Irland und könne nicht weg vom Hof, wegen der Ernte oder der Schafschur oder was auch immer man im Oktober auf einem Bauernhof zu tun hat.
Aber Anna wußte mit einer Sicherheit, die sie fast krank machte, daß er eine fadenscheinige Entschuldigung vorbringen würde. Der Trauzeuge und die Brautjungfer würden genauso wie die Nachbarn und der Priester merken, daß die Beziehung abgekühlt war.
Und das Silber würde seinen Glanz verlieren.
Wie sollte man ihn überreden zu kommen, das war das Problem. Aber war es wirklich ein Problem? Wozu sollte man ihn eigentlich zurückholen? Vielleicht war diese Frage viel entscheidender.
Als Schuljunge war Brendan immer sehr still gewesen. Wer hätte merken sollen, daß er dieses seltsame Verlangen verspürte, weg von seiner Familie zu gehen, an einen so weit entfernten Ort? Anna war schockiert an dem Tag, als er es ihnen sagte. Ganz direkt und ohne Rücksicht darauf, was er dem Rest der Familie damit antat.
»Ich werde im September nicht mehr zur Schule zurückgehen, versucht erst gar nicht, mich zu überreden. Ich werde nie ein Examen machen, und ich bin auch nicht scharf darauf. Ich gehe zu Vincent. Nach Irland. Sobald ich kann, werde ich hier verschwinden.«
Sie hatten geschimpft und gefleht. Ohne Erfolg. Genau so machte er es.
»Aber warum tust du uns das an?« Ihre Mutter weinte. »Ich tue euch überhaupt nichts an.« Brendan sprach sanft. »Ich mache das für mich, es wird euch kein Geld kosten. Es ist der Hof, auf dem Vater aufgewachsen ist. Ich dachte, es würde euch freuen.«
»Glaubt ja nicht, daß er dir die Farm automatisch überschreibt«, sprudelte Vater heraus. »Genausogut könnte der alte Einsiedler sie der Mission hinterlassen. Vielleicht kommst du schon bald dahinter, daß all deine Bestechungsversuche umsonst waren.« »Vater, ich denke nicht an Erbschaften, Testamente und sterbende Leute; ich denke darüber nach, wie ich meine Tage verbringen will. Ich war glücklich dort, und Vincent könnte Hilfe gebrauchen.«
»Na, ist es dann nicht verwunderlich, daß er niemals geheiratet hat, um sich eigene Helfer anzuschaffen, anstatt Fremde zu holen?«
»Ein Fremder bin ich wohl kaum, Vater«, hatte Brendan widersprochen. »Ich bin sein eigen Fleisch und Blut, das Kind seines Bruders!«
Es war der reinste Alptraum!
Und seither war die Kommunikation auf ein Mindestmaß begrenzt: Karten zu Weihnachten und zu Geburtstagen, vielleicht auch noch zu Hochzeitstagen, Anna konnte sich nicht daran erinnern. Hochzeitstage! Wie sollte sie die Truppe zu diesem hier zusammenbringen?
Die »Brautjungfer«, wie sie immer genannt wurde, war Maureen Barry. Sie war Mutters beste Freundin. Damals in Irland waren sie zusammen zur Schule gegangen. Maureen hatte niemals geheiratet. Sie war genauso alt wie Mutter, sechsundvierzig, sah aber jünger aus. In Dublin hatte sie zwei Bekleidungsgeschäfte – den Ausdruck Boutiquen lehnte sie ab. Vielleicht konnte Anna mit Maureen reden, um herauszufinden, was das beste war. Aber in ihrem Kopf ging laut eine Alarmglocke an. Mutter verstand es großartig, Familienangelegenheiten nicht nach außen dringen zu lassen.
Es hatte immer Geheimnisse vor Maureen gegeben. Wie damals, als Vater seinen Job verloren hatte. Das durfte man niemandem erzählen!
Und wie damals, als Helen mit vierzehn weggerannt war. Davon erfuhr Maureen kein Sterbenswörtchen! Mutter hatte gesagt, daß alles im Grunde nicht so wichtig war. Es gab für alles eine Lösung, solange nur die Familienangelegenheiten nicht an die Öffentlichkeit kamen und Nachbarn und Freunde nicht alles über das Familienleben der Doyles erfuhren. Wenn etwas nicht so lief, wie es sollte, schien dieses Stillschweigen ein sehr wirksames und besänftigendes Heilmittel zu sein, deshalb hatte sich die Familie auch immer daran gehalten.
Man sollte meinen, Anna könnte Maureen Barry einfach anrufen und Mutters beste Freundin fragen, was in bezug auf Brendan und den Hochzeitstag das beste war.
Aber Mutter würde sofort tot umfallen, wenn sie auch nur mit der geringsten Möglichkeit rechnen müßte, ein Mitglied der Familie könnte ein Geheimnis nach außen dringen lassen. Und das kühle Verhältnis zu Brendan war ein großes Geheimnis.
Es gab auch keine Angehörigen, die man bitten konnte zu vermitteln.
Nun, was für ein Fest sollte es sein? Es würde an einem Samstag stattfinden, also konnte man zum Mittagessen einladen. Um Pinner, Harrow und Northwood herum gab es eine Menge Hotels, Restaurants und andere Orte, die auf solche Anlässe eingerichtet waren. Vielleicht wäre ein Hotel das beste.
Zum einen wäre es auf diese Weise eine förmliche Angelegenheit. Der Bankettmanager könnte sie hinsichtlich Toasts, Kuchen und Fotografien beraten.
Auch ein wochenlanger anstrengender Hausputz und das Herrichten des Vorgartens bliebe ihnen erspart.
Aber Anna hatte aus ihrem lebenslangen Dasein als die Älteste der Doyle-Kinder gelernt, daß ein Hotel nicht das richtige war. Sie hatte in der Vergangenheit viel zu viele abwertende Äußerungen über Hotels gehört, zudem vernichtende und kritische Bemerkungen über die eine Familie, der man es nicht zumuten konnte, so etwas im eigenen Haus stattfinden zu lassen, oder über eine andere, die dich zwar gerne zu einem so unpersönlichen Ort wie einem gewöhnlichen Hotel einlud, dich aber nicht über die eigene Türschwelle ließ. Vielen Dank!
Es mußte also zu Hause stattfinden. Auf der Einladung hatte in silbernen Lettern zu stehen, daß der Gast nach Salthill, Rosemary Drive 26, Pinner geladen wurde. Salthill war ein Seebad drüben in Westirland, wo Mutter und Maureen Barry in ihrer Jugend oft hingefahren waren. Es war wunderschön dort, sagten sie. Vater war nie da gewesen. Er sagte, für einen langen Familienurlaub hätte es keine Zeit gegeben, als er in Irland groß wurde und seinen Weg machte.
Müde stellte Anna eine Liste auf. Das Fest würde soundso groß sein, falls aus Irland niemand kam, und soundso groß, wenn sie doch kämen. Soundso bei einem Essen zu Tisch, soundso bei einem Büfett. Wie groß, wenn es nur Getränke und Imbiß gab, wie groß bei einem vollständigen Essen.
Und wer sollte das alles bezahlen?
Sehr oft übernahmen das die Kinder, das wußte sie.
Aber Helen hatte ein Armutsgelübde abgelegt und besaß nichts. Und Brendan, selbst wenn er kommen sollte, was nicht zu erwarten war, verdiente einen Landarbeiterlohn. Anna hatte kaum Geld übrig, das sie für so ein Fest ausgeben konnte.
Sie hatte tatsächlich sehr wenig Geld. Nur weil sie sehr sparsam war, oft auf ein Mittagessen verzichtete und in Oxfam hin und wieder günstig einkaufte, hatte sie es geschafft, einhundertzweiunddreißig Pfund auf die Seite zu legen. Sie hoffte, es mit Hilfe der Sparkasse auf zweihundert Pfund zu bringen. Und dann, wenn Joe ebenfalls zweihundert beisammen hatte, wollten sie zusammen nach Griechenland fahren. Im Moment besaß Joe elf Pfund, er hatte also – was das Sparen betraf – noch einen längeren Weg vor sich. Aber er war sich sicher, bald eine Rolle zu bekommen. Sein Agent hatte gesagt, es täte sich einiges. Jeden Tag konnte es soweit sein.
Anna hoffte, daß er recht behielt. Sie hoffte es ganz aufrichtig.
Wenn er etwas Gutes bekam, etwas, womit er sich tatsächlich Anerkennung verschaffen konnte, etwas Zuverlässiges, dann würde ihm alles andere in den Schoß fallen. Nicht nur der Urlaub in Griechenland, sondern einfach alles. Er könnte den Unterhalt seiner Söhne bestreiten, Janet etwas geben, das ihr das Gefühl von Unabhängigkeit vermittelte, und endlich den Scheidungsprozeß in die Wege leiten. Anna könnte dann riskieren, bei »Bücher für Leute« zu kündigen, um bei einer größeren Buchhandlung anzufangen. Dort hätte sie als Fachkraft mit Berufserfahrung gute Aufstiegsmöglichkeiten. Bestimmt würde man sie mit offenen Armen aufnehmen.
Während sie nachdachte, verstrich die Zeit, und bald wurden Schlüssel im Schloß gedreht, und die anderen kamen. Gleich darauf öffnete sie die Ladentür, die Planungen waren damit wieder einmal zu Ende.
Beim Mittagessen beschloß Anna, am Abend nach Pinner zu fahren und ihre Eltern geradeheraus zu fragen, wie sie ihren Tag am liebsten feiern wollten. Obwohl ihr das weniger feierlich erschien als zu verkünden, alles sei bestens arrangiert.
Doch alles im Alleingang zu versuchen wäre tatsächlich unsinnig, schließlich konnte sie es genausogut falsch anpacken. Sie würde einfach ohne Umschweife fragen.
Sie rief an, um Bescheid zu sagen, daß sie vorbeikäme. Ihre Mutter freute sich.
»Das ist gut, Anna. Wir haben dich ja seit Ewigkeiten nicht gesehen! Gerade habe ich zu Vati gesagt: ›Hoffentlich geht es Anna gut und es ist nichts passiert!‹«
Anna knirschte mit den Zähnen.
»Wieso sollte was passiert sein?«
»Na, es ist einfach so lange her, und wir wissen gar nicht, was du machst.«
»Mutter, es sind gerade acht Tage! Letztes Wochenende war ich bei euch.«
»Ja, aber wir wissen nicht, was du so treibst …«
»Ich rufe fast jeden Tag bei euch an. Ihr wißt, was ich so treibe: aufstehen in Shepherd’s Bush, mit der U-Bahn hier reinfahren und wieder nach Hause. Genau das tue ich, Mutter, so wie viele Millionen anderer Leute in London auch.« Aus Wut über das Verhalten ihrer Mutter wurde sie laut.
Die Antwort war überraschend milde: »Warum schreist du mich an, Anna, mein liebes Kind? Ich habe doch nur gesagt, daß es mich freut, wenn du heute abend vorbeikommst. Dein Vater wird vor Begeisterung außer sich sein! Sollen wir ein kleines Steak mit Pilzen vorbereiten, so als kleine Willkommensfeier für dich? Ja, ich werde heute nachmittag zum Metzger laufen und etwas holen … Das ist einfach großartig, daß du mal wieder kommst! Ich kann gar nicht abwarten, es deinem Vater zu erzählen! Ich werde ihn gleich in der Arbeit anrufen und es ihm sagen.«
»Nein … Mutter, nur … also, ich meine …«
»Natürlich tue ich das! Gönne ihm doch das Vergnügen. Das ist doch was, worauf er sich freuen kann.«
Als sie aufgelegt hatte, stand Anna regungslos mit dem Hörer in der Hand da und dachte an das eine Mal, als sie Joe zum Essen mit nach Salthill, Rosemary Drive 26, genommen hatte. Sie hatte ihn als »Freund« angekündigt und die ganze Fahrt darauf verwendet, ihm das Versprechen abzuringen, weder etwas von ihrem Zusammenleben noch von seiner Ehe mit einer anderen verlauten zu lassen.
»Was davon ist gefährlicher, wenn es mir doch herausrutscht?« hatte Joe sie grinsend gefragt.
»Beides ist gleich gefährlich«, hatte sie mit solcher Ernsthaftigkeit gesagt, daß er sich im Zug zu ihr hinübergebeugt hatte, um sie vor allen Leuten auf die Nase zu küssen.
Für einen Besuch war es durchaus in Ordnung gewesen, fand Anna. Mutter und Vater hatten sich nach seiner Karriere erkundigt und ob er berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen kannte.
In der Küche hatte Mutter sie gefragt, ob sich zwischen ihnen etwas anbahnte.
Anna hatte nachdrücklich behauptet, er sei nur ein Freund.
Auf dem Nachhauseweg hatte sie Joe gefragt, wie ihm ihre Eltern gefielen.
»Sie sind nett, aber auch sehr verkrampft«, hatte er geantwortet.
»Verkrampft«? Mutter und Vater? Ihr war das nie in den Sinn gekommen. Aber irgendwie hatte er damit recht.
Dabei wußte Joe nicht einmal, wie sie sein konnten, wenn sie unter sich waren. Wenn Mutter sich fragte, warum Helen schon zweimal nicht dagewesen war, als sie vergangene Woche bei ihrer Gemeinschaft angerufen hatte. Und wenn Vater durch den Garten schritt, von den Blumen die Köpfe abriß und erklärte, der Junge sei so ruhelos und faul, daß er nur als strohhalmkauender Dorfidiot auf einem kleinen Bauernhof enden konnte. Daß es nur schwer nachzuvollziehen war, warum er ausgerechnet in dieses eine Dorf in Irland zurückkehren mußte, wo man sie kannte. Warum er ausgerechnet mit dem einen Menschen in Irland zusammenlebte, der garantiert den schlimmsten Eindruck von den Doyles und ihrem Tun und Lassen vermitteln konnte, seinem eigenen Bruder Vincent, Brendans Onkel. Nur um später einmal diesen elenden Bauernhof zu erben!
Joe hatte keine von diesen Seiten ihrer Eltern kennengelernt, und trotzdem fand er sie »verkrampft«.
Anna wollte der Sache auf den Grund gehen: »Warum? Wie äußert sich das?« Aber Joe wollte sich nicht ausfragen lassen.
»Es ist eben so!« hatte er erwidert. Dabei lächelte er, um seinen Worten die Schärfe zu nehmen. »Manche Leute leben halt so, daß man das eine sagen kann und das andere nicht, und sie überlegen gut, was sie erzählen können und was nicht. Es ist eine Handlungsweise, bei der alles Vorspiegelung ist – eine Rolle … Nun, es stört mich nicht, wenn jemand so leben will. Es ist zwar nicht meine Art, aber solche Leute stellen einen Haufen Regeln auf und leben danach …«
»Wir sind nicht so!« Sie war gekränkt.
»Ich kritisiere doch nicht dich, Liebes! Ich sage nur, was ich sehe … Ich sehe, wie kahlgeschorene Hare Krischnas tanzen und Glöckchen schwingen. Ich sehe, wie du und deine Familie die Dinge so darstellen, wie ihr es eben tut. Ich lasse keine Hare Krischnas an mich ran – und deine Alten genausowenig. Klar?« Er grinste sie freundlich an.
Mit einem hohlen, leeren Gefühl im Innern hatte sie zurückgegrinst und beschlossen, das Thema zu wechseln.
Der Tag ging dem Ende entgegen. Einer der netteren Verlagsvertreter war da, als das Geschäft schloß. Er lud Anna ein, mit ihm etwas trinken zu gehen.
»Ich muß noch ins finsterste Pinner fahren«, sagte Anna. »Am besten breche ich sofort auf.«
»Ich fahre in dieselbe Richtung. Wir könnten unterwegs was zusammen trinken«, schlug er vor.
»Kein Mensch fährt nach Pinner«, lachte sie.
»Oh, wie willst du wissen, ob ich da draußen nicht eine Geliebte habe oder hoffe, eine zu finden?« neckte er.
»Im Rosemary Drive würden wir über solche Dinge nicht reden«, meinte Anna eher spöttisch.
»Los, komm schon mit! Der Wagen steht im Halteverbot«, lachte er.
Es war Ken Green. Sie hatte sich in der Buchhandlung schon oft mit ihm unterhalten. Beide hatten sie am gleichen Tag angefangen zu arbeiten, dadurch hatten sie sich irgendwie miteinander verbunden gefühlt.
Genau wie sie wollte er seine Firma verlassen, um sich bei einer größeren zu bewerben. Keiner von ihnen hatte es bisher getan.
»Glaubst du, wir sind einfach zu feige?« fragte sie ihn, während er sich durch den Berufsverkehr kämpfte.
»Nein, ich hatte immer meine Gründe. Und was hält dich zurück? Deine sittenstrenge Verwandtschaft vom Rosemary Drive?«
»Wie kommst du darauf, daß sie sittenstreng sind?« fragte sie überrascht.
»Du hast mir gerade erzählt, daß man bei euch zu Hause nicht über Geliebte spricht«, sagte Ken.
»Das ist leider allzu wahr! Sie wären sehr enttäuscht, wenn sie wüßten, daß ich selbst eine bin«, sagte Anna.
»Das wäre ich auch!« Ken machte einen ernsten Eindruck.
»Hör bloß auf«, lachte sie ihn an. »Man tut sich immer leichter mit Komplimenten bei jemandem, von dem man weiß, daß er in festen Händen ist, das ist viel ungefährlicher. Hätte ich dir erzählt, ich wäre frei und wollte mich austoben, wärst du lieber meilenweit vor mir davongerannt, als mich auf einen Drink einzuladen!«
»Völlig falsch! Ich habe hauptsächlich deshalb euren Buchladen kurz vor Feierabend besucht, weil ich den ganzen Tag daran gedacht habe, wie nett es wäre, mich mit dir zu treffen. Willst du mir etwa Zaghaftigkeit vorwerfen, hey?«
Kameradschaftlich tätschelte sie sein Knie. »Nein, ich habe dich falsch eingeschätzt.« Sie seufzte tief. Es war so einfach, mit Ken zu reden. Sie mußte nicht mit allem aufpassen, was sie sagte, wie sie es im Rosemary Drive tun müßte und auch später, wenn sie wieder bei Joe war.
»War das ein Freudenseufzer?« fragte er.
Bei Joe oder Mutter und Vater hätte sie »ja« gesagt.
»Überdruß! Ich hab all die Lügen satt!« sagte sie. »Sehr satt!«
»Aber du bist doch jetzt ein großes Mädchen. Du brauchst doch bestimmt über dein Leben und die Art, wie du es führst, keine Lügen mehr zu erzählen!«
Anna nickte verdrießlich mit dem Kopf. »Das tue ich aber! Ehrlich, das tue ich!«
»Vielleicht meinst du das nur.«
»Nein, wirklich! Wie mit dem Telefon: Zu Hause habe ich erzählt, ich hätte es abgemeldet, damit sie nicht bei mir anrufen. Auf dem Anrufbeantworter ist nämlich eine Nachricht, die lautet: ›Dies ist der Anschluß von Joe Ashe!‹ Das braucht er, verstehst du? Weil er Schauspieler ist und immer erreichbar sein muß.«
»Ganz klar«, sagte Ken.
»Also will ich natürlich nicht, daß meine Mutter anruft und eine männliche Stimme hört. Und ich will auch nicht, daß mein Vater fragt, was dieser Mann in meiner Wohnung verloren hat.«
»Das könnte ihn tatsächlich interessieren, und warum Joe nicht selbst einen Anschluß mit einem eigenen Anrufbeantworter hat«, bemerkte Ken streng.
»Ich muß schon vorsichtig sein, daß ich nicht etwa anfallende Telefonrechnungen erwähne! Und ich muß immer daran denken, daß man nicht mit mir am Apparat rechnet. Das ist nur eine von neun Millionen Lügen.«
»Gut, das kann man verstehen – auf der anderen Seite! Ich meine, du mußt doch nicht etwa diesen Schauspielertypen anlügen?« Ken schien darauf erpicht, es zu erfahren.
»Lügen? Nein, überhaupt nicht! Weshalb sollte ich lügen müssen?«
»Ich weiß nicht. Du hast von all den Lügen geredet, die du überall erzählen mußt. Ich dachte, vielleicht ist er so ein eifersüchtiger Macho, daß du ihm nicht sagen kannst, daß du mit mir was trinken gegangen bist! Falls wir noch je zu unserem Drink kommen sollten!« Ken schaute unglücklich auf die Hecks der Autos vor ihnen.
»O nein, das verstehst du nicht! Joe würde es freuen, wenn er wüßte, daß ich mit einem Freund etwas trinken gehe. Es ist nur …« Ihre Stimme stockte. Was war es nur? Es war nur diese endlose, absolut endlose Verpflichtung zu heucheln. Daß es ihr in diesem seltsamen Club gefiel, wo sie immer hingingen. Daß sie dieses gleichgültige Verhalten seiner Mutter, seiner Frau und seinen Kindern gegenüber verstehen konnte. Daß sie diese verkommenen Theater mochte, wo er kleine Rollen spielen mußte. Daß sie jederzeit Lust hatte, mit ihm ins Bett zu gehen. Daß sie diese komplizierte Familienfeier, die vor ihr lag, auf die leichte Schulter nahm.
»Ich lüge Joe nicht an«, sagte sie, wie zu sich selbst. »Ich spiele ihm nur ein bißchen was vor.«
Einen Moment herrschte Schweigen.
»Tja, ich schätze, er ist eben Schauspieler«, sagte Ken irgendwann und versuchte damit, die Unterhaltung wieder in Gang zu bringen.
Das war es nicht! Der Schauspieler spielte gar nicht. Er machte nie jemandem etwas vor, nur um zu gefallen. Sie, seine Freundin, war diejenige, die alle diese Rollen spielte. Seltsam, daß sie noch nie so eingehend darüber nachgedacht hatte.
Als sie schließlich doch noch ein Pub gefunden hatten, setzten sie sich hin und unterhielten sich unbeschwert.
»Willst du deine Leute anrufen und ihnen Bescheid sagen, daß du aufgehalten wurdest?« schlug Ken vor.
Sie schaute ihn an, überrascht, wie rücksichtsvoll er war.
»Na ja, wenn sie schon Steaks und all das besorgt haben …«, sagte er.
Mutter war gerührt. »Das ist aber nett von dir, Liebes! Vater hat schon begonnen, nach dir Ausschau zu halten. Er wollte schon zum Bahnhof runtergehen!«
»Nein, ich habe eine Mitfahrgelegenheit.«
»Etwa mit diesem Joe? Joe Ashe, dem Schauspieler?«
»Nein, nein, Mutter, mit Ken Green, einem Freund, den ich von meiner Arbeit kenne.«
»Ich glaube nicht, daß ich genügend Steaks da habe …«
»Er kommt nicht mit zum Abendessen; er fährt mich nur hin.«
»Dann bitte ihn wenigstens herein, ja? Wir möchten deine Freunde sehr gern kennenlernen. Dein Vater und ich würden uns wirklich wünschen, du brächtest öfter mal jemanden mit. Das habt ihr doch früher alle getan, die ganzen Jahre über!« Ihre Stimme klang versonnen, als ob sie auf ihre Fotowand schaute und dort etwas vermißte.
»Na gut, ich werde ihn für einen Augenblick hineinbitten!« sagte Anna.
»Kannst du das verkraften?« fragte sie Ken.
»Ich tue es gerne. Ich könnte ein Tropfenfänger sein.«
»Was, in aller Welt, soll denn das sein?«
»Liest du denn keine Regenbogenpresse? Da ist einer, der die Aufmerksamkeit von dem wahren Geliebten ablenkt und auf sich zieht. Wenn sie einen so aufrichtigen Zeitgenossen wie mich kennenlernen, werden sie keine bösen, wollüstigen Schauspieler wittern, die ihre Anrufbeantworter an dein Telefon anschließen!«
»Oh, halt die Klappe!« lachte sie und fühlte sich dabei ganz unbeschwert.
Sie tranken noch etwas. Anna erzählte Ken Green von dem Hochzeitstag. Sie erklärte ihm kurz, daß ihre Schwester eine Nonne sei und ihr Bruder ein Aussteiger, der weggegangen war, um auf dem Bauernhof des älteren Bruders ihres Vaters zu arbeiten, in einem heruntergekommenen Ort an der Westküste Irlands.
Sie fühlte sich gleich leichter und erzählte ihm, daß das der Grund war, warum sie zum Essen heimkam: Zum ersten Mal seit langer Zeit wollte sie ganz offen mit ihren Eltern reden, sie über ihre Wünsche zum Hochzeitstag befragen, ihnen sagen, was ging und was nicht, und ihnen die Probleme darlegen.
»Wenn sie so sind, wie du sagst, gehst du besser nicht so hart ran mit Problemen und dem, was vielleicht nicht geht; bleib lieber bei der festlichen Seite!« riet er.
»Haben deine Eltern schon ihre Silberhochzeit gefeiert?«
»Vor zwei Jahren«, sagte Ken.
»War es schön?« wollte sie wissen.
»Nicht so ganz.«
»Oh!«
»Wenn ich dich besser kenne, werde ich dir alles darüber erzählen«, sagte er.
»Ich dachte, wir kennen uns bereits gut?« Anna war enttäuscht.
»Nein, um dir Einzelheiten aus meinem Leben zu verraten, brauche ich mehr als einen Drink!«
Anna ärgerte sich unsinnigerweise darüber, daß sie Ken alles über Joe Ashe erzählt hatte, während er zu Hause ein Geheimnis bleiben mußte.
»Ich glaube, ich rede zuviel«, sagte sie zerknirscht.
»Nein, du bist einfach ein netterer Mensch. Ich bin ziemlich zugeknöpft!« sagte Ken. »Los, kipp das runter, wir brechen auf zu den Salzminen!«
»Den was?«
»Hast du nicht gesagt, euer Haus heißt so?«
Anna lachte und versetzte ihm einen Stoß mit der Handtasche. Er brachte sie dazu, sich wieder normal zu fühlen, so wie vor langer Zeit, als es noch wunderbar war, ein Teil der Familie Doyle zu sein, anstatt durch ein Minenfeld laufen zu müssen, wie es heute schien.
Mutter wartete auf der Treppe.
»Ich bin nur rausgekommen, um zu sehen, ob ihr Schwierigkeiten beim Einparken habt«, erklärte sie.
»Danke, aber es war recht einfach … Wir hatten Glück!« meinte Ken ungezwungen.
»Wir haben noch nicht viel von Ihnen gehört – das ist also mal eine nette Überraschung!« Die Augen ihrer Mutter glänzten – zu sehr!
»Ja, für mich ist es auch eine Überraschung! Ich kenne Anna nicht sehr gut. Wir reden nur manchmal miteinander, wenn ich in die Buchhandlung komme. Heute abend wollte ich sie einladen, mit mir was trinken zu gehen. Und weil sie zufällig heute nach Pinner wollte, bot es sich an, gemeinsam zu fahren und ein bißchen zu plaudern.«
Anna erinnerte sich daran, daß Ken Green Geschäftsmann war, der seinen Lebensunterhalt damit verdiente, Bücher zu verkaufen, und der größere Aufträge als üblich an Land zog, indem er Buchhändler überredete, seine Bücher in der Auslage auszustellen und umfangreiche Präsentationspakete abzunehmen. Natürlich war er in der Lage, sich selbst genauso gut zu verkaufen!
Ihr Vater mochte ihn auch.
Ken schaffte es, die richtigen Fragen zu stellen und die falschen zu unterlassen. Er fragte unbefangen nach der Berufssparte, in der Mr. Doyle beschäftigt war. Das Gesicht ihres Vaters nahm seinen üblichen störrischen, abwehrenden Ausdruck an. Seine Stimme bekam den bekannten Tonfall, den sie immer hatte, wenn er von Arbeit und Rationalisierungsmaßnahmen sprach.
Die meisten Leute verhielten sich ausweichend und irgendwo mitfühlend, machten sich aber gleichzeitig über ihn lustig, wenn Desmond Doyle mit seiner Leidensgeschichte anfing: mit der Firma, der es dank seiner Mitarbeit recht gut ging, bis im Verlauf von Rationalisierungsmaßnahmen viele sichere und solide Stellen verlorengingen. Desmond Doyles Beruf hatte sich verändert, wie er Ken Green sagte. Vollkommen verändert! Heutzutage gab es in diesem Geschäft nicht mehr die Männer vom alten Schlag!
Anna fühlte sich bedrückt. Es war immer dasselbe. So stellte Vater die Geschichte immer dar. In Wahrheit war Vater wegen einem »persönlichen Konflikt« entlassen worden, wie Mutter es nannte. Aber das war ein Geheimnis. Ein großes Geheimnis, von dem niemand etwas erfahren sollte! Auch in der Schule durfte es nie erwähnt werden. Damals hatte es wohl angefangen, daß ihr Geheimniskrämerei zur Gewohnheit wurde, dachte Anna plötzlich. Vielleicht hatte überhaupt die ganze Geheimnistuerei damals angefangen! Denn ein Jahr später wurde Vater bei derselben Firma wieder eingestellt. Und auch das wurde niemals erklärt.
Von Ken war kein zustimmendes Gemurmel über die Welt im allgemeinen und dem Verhalten von Geschäftsmännern im besonderen zu vernehmen.
»Und wie haben Sie es geschafft, die Rationalisierungsmaßnahmen zu überstehen? Hatten Sie einen wichtigen Posten?«
Annas Hand flog zu ihrem Mund. Nie zuvor war jemand in diesem Haus so direkt gewesen. Annas Mutter blickte von einem zum anderen und sah höchst besorgt aus. Kurze Zeit herrschte Schweigen.
»Ich habe sie nicht überstanden, wie es halt manchmal so geht!« erwiderte Desmond Doyle. »Ich war ein Jahr lang draußen. Aber als wieder ein Personalwechsel anstand und ein paar persönliche Meinungsverschiedenheiten ausgebügelt waren, holten sie mich zurück.«
Annas Hand blieb an ihrem Mund. Das war das erste Mal, daß Vater je zugegeben hatte, ein Jahr arbeitslos gewesen zu sein! Sie fürchtete sich fast davor, die Reaktion ihrer Mutter darauf zu sehen.
Ken nickte zustimmend. »Das passiert oft! Es ist, als würde jemand alle Puzzleteile in eine Papiertüte packen, um später ein paar von ihnen auf den Tisch zurückzuschütten. Obwohl nicht immer alle Teile in die richtigen Lücken zurückgesteckt werden …?« Er lächelte ermutigend.
Anna schaute Ken Green an, als hätte sie ihn noch nie gesehen. Was tat er da? Er saß in diesem Zimmer und fragte ihren Vater über verbotene Themen aus? Würden Mutter und Vater auch nur den leisesten Verdacht schöpfen, daß sie sich mit Ken über private Dinge unterhalten hatte?
Gnädigerweise nahm Vater es ihm überhaupt nicht übel. Er war damit beschäftigt, Ken zu erklären, daß tatsächlich Leute in den falschen Abteilungen wieder eingesetzt wurden. Er selbst hätte eigentlich Manager in der Ablauforganisation werden sollen und bekam statt dessen die Abteilung »Sonderprojekte«. Das bedeutete soviel und sowenig, wie man wollte. Es war ein bedeutungsloser Job.
»Das läßt einem immer noch die Möglichkeit, daraus zu machen, was man will. So ist das mit bedeutungslosen Jobs. Ich habe einen, Anna hat einen, und jeder versucht auf seine Weise, etwas daraus zu machen.«
»Ich habe keinen bedeutungslosen Job!« rief Anna.
»Aber man könnte ihn doch so nennen, oder? Er bietet dir keine richtige Perspektive, keine Möglichkeit, dich hochzuarbeiten und echte Anerkennung zu ernten. Du machst daraus einen guten Job, weil dich das Verlagswesen interessiert, weil du die Verlagsprospekte studierst und verstehst, warum Bücher erscheinen und wer sie kauft. Genausogut könntest du rumstehen und deine Nägel feilen wie deine rothaarige Kollegin.«
Annas Mutter kicherte nervös.
»Solange du jung bist, hast du die Chance, etwas aus deinem Beruf zu machen, Ken, da haben Sie natürlich recht! Aber nicht mehr, wenn du alt bist.«
»Also sind Sie doch genau richtig«, schmeichelte Ken.
»Kommen Sie, schmeicheln Sie mir nicht …«
»Das tue ich nicht!« Kens Gesicht drückte aus, daß er das nicht im entferntesten beabsichtigte. »Sie sind doch bestimmt nicht älter als sechsundvierzig? Sechs- oder siebenundvierzig?« Anna ärgerte sich maßlos, daß sie so dumm gewesen war, einen solchen Tölpel nach Hause eingeladen zu haben.
»Das stimmt! Ich werde siebenundvierzig«, erwiderte Vater.
»Also das ist doch nie im Leben alt, nicht wahr? Nicht richtig alt, wie achtundfünfzig oder zweiundsechzig.«
»Deirdre, können wir aus dem Steak nicht vier Teile machen? Der junge Bursche da tut mir gut, er muß zum Abendessen bleiben!«
Annas Gesicht glühte. Wenn er ja sagte, würde sie ihm das niemals verzeihen!
»Nein, danke, Mr. Doyle! Nein, wirklich nicht, Mrs. Doyle! Es wäre sicher sehr nett, aber heute abend nicht! Ich trinke nur noch aus und will dann ihren gemeinsamen Abend nicht länger stören.«
»Aber es macht bestimmt keine Umstände, und wir würden uns freuen …«
»Heute abend nicht! Ich weiß, daß Anna mit Ihnen reden möchte.«
»Aber ich bin sicher, wenn es irgend etwas gibt …« Annas Mutter blickte verstört von ihrer Tochter zu diesem gutaussehenden jungen Mann mit den dunklen Haaren und den dunkelbraunen Augen. Anna war doch sicherlich nicht wegen irgendwelchen Ankündigungen, die ihn betrafen, nach Hause gekommen? War diese Ahnung ihrem Gesicht abzulesen?
Ken half ihr aus der Misere: »Nein, es hat wirklich nichts mit mir zu tun. Es geht um eine Familienangelegenheit – sie will mit Ihnen über Ihre silberne Hochzeit reden und wie Sie sie feiern werden.«
Desmond Doyle war enttäuscht, daß Ken definitiv gehen wollte. »Oh, das ist doch noch Monate hin!« wandte er ein.
»Egal, wann es ist, Hauptsache, Sie reden darüber und tun, was Sie beide gern möchten! Und weil ich weiß, daß Anna heimgekommen ist, um mit Ihnen darüber zu sprechen, werde ich Sie jetzt alleine lassen!«
Nachdem er allen die Hand geschüttelt und mit der linken Hand noch kurz nach Annas Arm gegriffen hatte, war er verschwunden.
Sie schauten ihm nach, wie er ausparkte und – mehr um sich erkenntlich zu zeigen – leise hupte.
Fast wortlos standen die drei Doyles auf der Türschwelle des Hauses Salthill, Rosemary Drive Nummer 26.
Anna schaute ihre Eltern an. »Ich habe nur so nebenbei erwähnt, daß wir Pläne machen wollten. Ich weiß gar nicht, wieso er deshalb so ein Tamtam gemacht hat.«
Sie hatte das Gefühl, daß ihr die beiden nicht zuhörten.
»Das war nicht der einzige Grund, warum ich gekommen bin. Schließlich wollte ich euch beide auch sehen.«
Immer noch Stille.
»Und ich weiß, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe ihm das nur erzählt, weil … nun, weil ich halt irgendwas sagen mußte!«
»Ein sehr sympathischer junger Mann«, bemerkte Desmond Doyle. »Sieht gut aus und ist gut gekleidet!«
Eine Welle des Zorns erfaßte Anna. Er wurde bereits zu seinem Vorteil mit Joe Ashe verglichen, Joe, den sie von ganzem Herzen liebte!
»Ja«, sagte sie mit gedämpfter Stimme.
»Du hast noch nie viel von ihm erzählt«, sagte ihre Mutter.
»Ich weiß, Mutter, das hast du bereits zwei Sekunden, nachdem du ihn kennengelernt hast, erwähnt.«
»Sei nicht so frech zu deiner Mutter!« sagte Desmond Doyle unwillkürlich.
»Um Himmels willen, ich bin dreiundzwanzig Jahre alt und kein freches Kind«, tobte Anna.
»Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst«, sagte ihre Mutter. »Wir haben ein schönes Abendessen für dich hergerichtet, stellen eine höfliche Frage, bemerken, wie nett dein Freund ist, und du beißt uns dafür die Köpfe ab!«
»Tut mir leid!« Das war wieder die alte Anna.
»Ist schon in Ordnung! Du bist einfach müde nach dem langen Tag. Vielleicht haben dir die Drinks und die ganze Fahrerei nicht gutgetan.«
Anna ballte die Fäuste und schwieg.
Sie waren ins Haus zurückgegangen und standen alle drei verlegen im Wohnzimmer herum, neben der Wand mit den Familienfotos.
»Also, was sollen wir jetzt deiner Meinung nach tun? Essen?« Hilflos schaute Mutter vom einen zum anderen.
»Als sie hörte, daß du heute abend kommen wolltest, ist Mutter extra zu den Läden runtergelaufen«, sagte Vater.
Einen verrückten Augenblick lang wünschte sie, Ken Green wäre gar nicht weggefahren, sondern hiergeblieben, um einen Keil in dieses verschwommene Gespräch zu treiben, dieses Im-Kreis-Gerede, das nirgendwo hinführte. Es lebte auf, ebbte wieder ab, verursachte Schuldgefühle und schuf Spannungen, die am Ende wieder beschwichtigt wurden.
Wäre er immer noch hiergewesen, hätte Ken wahrscheinlich gesagt: »Verschieben wir das Essen um ein halbes Stündchen und sprechen darüber, wie Sie Ihren Hochzeitstag nun tatsächlich gerne begehen möchten.« Genau das wären seine Worte gewesen. Nichts davon, was man tun sollte und was die anderen erwarten würden oder wie das Ganze anzupacken sei. Kurz bevor er ging, hatte er noch gesagt, Anna wollte mit ihren Eltern darüber reden, wie sie diesen Tag gerne verbringen würden.
»Gerne!« Das war ein Durchbruch in dieser Familie!
Spontan benutzte sie haargenau die gleichen Worte, die ihrer Meinung nach auch Ken gewählt hätte.
Verblüfft setzten sich die Eltern hin und schauten Anna erwartungsvoll an.
»Es ist euer Tag, nicht unserer! Was würde euch am besten gefallen?«
»Ja, also ehrlich …«, begann ihre Mutter verlegen. »Also, das hängt nicht von uns ab!«
»Es wäre natürlich erfreulich, wenn es für euch alle ein Grund zum Feiern wäre …«, sagte ihr Vater.
Anna schaute sie ungläubig an. Glaubten sie denn wahrhaftig, es sei nicht in erster Linie ihre Sache? War es tatsächlich möglich, daß sie die Heile-Welt-Vorstellung hatten, das Leben sei Sache ihrer Kinder, die gemeinsam beschlossen, daß dies ein Grund zum Feiern war? Hatten sie noch nicht gemerkt, daß sich in dieser Familie alle gegenseitig etwas vormachten … und daß sich die Darsteller, einer nach dem anderen, allmählich von der Bühne stahlen? Helen in ihre Gemeinschaft, Brendan auf seinen steinigen Einödhof in Westirland. Nur Anna, die zwei Bahnstationen entfernt wohnte, war wenigstens einigermaßen erreichbar.
Eine große Woge der Verzweiflung ergriff sie. Sie dürfte nicht in Wut geraten, das war ihr klar. Der ganze Abend würde nichts bringen, wenn er im Streit endete. Sie konnte förmlich hören, wie Joe sie milde fragte, warum, um alles in der Welt, sie solche langen, ermüdenden Fahrten auf sich nahm, wenn das Ganze nur in allgemeiner Verkrampfung und Unzufriedenheit endete.
Joe hatte das Leben richtig erkannt!
Sie spürte einen Schmerz, eine fast körperliche Sehnsucht, mit ihm zusammenzusein und auf dem Fußboden neben seinem Stuhl zu sitzen, während er ihr über die Haare strich.
Sie hatte zuvor nie erfahren, daß es möglich war, jemanden so intensiv zu lieben, und wie sie dieses sorgengeplagte Ehepaar da unterwürfig auf dem Sofa sitzen sah, fragte sie sich, ob ihre Eltern jemals auch nur den Bruchteil einer solchen Liebe gekannt hatten. Zwar konnte sie sich von ihren Eltern immer nur schwer vorstellen, wie sie gegenseitig ihre Liebe zueinander zeigten. Und daß sie miteinander schliefen, wie sie und Joe es taten, war erst recht jenseits aller Vorstellungen. Aber Anna wußte, daß jeder den eigenen Eltern gegenüber so empfand.
»Hört zu!« sagte sie. »Ich muß mal telefonieren. Ich möchte, daß ihr einen Augenblick aufhört, über das Festessen nachzudenken, und euch lediglich darüber unterhaltet, was ihr wirklich gerne hättet. Dann fange ich an, es zu organisieren. Klar?« Ihre Augen glänzten verdächtig, vielleicht hatten die Drinks ihr wirklich nicht gutgetan.
Sie ging zum Telefon und suchte einen Vorwand, warum sie mit Joe sprechen wollte – nichts Schwerwiegendes. Wenn sie nur seine Stimme hörte, würde sie sich wieder gut fühlen. Sie wollte ihm sagen, daß sie doch ein bißchen eher nach Hause kam, als sie gedacht hatte. Sollte sie einen chinesischen Imbiß mitbringen, eine Pizza oder einfach nur einen Becher Eis?
Weder jetzt noch später wollte sie ihm sagen, wie öde und bedrückend ihr früheres Zuhause war und daß ihre Eltern ihr ein Gefühl von Trauer und Elend, Frust und Wut vermittelten. So etwas wollte Joe Ashe nicht hören!
Sie wählte ihre eigene Nummer.
Sofort ging jemand an den Apparat. Joe mußte im Schlafzimmer gewesen sein! Ein Mädchen meldete sich.
Anna hielt den Hörer vom Ohr weg, wie man es oft im Kino sieht, wenn Fassungslosigkeit und Verwirrung demonstriert werden soll. Sie war sich dessen bewußt.
»Hallo!« wiederholte das Mädchen.
»Welche Nummer haben Sie?« fragte Anna.
»Bleiben Sie dran! Das Telefon steht auf dem Fußboden, ich kann’s nicht lesen. Eine Sekunde!« Das Mädchen klang jung und natürlich.
Anna stand völlig entgeistert da. In der Wohnung in Shepherd’s Bush stand tatsächlich das Telefon auf dem Fußboden. Um den Hörer abzunehmen, mußte man sich aus dem Bett lehnen.
Das Mädchen sollte sich nicht weiter bemühen – Anna wußte die Nummer.
»Ist Joe da?« wollte sie wissen. »Joe Ashe?«
»Nein, tut mir leid! Er ist Zigaretten holen gegangen. In ein paar Minuten wird er wieder dasein.«
Anna fragte sich, warum er nicht den Anrufbeantworter eingeschaltet hatte. Warum hatte er nicht automatisch den Knopf gedrückt wie immer, wenn er die Wohnung verließ, für den Fall, daß sein Agent anrief oder ein Anruf kam, der ihm endlich Anerkennung verschaffen sollte. Statt dessen war ein Anruf gekommen, der ihn verriet.
Sie lehnte sich an die Wand des Hauses, in dem sie aufgewachsen war. Sie brauchte eine Stütze.
Das Mädchen mochte keine Gesprächspausen. »Sind Sie noch dran? Wollen Sie zurückrufen, oder soll er Sie anrufen oder was?«
»Äh, ich weiß nicht recht!« Anna kämpfte um Zeit.
Wenn sie jetzt den Hörer auflegte, würde er niemals erfahren, daß sie etwas gemerkt hatte. Nichts hätte sich geändert, alles wäre wieder beim alten. Angenommen, sie sagte etwas wie: »Es ist nicht so wichtig« oder »Falsche Nummer« oder »Ich rufe ein anderes Mal an«, das Mädchen hätte mit einem Achselzucken aufgelegt und Joe gegenüber vielleicht gar nicht einmal erwähnt, daß jemand angerufen und wieder aufgehängt hatte. Anna würde niemals Fragen stellen. Sie wollte das, was sie miteinander hatten, nicht zerstören.
Aber was verband sie eigentlich noch miteinander? Ein Mann, der sich ein Mädchen ins Bett holte, in ihr Bett, sobald sie aus dem Haus war. Warum sollte sie versuchen, so etwas festzuhalten? Weil sie ihn liebte und weil eine große Leere über sie hereinbräche, wenn sie ihn nicht festhielt, und weil sie ihn so sehr vermissen würde, daß sie sterben wollte.
Angenommen sie sagte: »Bleiben Sie dran!« um ihn dann zur Rede zu stellen. Würde er Reue zeigen? Oder erklären, sie sei nur eine Schauspielerkollegin, die lediglich ihren Text mit ihm lernte?
Oder würde er sagen: »Es ist aus!« Dann würde die Leere und der Schmerz anfangen.
Das Mädchen war darauf aus, die Verbindung nicht zu verlieren, falls es sich um einen Job für Joe handelte.
»Bleiben Sie dran! Wenn Sie wollen, schreibe ich Ihren Namen auf. Augenblick, ich will nur schnell aufstehen! Mal sehen! Beim Fenster dort ist so eine Art Schreibtisch – nein, eine Frisierkommode … Jetzt habe ich einen Augenbrauenstift oder so was Ähnliches. Gut, wie war Ihr Name?«
Anna spürte, wie ihr die Galle hochkam. In ihrem eigenen Bett, unter der schönen teuren Tagesdecke, die sie zu Weihnachten gekauft hatte, lag ein fremdes Mädchen und war jetzt dabei, das Telefon zu dem Tisch mit Annas Make-up hinüberzutragen!
»Ist das Telefonkabel lang genug?« hörte Anna sich fragen.
Das Mädchen lachte. »Ja, es reicht tatsächlich!«
»Gut. Also, stellen Sie den Apparat mal kurz auf den rosa Stuhl, und greifen Sie auf den Kaminsims hoch! Genau! Sie finden da einen Spiralblock, an dem mit einer Schnur ein Bleistift befestigt ist.«