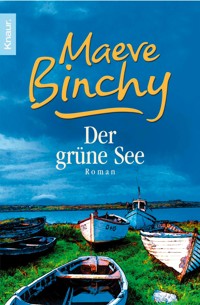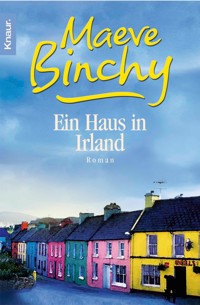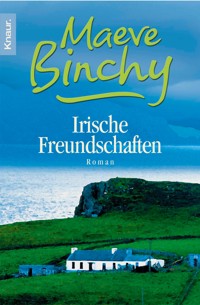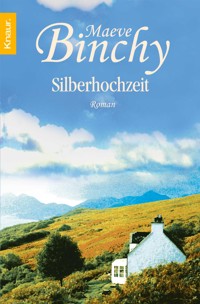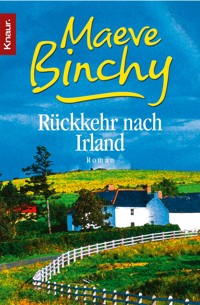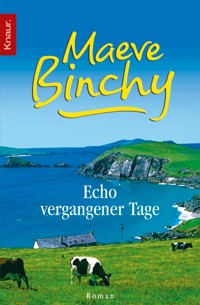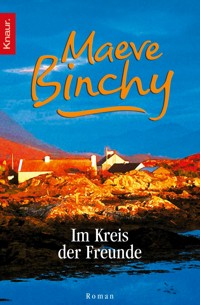
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die warmherzige Benny und die elfenhafte Eva Malone sind seit ihrer Schulzeit in dem schläfrigen Knockglen enge Freundinnen. Ihre Wege trennen sich auch nicht, als beide zum Studium nach Dublin gehen und sie auf einen Kreis junger Leute um den attraktiven Jack Foley und die schöne, aber egoistische Nan Mahon stoßen. Sehr bald müssen Benny und Eve lernen, daß wahre Freundschaft wichtiger ist als alle Zerstreuungen, die das Leben in der Großstadt ihnen bieten kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 875
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Maeve Binchy
Im Kreis der Freunde
Roman
Aus dem Englischen von Christine Strüh und Robert A. Weiß, Kollektiv Druck-Reif
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für meine große Liebe
Gordon Snell
Kapitel 1
1949
In der Küche duftete es nach frisch Gebackenem. Benny stellte ihre Schultasche ab und ging auf Inspektionstour.
»Die Torte ist noch nicht glasiert«, erklärte Patsy. »Das macht die gnädige Frau selbst.«
»Was wollt ihr denn draufschreiben?« fragte Benny neugierig.
»Na, wahrscheinlich ›Happy Birthday Benny‹«, erwiderte Patsy, erstaunt über die Frage.
»Vielleicht schreibt sie auch ›Benny Hogan, Zehn‹ drauf.«
»Das habe ich noch nie auf einer Torte gesehen.«
»Doch, wenn man einen runden Geburtstag hat, dann schon.«
»Na ja, kann sein.« Patsy klang nicht überzeugt.
»Und ist der Wackelpudding fertig?«
»Er ist in der Speisekammer. Aber bohr nicht mit dem Finger drin rum, sonst sieht man die Abdrücke, und dann reißen sie uns beiden den Kopf ab.«
»Ich kann es gar nicht fassen, daß ich zehn werde«, schwärmte Benny.
»Ja, das ist schon ein großer Tag«, sagte Patsy geistesabwesend, während sie die Bleche für die Rosinenkuchen mit einem Stück Butterpapier einfettete.
»Was hast du gemacht, als du zehn geworden bist?«
»Ach, weißt du, für mich waren alle Tage gleich«, meinte Patsy fröhlich. »Im Waisenhaus war jeder Tag wie der andere, bis ich rausgekommen bin und hier angefangen hab.«
Benny hörte gern Geschichten vom Waisenhaus. Sie gefielen ihr besser als alles, was sie in Büchern las. Es gab da den Schlafraum mit den zwölf eisernen Bettgestellen, die netten Mädchen und die garstigen Mädchen, und einmal hatten sie alle Nissen in den Haaren und mußten sich den Kopf rasieren lassen.
»Sie müssen doch auch Geburtstag gehabt haben.« Benny blieb hartnäckig.
»Ich erinnere mich nicht daran«, seufzte Patsy. »Es gab eine nette Nonne, die sagte zu mir, ich sei ein Mittwochskind, die machen immer Kummer.«
»Das war aber nicht nett.«
»Na, immerhin hat sie gewußt, daß ich an einem Mittwoch geboren bin … da kommt deine Mutter, jetzt laß mich weiterarbeiten.«
Annabel Hogan kam herein, mit drei großen Taschen beladen. Erstaunt blickte sie auf ihre Tochter, die am Küchentisch saß und mit den Beinen baumelte.
»Na, du bist heute aber früh heimgekommen. Warte, ich trage erst mal die Sachen hinauf.«
Als man die schweren Schritte ihrer Mutter auf der Treppe hörte, rannte Benny zu Patsy.
»Meinst du, sie hat es?«
»Frag mich nicht, Benny, ich weiß es nicht.«
»Das sagst du nur, aber du weißt es doch!«
»Nein, wirklich nicht.«
»War sie in Dublin? Ist sie mit dem Bus hingefahren?«
»Nein, bestimmt nicht.«
»Das kann nicht sein.« Benny wirkte sehr enttäuscht.
»Sie war überhaupt nicht lange weg … nur schnell mal im Dorf.«
Nachdenklich leckte Benny den Löffel ab. »Er schmeckt besser, wenn er nicht gebacken ist.«
»Das hast du auch früher immer gesagt.« Patsy sah sie liebevoll an.
»Wenn ich achtzehn bin und tun und lassen kann, was ich will, esse ich meinen Kuchen immer ungebacken«, verkündete Benny.
»Nein, das glaube ich nicht, denn mit achtzehn wirst du vollauf damit beschäftigt sein, auf deine Figur zu achten, und überhaupt keinen Kuchen mehr essen.«
»Ich werde immer Kuchen essen.«
»Das sagst du jetzt. Aber warte mal ab, bis du einem Mann gefallen willst.«
»Willst du einem Mann gefallen?«
»Na klar, was denn sonst?«
»Welchem Mann? Jedenfalls möchte ich nicht, daß du fortgehst.«
»Ich bekomme keinen Mann. Ein anständiger Mann könnte anderen nichts über mich erzählen … wer ich bin und woher ich komme. Ich habe keine Vergangenheit, keine Vorgeschichte, verstehst du?«
»Aber du hast doch ein großartiges Leben geführt«, rief Benny. »Du könntest jeden dazu bringen, daß er sich für dich interessiert.«
Sie hatten keine Zeit, weiter darüber zu debattieren. Bennys Mutter war in die Küche zurückgekommen, hatte den Mantel abgelegt und nahm die Glasur in Angriff.
»Warst du heute eigentlich in Dublin, Mutter?«
»Nein, mein Kind, ich hatte genug damit zu tun, alles für die Geburtstagsfeier vorzubereiten.«
»Ich habe mich nur gefragt …«
»Feste organisieren sich nicht von selbst, das muß dir doch klar sein.« Die Worte klangen hart, doch der Ton war freundlich. Benny wußte, daß ihre Mutter sich ebenfalls auf die Feier freute. »Und wird Vater zu Hause sein, wenn es die Torte gibt?«
»Ja. Wir haben die Gäste für halb vier eingeladen, gegen vier werden alle dasein, also werden wir frühestens um halb sechs Tee trinken. Und wenn dein Vater das Geschäft geschlossen hat und nach Hause kommt, haben wir mit der Torte noch nicht mal angefangen.«
Bennys Vater führte Hogan’s Outfitters, das große Herrenbekleidungsgeschäft mitten in Knockglen. An Samstagen herrschte meist Hochbetrieb, denn dann kamen die Bauern in den Ort. Die Männer, die einen halben Tag frei hatten, ließen sich von ihren Frauen in den Laden schleppen, um sich von Mr. Hogan neu ausstaffieren zu lassen – oder von Mike, dem alten Verkäufer und Schneider, der seit undenklichen Zeiten dort arbeitete. Schon seit Mr. Hogan in jungen Jahren das Geschäft gekauft hatte.
Benny war froh, daß ihr Vater zurück sein würde, wenn die Torte angeschnitten wurde, denn dann würde sie ihr Geschenk bekommen. Vater hatte gesagt, es würde eine herrliche Überraschung sein. Benny wußte einfach, daß sie ihr das Samtkleid mit dem Spitzenkragen und den dazu passenden Pumps schenken würden. Das hatte sie sich seit Weihnachten gewünscht, als die Familie zum Krippenspiel nach Dublin gefahren war und sie die Mädchen auf der Bühne gesehen hatte, die in genau solchen rosafarbenen Samtkleidern getanzt hatten.
Wie sie erfahren hatte, konnte man diese Kleider bei Clery’s kaufen, und das war nur ein paar Minuten von der Haltestelle entfernt, wo der Bus nach Knockglen abfuhr.
Benny war groß und kräftig, aber in einem rosafarbenen Samtkleid würde man ihr das nicht ansehen. Sie würde genau wie die zauberhaften Tänzerinnen auf dieser Bühne aussehen, und ihre Füße würden nicht klobig und breit wirken, weil die Schuhe schön spitz zuliefen und kleine Pompons hatten.
Die Einladungen zur Feier waren zehn Tage zuvor verschickt worden. Es würden sieben Mädchen aus der Schule kommen, vor allem Bauerntöchter aus der Umgebung von Knockglen. Und Maire Carroll, deren Eltern das Lebensmittelgeschäft besaßen. Die Kennedys von der Apotheke waren allesamt Jungs, sie würden also nicht kommen, und die Kinder von Dr. Johnson waren noch zu klein und deshalb auch nicht eingeladen worden. Peggy Pine, die das schicke Modegeschäft führte, sagte, möglicherweise werde um diese Zeit ihre junge Nichte Clodagh zu Besuch dasein. Eigentlich wollte Benny niemanden dabeihaben, den sie nicht kannte, und mit Erleichterung hörte sie, daß auch die Nichte Clodagh nicht zu fremden Leuten wollte.
Schlimm genug, daß ihre Mutter darauf bestanden hatte, Eve Malone einzuladen. Eve war das Mädchen, das im Kloster lebte und alle Geheimnisse der Nonnen kannte. In der Schule sagten manche, schaut nur, an Eve hat Mutter Francis nie etwas auszusetzen, die ist ihr Liebling; andere meinten, die Nonnen müßten sie aus Nächstenliebe behalten und hätten sie nicht so gern wie die anderen Mädchen, deren Familien etwas zum Unterhalt des Klosters St. Mary beitrügen.
Eve war klein und dunkel. Manchmal sah sie aus wie ein Kobold, ihre wachen Augen waren stets in Bewegung. Benny brachte Eve weder Sympathie noch Abneigung entgegen. Sie beneidete sie, weil sie so flink und behende war und gut auf Mauern klettern konnte. Und sie wußte, daß Eve im Kloster ein eigenes Zimmer hatte, hinter dem Vorhang in jenem Bereich, den kein anderes Mädchen betreten durfte. Die Mädchen behaupteten, es sei das Zimmer mit dem runden Fenster und dem Blick über den Ort, und wenn Eve am Fenster sitze, könne sie jeden beobachten und sehen, wer mit wem wohin gehe. In den Ferien verreiste sie nie, sie blieb die ganze Zeit bei den Nonnen. Gelegentlich nahmen Mutter Francis und Miss Pine vom Bekleidungsgeschäft sie zu einem Ausflug nach Dublin mit, doch sie war nie über Nacht fortgeblieben.
Als sie einmal einen Naturkunde-Ausflug gemacht hatten, hatte Eve auf eine kleine Kate gedeutet und gesagt, das sei ihr Haus. Es stand zusammen mit einigen anderen Häuschen, die alle mit niedrigen Steinmauern voneinander abgetrennt waren, am Rande des großen, stillgelegten Steinbruchs. Wenn sie älter sei, hatte Eve verkündet, dann würde sie ganz allein darin wohnen, und Milchflaschen vor der Tür wären ebensowenig erlaubt wie Kleiderbügel. Sie würde all ihre Sachen auf dem Boden ausbreiten, denn das Haus gehöre ihr, und sie könne damit machen, was sie wolle.
Manche Kinder fürchteten sich ein wenig vor Eve, und so zweifelte niemand ihre Geschichte an, aber es glaubte ihr auch niemand richtig. Eve war so seltsam, sie konnte Geschichten einfach erfinden, und wenn sie alle neugierig gemacht hatte, sagte sie: »Reingefallen.«
Benny wollte eigentlich nicht, daß Eve zu ihrer Feier kam, aber in diesem Fall war ihre Mutter unnachgiebig gewesen.
»Das Kind hat kein Zuhause, also muß es zu uns kommen, wenn es etwas zu feiern gibt.«
»Aber sie hat doch ein Zuhause, Mutter, sie hat das ganze Kloster für sich.«
»Das kann man nicht vergleichen. Sie kommt zu uns, das ist mein letztes Wort.«
Eve hatte einen tadellosen, fehlerfreien Brief geschrieben, in dem sie die Einladung dankbar annahm.
»Sie haben ihr beigebracht, ordentlich zu schreiben«, hatte Bennys Vater anerkennend festgestellt.
»Sie wollen eben eine Dame aus ihr machen«, hatte Mutter gesagt. Aber niemand hatte Benny erklärt, warum das wichtig sein sollte.
»Wenn sie Geburtstag hat, bekommt sie nur Heiligenbildchen und Weihwasserbecken«, wußte Benny zu berichten. »Was anderes haben die Nonnen ja nicht.«
»Lieber Himmel, jetzt würden sich ein paar von denen drüben unter den Eiben im Grab umdrehen«, hatte Bennys Vater gesagt. Und das hatte ihr wieder niemand erklärt.
»Die arme Eve, sie hat’s nicht leicht«, seufzte Bennys Mutter.
»Sagt mal, ist sie etwa auch an einem Mittwoch geboren – so wie Patsy?« Benny war plötzlich etwas eingefallen.
»Was macht das für einen Unterschied?«
»Dann hat sie Pech. Mittwochskinder machen immer Kummer«, plapperte Benny nach.
»Unsinn«, erwiderte ihr Vater mit einer wegwerfenden Handbewegung.
»An welchem Tag bin ich geboren?«
»An einem Montag. Montag, den achtzehnten September neunzehnhundertneununddreißig«, sagte ihre Mutter. »Um sechs Uhr abends.«
Ihre Eltern wechselten einen Blick, in dem die Erinnerung an die lange Zeit des Wartens auf das erste und – wie sich herausstellte – einzige Kind lag.
»Montagskind, schön anzuschauen«, sagte Benny und schnitt eine Grimasse.
»Na, das stimmt doch!« meinte ihre Mutter.
»Wer könnte denn ein hübscheres Gesicht haben als die junge Mary Bernadette Hogan, die seit knapp zehn Jahren alle in dieser Gemeinde mit ihrem Anblick erfreut«, bestätigte ihr Vater.
»Aber ich bin nicht mal blond.«
»Du hast die schönsten Haare, die ich je gesehen habe.«
Bennys Mutter strich ihr über die langen, kastanienbraunen Locken.
»Bin ich wirklich hübsch?« fragte Benny.
Ihre Eltern versicherten ihr, sie sei wunderschön, und da wußte Benny, daß sie ihr das Kleid gekauft hatten. Einen Augenblick lang hatte sie daran gezweifelt, doch nun war sie sich sicher.
Am nächsten Tag in der Schule gratulierten ihr sogar die Mädchen, die nicht zur Feier eingeladen waren, zum Geburtstag.
»Was kriegst du denn?«
»Ich weiß nicht, es ist eine Überraschung.«
»Ein Kleid?«
»Ich glaube schon.«
»Nun komm schon.«
»Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich bekomme es erst bei der Feier.«
»Ist es aus Dublin?«
»Ja, ich glaube schon.«
Eve ergriff das Wort. »Vielleicht haben sie es auch hier gekauft. Bei Miss Pine gibt es eine Menge netter Sachen.«
»Nein, das glaube ich nicht.« Benny schüttelte den Kopf.
Eve zuckte mit den Achseln. »Na gut.«
Als die anderen weggegangen waren, wandte sich Benny an Eve. »Warum hast du gesagt, sie hätten es bei Miss Pine gekauft? Was weißt du denn schon? Du hast keine Ahnung.«
»Ich hab doch gesagt, es ist schon gut.«
»Hast du denn ein Kleid?«
»Ja, Mutter Francis hat mir eines bei Miss Pine besorgt. Ich glaube aber nicht, daß es neu ist. Wahrscheinlich hat es jemand zurückgegeben, weil irgendwas damit nicht gestimmt hat.«
Eve suchte nicht nach einer Rechtfertigung. Ihre Augen blitzten, und sie sprach die Wahrheit offen aus, ehe ihr jemand einen Strick daraus drehen konnte.
»Woher willst du das denn wissen?«
»Ich weiß es nicht, aber ich nehme es an. Mutter Francis hat nicht genug Geld, um mir ein neues Kleid zu kaufen.«
Benny sah sie bewundernd an. Ihre Feindseligkeit schwand.
»Na, ich weiß auch nicht. Ich glaube, daß sie mir das hübsche Samtkleid schenken. Vielleicht aber auch nicht.«
»Jedenfalls haben sie dir etwas Neues gekauft.«
»Ja, aber in dem Kleid würde ich wirklich großartig aussehen«, meinte Benny. »Darin sieht jeder hübsch aus.«
»Denk lieber nicht zu oft daran«, warnte Eve.
»Ja, vielleicht hast du recht.«
»Es ist nett, daß du mich eingeladen hast. Ich habe immer gedacht, du kannst mich nicht leiden«, sagte Eve.
»Oh, doch, doch.« Die arme Benny wurde nervös.
»Gut. Solange man es dir nicht befohlen hat oder so.«
»Nein! Um Himmels willen!« beteuerte Benny viel zu nachdrücklich.
Eve musterte sie mit einem kritischen Blick. »Na schön«, meinte sie dann, »bis heute nachmittag.«
Am Samstag vormittag war noch Unterricht, und als um zwölf Uhr dreißig die Glocke ertönte, strömten alle zu den Schultoren hinaus. Alle mit Ausnahme von Eve, die in die Klosterküche ging.
»Wir müssen dich ordentlich füttern, bevor du gehst«, meinte Schwester Margaret.
»Schließlich wollen wir nicht, daß jemand denkt, ein Mädchen aus St. Mary schlingt alles rein, was es bekommen kann, wenn es zum Tee eingeladen wird«, erklärte Schwester Jerome. Sie wollten Eve nicht allzu deutlich spüren lassen, daß es in der Tat ein großes Ereignis war – ein Mädchen, das sie großgezogen hatten, wurde zu einer Feier eingeladen. Die ganze Klostergemeinschaft freute sich für sie.
Auf dem Heimweg durch das Dorf wurde Benny von Mr. Kennedy in die Apotheke gerufen.
»Die Spatzen pfeifen’s von den Dächern, daß du heute Geburtstag hast«, sagte er.
»Ich bin jetzt zehn«, bestätigte Benny.
»Ich weiß. Ich erinnere mich noch an deine Geburt. Es war in der Notaufnahme. Deine Mam und dein Dad waren ja so froh. Es hat ihnen nicht mal was ausgemacht, daß du kein Junge warst.«
»Glauben Sie, daß meine Eltern lieber einen Jungen gehabt hätten?«
»Jeder, der ein Geschäft hat, wünscht sich einen Jungen. Andererseits, ich habe drei, und ich glaube nicht, daß einer den Laden übernehmen wird.« Er seufzte schwer.
»Tja, ich glaube, ich muß jetzt …«
»Nein, nein. Ich habe dich hereingerufen, um dir etwas zu schenken. Da hast du ein Päckchen Malzbonbons, ganz allein für dich.«
»Oh, Mr. Kennedy …« Benny war überwältigt.
»Nicht doch. Du bist ein prächtiges Mädchen. Wenn ich dich vorübergehen sehe, dann denke ich mir oft, schau, da kommt Benny Hogan, das kleine Pummelchen.«
Die Malzbonbons erschienen Benny mit einemmal nicht mehr ganz so verlockend. Ein wenig niedergeschlagen riß sie eine Ecke von der Packung ab und aß eines von den Bonbons.
Dessie Burns, dessen Haushaltswarengeschäft gleich neben Kennedys Apotheke lag, rief ihr freundlich zu.
»Ja, die gute Benny, genau wie ich, immer die Nase im Freßbeutel. Na, wie geht’s denn so?«
»Ich werde heute zehn, Mr. Burns.«
»Jessas, das ist ja wunderbar! Wenn du sechs Jahre älter wärst, würde ich dich zu Shea’s mitnehmen, dich auf meine Knie setzen und dir einen Gin ausgeben, das wär doch was.«
»Danke, Mr. Burns.« Ängstlich blickte sie ihn an.
»Was macht denn dein Vater da drüben? Sag bloß, der stellt noch jemanden ein. Das halbe Land drängt sich auf die Auswandererschiffe, und Eddie Hogan will sein Geschäft vergrößern.«
Dessie Burns’ kleine Schweinsäuglein starrten mit unverhohlener Neugier zu Hogan’s Gentleman’s Outfitters auf der anderen Straßenseite hinüber. Bennys Vater schüttelte einem Mann die Hand – oder einem Jungen, das war schwer zu sagen. Er mochte etwa siebzehn sein, schätzte Benny, und war dünn und blaß. Er hielt einen Koffer in der Hand und sah zu dem Schild über der Ladentür hinauf.
»Davon weiß ich nichts, Mr. Burns«, sagte sie.
»Kindchen, ich sage dir, halte dich lieber aus geschäftlichen Dingen heraus, die machen einem nur das Leben schwer. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich mich auch kein bißchen darum scheren. Ich würde mir einfach einen braven Trottel von einem Mann suchen, der mich den lieben langen Tag mit Malzbonbons füttert.«
Benny setzte ihren Weg fort, vorbei an dem leeren Laden, in dem angeblich bald ein echter Italiener aus Italien ein Geschäft eröffnen würde. Als sie am Schuhmachergeschäft vorüberkam, winkten ihr von drinnen Paccy Moore und seine Schwester Bee zu. Paccy hatte einen kranken Fuß. Er ging nicht zur Messe, aber es hieß, ein Priester besuche ihn einmal im Monat, um ihm die Beichte abzunehmen und ihn an der heiligen Kommunion teilhaben zu lassen. Benny hatte gehört, daß man in Dublin und womöglich sogar in Rom um einen Dispens ersucht hatte. Dabei war Paccy gar kein sündiger Mensch oder ein Abtrünniger der Kirche oder so etwas.
Schließlich war sie daheim angelangt, im Haus Lisbeg. Der neue Hund, halb Collie, halb Schäferhund, döste auf der Türschwelle und genoß die Septembersonne.
Durch das Fenster sah Benny den festlich gedeckten Tisch. Patsy hatte eigens das Messing geputzt, und Mutter hatte den Vorgarten in Ordnung gebracht. Benny schluckte das Malzbonbon hinunter, damit man ihr nicht vorwarf, sie würde in aller Öffentlichkeit Süßigkeiten essen, dann trat sie durch die Hintertür ein.
»Der Hund könnte wenigstens einen Ton von sich geben, damit ich weiß, wann du kommst«, brummelte ihre Mutter.
»Er darf mich nicht anbellen, ich gehöre doch zur Familie«, verteidigte Benny das Tier.
»Eher gibt es weiße Amseln, als daß Shep einmal bellt, außer weil es ihm gerade Spaß macht. Na, hattest du einen schönen Tag in der Schule, warst du die große Heldin des Tages?«
»Ja, Mutter.«
»Dann ist’s ja gut. Wenn sie dich heute nachmittag sehen, werden sie dich nicht wiedererkennen.«
Bennys Herz schlug höher. »Bekomme ich etwas Besonderes zum Anziehen für das Fest, vielleicht was Neues?«
»Ja, das kann man wohl sagen. Wir werden dich richtig fesch machen, bevor die Gäste kommen.«
»Darf ich es jetzt schon anziehen?«
»Warum nicht?« Bennys Mutter schien selbst gespannt zu sein, wie ihre Tochter in dem neuen Kleid aussah. »Ich lege es dir gleich oben zurecht. Komm rauf, wasch dich ein bißchen, dann ziehen wir dich an.«
Benny stand im Badezimmer und ließ sich geduldig den Nacken schrubben. Jetzt würde es nicht mehr lange dauern.
Danach wurde sie ins Schlafzimmer geführt.
»Mach die Augen zu«, sagte ihre Mutter.
Als Benny die Augen aufschlug, erblickte sie einen dicken dunkelblauen Rock und einen Fair-Isle-Pullover in Dunkelblau und Rot. Ein Paar großer, klobiger Halbschuhe lag in einer Schachtel, daneben ordentlich zusammengelegt dicke weiße Socken. Aus einer Seidenpapierverpackung lugte eine kleine rote Umhängetasche hervor.
»Eine komplette Kombination«, rief ihre Mutter. »Von Kopf bis Fuß eingekleidet von Peggy Pine …«
Sie trat einen Schritt zurück, um Bennys Reaktion zu beobachten.
Benny war sprachlos. Kein Samtkleid mit schönen Spitzen, kein hübscher, weicher, kuscheliger Samt, der sich so angenehm anfühlte. Nur schrecklich rauher, grober Stoff wie Pferdehaar. Kein zartes Rosa, sondern gewöhnliche, biedere Farben. Und die Schuhe! Wo waren die Pumps, die so schön spitz zuliefen?
Benny biß sich auf die Lippen und unterdrückte die Tränen.
»Na, was sagst du?« fragte ihre Mutter, strahlend vor Stolz. »Dein Vater hat gesagt, du sollst auch die Tasche und die Schuhe dazu bekommen, damit die Kombination komplett ist. Zum ersten runden Geburtstag, hat er gesagt, soll es schon etwas Besonderes sein.«
»Sehr hübsch«, murmelte Benny.
»Ist der Pullover nicht wundervoll? Eine halbe Ewigkeit habe ich auf Peggy eingeredet, sie soll etwas in dieser Art besorgen. Ich habe ihr gesagt, ich will nichts von diesem billigen Schund … etwas Robustes, das nicht gleich kaputtgeht, wenn du dich herumbalgst.«
»Es ist großartig«, sagte Benny.
»Fühl doch mal den Stoff«, drängte ihre Mutter.
Doch das wollte sie nicht – nicht, bis sie den Gedanken an Samt aus ihrem Kopf verbannt hatte.
»Ich ziehe mich selbst um, Mutter, dann komme ich runter und zeige es dir«, erklärte sie.
Ihre Selbstbeherrschung hing an einem seidenen Faden.
Zum Glück mußte Annabel Hogan gehen, um die Biskuitrolle mit Liebesperlen zu verzieren. Sie war gerade auf dem Weg nach unten, als das Telefon klingelte. »Das wird dein Vater sein«, meinte sie fröhlich und lief mit schnellen Schritten die Treppe hinunter.
Während Benny ins Kissen schluchzte, drangen Gesprächsfetzen an ihr Ohr.
»Sie war hingerissen, Eddy, weißt du, es war beinahe zuviel für sie, sie konnte es kaum fassen, so viele Sachen, die Tasche, die Schuhe, und die Strümpfe noch dazu. Ein Kind in ihrem Alter ist es einfach nicht gewöhnt, daß es soviel auf einmal bekommt … Nein, noch nicht, sie zieht es gerade an. Es wird ihr wunderbar stehen …«
Mühsam rappelte Benny sich vom Bett auf und trat vor den Spiegel am Kleiderschrank, um zu sehen, ob ihr Gesicht wirklich so rot und verheult aussah, wie sie befürchtete. Sie erblickte ein stämmiges Kind in Unterhemd und Schlüpfer, mit rotgeschrubbtem Hals und rotgeweinten Augen. Niemand würde je auf die Idee kommen, so ein Mädchen in ein rosafarbenes Kleid und hübsche spitze Pumps zu stecken. Da fiel ihr plötzlich Eve Malone ein. Sie erinnerte sich an das kleine, ernste Gesicht und wie sie sie gewarnt hatte, nicht zu viele Gedanken an das Kleid aus Dublin zu verschwenden.
Vielleicht hatte Eve es von Anfang an gewußt, vielleicht war sie im Geschäft gewesen, als ihre Mutter all diese … all diese scheußlichen Klamotten gekauft hatte. Eine entsetzliche Vorstellung, daß Eve es vor ihr gewußt hatte! Andererseits hatte Eve noch nie etwas Neues bekommen, sie wußte, daß das Kleid, das sie heute bekam, zweite Wahl war. Benny erinnerte sich, in welchem Ton Eve gesagt hatte: »Jedenfalls haben sie dir etwas Neues gekauft.« Sie würde sich nicht anmerken lassen, wie enttäuscht sie war. Niemals.
Der Rest des Tages verlief – zumindest in Bennys Augen – nicht besonders heiter, denn die Enttäuschung überschattete alle nachfolgenden Ereignisse. Als die Feier begann, besann sie sich darauf, die richtigen Worte zu sagen, und machte artige Bewegungen wie eine Marionette. Maire Carroll erschien in einem echten Ballkleid. Es hatte einen Unterrock, der raschelte, und war in einem Paket aus Amerika gekommen.
Es wurden Spiele gespielt, bei denen jeder einen Preis gewann. Bennys Mutter hatte in Birdie Macs Laden Tütchen mit Süßigkeiten gekauft, die alle in verschiedenfarbiges Papier eingewickelt waren. Die Kinder wurden zusehends aufgekratzter, doch mit der Torte mußte gewartet werden, bis Mr. Hogan aus dem Geschäft nach Hause kam.
Das Angelusläuten war zu hören, der dunkle Klang der Glocken, der jedem in Knockglen zweimal am Tag, nämlich um zwölf Uhr mittags und um sechs Uhr abends, die genaue Uhrzeit verkündete und zum Gebet rief. Doch Bennys Vater war weit und breit nicht zu sehen.
»Hoffentlich hat er sich nicht ausgerechnet heute mit irgendeinem Kunden verplaudert«, hörte Benny ihre Mutter zu Patsy sagen.
»Bestimmt nicht, Mam. Er muß schon unterwegs sein. Shep ist nämlich aufgestanden und hat sich ausgiebig gestreckt. Das ist immer ein Zeichen dafür, daß sein Herrchen nach Hause kommt.«
Und sie hatte recht. Eine halbe Minute später kam Bennys Vater mit banger Miene herein.
»Ich hab’s doch nicht verpaßt, oder bin ich zu spät?«
Man setzte ihn mit beruhigenden Worten auf einen Stuhl und stellte zur Stärkung eine Tasse Tee und ein Wurstbrötchen vor ihn hin, während sich die Kinder versammelten und der Raum in verheißungsvolles Dunkel getaucht wurde.
Benny gab sich Mühe, das Kratzen des Wollpullovers in ihrem Nacken zu ignorieren, und mühte sich, ihrem Vater, der für den großen Augenblick aus dem Dorf herbeigeeilt war, ein aufrichtiges Lächeln zu schenken.
»Gefällt dir deine Kombination … deine erste richtige Kombination?« rief er ihr zu.
»Sie ist entzückend, Vater, ganz entzückend. Du siehst ja, ich habe schon alles an.«
Die anderen Kinder in Knockglen hatten sich immer darüber lustig gemacht, daß Benny »Vater« sagte. Sie nannten ihre Väter Daddy oder Da. Mittlerweile hatten sie sich aber daran gewöhnt. So war es nun einmal. Benny war das einzige Kind, das keine Geschwister hatte; die meisten von ihnen mußten sich Mutter und Vater mit fünf oder sechs anderen teilen. Ein Einzelkind war eine Seltenheit. Eigentlich kannten sie überhaupt keines außer Benny. Und natürlich Eve Malone, aber das war etwas anderes, denn sie hatte überhaupt keine Familie.
Eve stand neben Benny, als die Torte hereingebracht wurde.
»Oh, und alles für dich«, flüsterte sie ehrfürchtig.
Sie trug ein Kleid, das ihr einige Nummern zu groß war. Schwester Imelda, die einzige Nonne im Kloster, die mit Nadel und Faden umzugehen verstand, mußte das Krankenbett hüten, und so war das Kleid nur ziemlich dürftig umgesäumt worden. Es hing wie ein Vorhang an Eve herunter.
Aber immerhin war es rot und offensichtlich neu. Daß es nicht gelobt oder bewundert werden würde, lag auf der Hand, doch Eve Malone schien über diese Dinge erhaben zu sein. Der Anblick von Eve in dem weiten, plumpen Gewand wirkte auf Benny irgendwie ermutigend. Ihr eigenes schreckliches Kostüm hatte zumindest die passende Größe, und obwohl es meilenweit von einem Ballkleid entfernt war, war es doch keine Zumutung wie das Kleid von Eve. Sie straffte die Schultern und lächelte das kleinere Mädchen plötzlich an.
»Ich gebe dir was von der Torte mit, wenn was übrigbleibt«, sagte sie.
»Danke. Mutter Francis ißt gern mal ein Stück Torte«, erwiderte Eve.
Und dann war es soweit: schummeriges Kerzenlicht, Happy-Birthday-Singen und das große Kerzenausblasen. Danach klatschten alle, und als die Vorhänge wieder aufgezogen wurden, sah Benny den dünnen jungen Mann, dem ihr Vater die Hand geschüttelt hatte. Er war viel zu alt für die Feier. Offenbar hatten sie ihn hergebracht, um mit den Erwachsenen, die später kommen würden, Tee zu trinken. Er war tatsächlich sehr dünn und blaß, und seine Augen blickten starr und kalt.
»Wer war das?« fragte Eve Benny am Montag.
»Das ist der neue Verkäufer. Er ist gekommen, um meinem Vater im Geschäft zu helfen.«
»Er ist schrecklich, findest du nicht?«
Sie waren jetzt Freundinnen und saßen in der Pause zusammen auf der Schulhofmauer.
»Ja. Irgendwas stimmt nicht mit seinen Augen, glaube ich.«
»Wie heißt er denn?« fragte Eve.
»Sean. Sean Walsh. Er wird im Laden wohnen.«
Eve zog die Nase kraus. »Ißt er etwa auch mit euch?«
»Nein, das ist das einzig Gute. Er will nicht. Mutter hat ihn eingeladen, Sonntag mittag mit uns zu essen, aber er hat irgendwas dahergebrabbelt, daß er betrauert und so.«
»Er bedauert.«
»Na ja, ist ja egal, jedenfalls will er nicht, und das heißt wohl, daß er nicht zum Essen kommt. Er sagt, er will für sich selbst sorgen.«
»Gut.« So etwas gefiel Eve.
»Mutter hat gesagt …«, brachte Benny zögernd hervor.
»Ja?«
»Wenn du irgendwann mal zu uns kommen willst … das wäre … das wäre in Ordnung.«
Benny sprach die Worte in einem schroffen Tonfall, als fürchtete sie, Eve würde die Einladung ablehnen.
»Oh, ich würde gern kommen«, erwiderte Eve.
»Zum Beispiel wochentags zum Tee oder vielleicht auch mal zum Mittagessen an einem Samstag oder Sonntag.«
»Sonntag wäre mir sehr recht. Sonntags ist es immer ziemlich langweilig bei uns. Da wird viel gebetet, weißt du.«
»Gut, ich sag es ihr.« Bennys Miene hatte sich aufgehellt.
»Ach, eines muß ich dir aber noch sagen …«
»Was denn?« Benny gefiel Eves angespannter Gesichtsausdruck nicht.
»Ich kann die Einladung nicht erwidern. Die Nonnen und ich, wir essen hinter dem Vorhang, weißt du.«
»Das macht gar nichts.« Benny war erleichtert, daß dies das einzige Hindernis war.
»Aber wenn ich erwachsen bin und mein eigenes Haus habe, du weißt schon, die Kate, dann kann ich dich dort einladen«, sagte Eve in ernstem Ton.
»Ist es wirklich dein Haus?«
»Das habe ich doch allen erzählt«, entgegnete sie streitlustig.
»Ich dachte, das hättest du nur so gesagt«, meinte Benny entschuldigend.
»Warum sollte ich das? Das Haus gehört mir. Ich bin darin geboren, es hat meiner Mutter und meinem Vater gehört. Sie sind beide tot, nun ist es mein Haus.«
»Warum kannst du jetzt nicht dort wohnen?«
»Ich weiß nicht. Sie sagen, ich bin zu jung, um ein selbständiges Leben zu führen.«
»Na, sicher bist du dazu zu jung«, meinte Benny. »Aber doch nicht zum Anschauen, oder?«
»Mutter Francis hat gesagt, das ist eine sehr ernste Angelegenheit, mein eigenes Zuhause, mein Erbe, wie sie es nennt. Sie sagt, ich soll es nicht zu einem Puppenhaus, zu einem Spielplatz machen, solange ich nicht erwachsen bin.«
Die beiden dachten eine Weile darüber nach.
»Vielleicht hat sie recht«, sagte Benny mürrisch.
»Vielleicht.«
»Hast du mal durchs Fenster geschaut?«
»Ja.«
»Und war keiner dort und hat dir einen Schweinestall hinterlassen?«
»Nein, dort kommt nie jemand hin.«
»Warum denn nicht? Man hat doch eine hübsche Aussicht über den Steinbruch.«
»Sie fürchten sich vor dem Haus. Es sind dort Menschen gestorben.«
»Menschen sterben überall.« Benny zuckte die Achseln.
Das gefiel Eve. »Du hast recht. Daran habe ich noch gar nicht gedacht.«
»Wer ist denn in dem Haus gestorben?«
»Meine Mutter. Und kurz darauf mein Vater.«
»Oh.«
Darauf wußte Benny nichts zu sagen. Es war das erstemal, daß Eve über ihre Vergangenheit gesprochen hatte. Für gewöhnlich schleuderte sie jedem, der sie darauf ansprach, ein bissiges »Das geht dich nichts an!« entgegen.
»Aber sie sind nicht mehr in dem Haus. Sie sind jetzt im Himmel«, sagte Benny schließlich.
»Ja, natürlich.«
Das Gespräch schien wieder an einem toten Punkt angelangt.
»Ich würde gern mal mit dir hingehen und durchs Fenster gucken«, erbot sich Benny.
Eve wollte gerade etwas darauf erwidern, als Maire Carroll vorbeikam.
»Es war ein netter Geburtstag, Benny«, sagte sie.
»Danke.«
»Ich hab aber gar nicht gewußt, daß man sich verkleiden sollte.«
»Was meinst du damit?« fragte Benny.
»Na ja, Eve war doch verkleidet, oder, Eve? Ich meine dieses weite rote Ding. Das sollte doch kein normales Kleid sein, oder?«
Eves Gesicht nahm wieder den wohlbekannten harten Ausdruck an. Benny haßte es, sie so zu sehen.
»Ich fand es ganz lustig«, fuhr Maire fort und kicherte. »Das fanden wir alle, als wir nach Hause gingen.«
Benny blickte über den Schulhof. Mutter Francis sah gerade in die andere Richtung.
Mit ganzer Kraft stürzte Benny Hogan sich von der Mauer herab auf Maire Carroll, der es den Atem verschlug, als sie zu Boden stürzte.
»Ist dir was passiert, Maire?« erkundigte sich Benny scheinheilig.
Mit wehendem Habit eilte Mutter Francis herbei.
»Kind, was ist geschehen?« Sie versuchte, Maire zu beruhigen und sie auf die Beine zu stellen.
»Benny hat mich geschubst …«, keuchte Maire.
»Mutter, es tut mir leid, ich bin so ungeschickt. Ich wollte nur von der Mauer runter.«
»Ist schon gut, sie hat sich ja weiter nichts getan. Bringt ihr einen Stuhl.« Mutter Francis kümmerte sich um die schwer atmende Maire.
»Sie hat’s mit Absicht getan.«
»Still, Maire. Hier ist ein Stuhl, setz dich.«
Maire weinte. »Mutter, sie hat sich von der Mauer auf mich drauffallen lassen wie ein Sack Steine … Dabei hab ich nur gesagt …«
»Maire hat mir erzählt, wie gut es ihr auf meinem Geburtstag gefallen hat. Es tut mir ja so leid«, fiel Benny ihr ins Wort.
»Na gut, Benny, aber paß in Zukunft besser auf. Sei nicht immer so wild. Komm, Maire, hör auf zu jammern. Das ist gar nicht nett. Benny hat sich doch entschuldigt. Du weißt selbst, daß es ein Versehen war. Du bist doch ein großes Mädchen.«
»So groß wie Benny Hogan möchte ich nie sein. Das will keine.«
Nun wurde Mutter Francis ärgerlich. »Jetzt reicht’s aber, Maire Carroll. Schluß damit, hörst du? Nimm den Stuhl und setz dich in die Garderobe, und da bleibst du, bis ich dich rufe.«
Damit rauschte Mutter Francis davon. Und wie alle schon erwartet hatten, läutete sie die Glocke zum Zeichen, daß die Pause beendet war.
Eve sah Benny an. Einen Augenblick lang sagte sie gar nichts, sondern schluckte nur, als hätte sie einen Kloß im Hals.
Benny war ebenfalls um Worte verlegen, sie zuckte nur mit den Schultern und streckte in einer ratlosen Geste die Handflächen nach oben.
Plötzlich ergriff Eve ihre Hand. »Eines Tages, wenn ich groß und stark bin, dann schlage ich auch jemanden für dich zu Boden«, sagte sie. »Ganz im Ernst, das tu ich.«
»Erzählt mir von Eves Eltern«, bat Benny am Abend desselben Tages.
»Ach, das ist alles schon lange her«, meinte ihr Vater.
»Aber ich weiß nichts darüber. Ich war ja noch nicht auf der Welt.«
»Hat doch keinen Sinn, alte Geschichten wieder aufzuwärmen.«
»Sie ist meine Freundin. Ich möchte etwas über sie erfahren.«
»Früher war sie aber nicht deine Freundin. Ich mußte dich geradezu anflehen, damit du sie zu deiner Geburtstagsfeier einlädst«, erwiderte ihre Mutter.
»Das ist doch nicht wahr.« Benny konnte es schon gar nicht mehr glauben.
»Ich freue mich, daß das Kind am Sonntag zum Essen kommt«, sagte Eddie Hogan. »Ich wünschte, ich könnte den langen Lulatsch aus meinem Laden auch dazu überreden, aber er möchte uns ja um keinen Preis über Gebühr beanspruchen, wie er es nennt.«
Benny war froh, das zu hören.
»Macht er sich gut, Eddie?«
»Könnte nicht besser sein, meine Liebe. Wir können uns glücklich schätzen mit ihm, das sag ich dir. Er ist so erpicht darauf, was zu lernen, daß er beinahe zu hecheln anfängt wie unser guter Shep hier. Er wiederholt alles immer und immer wieder, als wollte er es auswendig lernen.«
»Mag Mike ihn?« erkundigte sich Bennys Mutter.
»Ach, du kennst ja Mike, der mag niemanden.«
»Was paßt ihm denn nicht?«
»Die Art und Weise, wie Sean die Bücher führt. Meine Güte, das kann jeder lernen, das könnte sogar ein Kind, aber der alte Mike muß sich erst mal quer stellen. Er sagt, er kennt die Maße von jedem Kunden und weiß, wer was bezahlt hat und was noch aussteht. Er hält es für unter seiner Würde, alles aufzuschreiben.«
»Könntest du nicht die Bücher führen, Mutter?« schlug Benny unvermittelt vor.
»Nein, nein, das könnte ich nicht.«
»Aber wenn es so einfach ist, wie Vater sagt …«
»Sie könnte es schon, aber deine Mutter muß hier sein. Das ist unser Heim, und sie führt den Haushalt für dich und mich, Benny.«
»Das könnte doch auch Patsy. Dann müßtest du Sean nichts bezahlen.«
»Unsinn, Benny«, beharrte ihr Vater.
Doch Benny blieb hartnäckig. »Warum denn nicht? Mike wäre es bestimmt recht, wenn Mutter da wäre. Er mag sie, und dann hätte sie auch den ganzen Tag was zu tun.«
Ihre Eltern lachten.
»Ist es nicht herrlich, ein Kind zu sein?« meinte ihr Vater.
»Die Vorstellung, ich hätte nicht genug zu tun …«, pflichtete ihre Mutter ihm bei.
Benny wußte sehr wohl, daß der Tag ihrer Mutter alles andere als ausgefüllt war. Sie dachte, es würde ihrer Mutter vielleicht Spaß machen, im Geschäft mitzuarbeiten. Aber offensichtlich stieß ihr Vorschlag auf taube Ohren.
»Wie sind Eves Eltern ums Leben gekommen?« fragte sie.
»Darüber redet man nicht.«
»Warum nicht? Sind sie ermordet worden?«
»Nein, natürlich nicht«, entgegnete ihre Mutter ungeduldig.
»Aber warum …?«
»Herr im Himmel, du kannst einem aber auf die Nerven gehen«, stöhnte ihr Vater.
»In der Schule heißt es immer, man soll Fragen stellen. Mutter Francis hat gesagt, wenn man wißbegierig ist, lernt man auch viel.« Benny wiegte sich im Gefühl des Triumphs.
»Eves Mutter ist bei ihrer Geburt gestorben. Und kurze Zeit später stürzte ihr armer Vater, Gott hab ihn selig, in geistiger Umnachtung den Abhang in den Steinbruch hinunter, als er das Haus verließ.«
»Das ist ja schrecklich!« Entsetzt riß Benny die Augen auf.
»Du siehst, es ist eine ziemlich traurige Geschichte, die lange zurückliegt, fast zehn Jahre. Und wir möchten nicht immer wieder damit anfangen.«
»Aber das ist noch nicht alles, oder? Es gibt irgendein Geheimnis.«
»Eigentlich nicht.« Der Blick ihres Vaters wirkte aufrichtig. »Ihre Mutter war eine sehr wohlhabende Frau und ihr Vater eine Art Hilfsarbeiter. Er machte sich im Kloster nützlich und arbeitete gelegentlich oben in Westlands. Es gab damals ein bißchen Gerede deswegen.«
»Aber es gibt kein Geheimnis und keinen Skandal oder so etwas.« Annabel Hogans Stirn hatte sich in bedrohliche Falten gelegt. »Sie haben katholisch geheiratet.«
Benny erkannte, daß aus ihren Eltern nicht mehr herauszubekommen war. Sie wußte, wann sie aufhören mußte.
Später fragte sie Patsy.
»Frag mich nicht irgendwelche Sachen hinter dem Rücken deiner Eltern.«
»Tu ich doch gar nicht. Ich hab sie gefragt, und da haben sie mir das erzählt. Ich wollte nur wissen, ob du mehr darüber weißt, sonst nichts.«
»Das war, bevor ich hierhergekommen bin, aber ich habe ein bißchen was von Bee Moore gehört … das ist Paccys Schwester, weißt du, sie arbeitet oben in Westlands.«
»Was hast du erfahren?«
»Daß Eves Vater sich bei der Beerdigung schrecklich danebenbenommen hat, er hat geflucht und geschrien …«
»Geflucht und geschrien, in der Kirche …!«
»Nicht in unserer Kirche, nicht in der richtigen Kirche, sondern in der protestantischen, aber das war schlimm genug. Weißt du, Eves Mutter war aus Westlands – von dem Gutshaus da drüben. Sie stammte aus dieser Familie, und der arme Jack, das war der Vater, der meinte, sie würden sie schlecht behandeln …«
»Und weiter?«
»Mehr weiß ich auch nicht«, sagte Patsy. »Und bring das arme Kind nicht mit deinen Fragen in Verlegenheit. Wer keine Eltern hat, mag’s nicht, wenn man ihm dauernd Fragen stellt.«
Benny nahm sich diesen guten Rat zu Herzen, und zwar nicht nur im Hinblick auf Eve, sondern auch auf Patsy.
Mutter Francis beobachtete mit Genugtuung, wie sich die neue Freundschaft entwickelte, doch sie war im Umgang mit Kindern viel zu erfahren, um darüber zu sprechen.
»Du gehst wieder zu den Hogans, stimmt’s?« sagte sie mit einem leicht verdrießlichen Unterton.
»Macht es dir etwas aus?« fragte Eve.
»Nein, nein, macht mir nichts aus.« Die Nonne gab sich große Mühe, ihre Freude zu verbergen.
»Ich gehe nicht dorthin, weil ich von hier fort möchte«, erklärte Eve ernst.
Mutter Francis unterdrückte das Bedürfnis, das Kind in die Arme zu nehmen. So wie sie es früher getan hatte, als Eve noch ein Baby war, das durch die Umstände seiner Geburt in ihre Obhut gegeben worden war.
»Nein, natürlich nicht, mein Kind. So fremd dir hier auch alles sein mag, es ist dein Heim.«
»Es war immer ein schönes Heim.«
Der Nonne traten Tränen in die Augen. »Jedes Kloster sollte ein Kind haben. Ich weiß nur nicht, wie wir das machen sollen«, sagte sie leichthin.
»Bin ich euch nicht zur Last gefallen, als ich zu euch kam?«
»Wir hatten unsere helle Freude an dir, weißt du. Es waren die besten zehn Jahre, die St. Mary je erlebt hat … deinetwegen.«
Mutter Francis stand am Fenster und beobachtete die kleine Eve, die, an diesem Sonntag ganz auf sich gestellt, die Straße vom Kloster hinunterschritt, um mit den Hogans zu Mittag zu essen. Sie betete, die Leute möchten nett zu ihr sein, und Benny möge es sich nicht anders überlegen und eine neue Freundin suchen.
Sie erinnerte sich an die Kämpfe, die sie durchfechten mußte, um Eve überhaupt behalten zu können. Schließlich hatten sich so viele andere Möglichkeiten angeboten. Zum einen gab es einen Cousin der Westwards in England, der sich bereit erklärte, das Kind zu sich zu nehmen und sie einmal wöchentlich in römisch-katholischer Religionslehre unterrichten zu lassen. Von den Healys, die das Hotel eröffnen wollten, hieß es, sie hätten Schwierigkeiten bei der Familiengründung. Sie würden Eve gerne bei sich aufnehmen, sagten sie, selbst wenn sich doch noch eigener Nachwuchs einstellen sollte. Doch Mutter Francis hatte wie eine Löwin um das kleine Bündel gekämpft, das sie am Tag seiner Geburt aus der Kate gerettet hatte. Das Kind sollte im Kloster aufwachsen, bis sich eine Lösung fand. Niemand hatte damit gerechnet, daß Jack Malones Lösung darin bestand, sich in einer finsteren Nacht den Steinbruch hinunterzustürzen. Danach konnte keiner einen berechtigteren Anspruch auf Eve geltend machen als die Nonnen, die sie in Pflege genommen hatten.
Für Eve war es das erste von vielen sonntäglichen Mittagessen im Haus Lisbeg. Sie kam gern dorthin. Jede Woche brachte sie Blumen mit, die sie in einer Vase arrangierte. Mutter Francis hatte ihr gezeigt, wo es an dem langen, windigen Weg hinter dem Konvent wildwachsende Blumen und Blätter zu pflücken gab. Anfangs übte Eve mit den Nonnen das Arrangieren der Blumen, damit sie es konnte, wenn sie zu den Hogans kam, doch im Lauf der Wochen wurde sie zusehends geschickter. Sie brachte ganze Arme voller bunter Herbstblumen und ordnete sie auf der Flurkommode zu bezaubernden Sträußen. Es wurde ein richtiges Ritual. Patsy hielt immer schon die Vasen bereit, um zu sehen, was Eve diesmal mitbrachte.
»Sie haben aber ein hübsches Haus!« sagte sie wehmütig, und Annabel Hogan lächelte zufrieden und beglückwünschte sich dazu, daß sie die beiden Mädchen zusammengebracht hatte.
»Wie haben Sie Mrs. Hogan kennengelernt?« fragte sie Bennys Vater. Und: »Wollten Sie immer schon ein Geschäft führen?«
Benny wäre nie darauf gekommen, Fragen dieser Art zu stellen, aber die Antworten interessierten sie immer.
So hatte sie nicht gewußt, daß ihre Eltern sich zum erstenmal bei einem Tennisspiel in einer weit entfernten Grafschaft begegnet waren. Es war ihr auch neu, daß ihr Vater in einem Geschäft in der Stadt Ballylee eine Lehre gemacht hatte. Oder daß ihre Mutter nach ihrem Schulabgang ein Jahr in Belgien gewesen war, um in einem Kloster Englisch zu unterrichten.
»Du bringst meine Eltern dazu, hochinteressante Sachen zu erzählen«, sagte sie eines Nachmittags zu Eve, als sie in Bennys Zimmer saßen und Eve darüber staunte, daß man den beiden erlaubte, das elektrische Heizgerät anzustellen – ganz für sie allein.
»Ja, sie können herrliche Geschichten von früher erzählen.«
»Na ja …«, meinte Benny zweifelnd.
»Weißt du, bei den Nonnen ist das nicht so.«
»Unmöglich. Sie können nicht alles vergessen haben«, erwiderte Benny.
»Aber sie sollen nicht an Vergangenes denken und an ihr Leben vor dem Eintritt ins Kloster. Für sie hat ein neues Leben begonnen, als sie Bräute Christi wurden. Sie erzählen keine Geschichten aus den alten Zeiten wie deine Eltern.«
»Möchten sie, daß du auch Nonne wirst?« fragte Benny.
»Nein, Mutter Francis sagt, sie würden mich nicht nehmen, solange ich nicht einundzwanzig bin. Nicht einmal, wenn ich es wollte.«
»Warum denn das?«
»Sie sagt, es ist das einzige Leben, das ich kenne, und ich würde vielleicht nur deshalb eintreten wollen. Also soll ich nach der Schule weggehen und mindestens drei Jahre lang arbeiten. Vorher kann ich es mir aus dem Kopf schlagen, Nonne zu werden.«
»Es war ein großes Glück, daß du an sie geraten bist, nicht?«
»Ja, schon.«
»Ich meine, natürlich war es kein Glück, daß deine Eltern gestorben sind, aber da es nun mal so gekommen ist, war es doch gut, daß du zu ihnen und nicht zu irgendwelchen schrecklichen Leuten gekommen bist?«
»Wie im Märchen von der bösen Stiefmutter«, stimmte Eve zu.
»Ich frage mich, warum sie dich eigentlich bekommen haben. Nonnen haben doch sonst nichts mit Kindern zu tun, außer in Waisenhäusern.«
»Mein Vater hat für sie gearbeitet. Später haben sie ihn dann nach Westlands geschickt, damit er mehr Geld verdient, weil ihm das Kloster nicht viel zahlen konnte. Und da hat er meine Mutter kennengelernt. Ich glaube, sie fühlen sich irgendwie verantwortlich.«
Benny hätte schrecklich gern mehr erfahren. Doch sie erinnerte sich an Patsys Rat.
»Na ja, immerhin hat es ein gutes Ende genommen. Sie haben dich alle furchtbar lieb da oben.«
»Deine Eltern haben dich auch furchtbar lieb.«
»Ja, manchmal ist es aber ein bißchen schwierig. Zum Beispiel, wenn man mal raus möchte.«
»Das ist es für mich auch«, meinte Eve. »Oben im Kloster kann man schlecht raus.«
»Das ändert sich erst, wenn wir älter sind.«
»Nicht unbedingt«, sagte Eve weise.
»Wie meinst du das?«
»Ich meine, wir müssen ihnen beweisen, daß wir wirklich zuverlässig sind und so. Wir müssen ihnen zeigen, daß wir rechtzeitig zurückkommen, wenn sie uns mal raus lassen.«
»Wie könnten wir ihnen das zeigen?« Benny war ganz aufgeregt.
»Ich weiß nicht. Wir müßten mit etwas Einfachem anfangen. Könntest du mich zum Beispiel einladen, mal bei euch zu übernachten?«
»Natürlich.«
»Dann könnte ich Mutter Francis beweisen, daß ich rechtzeitig zur Messe in der Kapelle wieder da bin, und sie wüßte dann, daß sie sich auf mich verlassen kann.«
»Messe an einem Werktag?«
»Jeden Tag um sieben.«
»Nein!«
»Es ist ganz nett. Und so friedlich. Die Nonnen singen wunderschön. Es macht mir wirklich nichts aus. Pater Ross kommt eigens her und kriegt ein prächtiges Frühstück im Besuchszimmer. Er sagt, die anderen Priester beneiden ihn.«
»Ich wußte das gar nicht … jeden Tag …«
»Du sagst es aber niemandem weiter, versprochen?«
»Versprochen. Ist es ein Geheimnis?«
»Nein, überhaupt nicht. Es ist nur so, daß ich nicht alles weitererzähle, verstehst du? Das gefällt der Ordensgemeinschaft, sie haben das Gefühl, daß ich zu ihnen gehöre. Früher habe ich auch keine Freundin gehabt und niemanden, dem ich’s hätte erzählen können.«
Benny strahlte übers ganze Gesicht. »An welchem Abend willst du kommen? Am Mittwoch?«
»Ich weiß nicht, Eve. Du hast doch keinen hübschen Schlafanzug und was man sonst so mitnimmt, wenn man woanders übernachtet. Einen richtigen Toilettenbeutel hast du auch nicht. Das sind alles Sachen, die man bei so einem Besuch braucht.«
»Mein Schlafanzug ist doch schön, Mutter.«
»Na ja, du könntest ihn natürlich bügeln. Und einen Morgenrock hast du ja.« Mutter Francis wirkte unentschlossen. »Aber einen Toilettenbeutel?«
»Könnte mir nicht Schwester Imelda einen machen? Dafür übernehme ich dann ihren Aufräumdienst.«
»Und wann wirst du zurück sein?«
»Ich werde rechtzeitig zur Messe am Betpult sein, Mutter.«
»Du wirst aber nicht so früh aufstehen wollen, wenn du dort zu Gast bist.« Mutter Francis sah sie gütig an.
»Doch, das will ich, Mutter.«
Es wurde ein herrlicher Abend. Sie saßen lange in der Küche und spielten mit Patsy Rommé, denn Mutter und Vater waren bei Dr. und Mrs. Johnson von gegenüber, die anläßlich der Taufe ihres jüngsten Kindes ein Essen gaben.
Eve fragte Patsy über das Waisenhaus aus, und Patsy berichtete ihr Dinge, die Benny nie von ihr erfahren hatte. Sie erzählte, wie sie immer Lebensmittel gestohlen hatte und wie schwer es für sie gewesen war, als sie bei den Hogans zu arbeiten anfing und begriff, daß es nun nicht mehr nötig war, heimlich ein Keks oder eine Handvoll Zucker in der Schürze verschwinden zu lassen.
Als die Mädchen später im Bett lagen, meinte Benny verwundert: »Ich weiß nicht, warum Patsy uns das alles erzählt hat. Erst neulich hat sie zu mir gesagt, Leute, die keine Eltern haben, mögen es nicht, wenn man sie ausfragt.«
»Ach, bei mir ist das was anderes«, entgegnete Eve. »Ich bin eine wie sie.«
»Nein, bist du nicht!« entrüstete sich Benny. »Patsy hatte gar niemanden. Sie mußte in diesem garstigen Haus arbeiten, hat Läuse bekommen, mußte stehlen und ist geschlagen worden, weil sie ins Bett gemacht hat. Mit fünfzehn mußte sie fortgehen und ist hierhergekommen. Das ist was ganz anderes als bei dir.«
»Trotzdem, wir sind uns sehr ähnlich. Sie hat keine Familie, ich habe keine. Ein Heim, wie du es hast, gab es nicht für sie.«
»Hast du ihr deshalb mehr erzählt als mir?« Was Benny nämlich noch mehr verblüfft hatte, waren die Fragen, die Patsy Eve ganz unverblümt gestellt hatte. Etwa, ob Eve die Westwards haßte, die so reich waren, aber sie nicht in ihrem großen Haus aufnahmen. Nein, hatte Eve erklärt, sie könnten sie nicht zu sich nehmen, weil sie Protestanten waren. Und vieles mehr, was Benny nie zu fragen gewagt hätte.
»Du hast mich eben nie so etwas gefragt«, meinte Eve schlicht.
»Ich hatte Angst, dich vor den Kopf zu stoßen.«
»Einen Freund kann man gar nicht vor den Kopf stoßen«, erwiderte Eve.
Beide waren erstaunt, was die andere nicht über Knockglen wußte. Obwohl sie beide doch immer hier gelebt hatten!
Benny wußte nicht, daß die drei Priester, die im Pfarrhaus wohnten, ein Scrabble besaßen und jeden Abend ein Spielchen machten. Manchmal riefen sie im Kloster an, um Mutter Francis zu fragen, ob es beispielsweise ein Wort wie »quichottisch« gebe, weil Vater O’Brian dann den dreifachen Wortwert bekommen würde. Eve wiederum hatte nicht gewußt, daß Mr. Burns vom Haushaltswarenladen gern ein Glas über den Durst trank. Oder daß Dr. Johnson zu Wutausbrüchen neigte und sich angeblich lautstark über die Behauptung ausließ, Gott würde keine Kinder auf die Welt kommen lassen, ohne dafür zu sorgen, daß sie zu essen hatten. Dr. Johnsons Ansicht nach gab es eine Menge hungriger Mäuler, die Gott zu stopfen vergessen hatte – besonders in den Familien mit bis zu dreizehn Kindern.
Benny hörte zum erstenmal, daß Peggy Pine eine alte Freundin von Mutter Francis war, und zwar seit ihren Mädchenjahren. Wenn Peggy Mutter Francis im Kloster besuchte, redete sie diese mit Bunty an.
Dafür hatte Eve nicht gewußt, daß Birdie Mac, die den Süßwarenladen betrieb, einen Verehrer aus Ballylee hatte, der sie seit fünfzehn Jahren immer wieder besuchte. Doch sie wollte ihre alte, gebrechliche Mutter nicht verlassen, und er wollte nicht nach Knockglen ziehen.
Dank solcher Einblicke fanden die beiden Mädchen das Dorf viel interessanter. Vor allem, weil sie wußten, daß dies alles dunkle Geheimnisse waren, die sie niemandem anvertrauen durften. Sie tauschten ihr Wissen darüber aus, wie Kinder geboren werden, gelangten jedoch zu keinen neuen Erkenntnissen. Beide wußten sie, daß die Babys wie Kätzchen herauskamen, aber wie sie hineingekommen waren, konnten sie sich nicht erklären.
»Es hat wohl was damit zu tun, daß man sich nebeneinander legt, wenn man verheiratet ist«, meinte Eve.
»Ja, es geht nicht, wenn man nicht verheiratet ist. Stell dir vor, du würdest neben jemandem wie Dessie Burns hinfallen.« Der Gedanke beunruhigte Benny.
»Nein, man muß schon verheiratet sein.« Eve war sich da ganz sicher.
»Aber wie kommt es rein?« Das blieb das große Rätsel.
»Vielleicht mit dem Bauchknopf …«, meinte Benny nachdenklich.
»Bauchknopf?«
»Na, das da auf dem Bauch.«
»Ach so, der Nabel, wie Mutter Francis es nennt.«
»Das muß es sein«, rief Benny triumphierend aus. »Wenn sie verschiedene Namen dafür haben, dann ist es immer ein Geheimnis.«
Sie gaben sich große Mühe, zuverlässig zu sein. Wenn sie sagten, sie würden um sechs Uhr zu Hause sein, dann waren sie fünf Minuten vor dem Stundenschlag und dem Angelusläuten da. Wie Eve vorhergesagt hatte, konnten sie sich auf diese Weise tatsächlich viel mehr Freiheiten erobern. Wenn sie mal in hysterisches Gekicher ausbrachen, dann nie in der Öffentlichkeit.
Oft drückten sie sich die Nasen am Fenster von Healys Hotel platt. Sie konnten Mrs. Healy nicht ausstehen. Sie war so überheblich und stolzierte immer einher wie eine Königin. Kinder behandelte sie stets von oben herab.
Von Patsy erfuhr Benny, daß die Healys in Dublin gewesen waren, um ein Kind zu adoptieren, doch sie hatten keines bekommen, weil Mr. Healy lungenkrank war.
»Um so besser«, hatte Eve mitleidlos bemerkt. »Die wären bestimmt schreckliche Eltern.« Das sagte sie in aller Unschuld. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, daß man in Knockglen einst gemeint hatte, sie sei das ideale Kind für dieses Paar.
Mr. Healy war wesentlich älter als seine Frau. Wie Patsy erzählt hatte, munkelte man, er habe kein bißchen Mumm in den Knochen. Eve und Benny zerbrachen sich stundenlang den Kopf darüber, was das bedeuten sollte. Hing das mit seiner Krankheit zusammen? Aber was hatten die Lungen mit den Knochen zu tun? Und überhaupt, was war Mumm?
Mrs. Healy sah aus wie hundert, war aber angeblich erst siebenundzwanzig. Sie hatte mit siebzehn geheiratet und steckte all ihre Zeit und Energie in das Hotel, denn Kinder hatte sie ja keine.
Gemeinsam erkundeten Benny und Eve Orte, an die sie sich allein nie getraut hätten. Beispielsweise Flood’s, die Metzgerei, wo sie hofften, beim Schlachten zuschauen zu können.
»Aber wollen wir zusehen, wie die Tiere umgebracht werden?« wandte Benny ängstlich ein.
»Nein, aber wir möchten wenigstens am Anfang dabeisein, damit wir zuschauen könnten, wenn wir wollen, und dann laufen wir weg«, erklärte Eve. Doch Mr. Flood ließ sie gar nicht erst in die Nähe seines Hofes, und damit hatte sich die Sache von selbst erledigt.
Sie waren auch neugierige Zaungäste, als der Italiener aus Italien kam und seinen Fish-and-Chip-Laden aufmachte.
»Ihr kleine Mädchen kommen jeden Tag und kaufen meine Fisch?« fragte er hoffnungsvoll die beiden Kinder, die von so unterschiedlicher Größe waren und mit ernster Miene jeden seiner Handgriffe beobachteten.
»Nein, ich glaube, das dürfen wir nicht«, meinte Eve traurig.
»Warum denn nicht?«
»Weil es heißen würde, das ist Geldverschwendung«, sagte Benny.
»Und weil wir nicht mit Fremden reden dürfen«, fügte Eve hinzu, um die letzten Zweifel auszuräumen.
»Meine Schwester ist verheiratet mit Mann aus Dublin«, erklärte Mario.
»Wir werden es weitersagen«, versprach Eve feierlich.
Manchmal gingen sie auch zum Geschirrmacher. Eines Tages erschien ein eleganter Mann auf einem Pferd und erkundigte sich nach einem bestellten Zaumzeug, das allerdings noch nicht fertig war.
Dekko Moore, der Cousin von Paccy Moore, dem Schuhmacher, war ganz kleinlaut und sah so jämmerlich drein, als wolle man ihn wegen der Verzögerung aufs Schafott führen.
Der Mann riß sein Pferd herum. »Na schön, dann liefern Sie es mir bis morgen ins Haus«, rief er.
»Natürlich, Sir, vielen Dank, Sir. Wirklich, Sir, es tut mir sehr leid, Sir.« Dekko Moore hörte sich an wie der Bösewicht in einem Theaterstück, der soeben entlarvt worden war.
»Himmel, wer war denn das?« fragte Benny erstaunt, während Dekko ein Stein vom Herzen fiel, weil er noch einmal glimpflich davongekommen war.
»Das war Mr. Simon Westward«, erwiderte Dekko und fuhr sich mit der Hand über die Stirn.
»Das habe ich mir gedacht«, sagte Eve grimmig.
Gelegentlich besuchten sie Bennys Vater in Hogan’s Gentleman’s Outfitters. Er überhäufte die Mädchen immer mit Aufmerksamkeiten, ebenso wie der alte Mike und jeder andere, der sich gerade im Laden aufhielt.
»Werden Sie hier auch noch arbeiten, wenn Sie alt sind?« hatte Eve Mike flüsternd gefragt.
»Ich glaube nicht. Das überlasse ich dann einem jungen Burschen.«
»Warum denn einem Burschen?« wollte Eve wissen.
»Na ja, da muß man bei den Männern Maß nehmen. Ihnen Maßbänder um die Taille legen und so.« Sie kicherten.
»Aber du bist ja die Tochter vom Chef, du brauchst das nicht zu tun. Du mußt nur vorbeikommen und deine Angestellten anschreien wie Mrs. Healy in ihrem Hotel.«
»Hm«, meinte Benny zweifelnd. »Muß ich aber dann nicht wissen, was ich schreien muß?«
»Das lernst du schon. Andernfalls übernimmt die Schlafmütze den Laden.«
So nannten sie Sean Walsh, der seit seiner Ankunft noch blasser und dünner geworden zu sein schien. Auch sein Blick wirkte noch stechender als früher.
»Nein, das geht doch nicht, oder?«
»Du könntest ihn ja heiraten.«
»Uff!«
»Und viele Kinder haben, wenn du dich mit deinem Bauchknopf neben ihn legst.«
»Ach, Eve, so was will ich gar nicht hören. Ich glaube, ich gehe ins Kloster.«
»Ich auch, glaube ich. Dann ist alles viel einfacher. Du kannst ja gehen, wann du willst, du Glückspilz, aber ich muß warten, bis ich einundzwanzig bin.« Eve war tieftraurig.
»Vielleicht lassen sie dich mit mir zusammen eintreten, wenn sie glauben, daß du dich wirklich berufen fühlst«, versuchte Benny sie zu trösten.
Ihr Vater war aus dem Laden verschwunden, doch nun kam er mit zwei Lutschern zurück, die er den Kindern stolz überreichte.
»Es ist uns eine große Ehre, die beiden Damen unter unserem bescheidenen Dach willkommen zu heißen«, sagte er so laut, daß jeder es hören konnte.
Bald wußte ganz Knockglen, daß sie ein unzertrennliches Paar waren: die große, stämmige Benny Hogan mit den festen Schuhen und dem praktischen, hochgeschlossenen Mantel und die etwas verwahrlost wirkende Eve, in Kleidern, die ihr stets zu lang waren und um den Körper schlotterten. Gemeinsam erlebten sie mit, wie der erste Fish-and-Chip-Laden des Ortes aufmachte, sahen, wie Mr. Healy vom Hotel mehr und mehr dahinsiechte, bis man ihn eines Tages ins Sanatorium brachte. Gemeinsam waren sie unbesiegbar. Niemand erlaubte sich ungestraft eine unbesonnene Bemerkung über eine von ihnen.
Einmal beging Birdie Mac im Süßwarenladen den Fehler, Benny zu sagen, daß die vielen Sahnebonbons nicht gut für sie seien. Sofort funkelte Eves kleines Gesicht sie zornig an.
»Wenn Sie sich deshalb so viele Sorgen machen, Miss Mac, warum verkaufen Sie dann überhaupt welche?« sagte sie in einem Ton, bei dem sich jede Antwort erübrigte.
Und als Maire Carrolls Mutter einmal nachdenklich zu Eve sagte: »Weißt du, ich verstehe nicht, warum eine vernünftige Frau wie Mutter Francis dich wie ein armes Waisenkind herumlaufen läßt«, verfinsterte sich Bennys Miene.
»Ich sag Mutter Francis, daß sie es Ihnen erklärt«, hatte sie wie aus der Pistole geschossen erklärt. »Mutter Francis sagt, man soll immer fragen, wenn man etwas wissen möchte.«
Ehe Mrs. Carroll sie zurückhalten konnte, war Benny aus dem Laden hinausgestürmt und lief in Richtung Kloster.
»Ach, Mam, was hast du da angerichtet«, jammerte Maire Carroll. »Mutter Francis wird wie eine Furie über uns herfallen.«
Und das tat sie auch. Mrs. Carroll hatte nicht damit gerechnet, daß der Zorn der Nonne in voller Wucht über sie hereinbrechen würde, und sie wünschte nur, ihn niemals wieder spüren zu müssen.
Doch alle diese Dinge kümmerten Eve und Benny nicht im geringsten. Man konnte es in Knockglen gut aushalten, wenn man eine Freundin hatte.
Kapitel 2
1957
In Knockglen hatte man noch nicht viele Halbstarke zu Gesicht bekommen. Genaugenommen konnte sich überhaupt niemand erinnern, je einen gesehen zu haben – außer in Dublin, wo sie gruppenweise an Straßenecken herumlungerten. Benny und Eve saßen in Healys Hotel am Fenster und übten Kaffeetrinken, um sich nicht zu blamieren, wenn sie in Dublin in ein Café gingen.
Da sahen sie ihn vorübergehen, unbekümmert und selbstsicher, mit Röhrenhose und langer Jacke, der Kragen und die Ärmelaufschläge aus Samt. Seine Beine sahen spindeldürr aus, seine Schuhe wirkten riesig. Daß die ganze Stadt ihn anstarrte, schien ihn nicht zu stören. Erst als er die beiden Mädchen bemerkte, die eigens aufgestanden waren, um hinter Healys Fenster durch die Vorhänge zu spähen, zeigte er eine Reaktion. Er sah sie mit einem breiten Grinsen an und warf ihnen eine Kußhand zu.
Verwirrt und ärgerlich setzten sie sich wieder hin. Zuschauen war ja schön und gut, aber selbst Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen war doch etwas anderes. Aufsehen zu erregen stand im Sündenregister von Knockglen an erster Stelle. Jeder, der gerade aus dem Fenster blickte, hätte mitkriegen können, daß sie sich mit einem Halbstarken abgaben. Bennys Vater etwa, wenn er, ein Maßband um den Hals, herausgeblickt hätte. Oder der widerliche, verschlagene Sean Walsh, dem nie ein Wort über die Lippen kam, bevor er sich dessen Wirkung genau überlegt hatte. Oder der alte Mike, der ihren Vater seit Jahren Mr. Eddie nannte und keinen Grund sah, daran etwas zu ändern.
Und Eve war in Knockglen nicht weniger bekannt. Schon seit langem hatten die Nonnen ihren Ehrgeiz daran gesetzt, zu erreichen, daß man Eve im Ort als Dame betrachtete. Sie machte das Spiel sogar mit. Deshalb war sie nicht darauf erpicht, daß jemand den Nonnen hinterbrachte, sie kokettiere in Healys Hotel und werfe Halbstarken verliebte Blick zu. Während Mädchen mit richtigen Müttern allen Verlockungen, sich über ihren Stand zu erheben, widerstanden, studierten Eve und Mutter Francis Benimmbücher, blätterten in Zeitschriften mit Bildern von hübschen Kleidern und waren für jeden Hinweis über Verhaltensregeln dankbar.
»Ich möchte nicht, daß du dir einen künstlichen Akzent zulegst«, hatte Mutter Francis sie ermahnt, »und auch nicht, daß du beim Teetrinken den kleinen Finger abspreizt.«
»Wen wollen wir eigentlich beeindrucken?« hatte Eve einmal gefragt.
»Nein, sieh es mal von der anderen Seite. Es geht darum, wen wir nicht enttäuschen sollten. Alle meinten, wir wären verrückt, wir könnten dich nicht großziehen. Und es ist mir ein menschliches und nicht sehr frommes Bedürfnis, zu den Mißgünstigen sagen zu können: ›Seht ihr wohl?‹«
Das hatte Eve sofort begriffen. Und es gab auch nach wie vor Hoffnung, daß die Westwards eines Tages der eleganten Dame begegnen und dann bedauern würden, daß sie die Verbindung zu dem Kind abgebrochen hatten, das schließlich blutsverwandt mit ihnen war.
Mrs. Healy kam auf sie zu. Sie war mittlerweile verwitwet, aber noch immer dieselbe furchteinflößende Persönlichkeit, der man auf fünfzig Meter Entfernung ihre Mißbilligung anmerkte. Zwar gab es keinen Grund, warum Benny Hogan vom Laden gegenüber und Eve Malone aus dem Kloster nicht an ihrem Erkerfenster sitzen und Kaffee trinken sollten, doch irgendwie hätte sie es lieber gesehen, wenn dieser Platz vermögenderen und wichtigeren Damen Knockglens vorbehalten geblieben wäre.
Sie rauschte zum Fenster. »Ich muß mal die Gardinen zurechtrücken, die habt ihr ja ganz zerknittert«, sagte sie.
Eve und Benny wechselten einen Blick. Es war alles in bester Ordnung mit den schweren Gardinen in Healys Hotel, sie waren so wie immer: dick genug, um die Gäste vor neugierigen Blicken von draußen zu bewahren, ohne die neugierigen Blicke nach draußen zu behindern.
»Na, was ist denn das für ein armer Irrer!« rief Mrs. Healy aus, nachdem sie ohne Mühe festgestellt hatte, was den Mädchen da draußen so interessant erschienen war.