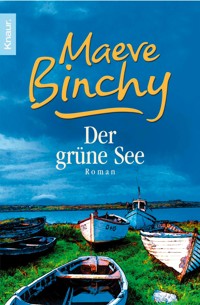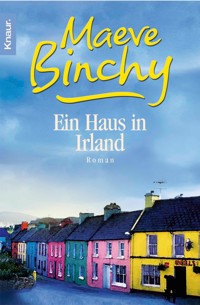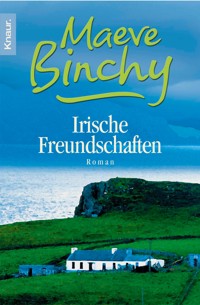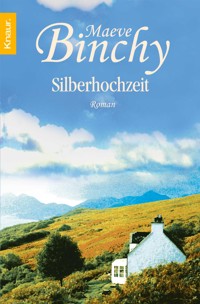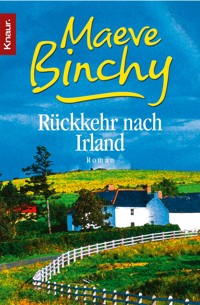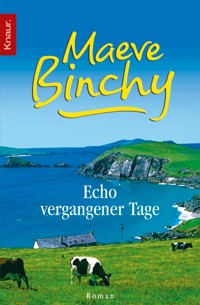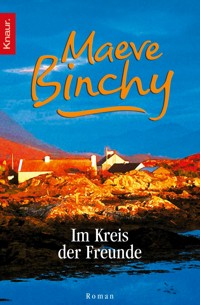6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebenswerte Szenen aus dem südlichen Teil Dublins, einem eher eleganten Viertel der irischen Hauptstadt, spiegeln den ganz normalen Wahnsinn seiner Bewohner wider. Ein Mädchen vom Land lernt die Freuden des Stadtlebens kennen, eine Studentin schlägt sich mit den Folgen einer ungewollten Schwangerschaft herum und ein alkoholabhängiger Fotograf versucht einen beruflichen Neuanfang ... Ihre einzigartige Darstellung menschlicher Gefühle und ihr unglaubliches Gespür für Dialoge machen Maeve Binchys Geschichten konkurrenzlos gut und ihre Figuren immer wieder unvergesslich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Maeve Binchy
Das Herz von Dublin
Neue Geschichten aus Irland
Aus dem Englischen von Christa Prummer-Lehmair und Sonja Schuhmacher (Kollektiv Druck-Reif)
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für Gordon in Liebe
Dinner in Donnybrook
Sie zeichnete die Sitzordnung sechsmal auf, aber immer kam dasselbe heraus. Wenn man den Gastgeber an das eine Ende der Tafel setzte und die Gastgeberin ans andere, ging es nicht auf. Sie würde mit dem Rücken zum Fenster sitzen und zu beiden Seiten einen Herrn haben. Ihr gegenüber säße dann Dermot mit einer Dame zu beiden Seiten. So weit, so gut, aber wie sollte man die Plätze dazwischen verteilen? Wie man es auch anstellte, stets saß am Ende ein Herr neben einem Herrn und eine Dame neben einer Dame.
Verwirrt schüttelte sie den Kopf. Das Problem glich einer dieser Knobelaufgaben, die sie von der Schule her kannte: Wenn auf einer Insel drei Missionare und drei Kannibalen sitzen und im Boot nur zwei Mann Platz haben … So wichtig war es natürlich nicht, und wenn jemand gewußt hätte, wieviel Zeit sie damit zugebracht hatte, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, hätte er sie bestimmt für verrückt gehalten. Aber ärgerlich war es trotzdem. Es mußte doch eine Lösung geben.
»Gibt es auch«, sagte ihre Tochter Anna. Sie hatte Anna wegen einer anderen Sache angerufen und dann das Gespräch auf die verwickelte Sitzordnung gelenkt. »Bei einem Essen für acht Personen können Gastgeber und Gastgeberin einander eben nicht gegenübersitzen. Vis-à-vis von dir muß die wichtigste Dame sitzen … und Dad bekommt den Platz links von dieser Dame.«
Anna hatte inzwischen das Thema gewechselt, doch sie konnte nicht wissen, daß ihre Mutter nun erneut die Tafel zeichnete, wobei die wichtigste Dame ihr gegenüber am anderen Ende des Tisches saß und links von ihr Dermot mit Blick aufs Buffet.
»Alles in Ordnung, Mutter?« fragte Anna. Normalerweise nannte Anna sie »Mum«, aber seit neuestem sagte sie »Mutter«, und zwar mit einem scherzhaften Unterton, als sagte sie »gnädige Frau«. Es klang, als wäre das Wort Mutter ebenso unpassend.
»Mir geht es gut, Liebes«, erwiderte Carmel. Sie fand es ärgerlich, wenn die Leute sie fragten, ob alles in Ordnung sei. Nie wäre sie auf die Idee gekommen, andere zu fragen, ob alles in Ordnung sei, selbst wenn sie sehr merkwürdig oder zerstreut wirkten. Jeder glaubte, sie herablassend behandeln zu können, als wäre sie ein Kind. Sogar ihre eigene Tochter.
»Dann ist es ja gut. Du hast so geklungen, als wärst du in Gedanken ganz woanders. Jedenfalls sind wir, wie gesagt, am Wochenende im Cottage, und du mußt mir dann erzählen, wie es dir mit deinen Gästen ergangen ist. Freut mich, daß du und Dad Leute einladet. Schön, daß sich bei euch etwas rührt und ihr auch einmal etwas unternehmt.«
Wieder fragte sich Carmel, warum Dermot nach wie vor »Dad« hieß, und nicht »Vater«, und was daran schön sein sollte, wenn sich »etwas rührte«. Warum sollte sich eigentlich etwas rühren? Beim Kochen ja, aber bei Menschen? Allzuviel Rühren tat nicht gut, sie sollten lieber köcheln oder abkühlen oder sogar eine Kruste bilden, wenn ihnen danach war. Doch diese Gedanken teilte sie ihrer ältesten Tochter nicht mit.
»Aber nein, Liebes, die Dinnerparty ist nicht dieses Wochenende. Sie ist in einem Monat … ich habe nur ein wenig vorausgeplant.«
Anna lachte schallend. »Mutter, du bist wirklich für Überraschungen gut. In einem Monat! Nicht einmal James würde so lange vorausplanen. Auf jeden Fall haben wir dann ja noch jede Menge Zeit, um darüber zu reden.« Anna sprach in einem Tonfall darüber, als ginge es darum, in der Beschäftigungstherapie Körbe zu flechten. Aber Carmel ließ sich ihren Ärger nicht anmerken und wünschte ihnen ein schönes Wochenende. Der Wetterbericht war gut, vor allem für den Südwesten.
Ihrer Meinung nach waren Anna und James nicht ganz bei Trost, wenn sie am Freitag nachmittag 334 Kilometer hin- und am Sonntag dieselbe Entfernung wieder zurückfuhren. Was hatten sie denn von ihrem Haus mit Garten in Sandycove, wenn sie kaum je das Wochenende dort verbrachten? Das Cottage in Kerry war doch nur ein Klotz am Bein, fand Carmel. Daß eine Fahrt von fünf Stunden angenehm war, konnte sie sich nicht vorstellen. »Vier Stunden und fünfunddreißig Minuten, Großmama, wenn man die Abkürzungen kennt …« James mit seinem »Großmama« war nun wirklich albern; da hätte er ebensogut »Großherzogin« sagen können. Aber Anna beklagte sich nie, sondern erzählte voller Begeisterung: »Mutter, es ist einfach toll, wir kommen gegen halb zehn an, machen Feuer, holen die Steaks heraus und öffnen den Wein, die Kinder sind schon halb eingeschlafen und brauchen bloß noch einen Gutenachtkuß … man fühlt sich so frei … auf dem Land … in unserem Häuschen … du kannst es dir nicht vorstellen!«
Auch Anna hatte den Wetterbericht gehört. »Ja, ich bin froh, weil wir am Sonntag eine Menge Leute zum Mittagessen da haben, und es ist viel schöner, wenn wir alle draußen sitzen können.«
Eine Menge Leute zum Mittagessen, in dieser Hütte, in Kerry, also praktisch in der Wildnis, meilenweit entfernt von ihrer Küche, ihrer Tiefkühltruhe, ihrer Geschirrspülmaschine. Kein Wunder, daß Anna wenig Verständnis dafür hatte, daß sie, Carmel, sich den Kopf über die Sitzordnung einer Abendgesellschaft zerbrach, die in einem Monat stattfand. Aber natürlich hatte Anna andere Sorgen. Anna hätte sich nie in eine Situation begeben, in der solche Probleme auftauchten.
Noch einmal zeichnete Carmel die Tafel und trug sorgfältig die Namen der Gäste ein. Am oberen Ende des Tisches, mit dem Rücken zum Fenster, schrieb sie Carmel, und am Kopfende Ruth O’Donnell, Wichtigste Dame. Dann setzte sie die anderen Namen ein und schrieb unter jeden noch eine Bemerkung. Dermot, Liebevoller Ehemann. Sheila, Kluge Freundin. Ethel, Vornehme Freundin. Martin, Netter Mann der klugen Freundin. David, Aufgeblasener Mann der vornehmen Freundin. Und dann, rechts neben Ruth O’Donnell, schrieb sie mit Bedacht: Joe, Lebensretter. Lange Zeit saß sie da und betrachtete den Plan. Nun war er nicht länger die Zeichnung eines Rechtecks mit kleinen Quadraten rundherum, in denen Namen und Bemerkungen standen. Er wurde zu einem Tisch mit Gläsern und Blumen, gutem Porzellan und glänzendem Tafelsilber. Beinahe roch sie schon den Duft der Speisen und hörte, was gesprochen wurde. Sie lernte die Sitzordnung auswendig, so wie sie früher als Kind die Großen Seen oder die Städte der Grafschaft Cavan auswendig gelernt hatte. Ganz mechanisch, mit geschlossenen Augen, prägte sie sich Namen ein, so wie sie dastanden – mit den realen Menschen hatte das nichts zu tun.
Dann nahm sie all die Zettel und legte sie in den offenen Kamin. Vom Feuer des vergangenen Abends war noch Schlacke und ein wenig Glut übrig, aber darauf vertraute sie nicht. Sie nahm einen halben Feueranzünder aus der Packung und zündete ihn an. Und hier, in dem Raum, in dem sie in einem Monat ihre Abendgesellschaft geben würde, saß sie nun und beobachtete, wie die Flammen die Listen und Sitzordnungen verzehrten, bis nur noch feine Asche auf der Schlacke des Vorabends zurückblieb.
»Ich glaube, Carmel Murray verliert allmählich den Verstand«, bemerkte Ethel beim Frühstück.
David brummte nur, denn er las gerade seine eigene Post und wollte sich von Ethels Worten nicht ablenken lassen.
»Nein, im Ernst, hör dir das an …« Ethel schickte sich an, ihm den Brief vorzulesen.
»Einen Augenblick, Ethel …«
»Nein, dann springst du auf und bist weg. Ich möchte, daß du dir das anhörst.«
Er sah sie an und begriff, daß es besser war nachzugeben. Ethel setzte ohnehin immer ihren Kopf durch, und wenn man das akzeptierte, war das Leben leichter.
»Carmel hat den Verstand verloren? Sprich weiter.«
»Ja, ganz bestimmt. Sie hat uns geschrieben. Eine schriftliche Einladung zu einer Abendgesellschaft … nächsten Monat … kannst du dir das vorstellen?«
»Ja, das ist aber nett von ihr«, meinte David ausweichend. »Vermutlich können wir uns doch aus der Affäre ziehen. Warum regst du dich auf? Was ist denn so verrückt daran? Es ist üblich, daß man Abendgesellschaften gibt. Das macht doch jeder.«
Ihm war klar, daß er sich mit dieser superklugen Antwort bei Ethel nur Ärger einhandeln würde. Und er irrte sich nicht; es war ein Fehler gewesen.
»Ich weiß, daß jeder Abendgesellschaften gibt, Schatz«, sagte sie. »Aber Carmel Murray hat es noch nie getan. Die arme Carmel, zu der wir nett sein müssen, weil Dermot so ein guter Kerl ist … deshalb ist es ungewöhnlich. Und hast du jemals etwas so Merkwürdiges gehört? Eine schriftliche Einladung, wo sie doch nur fünf Minuten entfernt wohnt! Schließlich gibt es Telefone.«
»Ja, ja, das ist seltsam. Stimmt. Mach einfach, was du möchtest, sag, daß wir nicht da sind, sag, es ist schade … ein andermal. Ja?«
»Sie weiß, daß wir hier sind. Das ist ja das Merkwürdige, das Essen ist an dem Tag, an dem Ruth O’Donnells Ausstellung eröffnet wird. Carmel weiß, daß wir diesen Termin auf keinen Fall versäumen werden …«
»Woher weißt du, daß es am selben Tag ist?«
»Weil sie es in ihrer Einladung selbst sagt … sie schreibt, daß sie Ruth ebenfalls eingeladen hat. Verstehst du jetzt, warum ich glaube, daß sie nicht alle Tassen im Schrank hat?«
Ethel war die Röte in die Wange gestiegen, und sie blickte ihn triumphierend an. Wieder einmal hatte sie bewiesen, daß sie recht hatte. In ihrem seidenen Kimono thronte sie am Tisch und wartete darauf, daß sich ihr Mann entschuldigte, was er auch tat.
»Sie lädt Ruth ein … Herrje. Jetzt begreife ich, was du meinst.«
Während des Unterrichts ließ sich Sheila nur ungern stören. Es machte die Nonnen nervös, wenn sie jemanden ans Telefon rufen mußten. Was Kommunikation betraf, lebten sie noch in der Steinzeit, das Telefon befand sich nach wie vor in einer kalten zugigen Zelle in der Eingangshalle, was für alle unbequem war. Beunruhigt hörte sie, daß ihr Mann sie sprechen wollte …
»Martin, was ist los, was ist passiert?« fragte sie.
»Nichts. Ist schon gut, beruhig dich.«
»Nichts? Was soll das bedeuten? Was ist los?«
»Reg dich nicht auf, Sheila, es ist nichts.«
»Du hast mich also wegen nichts aus der dritten Klasse herunterholen lassen? Schwester Delia erweist mir einen großen Gefallen und vertritt mich für ein paar Minuten. Was ist los, Martin? Ist etwas mit den Kindern …?«
»Hör mal, ich dachte mir, du solltest wissen, daß wir einen sehr merkwürdigen Brief von Carmel bekommen haben.«
»Einen was … von Carmel?«
»Einen Brief. Ja, ich weiß, das ist nicht ihre Art, da dachte ich mir, vielleicht stimmt etwas nicht und es wäre besser, wenn du Bescheid weißt …«
»Ja, gut, was hat sie geschrieben, was fehlt ihr?«
»Nichts, das ist ja das Problem. Sie lädt uns zum Essen ein.«
»Zum Essen?«
»Ja, ist doch komisch, oder? Als ob sie nicht ganz gesund wäre oder so. Jedenfalls wollte ich es dir sagen, nur für den Fall, daß sie sich bei dir meldet.«
»Hast du mich wirklich deshalb herunterholen lassen? Die dritten Klassen sind im obersten Stockwerk, weißt du. Ich dachte schon, das Haus sei abgebrannt! Na warte, wenn ich heimkomme, kannst du was erleben.«
»Das Essen ist erst in einem Monat, und sie schreibt, sie hätte Ruth O’Donnell eingeladen.«
»Du meine Güte.«
Henry rief zu Joe hinaus: »He, der Brief aus Irland ist da. Bestimmt hat sie den Termin festgelegt, die arme alte Tante.«
Joe kam herein und öffnete den Umschlag.
»Ja, es ist in einem Monat, sie schreibt, alles soll planmäßig ablaufen. Sie hat das Ticket und das Geld geschickt.«
»Sie ist in Ordnung, stimmt’s?« Henry schien zufrieden.
»Oh, wirklich schwer in Ordnung, und ich habe ihr viel zu verdanken, sehr viel sogar. Jedenfalls werde ich die Sache regeln …«
»Wenn du das nicht zustande bringst, wer dann?« meinte Henry voller Bewunderung, und Joe erwiderte sein Lächeln, als er die Kaffeemaschine herbeiholte.
»Ich glaube, Mutter geht jetzt etwas mehr aus sich heraus, Liebling«, sagte Anna zu James, als sie im Nachmittagsverkehr dahinschlichen.
»Schön. Kein Wunder, daß dieses Land vor die Hunde geht! Schau dir mal an, was hier auf den Straßen los ist, und es ist noch nicht mal vier. Anscheinend nimmt sich die Hälfte der Leute ab Mittag frei. Macht nichts, in ein paar Minuten sind wir da raus. Was hast du gerade über Großmama gesagt?«
»Sie hat mir erzählt, daß sie eine Abendgesellschaft geben will, mit einer festlich gedeckten Tafel und einer Sitzordnung. Das hört sich gut an.«
»Ich habe schon immer gesagt, daß sie gar nicht so langweilig ist, wie du und Bernadette immer behaupten. Mir geht mit ihr nie der Gesprächsstoff aus.«
»Nein, dir nicht, du redest auf sie ein … und sie steht ganz in deinem Bann, weil du so interessant bist, aber ein echtes Gespräch ist das nicht.«
James war anderer Meinung. »Da irrst du dich, sie erzählt mir auch so manches. Nein, im Moment fällt mir nichts ein … das ist doch albern, Beispiele zu verlangen. Aber ich verstehe mich gut mit ihr … sie braucht nur hin und wieder ein Kompliment, etwas Aufmunterndes. ›Du siehst toll aus, Großmama‹, und schon strahlt sie … sie mag es einfach nicht, wenn man ihr sagt, sie sei albern.«
Anna dachte eine Weile nach.
»Wahrscheinlich bekommt sie das wirklich oft zu hören. Ja, du hast recht. Ich sage immer ›Sei nicht albern, Mutter‹, aber so meine ich das nicht. Es ist nur, weil sie sich oft unnötig aufregt, und ich glaube, wenn ich ihr sage ›sei nicht albern‹, dann beruhigt sie sich ein wenig. Und bei ihrer lächerlichen Dinnerparty werde ich sie mit Rat und Tat unterstützen.«
James tätschelte ihr Knie.
»Du bist großartig, Schätzchen. Und weil wir gerade über Partys reden, erzähl mir doch, was du für Sonntag vorbereitet hast …«
Anna lehnte sich zufrieden zurück und berichtete von den guten Sachen, die in Folie eingeschweißt, vakuumversiegelt und luftdicht verpackt in der riesigen Schachtel lagen, die sie behutsam im Kofferraum verstaut hatten.
»Das ist toll, Mama«, sagte Bernadette. »Wirklich toll. Es wird sicher ein wunderbarer Abend.«
»Ich dachte nur, daß es dich vielleicht interessiert …«, meinte Carmel.
»Ja, natürlich bin ich begeistert, Mama. Ist es heute abend oder wann?«
»Aber nein, Liebes, es ist eine Abendgesellschaft … sie findet erst in einem Monat statt.«
»In einem Monat! Mama, geht es dir gut?«
»Ja, Liebes, es könnte nicht besser gehen.«
»Oh. Ich meine, soll ich vielleicht … möchtest du, dass ich komme und dir bei der Planung helfe oder so?«
»Nein, nein, es ist schon alles geplant.«
»Oder soll ich servieren? Weißt du, dann hast du deine Ruhe und mußt dich an dem Abend nicht unnötig aufregen?«
»Nein, nein, Liebes, vielen Dank, aber ich werde mich überhaupt nicht aufregen.«
»Das ist toll, Mama! Und freut sich Daddy, daß du nun häufiger Leute einlädst?«
»Ich lade nicht häufiger Leute ein … es handelt sich um eine einzige Abendgesellschaft.«
»Du weißt schon, was ich meine. Ist Daddy begeistert?«
»Ich habe es ihm noch nicht gesagt.«
»Mama, bist du sicher, daß es dir gutgeht? Du bist doch nicht durcheinander, so wie …«
»Wie was, Liebes?«
»So wie damals, als du ganz durcheinander warst.«
»Aber nein, Liebes, natürlich nicht. Damals hatte ich ja die Schlafstörungen, da war ich völlig aus dem Lot … Nein, davon bin ich Gott sei Dank geheilt. Das weißt du doch, Bernadette. Jetzt schlafe ich nachts wie ein Stein. Nein, nein, das ist vorbei, dem Himmel sei Dank.«
Bernadette wirkte besorgt.
»Dann ist es ja gut. Paß auf dich auf, Mama. Du regst dich oft über ganz alberne Sachen auf. Ich möchte nur nicht, daß du wegen dieser Party nervös wirst …«
»Du hast mich nicht ganz verstanden, Kind, ich freue mich darauf.«
»Gut, und wir kommen dich bald besuchen. Es ist ja eine Ewigkeit her.«
»Jederzeit, wenn es dir paßt, Liebes. Ruf aber zuerst an, denn in den nächsten Wochen werde ich öfter außer Haus sein …«
»Tatsächlich, Mama? Wo gehst du denn hin?«
»Hierhin und dorthin, Bernadette. Jedenfalls freue ich mich, dich zu sehen. Wie geht’s Frank?«
»Ganz gut, Mama. Paß auf dich auf, ja?«
»Ja, Bernadette. Danke, Liebes.«
Dermot fand, daß Carmel an diesem Morgen vollkommen geistesabwesend wirkte. Schon zweimal hatte er gesagt, es könne spät werden, und sie solle sich keine Sorgen machen, wenn er auf dem Heimweg noch im Golfclub vorbeischaute. Er müsse mit ein paar Leuten reden, und dort sei der geeignete Ort dafür. Zweimal hatte sie liebenswürdig und unbeteiligt genickt, als hätte sie nicht gehört oder nicht verstanden, was er sagte.
»Ist das in Ordnung? Was hast du heute vor?« fragte er, was sonst nicht seine Art war.
Sie lächelte. »Komisch, daß du das fragst. Ich dachte gerade, daß ich den ganzen Tag nichts zu tun habe, also könnte ich einen Einkaufsbummel durch die Innenstadt machen. Das ist doch beinahe eine Sünde … wenn man den Tag so vertrödelt …«
Dermot hatte ihr Lächeln erwidert. »Eine solche Sünde steht dir zu. Mach dir einen schönen Tag. Und wie gesagt, es kann spät werden, und dann brauchst du nichts mehr für mich zu kochen. Vielleicht gehen wir ein Steak essen … du weißt schon. Reg dich nicht auf, mach dir wegen mir keine Umstände.«
»Nein, ist schon gut«, hatte sie gesagt.
Und als er in der Morehampton Road im Verkehr festsaß und hörte, wie der Rundfunksprecher blöderweise genau das sagte, was er schon wußte, nämlich daß die Morehampton Road dicht war, dachte Dermot an Carmel, und es war ihm nicht ganz wohl dabei. Aber er schüttelte den Kopf und verscheuchte den Gedanken.
»Allmählich werde ich neurotisch«, sagte er sich. »Wenn sie mich über jeden Schritt ausfragt und mir in aller Ausführlichkeit ihren simplen Tagesablauf erzählt, werde ich ärgerlich. Und jetzt fühle ich mich unbehaglich, weil sie es nicht tut. Mir kann man es wirklich nicht recht machen.« Weil für seinen Geschmack auf Radio Eireann allzu muntere Töne angeschlagen wurden, schaltete er auf BBC um, wo es ernster zuging. Das paßte besser zu den Gedankengängen eines Mannes, der morgens ins Büro fuhr.
Ruth O’Donnell hatte ihre Einladung noch nicht erhalten, weil sie auf Reisen war. Sie hatte sich in ein Bauernhaus in Wales zurückgezogen, um einmal richtig auszuspannen. Ebensogut hätte sie in Irland aufs Land fahren können, aber sie wollte keinen Bekannten begegnen. Wenn sie Leute traf, hätte sie nicht vollkommen ausspannen können. Sie wollte absolut allein sein.
Carmel wartete, bis Gay Byrnes Sendung vorüber war. Während Living Word lief, zog sie den Mantel an und holte ihren Einkaufskorb auf Rädern heraus. Gay wollte sie nicht versäumen; einmal hatte sie ihm einen kleinen Kocher für eine alleinerziehende Mutter überlassen können. Mit ihm persönlich hatte sie nicht gesprochen, aber das Mädchen beim Sender war sehr nett gewesen, und ein weiteres nettes Mädchen war erschienen, um den Kocher abzuholen; vielleicht kam sie aber auch von der Organisation, die darum gebeten hatte. Das war nicht ganz klargeworden. Carmel hatte sich auch ein-, zweimal beworben, um bei der »geheimnisvollen Stimme« mitzuraten, aber man hatte sie nie angerufen. Vor dem Living Word verließ sie nicht gern das Haus. Es wäre unhöflich gegenüber Gott gewesen, wenn sie ausgerechnet während des kurzen religiösen Beitrags hinausging.
Auch die anschließenden Sendungen wie Day by Day hätte sie eigentlich anhören sollen, um auf dem laufenden zu bleiben, aber seltsamerweise schweiften ihre Gedanken immer wieder ab, und sie begriff nicht ganz, warum sich die Leute über irgendwelche Themen so ereiferten. Einmal hatte sie zu Sheila gesagt, es wäre schön, wenn jemand neben einem sitzen und erzählen würde, was in der Welt passierte, aber Sheila hatte erwidert, sie solle den Mund halten, sonst würde jeder sagen, sie hätten nach all den Jahren bei den Loreto-Nonnen nichts gelernt … Carmel dachte, daß Sheila an diesem Tag etwas durcheinander gewesen war, aber mit Sicherheit ließ sich das nicht sagen.
Draußen war es heiter und sonnig, ein schöner Herbsttag. Sie schob ihre tartanbezogene Einkaufstasche vor sich her und dachte an die Zeit zurück, als sie noch mit dem Kinderwagen unterwegs gewesen war. Damals hatte sie viel mehr Leute gekannt. Immer wieder war sie stehengeblieben und hatte sich mit Passanten unterhalten, nicht wahr? Oder spielte ihr das Gedächtnis einen Streich, so wie sie glaubte, die Sommer seien in ihrer Kindheit immer heiß gewesen und sie hätten ihre ganze Freizeit am Killiney-Strand verbracht? Das traf nicht zu; laut ihrem jüngeren Bruder Charlie waren sie während des Sommers nur zwei-, dreimal hingefahren; möglicherweise stimmten andere Erinnerungen auch nicht. Vielleicht war sie gar nicht unten an der Eglinton Road stehengeblieben und hatte den Mädchen gezeigt, wo die Busse im Depot schlafen gingen; vielleicht hatte sie auch damals kaum Bekannte gehabt …
An der Weinhandlung machte sie halt und begutachtete die Preise; einige Sorten schrieb sie sich auf, damit sie später eine Liste aufstellen und eine Auswahl treffen konnte. Dann verbrachte sie eine vergnügliche Stunde in einem großen Buchladen, wo sie sich Kochbücher ansah. Ein Rezept nach dem anderen schrieb sie sich in ihr kleines Notizbuch ab. Von Zeit zu Zeit fing sie einen Blick von den Buchhändlern auf, aber da sie anständig aussah und niemanden störte, sagten sie nichts. In ihr Gedächtnis eingebrannt hatte sich eine Bemerkung Ethels über ein Haus, in dem sie zu Gast gewesen war: Die Frau hat keine Phantasie. Ich begreife nicht, warum man Leute einlädt, um dann Krabbencocktail und Roastbeef aufzutischen … Ich meine, warum sagt man ihnen nicht gleich, sie sollen zu Hause essen und anschließend auf einen Drink vorbeikommen? Krabbencocktail aß Carmel schrecklich gern, und sie hatte kleine Glasschalen, in denen er sehr gut aussehen würde. Als sie ein Kind war, hatten sie daraus die Nachspeise gegessen. Die Schalen waren an Carmel gegangen, als Charlie und sie den Hausrat der Eltern aufteilten, aber sie benutzte sie nie. Acht Stück waren es; sie standen hinten im Küchenschrank und setzten Staub an. Als Vorspeise würde sie etwas anderes auswählen, keinen Krabbencocktail, aber die Glasschalen würde sie dafür verwenden, ganz gleich wofür sie sich entschied. Grapefruit kam nicht in Frage. Sie ging das Problem systematisch an. Pastete schied ebenfalls aus, denn sie mußte auf einem Teller serviert werden; Suppe konnte man nicht in Glasschalen auftischen, Fisch natürlich auch nicht … nein, es mußte etwas Kaltes sein, das man löffeln konnte.
Das Passende würde sich schon noch finden, schließlich hatte sie den ganzen Tag Zeit, noch volle neunundzwanzig Tage … kein Grund zur Eile. Sie brauchte sich nicht aufzuregen. Nun hatte sie es. Orangen in Vinaigrette. Da konnte Ethel wirklich nicht behaupten, sie sei phantasielos … man schnitt Orangen in Stücke, außerdem schwarze Oliven, Zwiebeln und frische Minze … hörte sich toll an, dann gab man die Vinaigrettesoße darüber … perfekt. Carmel lächelte zufrieden. Sie hatte die richtige Entscheidung getroffen. Es kam nur darauf an, mit Bedacht vorzugehen.
Jetzt würde sie heimgehen und sich ausruhen; morgen wollte sie dann ein Hauptgericht auswählen, und zuletzt stand die Entscheidung über die Nachspeise an. Zu Hause wartete auch noch Arbeit auf sie. Joe hatte gesagt, wenn er kommen und ihr helfen solle, müsse sie aber auch das ihre dazutun. Sie durfte nicht wie eine in die Jahre gekommene Vogelscheuche aussehen; elegant und bezaubernd und geschmackvoll zurechtgemacht sollte sie sein. Um das zu erreichen, hatte sie dreißig Nachmittage zur Verfügung.
Auf dem Heimweg von der Schule schaute Sheila bei ihr vorbei. Offensichtlich erleichtert stellte sie fest, daß Carmel daheim war. Sie machte ein besorgtes Gesicht.
»Ich bin ein bißchen beunruhigt. Martin hat mir erzählt, daß du uns geschrieben hast.«
»Es war nur eine Einladung.« Carmel lächelte. »Komm doch rein und trink einen Kaffee mit mir. Ich bin gerade dabei, die Schränke auszumisten … eine Menge Kleider habe ich da, die nur noch für die Altkleidersammlung taugen … aber du weißt ja, wie das ist, man schämt sich, sie in diesem Zustand wegzugeben, also läßt man sie erst einmal reinigen. Und wenn sie aus der Reinigung zurückkommen, sehen sie besser aus als die restlichen Sachen im Schrank, und man behält sie am Ende doch.« Mit einem vergnügten Lachen ging Carmel in die Küche, um Wasser aufzusetzen.
»Es kam mir nur merkwürdig vor, daß du schreibst, wo wir uns doch fast täglich sehen …«
»Wirklich? Ach, ich weiß nicht, weil ich so eine miserable Gastgeberin bin, dachte ich mir, ich muß eine schriftliche Einladung rausgeben, sonst glaubt mir sowieso niemand. Vermutlich habe ich aus diesem Grund geschrieben. Ich hätte es dir auf jeden Fall noch gesagt.«
»Aber gestern hast du es nicht erwähnt.«
»Da muß ich es wohl vergessen haben.«
»Ist alles in Ordnung, Carmel? Es geht dir doch gut, oder?«
Carmel hatte Sheila den Rücken zugewandt. Mit Bedacht entspannte sie ihre Schultern und widerstand dem Impuls, die Fäuste zu ballen. Niemand sollte ihr anmerken, wie sehr es sie ärgerte, wenn andere sie in diesem Tonfall fragten, ob alles in Ordnung sei.
»Gewiß geht es mir gut. Warum auch nicht – schließlich führe ich ein ruhiges, streßfreies Leben. Du bist diejenige, die eigentlich erschöpft sein müßte, nachdem du dich den ganzen Tag mit diesen kleinen Teufeln herumgeschlagen hast. Und dazu noch der Lärm! Man sollte dich heiligsprechen.«
»Erzähl doch mal von deiner Dinnerparty«, forderte Sheila sie auf.
»Ach, die ist erst in einem Monat«, lachte Carmel.
»Ich weiß.« Sheila verlor langsam die Geduld. »Ich weiß, daß sie erst in einem Monat ist, aber da du zur Feder gegriffen und uns geschrieben hast, dachte ich, es ist etwas Größeres.«
»Nein, nein, wir sind nur zu acht, das steht auch in meinem Brief.«
»Ja, Martin hat es mir gesagt. Ich war nämlich nicht zu Hause, als der Brief ankam.«
»Er hat dich eigens angerufen? Wie nett von ihm. Es wäre aber nicht nötig gewesen. Du hättest mir auch später Bescheid geben können.«
»Und du hättest mir auch Bescheid geben können.« Sheila machte ein besorgtes Gesicht.
»Natürlich. Meine Güte, was machen wir beide für ein Theater darum! Wenn man bedenkt, wie oft Ethel auf Partys geht oder auch selbst welche gibt …«
»Schon, aber Ethel ist Ethel.«
»Und ihr, ich meine du und Martin, ihr habt doch auch hin und wieder Gäste, oder? Ihr erzählt mir so oft, daß ihr Besuch hattet.«
»Ja, aber das ist immer eine ganz zwanglose Sache.«
»Bei uns geht es auch zwanglos zu. Hauptsächlich Leute, die wir gut kennen.«
»Nur Ruth … Ruth O’Donnell … die kennen wir nicht besonders gut. Und ehrlich gesagt, glaube ich, daß am selben Tag ihre Ausstellung eröffnet wird – ich bin mir sogar ganz sicher.«
»Ja, das weiß ich, ich habe es auch in dem Brief geschrieben. Hat Martin es dir nicht gesagt? Also werden wir alle dort sein … aber die Vernissage ist um vier Uhr … um sechs ist sie spätestens vorbei, und sogar wenn die Leute anschließend noch etwas trinken … die Party hier beginnt erst um acht und das Essen um halb neun.«
»Ja, aber glaubst du nicht, daß sie am Abend ihrer Vernissage mit ihren eigenen Freunden ausgehen möchte?«
»Aber wir sind doch gewissermaßen ihre Freunde.«
»Eigentlich nicht, oder? Bist du etwa mit ihr befreundet? Normalerweise kommt sie doch nicht zu dir?«
»Nein, ich glaube nicht, daß sie je hier gewesen ist. Aber ich dachte mir, es wäre schön für sie … und sie wohnt in der Nähe, in diesem neuen Wohnblock, also hat sie es nicht weit, wenn sie sich umziehen will.«
Sheila setzte ihren Kaffeebecher ab.
»Meiner Meinung nach ist das keine gute Idee. Wir kennen sie schließlich nicht. Warum lädst du jemanden, den wir kaum kennen, zu einer Dinnerparty ein? Treffen wir uns doch einfach zu sechst … das wäre viel angenehmer.«
»Nein. Außerdem habe ich die Einladung schon abgeschickt. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet du das vorschlägst, du sagst doch selbst immer, ich sollte mehr ausgehen und Leute kennenlernen.«
»Damit habe ich aber nicht gemeint, daß du bekannte Künstlerinnen zum Abendessen einladen sollst«, murrte Sheila.
»Halte mir jetzt bitte keine Strafpredigt«, meinte Carmel lachend, und Sheila mußte sich eingestehen, daß ihre Freundin vergnügter und besser aussah als die ganze letzte Zeit. Sie war beinahe wieder ganz die alte.
»In Ordnung, ich halte mich zurück. Laß mich mal sehen, was du aus deinen Schränken ausmusterst. Vielleicht könntest du das eine oder andere mir geben, anstatt es für wohltätige Zwecke zu spenden. Ich könnte schon etwas gebrauchen. Als Lehrer sind wir ziemlich unterbezahlt, wenn man bedenkt, daß wir tagtäglich unser Leben aufs Spiel setzen.«
»Wie geht’s Martin?«
»Ach, er kommt gut zurecht. Weißt du, er ist einfach toll, er beklagt sich nie. Bestimmt hat er die Nase voll, aber er beklagt sich nicht.« Martin war vor zwei Jahren im Zuge einer Unternehmensfusion entlassen worden. Man hatte ihm eine Abfindung gegeben. Mit seinen zweiundfünfzig Jahren hatte er zunächst gehofft, wieder Arbeit zu finden; dann nahm er sich vor, ein Buch zu schreiben. Alle glaubten, er schriebe tatsächlich eins, aber Sheila schenkte Carmel reinen Wein ein. Vor ihrer Freundin gab sie zu, daß Martin das Haus sauberhielt und einkaufen ging. Sie taten so, als freue es Sheila, daß sie wieder unterrichten konnte. Die wenigsten wußten, wie sie ihren Beruf haßte. Auch ihre Kinder hatten keine Ahnung, und nicht einmal Martin war sich darüber im klaren. Carmel ahnte etwas, aber sie war eine alte Freundin, und wenn sie etwas wußte, war es nicht schlimm. Besorgniserregend schien nur, was sie gelegentlich anstellte, zum Beispiel, daß sie diese Frau zu einer Dinnerparty einlud. War es denkbar, daß Carmels Nerven wieder nachließen? Sie sprach ganz vernünftig und wirkte gesund und munter. Aber auf solche Ideen kamen nur Verrückte.
»Du leistest ja gründliche Arbeit. Der ganze Schrank ist leer geräumt. Welcher Stapel soll zur Altkleidersammlung?«
»Ich weiß nicht, für mich sehen die Sachen alle gleich aus, wie Mäusekostüme, findest du nicht? Erinnerst du dich noch an die Theateraufführung, die wir vor Jahren besucht haben? Die Darsteller trugen Mäuse- und Rattenkostüme … genauso kommen mir die Kleider vor!«
»Carmel, das ist doch absurd! Deine Sachen sind doch toll. Hast du von diesen blauen Strickjacken zwei Stück?«
»Ich glaube, ich habe sogar drei. Wenn ich in ein Geschäft gehe, kann ich mich für nichts entscheiden, also nehme ich immer blaue Strickjacken und graue Röcke. Nimm dir von jedem eins.«
»Das meine ich ernst. Es ist vollkommen absurd.«
Carmel lächelte erfreut. Andere Leute sagten »Sei nicht albern«; Sheila dagegen nannte es absurd. Das klang doch viel netter.
»Und?« Martin wollte wissen, was los war.
»Ich glaube, alles ist in Ordnung. Es läßt sich schwer beurteilen.«
»Du meinst, die Einladung war ein Scherz?«
»Nein, es ist ihr ernst damit. Die Party steigt. Carmel will nur nicht darüber reden.«
»Dann stimmt etwas nicht.«
»Kann sein, aber sie wirkt völlig normal. Sie hat mir einen Rock und eine Strickjacke geschenkt.«
»Und deshalb wirkt sie schon normal?«
»Nein, du weißt schon, was ich meine. Sie hat über ganz gewöhnliche Dinge gesprochen, hat sich überhaupt nicht in irgendwelche Phantasien verstiegen …«
»Also hast du es ihr ausgeredet?« wollte Martin wissen.
»Das ging nicht. Sie wollte überhaupt nicht darüber diskutieren. Das habe ich dir doch gesagt.«
»Na großartig«, seufzte er. »Das hat uns gerade noch gefehlt. Du bist doch ihre Freundin, lieber Himmel.«
»Martin, ich hatte heute einen scheußlichen Tag, und er war nicht nur ein bißchen scheußlich, sondern von vorne bis hinten miserabel. Und jetzt will ich nicht mehr darüber reden. Ich habe mein Bestes getan und mit Carmel gesprochen, aber sie ist nicht darauf eingegangen. Könntest du mich bitte in Ruhe lassen!«
»Ja, ist schon klar, ich hätte dich vor dem Kaminfeuer mit einem Drink empfangen sollen, damit du deine Sorgen schnell vergißt … wie eine richtige Hausfrau. Tut mir leid, daß ich die Rolle nicht besser ausfülle. Du brauchst mir das nicht zu sagen.«
»Meine Güte, Martin, wenn du ausgerechnet heute darüber jammern willst, daß du nicht einmal deine Familie ernähren kannst, dann hast du den Zeitpunkt falsch gewählt. Hör bitte auf und setz dich. Ich liebe dich und lege keinen Wert darauf, daß du hier herumblödelst und mir schöntust, nur weil mein Laden noch nicht dichtgemacht wurde … verstehst du mich?«
Er wirkte zerknirscht.
»Tut mir wirklich leid. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, das ist alles.«
»Ich auch.«
»Glaubst du, sie weiß über Ruth Bescheid? Ob sie wohl etwas gehört hat …?«
»Wo sollte sie es gehört haben? Mit wem kommt sie schon zusammen? Sie geht doch kaum aus. Wenn sie es nicht im Radio gebracht haben, bei Gay Byrne, oder im Evening Press Diary, dann weiß sie bestimmt nichts.«
»Was sollen wir tun?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung.«
»Entschuldige, daß ich so spät komme«, rief David. »Der Verkehr war grauenhaft. Heutzutage ist es völlig unsinnig, Auto zu fahren, das habe ich schon immer gesagt.«
»Meine Rede! Und die Linie 10 hält praktisch vor deiner Haustür.«
»Den Bus kann ich nicht nehmen, man muß endlos warten, und wenn er kommt, ist er voll.«
»Wozu kauft man auch ein großes Auto, wenn man dann nicht damit angeben kann?«
»Was?«
»Nichts. Du sagtest, es tut dir leid, daß du so spät kommst. Also beeil dich ein bißchen, wenn du dich noch umziehen oder frisch machen willst …«
»Wozu?« David klang gereizt. »Großer Gott, das hatte ich vergessen. Müssen wir? Können wir nicht …?«
»Wir müssen. Wir können nicht anrufen und behaupten, wir seien verhindert. Schließlich haben wir schon vor zwei Wochen zugesagt.«
»Für dich ist das ja kein Problem.« Mißmutig stapfte David die Treppe hinauf. »Du hast den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als dich herauszuputzen.«
»Vielen Dank«, sagte Ethel kalt.
Sie setzte sich an den Frisiertisch im gemeinsamen Schlafzimmer. Die Tür zum Bad stand offen, und sein Blick fiel auf die dicken bunten Handtücher, die sich auf der Kommode stapelten. Bestimmt würde es ihm besser gehen, wenn er ein Bad nahm. Und seiner Frau die Schuld zu geben war wirklich unfair, das wußte er.
»Tut mir leid«, sagte er. Er trat an den Frisiertisch und küßte sie. Sie roch den Whiskey.
»Werden im Verkehrsstau jetzt schon Cocktails serviert?« bemerkte sie.
Er lachte. »Du bist mir auf die Schliche gekommen. Ich war noch auf einen Sprung im Club«, gab er mit reumütiger Miene zu.
»Und der liegt natürlich auf dem Heimweg.« Sie war immer noch nicht ganz aufgetaut.
»Nein, natürlich nicht, aber ich habe die untere Straße genommen. Verdammt, es waren nur zwei, die ich mir genehmigt habe. Aber rate mal, wen ich dort getroffen habe? Du kommst nie drauf, was passiert ist.«
Das machte sie neugierig. Es kam selten vor, daß er etwas Interessantes zu berichten hatte. Sonst mußte sie ihm alles aus der Nase ziehen, wenn sie wissen wollte, ob es irgend etwas Neues gab. Sie folgte ihm ins Badezimmer, wo er das Jackett ablegte und sich mit seinem Hemd abmühte.
»Ich habe Dermot getroffen, Dermot Murray.«
»Ach ja?« Jetzt war sie wirklich gespannt, und ihr Ärger war verflogen. »Was hat er gesagt?«
»Es ist erstaunlich, wirklich erstaunlich.«
»Ja? Was denn?«