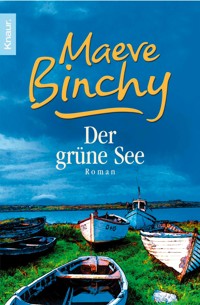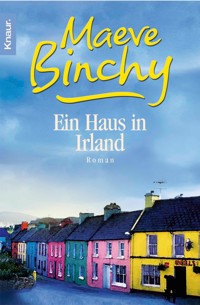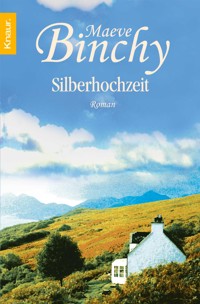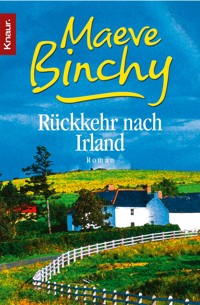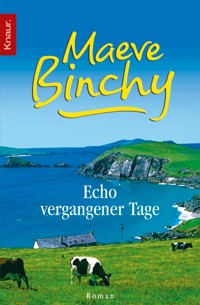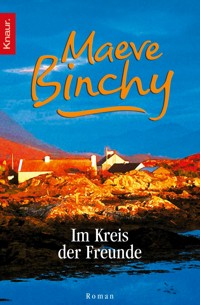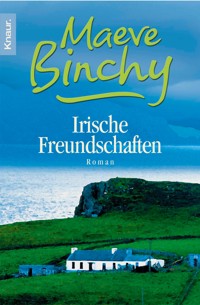
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während des Zweiten Weltkrieges wird das Londoner Mädchen Elizabeth von ihrer Mutter Violet nach Irland in die Familie der Eileen O'Connor geschickt. Zunächst ist für Elizabeth alles fremd: die irische Sprache, der Katholizismus, das aufbrausende Temperament der O'Connor-Familie. Doch dank Eileens mütterlichem Wesen und vor allem der Freundschaft der zehnjährigen Aisling fühlt sie sich bald in dem fremden Land heimisch. Über zwanzig Jahre hinweg verfolgt Maeve Binchy das Leben von Elizabeth und Aisling, ihre Erfahrungen mit den Männern und der Liebe, ihre Sorgen und ihr Leid. Immer wieder kreuzen sich ihre Wege; ihrer beider Leben bleibt für immer miteinander verbunden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1062
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Maeve Binchy
Irische Freundschaften
Roman
Aus dem Englischen von Christine Strüh und Ursula Wulfekamp, Kollektiv Druck-Reif
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Im Saal des Coroners herrschte eine sehr nüchterne und sachliche Atmosphäre. Keine erhöhten Sitze mit perückengeschmückten Richtern, keine Anklagebank, keine Polizisten in Uniform, die auf den Korridor traten und die Zeugen aufriefen. Eigentlich sah alles aus wie in einem ganz gewöhnlichen Büro; Bücher standen in Schränken mit Glastüren, der Boden war mit Linoleum ausgelegt, das an einer Ecke ganz eindeutig angenagt aussah. Draußen ging das Leben seinen gewohnten Gang. Busse fuhren vorbei, und niemand blieb neugierig stehen. Ein Mann im Taxi las die Zeitung und hob nicht einmal die Augen, als die kleine Gruppe aus dem Gebäude trat.
Die beiden Frauen waren schwarz gekleidet, aber bei formellen Anlässen war das nichts Ungewöhnliches. Aisling trug einen schwarzen Samtblazer über ihrem grauen Kleid, und diese Kombination ließ ihre kupferroten Haare noch leuchtender hervortreten als gewöhnlich. Elizabeth hatte ihren guten schwarzen Mantel angezogen, den sie vor zwei Jahren im Winterschlußverkauf zum halben Preis erstanden hatte. Die Verkäuferin hatte damals gesagt, der Mantel sei die einzige echte Okkasion im ganzen Laden. »Damit machen Sie bei jeder Gelegenheit eine gute Figur«, hatte sie gesagt, und das hatte Elizabeth überzeugt.
Zwar nahm der Rest der Welt keine Notiz von ihnen, doch die kleine Gruppe musterte die beiden Frauen einen Moment lang. Elizabeth beschattete mit der Hand die Augen und trat dann auf die Treppe, die zur Straße hinunterführte. Aisling wartete dort bereits. Sie sahen einander lange in die Augen – wahrscheinlich waren es nur ein paar Sekunden, aber das ist oft eine lange Zeit …
Erster Teil
1940–1945
Kapitel 1
Violet hatte das Buch aus der Bücherei ausgelesen und klappte es zu. Schon wieder war eine von Selbstzweifeln geplagte, flatterige, geistig völlig unbedarfte Heldin von einem starken Mann erobert worden. Er hatte ihren Protest mit Küssen erstickt, und seine ungestüme Leidenschaft hatte sich auf unterschiedliche, doch stets überzeugende Art und Weise Ausdruck verschafft … Er bereitete alles vor, daß sie zusammen durchbrennen konnten, er schmiedete die Heiratspläne und organisierte die Auswanderung nach Südamerika, wo er ein Gut besaß. Niemals brauchte die Heldin sich um derlei Dinge zu kümmern oder in den Reisebüros, am Fahrkartenschalter und beim Paßamt Schlange zu stehen. Violet dagegen mußte alles selbst erledigen. Gerade war sie nach Hause gekommen, nachdem sie den ganzen Morgen endlos in den Geschäften Schlange gestanden hatte, um trotz der allgemeinen Engpässe etwas zu ergattern. Anscheinend gab es Frauen, denen das Ganze sogar Spaß machte und die es als eine Art Spiel betrachteten. »Ich sag dir, wo es Brot gibt, wenn du mir sagst, woher du die Karotten hast.«
Auch in der Schule war Violet gewesen und hatte ein höchst unbefriedigendes Gespräch mit Miss James geführt. Miss James würde für ihre Klasse keine Evakuierung in die Wege leiten. Die Eltern ihrer Schüler hatten alle Freunde oder Verwandte auf dem Land, und es kam gar nicht in Frage, die ganze Klasse irgendwo auf ein Dorf zu verfrachten und den Unterricht dort fortzusetzen, wo sie vor den Bomben sicher waren und deftige Landkost bekamen. Ziemlich spitz meinte Miss James, sicher hätten auch Mr. und Mrs. White Freunde außerhalb von London. Auf einmal fragte sich Violet, ob sie überhaupt irgendwo Freunde hatten, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Sie ärgerte sich, daß Miss James sie praktisch dazu gezwungen hatte, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. George hatte Verwandte in Somerset, in der Nähe von Wells. Aber die hatten sie längst aus den Augen verloren. O ja, sie kannte die herzerfrischenden Geschichten von den lange getrennten Familien, die durch die Evakuierung der Kinder wieder zusammenfanden, aber irgendwie glaubte sie nicht daran, daß George so etwas passieren würde. Violet selbst hatte eigentlich überhaupt keine richtige Verwandtschaft. Ihr Vater und seine zweite Frau wohnten in Liverpool, aber die Fehde zwischen ihnen war so alt, daß es keine Hoffnung auf Versöhnung mehr gab. Dafür hätte man alte Wunden wieder öffnen, sie untersuchen und sich dann gegenseitig verzeihen müssen. Aber es war alles so lange her, daß sich keiner mehr so recht daran erinnerte, was passiert war. Wahrscheinlich war es besser, wenn das so blieb.
Elizabeth war so schüchtern, so wenig selbstsicher, daß eine Evakuierung bestimmt nicht einfach für sie sein würde. Offenbar hat sie die Unbeholfenheit ihres Vaters geerbt, dachte Violet bekümmert. Sie schien in jeder Situation grundsätzlich das Schlimmste zu erwarten. Tja, vielleicht war das besser, als sich wunder was zu erhoffen und dann enttäuscht zu werden. Möglicherweise waren George und Elizabeth ja sogar gut dran: Wenn man sich auf Niederlagen und Konflikte einstellte und darauf, daß man ohnehin immer nur die zweite Geige spielen würde, dann war es jedenfalls kein Schock, wenn sich die Befürchtungen bestätigten.
Mit George darüber zu sprechen hatte keinen Zweck. Für George gab es derzeit nur ein einziges Gesprächsthema: Was war das für ein Land, das einen Mann zum Militärdienst zuließ, der kein bißchen Hirn im Kopf hatte, aber einen Mann wie George, der im Krieg doch wirklich seinen Beitrag leisten könnte, ablehnte. Es war schlimm genug gewesen, mit ansehen zu müssen, wie all die wesentlich jüngeren, geistlosen Männer bei der Bank so gut vorankamen, wie sie befördert wurden, sich sogar Autos kaufen konnten – das hatte George zutiefst verbittert. Aber jetzt, da das Land bedroht und die Nation in Gefahr war, hatte man George gesagt, daß gewisse Dienste für das Vaterland lebenswichtig seien – unter anderem das Bankwesen.
Bei der Musterung hatte man keine ernste Erkrankung bei ihm festgestellt, lediglich eine Reihe kleinerer Beschwerden. George hatte Plattfüße, ein Pfeifen in der Lunge, Schwierigkeiten mit den Nebenhöhlen, Krampfadern, und auf einem Ohr hörte er schlecht. Seine Bereitschaft, sein Leben für das Vaterland zu opfern, wurde mit einer Reihe von Beleidigungen quittiert.
Von Zeit zu Zeit fühlte Violet ein altes, vertrautes Gefühl der Zuneigung für George in sich aufsteigen, und sie konnte seine Empörung nachvollziehen. Aber meistens dachte sie, daß er sich eine Menge der Probleme selbst zuzuschreiben hatte. Nicht die Taubheit, nicht die Krampfadern, aber die Zurückweisung und die Enttäuschung – die beschwor er irgendwie selbst herauf.
Die Frage, was man mit Elizabeth machen sollte, würde also Violet lösen müssen, und zwar ganz allein. Genauso wie die meisten anderen Probleme.
Violet stand auf und betrachtete ihr Gesicht im Spiegel. Ein durchaus vorzeigbares Gesicht. Nach dem zu urteilen, was in den Modezeitschriften stand, hatte sie einen hübschen Teint; außerdem waren ihre Haare blond – naturblond. Violet hatte schon immer eine gute Figur gehabt, und lange bevor man aus Patriotismus und wegen dieses gräßlichen Kriegs den Gürtel enger schnallen mußte, hatte Violet auf ihre schlanke Linie geachtet. Warum strahlte ihr Gesicht dann nicht? Ihm fehlte etwas, es war einfach nicht richtig lebendig. Irgendwie sah es fad aus.
Kein Wunder, wenn ich fad aussehe, dachte Violet wütend. Jedes Gesicht würde fad aussehen, wenn die dazugehörige Person so wenig Glück im Leben gehabt hatte. Der Mann, der ihr erzählt hatte, ihre Augenfarbe entspreche genau ihrem schönen Namen, hatte sich als Hochstapler entpuppt – er hatte alle möglichen Leute hereingelegt. Der Kerl, der ihr eingeredet hatte, sie solle Sängerin werden, hatte nur gemeint, sie solle ihm im Badezimmer etwas vorsingen, während er ihr Sekt einschenkte. Der ehrgeizige junge Bankangestellte, der ihr vorgeschwärmt hatte, wie sie zusammen unaufhaltsam in der Londoner Gesellschaft aufsteigen würden, bis jeder Violets Namen kannte und ihren berühmten Ehemann und sein Glück beneidete, dieser Bankangestellte hockte momentan mit seinen Plattfüßen und seinen Krampfadern in der kleinen Bankfiliale, stocherte in den Zähnen und erfand Ausreden – und würde garantiert bis zu seinem Lebensende dort bleiben.
Alles war ganz anders gekommen und so furchtbar langweilig geworden. So ungerecht, so fad. Natürlich hatte sich ihr Gesicht diesen Bedingungen irgendwann angepaßt.
Violet blickte auf ihr Buch aus der Stadtbücherei. Unter dem durchsichtigen Schutzumschlag lehnte ein Mann, die Reitgerte in der Hand, an einem knorrigen alten Apfelbaum. Manchmal überlegte sie sich, ob Leute, die solche Romane verfaßten, nicht strafrechtlich verfolgt werden sollten.
Auf dem Heimweg von der Schule ließ Elizabeth sich Zeit. Ihre Mutter sei dagewesen, um ein paar Dinge zu besprechen, hatte Miss James gesagt. Sie solle nicht so ängstlich dreinschauen, kein Grund zur Besorgnis. Nein, wirklich nicht, hatte Miss James immer wieder versichert, Elizabeths Mutter und sie hatten nur darüber beraten, was mit Elizabeth passieren sollte, wenn die anderen Kinder aufs Land gingen, in stille Dörfer am Meer oder auf Bauernhöfe. Aber Elizabeth ließ sich nicht davon täuschen, wie Miss James die Zukunft ausmalte. Sie wußte, daß ihnen etwas Gräßliches bevorstand, etwas, von dem Eltern voll Schrecken sprachen … beinahe, als wäre es eine Art Folter. Zwar versuchten sie immer, es herunterzuspielen, aber das half nichts. Zuerst hatte Elizabeth gedacht, es handle sich um eine »Vakzinierung« – ein unbekanntes Wort mit bedrohlichen Assoziationen. Vater hatte gelacht und sie in den Arm genommen, und sogar Mutter hatte gelächelt. Nein, erklärten sie ihr, das Wort hieß »Evakuierung« und bedeutete, daß die Kinder aufs Land geschickt wurden, damit sie, falls Bomben auf die Stadt fielen, nicht verletzt wurden. Aber warum kamen die Eltern dann nicht mit aufs Land, wollte Elizabeth wissen. Vater antwortete, er müsse in der Bank bleiben und arbeiten, worauf Mutter die Nase rümpfte, und plötzlich war das freundliche Lächeln über Elizabeths Unwissenheit verschwunden, und die gute Laune war verflogen. Vater meinte, Mutter könne ruhig mit aufs Land kommen, denn sie habe ja keine Arbeit. Mutter erwiderte spitz, wenn sie eine Arbeit hätte, wäre sie jedenfalls bestimmt nicht fünfzehn Jahre lang auf der untersten Stufe hocken geblieben.
Unter dem Vorwand, sie müsse dringend ihre Hausaufgaben machen, ergriff Elizabeth die Flucht. Aber dann holte sie nur ihre alte Puppe hervor und trennte sie auf, Stich für Stich, und dabei weinte sie und überlegte krampfhaft, was sie tun könne, damit ihre Eltern ein bißchen mehr lächelten, und zerbrach sich den Kopf, was sie angerichtet hatte, daß die beiden dauernd so gereizt waren.
Aber heute lag ihr etwas anderes auf der Seele. Vielleicht hatten sich ihre Mutter und Miss James gestritten? Mutter fand Miss James ohnehin albern, weil sie ihre Schülerinnen Kindergartenlieder singen ließ – mehrstimmig. »Da stehen diese großen, zehnjährigen Mädchen und müssen irgendwelche lächerlichen Liedchen trällern«, hatte sie gesagt, und Miss James hatte es ihr freundlich erklärt. Aber danach machte das Singen irgendwie keinen rechten Spaß mehr.
Elizabeth fand es ausgesprochen schwierig einzuschätzen, wann ihre Mutter guter Laune sein würde. Manchmal war sie tagelang guter Laune, wie damals, als sie mit Elizabeth in die Music Hall ging und dort einem alten Freund begegnete, der ihr sagte, sie hätte früher viel besser gesungen als alle, die jetzt in London auf der Bühne standen. Vater war ein wenig verstimmt, aber da Mutter so fröhlich war und sogar vorschlug, man könne im Laden um die Ecke Fish and Chips essen, besserte sich schließlich auch seine Stimmung. Normalerweise schlug Mutter so etwas Gewöhnliches nicht vor. Wenn es zu Hause Fisch gab, waren das immer kleine Stückchen voller Gräten, und man aß ihn mit diesen komischen Messern, die eigentlich gar keine waren. Mutter liebte diese Messer. Sie waren ein Hochzeitsgeschenk, und sie ermahnte jeden, beim Abwaschen die Griffe nicht ins Wasser zu tauchen. Elizabeth schmeckte der Fisch nicht, den ihre Mutter zubereitete, mit den ganzen Gräten und den hartgekochten Eierstückchen und der Petersilie obendrauf, aber sie freute sich trotzdem, weil die Messer ihre Mutter immer so fröhlich machten.
Und manchmal, wenn Elizabeth von der Schule kam, dann sang Mutter; das war immer ein besonders gutes Zeichen. Gelegentlich setzte sie sich an Elizabeths Bett, streichelte ihre feinen, blonden Haare und erzählte ihr von ihrer Kindheit und von den Büchern, die sie gelesen hatte – über tapfere Männer, die einer schönen Frau zuliebe Heldentaten vollbrachten. Manchmal erzählte sie Elizabeth auch lustige Anekdoten über die Nonnen in der Klosterschule, wo alle streng katholisch gewesen waren und an die seltsamsten Dinge geglaubt hatten. Aber Mama durfte während des Religionsunterrichts immer spazierengehen, weil dort wirklich alles sehr eigenartig war.
Das Schlimme an der Sache war nur, daß man nie genau wußte, an welchen Tagen Mutter gute Laune haben würde und an welchen nicht.
Heute schrieb sie gerade einen Brief, was eher ungewöhnlich war. Elizabeth dachte sofort, daß es sicher ein Beschwerdebrief war; und sie betete zu Gott, daß es nicht um Miss James gehen würde. Ängstlich kam sie näher.
»Bist du beschäftigt, Mutter?« fragte sie.
»Mhm«, antwortete Mutter.
Elizabeth blieb stehen, ein dünnes, kleines, zehnjähriges Mädchen, die kurzen, hellen – fast weißen – Haare mit einem Haarband aus der Stirn gehalten. Wenn sie aufgeregt war – wie jetzt –, rutschten immer ein paar Strähnen heraus und standen stachelig ab. Ihr Gesicht war rot und weiß gleichzeitig: Der Bereich um Augen und Nase aschfahl, während sich das Rot von den Wangenknochen aus wie ein Schatten ausbreitete.
»Oh«, sagte Elizabeth nur.
»Ich werde dich zu Eileen schicken.«
Eileen war für Elizabeth lediglich ein Name auf einer Weihnachtskarte, ein Name, bei dem sie an das kleine, billige Spielzeug dachte, das an ihrem Geburtstag eintraf. Letztes Jahr hatte Mutter gesagt, sie wünschte, Eileen würde aufhören, Geburtstagsgeschenke zu verschicken, es sei doch albern, damit weiterzumachen, und von ihr könne man doch wirklich nicht erwarten, daß sie all die Geburtstage von Eileens zahlreicher Kinderschar im Kopf habe.
»Ich glaube, das ist die einzige Lösung.«
Tränen stiegen Elizabeth in die Augen. Wäre ihr nur etwas eingefallen, was sie tun konnte, um bleiben zu dürfen! Sie wünschte sich so, zu den Kindern zu gehören, die nicht weggeschickt wurden – oder deren Eltern wenigstens mitkamen.
»Kommst du mit?« Elizabeth starrte auf den Teppich.
»Um Himmels willen, nein.«
»Ich habe nur gehofft.«
»Elizabeth, sei nicht albern. Ich kann unmöglich mit dir zu Eileen, zu den O’Connors … Schätzchen, sie wohnen in Irland. Wer geht schon freiwillig nach Irland, Elizabeth? Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage.«
Donnerstags war immer viel los, weil die Bauern zum Markt in die Stadt kamen und mit ihren Einkaufslisten im Laden erschienen. Sean hatte einen Jungen namens Jemmy eingestellt, der zwar »nicht ganz dicht« war, ihm aber helfen konnte, die Waren vom Hof hereinzuschleppen. Weil es donnerstags so voll war, wollte er nicht, daß auch noch die Kinder im Laden herumwimmelten, und das hatte er ihnen schon hundertmal erklärt. Mit seiner staubigen Hand wischte er sich verärgert über die Stirn, als er sah, wie sich Aisling und Eamonn trotz Peggys heftigen Ermahnungen von ihr losrissen und in den Laden stürmten.
»Wo ist Mammy, Dad, wo ist Mammy?« schrie Aisling.
»Wo ist Mammy, wo ist Mammy?« wiederholte Eamonn.
Peggy rannte kichernd hinterher und war mindestens genauso lästig wie die beiden Kinder.
»Wollt ihr wohl herkommen, ihr Satansbraten«, lachte sie. »Ich schlag’ dir den Hintern grün und blau, wenn ich dich erwische, Aisling. Dein Vater hat dir schon tausendmal gesagt, daß er euch einsperrt, wenn ihr euch an einem Donnerstag hier blicken laßt.«
Die Bauern, vielbeschäftigte Männer, die es haßten, bei den Verkaufsgesprächen und Verhandlungen über ihr Vieh unterbrochen zu werden, lachten über die kleine Extradarbietung. Peggy – mit aus dem Knoten gerutschten Haarsträhnen und einer Schürze, der man mindestens die letzten zwanzig Mahlzeiten ansah, die sie serviert hatte – liebte das Aufsehen, das sie verursachte. Hilflos sah Sean ihr nach, wie sie hin und her flitzte und das Ganze noch mehr zum Spiel machte als die Kinder. Sie zwinkerte den Bauern zu, und ihre Blicke waren unmißverständlich: Wenn der Markt vorbei ist und ihr euch in den Pubs Mut angetrunken habt, könnt ihr gern zu mir kommen. Mit offenem Mund verfolgte Jemmy die Szene und umklammerte dabei die Bretter, die er eigentlich auf den Anhänger laden sollte. »Scher dich raus mit deinen blöden Brettern und mach, daß du wieder reinkommst«, röhrte Sean. »Also, Michael, kümmere dich nicht um das Gekasper, die Rasselbande nehme ich mir später vor. Wieviel brauchst du für den Verputz? Machst du alle Nebengebäude auf einmal? Nein, natürlich nicht, das wäre ja viel zuviel.«
Eileen hatte den Aufruhr mitbekommen, und eilig ging sie aus ihrem kleinen Büro in den Laden hinunter. Mit der Mahagoni-Umrandung und den Fenstern rundum sah ihr Büro aus wie eine Art Kanzel, hatte Sean junior einmal festgestellt. Eigentlich sollte Eileen von hier den Leuten im Laden eine Predigt halten und nicht Bücher führen und Rechnungen ausstellen. Aber wenn sie sich nicht mit der Buchhaltung beschäftigte, dann würde es bald keinen Laden mehr geben, kein Haus und keinen Luxus wie Peggy und Jemmy, die jeden Donnerstag ein paar Shilling bekamen – was ihm in seiner Familie wieder ein gewisses Ansehen verlieh.
Mit grimmig-entschlossenem Gesicht schritt Eileen zu den aufgeregten Kindern und der erhitzten Peggy, packte die Kinder an einer sehr empfindlichen Stelle direkt unter der Schulter und führte sie mit festem Griff aus dem Laden. Nach einem einzigen Blick ihrer Herrin war es auch vorbei mit Peggys Elan, und sie folgte den dreien mit niedergeschlagenen Augen. Sean seufzte tief und erleichtert auf und machte sich wieder an die Arbeit, von der er etwas verstand.
Im Obergeschoß des Hauses stellte Eileen die lautstark protestierenden Kinder unerbittlich zur Rede.
»Stell bitte Teewasser auf, Peggy«, sagte sie kühl.
»Aber Mammy, wir wollten dir doch nur den Brief zeigen.«
»Da ist ein Bild von einem Mann drauf.«
»Er ist mit der Nachmittagspost gekommen …«
»Und Johnny hat gesagt, er ist aus England …«
»Und daß der Mann der König von England ist …«
Eileen achtete nicht auf ihre Worte. Sie ließ die beiden auf zwei Eßzimmerstühlen Platz nehmen und setzte sich ihnen gegenüber.
»Ich habe euch schon hunderttausendmal gesagt, daß euch euer Vater am Donnerstag, am Markttag, nicht im Laden sehen will, kein Zipfelchen von euch – und ich auch nicht. Er wartet jetzt auf mich, daß ich zurückkomme und die Rechnungen erledige und für die Bauern die Bücher ausfülle. Wißt ihr denn überhaupt nicht, was es heißt zu gehorchen? Aisling – ein großes, zehnjähriges Mädchen? Hörst du mir zu?«
Aber Aisling hatte nicht aufgepaßt. Sie wollte nur, daß ihre Mutter endlich den Brief öffnete, denn das, was der Briefträger gesagt hatte, hatte sich in ihrem Kopf zu der vagen Idee verdichtet, er sei vom englischen König persönlich.
»Aisling, jetzt hör endlich zu!« schrie Eileen, und als sie merkte, daß sie damit nichts ausrichtete, versetzte sie beiden Kindern einen klatschenden Schlag auf die nackten Beine. Aisling und Eamonn begannen zu heulen; dieses Geräusch weckte Niamh, deren Bettchen in der Ecke des Wohnzimmers stand, und sie fing ebenfalls an zu weinen.
»Ich wollte dir nur den Brief geben«, jammerte Aisling. »Ich hasse dich, ich hasse dich.«
»Ich hasse dich auch«, echote Eamonn.
Eileen marschierte zur Tür. »Dann bleibt ihr eben hier sitzen und haßt mich.« Sie versuchte, die Stimme zu dämpfen, denn sie wußte, daß der kleine Donal in seinem Bett saß und jedes Wort mitbekam. Sobald sie an sein Gesicht dachte, wurde ihr warm ums Herz, und sie beschloß, nach oben zu laufen und kurz nach ihm zu sehen. Wenn sie zu ihm hineinging und ein paar freundliche Worte sagte, lächelte er sie gewiß an und vertiefte sich dann wieder in sein Buch. Sonst würde er nachher, wenn sie wieder hinüber zum Laden ging, wieder ängstlich das Gesicht ans Fenster pressen und ihr nachschauen. Leise streckte sie den Kopf durch die Tür, obwohl sie genau wußte, daß er wach war.
»Du sollst versuchen zu schlafen, mein Herz, das weißt du doch.«
»Warum habt ihr so geschrien?« fragte Donal.
»Weil deine beiden ungezogenen Geschwister im Laden Remmidemmi gemacht haben, obwohl Donnerstag ist, deshalb«, erwiderte Eileen und zupfte die Bettdecke zurecht.
»Haben sie sich dafür entschuldigt?« erkundigte er sich, in der Hoffnung auf eine tröstliche Antwort.
»Nein, das haben sie nicht – noch nicht«, antwortete Eileen.
»Und was passiert jetzt mit ihnen?«
»Nichts allzu Schlimmes«, meinte sie und gab ihm einen Kuß.
Sie ging ins Wohnzimmer zurück. Aisling und Eamonn waren immer noch aufsässig.
»Peggy hat uns zum Tee gerufen, aber wir gehen nicht«, verkündete Aisling.
»Wie ihr wollt. Meinetwegen könnt ihr hier sitzenbleiben, so lange ihr möchtet. Denn nachdem ihr derartig ungezogen wart, bekommt ihr beide heute abend sowieso keine Limonade.«
Die Kinderaugen weiteten sich ungläubig und enttäuscht. Jeden Donnerstag, wenn das Bestellbuch voll war und die Kasse beinahe überlief, ging Sean O’Connor mit seiner Frau und den Kindern zu Maher’s Pub, wo es ausgesprochen gemütlich war. Dort gab es keine Bauern mit verdreckten Stiefeln, die unbedingt noch einen Handel abschließen wollten. Maher’s war Textilgeschäft und Kneipe in einem, und Eileen sah sich gern mit Mrs. Maher die neuen Jacken oder die großen Schachteln mit den Pullovern an. Sean junior und Maureen saßen immer auf den hohen Stühlen, lasen die Anschläge, die hinter der Bar hingen, und fühlten sich wie Erwachsene; Aisling und Eamonn liebten das Prickeln, wenn die sprudelige rote Limonade ihnen in die Nase stieg, und freuten sich, wenn Mrs. Maher ihnen einen Keks mit Zuckerguß schenkte, worauf ihr Vater jedesmal meinte, sie seien verwöhnt. Außerdem hatte die Katze der Mahers gerade Junge bekommen. Letzten Donnerstag waren die Augen der Kätzchen noch nicht aufgewesen, und diese Woche würde man zum erstenmal mit ihnen spielen können.
Und das alles war jetzt plötzlich gestrichen!
»Bitte, Mammy, bitte, ich werde brav sein, ich werde ganz brav sein …«
»Ich dachte, du haßt mich?«
»Eigentlich nicht«, beteuerte Eamonn hoffnungsvoll.
»Ich meine, das geht doch gar nicht, daß man seine Mutter haßt«, fügte Aisling hinzu.
»Das habe ich mir eigentlich auch gedacht«, sagte Eileen. »Deshalb war ich so erstaunt, daß ihr beide es vergessen hattet, genau wie das Ladenverbot …« Sie lenkte ein. Donnerstagabend war das einzige Mal, daß Sean sich richtig entspannte; diese Stunde bei Maher’s, wenn die Kinder frisch gewaschen und adrett mit Katzen oder Kaninchen oder Vögeln in Käfigen spielten. Eileen nahm den Brief und ging in die Küche.
»Ich hab’ den Tee schon aufgebrüht«, versicherte Peggy nervös.
»Bitte schenk mir eine große Tasse voll ein. Und sieh zu, daß die Kinder im Wohnzimmer bleiben – und kümmere dich um das Baby.« Im nächsten Moment hatte Eileen ihre Teetasse in der Hand und war unterwegs zum Laden, den Brief in der Tasche. Erst nach einer Stunde fand sie die Zeit, ihn zu öffnen.
Am Abend bei Maher’s gab sie Sean den Brief zum Lesen.
»Meine Augen sind so müde, daß ich kaum was sehen kann«, meinte er. »Auf alle Fälle erinnert mich die Handschrift an eine Spinne, die halb betrunken aus einem Tintenfaß krabbelt.«
»Das ist Kursivschrift, du Dummkopf, das haben uns die Nonnen in St. Mark beigebracht. Violet kann sie noch, ich nicht, das ist alles.«
»Diese Violet braucht eben sonst nicht viel zu können«, sagte Sean. »Sie führt ein bequemes Leben da drüben.«
»Seit dem Krieg nicht mehr«, entgegnete Eileen.
»Nein«, stimmte Sean zu, die Nase im Bierglas. »Nein. Ist ihr Mann draußen an der Front im Schützengraben? Wahrscheinlich als Offizier oder so – wo er doch Bankangestellter ist. Wenn ein Mann den richtigen Akzent hat, kriegt er auch einen guten Job und wird Offizier.«
»Nein, George ist nicht beim Militär, ihm fehlt irgendwas. Ich weiß nicht genau, was, aber er war aus medizinischen Gründen untauglich.«
»Vermutlich war es zu gemütlich bei der Bank, da wollte er nicht weg«, meinte Sean.
»Sean, es geht um das kleine Mädchen, um Violets Tochter Elizabeth. Man schickt die Kinder aus London weg, für den Fall, daß die Stadt bombardiert wird … du weißt doch, das stand schon in der Zeitung. Violet möchte wissen, ob wir möglicherweise bereit wären, Elizabeth bei uns aufzunehmen.«
»Aber … daß sie ihre Kinder nach Irland evakuieren wollen … das ist schließlich unser Land. Sie können uns nicht in ihren elenden Krieg hineinziehen, indem sie uns ihre Kinder und ihre alten Leute schicken. Haben sie nicht schon genug Schaden angerichtet?«
»Sean, jetzt hör mir mal zu«, fauchte Eileen. »Violet möchte nur wissen, ob wir ihre Tochter für ein paar Monate aufnehmen können. Man will die kleine Schule schließen, auf die sie geht, weil alle Kinder evakuiert werden. George hat Verwandte und Violet auch, aber sie … sie fragen, ob ihre Tochter hierherkommen kann. Was meinst du dazu?«
»Ich finde das ganz schön dreist und unverschämt – typisch für das britische Empire. Solange nichts für sie dabei rausspringt, kümmern sie sich nicht um uns, wollen nichts mit uns zu tun haben, schreiben keine Briefe, höchstens mal mit Ach und Krach eine Weihnachtskarte. Aber jetzt, wo sie in diesem blöden Krieg stecken, kommen sie plötzlich angeschwänzelt. Das ist meine Meinung.«
»Violet ist nicht das britische Empire, sie ist meine Schulfreundin. Sie hat noch nie gern Briefe geschrieben, und auch der hier ist holprig und … ich weiß auch nicht, voller Klammern und Gänsefüßchen. Sie ist es nicht gewöhnt, Leuten Briefe zu schreiben – geschweige denn zwanzig, dreißig Briefe am Tag wie ich. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, ob wir das Mädchen bei uns aufnehmen.«
»Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, daß sie die Unverschämtheit besitzt zu fragen.«
»Soll ich dann nein sagen? Soll ich ihr heute abend schreiben, tut mir leid, es geht nicht? Und aus welchem Grund? Weil Sean sagt, das britische Empire ist unverschämt? Meinst du, das genügt?«
»Werd doch nicht gleich so wütend …«
»Ich bin nicht wütend. Aber mein Tag war genauso anstrengend wie deiner. Also, natürlich finde ich auch, daß Violet reichlich unverfroren ist. Natürlich verletzt es mich, daß sie keine Zeit für mich übrig hat und nur schreibt, wenn sie etwas von mir will. Das ist doch klar. Die Frage ist aber, ob wir das Kind aufnehmen oder nicht. Sie ist in Aislings Alter, sie hat Deutschland nicht den Krieg erklärt, sie ist nicht in Irland einmarschiert und hat auch nicht De Valera[1] angegriffen oder sonstwas … Sie ist erst zehn Jahre alt, und wahrscheinlich liegt sie nachts im Bett und fragt sich, ob vielleicht eine Bombe auf ihr Haus fällt und sie in Stücke reißt. Also, nehmen wir sie auf oder nicht?«
Sean blickte seine Frau überrascht an. Gewöhnlich hielt Eileen keine langen Reden. Und was noch ungewöhnlicher war: Sie gab zu, daß das Verhalten ihrer lieben Freundin aus der Schulzeit sie verletzte und beleidigte.
»Meinst du, sie wird dir viel Mühe machen?« fragte er.
»Nein. Vielleicht freundet sie sich sogar mit Aisling an. Und ein Kind mehr wird uns auch nicht arm essen.«
Sean bestellte sich noch ein weiteres Bier, einen Portwein für Eileen und noch eine Limonade für die Kinder. Er betrachtete Eileen, wie sie ihm adrett gekleidet in ihrer weißen Bluse mit der Brosche am Hals gegenübersaß, die rotbraunen Haare an den Seiten mit zwei Kämmen zurückgesteckt. Eine schöne Frau, dachte er, und eine starke, zuverlässige Partnerin in jeder Lebenslage. Nur wenige Leute, die sie in ihrem dunkelblauen Bürokittel zu Gesicht bekamen, wie sie sich mit der finanziellen Seite des florierenden Geschäfts befaßte, ahnten, was für ein Mensch sich unter dieser Oberfläche verbarg. Eine leidenschaftliche Ehefrau – Sean hatte immer gestaunt, daß sie so temperamentvoll reagierte, wenn er sich ihr zuwandte – und eine liebende Mutter. Voll Zuneigung sah er sie an. In ihrem großen Herz war Platz für noch mehr Kinder, als sie schon hatte.
»Laß sie kommen. Das ist ja wohl das mindeste, was wir tun können – ein Kind vor dem Irrsinn da drüben zu schützen«, erklärte er. Und Eileen streichelte seinen Arm – ein Ausdruck ihrer Zuneigung, die sie in der Öffentlichkeit selten zur Schau stellte.
Eileens Brief kam so schnell, daß Violet überzeugt war, er enthalte eine Absage. Ihrer Erfahrung nach schrieben Leute, die Ausreden suchten und ihr Verhalten rechtfertigen wollten, immer sehr rasch und sehr ausführlich. Mit einem tiefen Seufzer hob sie das Schreiben von der Fußmatte auf.
»Tja, dann müssen wir wohl doch die Verwandtschaft deines Vaters ausfindig machen«, meinte sie resigniert, als sie mit dem Brief zurück an den Frühstückstisch kam.
»Heißt das, daß sie nein sagt …? Vielleicht steht doch ja drin …« begann Elizabeth.
»Sprich nicht mit vollem Mund. Heb deine Serviette auf und versuch wenigstens, dich anständig zu benehmen, Elizabeth, bitte«, sagte Violet mechanisch, während sie den Umschlag mit dem Brieföffner aufschlitzte. George war schon zur Arbeit gegangen, und die beiden saßen allein am Tisch. Violet glaubte fest daran, daß man unaufhaltsam in die Katastrophe steuerte, wenn man es mit den guten Manieren nicht so genau nahm, deshalb wurde auch der Toast – ohne Kruste! – in einem kleinen chinesischen Toastständer serviert, und alle drei Familienmitglieder hatten ihren Serviettenring, in den die zusammengefaltete Serviette nach jeder Mahlzeit zurückgesteckt werden mußte. Elizabeth platzte fast vor Ungeduld; sie konnte es nicht erwarten, daß Violet ihr endlich die entscheidende Nachricht mitteilte. Mutter machte einen ganz kribbelig – wie sie ab und zu einen Satz laut vorlas und dann wieder unverständlich vor sich hin murmelte.
»Meine liebe Violet … habe mich sehr gefreut, von Dir zu hören … ähmmm … ähmmm … viele Leute hier sind der Meinung, daß auch wir an dem Krieg teilnehmen sollten … wir tun, was wir können … die Kinder sind begeistert und gespannt …«
Elizabeth wußte, daß ihr nichts anderes übrigblieb, als zu warten. Vor lauter Aufregung knüllte sie ihre Serviette zu einem winzigen Ball zusammen. Eigentlich wußte sie nicht mal, ob sie wirklich hören wollte, was in dem Brief stand: Es wäre eine große Erleichterung, wenn sie nicht übers Meer in ein anderes Land reisen mußte, an einen Ort, den ihr Vater offensichtlich für mindestens so gefährlich hielt wie London und von dem ihre Mutter abschätzig meinte, man könne es wirklich nur im allerhöchsten Notfall dort aushalten. Elizabeth wollte nicht in einem ekelhaften verwahrlosten Nest mit Dutzenden von Kindern leben müssen, in einer Stadt voll Tiermist und Besoffener. So hatte ihre Mutter Kilgarret nämlich beschrieben. Elizabeth wollte nicht irgendwo wohnen, wo es schmutzig war, an einem Ort, den ihre Mutter unzumutbar fand. Andererseits hatte Mutter selbst gesagt, dort wäre Elizabeth am besten aufgehoben. Vielleicht hatte sich ja alles verändert, seit ihre Mutter das letztemal dort war – schließlich war das Jahre her, lange bevor sie Vater geheiratet hatte. Sie wollte nie wieder dorthin – und sie konnte sich gar nicht vorstellen, wie Eileen das alles aushielt.
Aber offenbar gab es nur zwei Möglichkeiten: dieser schmutzige, gefährliche Ort oder aber weitere Schwierigkeiten und noch mehr Aufregung bei der Suche nach Vaters Verwandten.
Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis Violet die beiden Briefbögen bewältigt hatte. Dann sah sie endlich auf.
»Sie nehmen dich.«
Elizabeths Gesicht nahm seine puterrot-weiße Färbung an – sehr zum Ärger Violets. Sie konnte es nicht leiden, wenn Elizabeth wegen irgendwelcher Lappalien so in Aufregung geriet.
»Wann soll ich fahren?«
»Wann es uns paßt. Natürlich brauchen wir ein bißchen Zeit. Wir müssen packen, und ich muß Eileen wegen der Schulbücher schreiben … was du brauchst und so. In ihrem Brief schreibt sie groß und breit, daß du ihnen willkommen bist, aber auf das Praktische geht sie kaum ein – was du mitbringen sollst und was du brauchen wirst. Oh, und hier ist auch ein Briefchen für dich …«
Elizabeth nahm das Blatt an sich. Es war der erste Brief, den sie je bekommen hatte. Sie las ihn ganz langsam, um ihn richtig auszukosten.
Liebe Elizabeth,
wir finden es alle sehr schön, daß Deine Mama Dich eine Weile an uns ausleiht, und wir hoffen, daß es Dir hier gefallen wird. Kilgarret ist ganz anders als London, aber alle freuen sich schon auf Dich, und wir wollen, daß Du Dich hier wie zu Hause fühlst. Du kannst mit Aisling in einem Zimmer schlafen; sie ist genauso alt wie Du, nur mit einer Woche Unterschied. Da hoffen wir, daß Ihr gute Freundinnen wendet! Schwester Mary von der Schule sagt, wahrscheinlich weißt Du schon mehr als ihre ganze Klasse zusammen. Bring so viele Spielsachen und Puppen und Bücher mit, wie Du willst, wir haben hier jede Menge Platz, und wir zählen schon die Tage, bis Du kommst.
Deine Tante Eileen
Unten auf der Seite waren Linien gezogen, damit man gerade schreiben konnte, und dort stand:
Liebe Elizabeth,
ich habe die ganzen Regale auf der linken Seite für Dich freigemacht und den halben Kleiderschrank und die halbe Frisierkommode. Sieh zu, daß Du rechtzeitig zu Eamonns Geburtstag kommst, da gibt es nämlich eine Party. Die Kätzchen bei den Mahers sind süß, sie haben jetzt die Augen auf. Mammy holt eine, die gehört dann uns beiden.
Liebe Grüße, Aisling
»Wir kriegen ein Kätzchen«, sagte Elizabeth mit leuchtenden Augen.
»Aber kein Wort über das Schulgeld, über die Uniform, nichts«, erwiderte Violet.
Donals Husten wurde schlimmer, aber Doktor Lynch sagte, es bestehe kein Grund zur Sorge. Man solle darauf achten, daß er es warm hatte und keinen Zug bekam, aber trotzdem für viel frische Luft sorgen. Wie um alles in der Welt sollte man das wohl anstellen, überlegte Eileen. Donal wurde die Aufregung um das englische Mädchen beinahe zuviel.
»Wann kommt sie denn?« fragte er ein dutzendmal am Tag.
»Sie wird aber meine Freundin, nicht deine«, sagte Aisling.
»Mam sagt, sie ist die Freundin von allen«, protestierte er mit finsterem Gesicht.
»Ja, schon, aber vor allem meine. Immerhin hat sie auch mir geschrieben«, beharrte Aisling. Und das war unbestreitbar: Aisling hatte einen Brief bekommen, den sie mehrmals vorlas. Er war sehr förmlich – der erste richtige Brief, den Elizabeth je geschrieben hatte. Wendungen wie »zu Dank verpflichtet« und »ich weiß das zu schätzen« kamen darin vor.
»Da drüben haben sie anscheinend ein besseres Bildungssystem als hier«, lautete Eileens Kommentar, als sie den Brief gelesen hatte.
»Wen wundert das? Schließlich haben sie ja genügend Geld – das sie mit der Arbeit anderer Leute verdient haben«, meinte Sean. Das war beim Mittagessen am Samstag. Sean aß Speck und Weißkohl. Am Samstag schloß der Laden schon um halb zwei, und den Nachmittag über bereitete Sean hinten im Hof die Bestellungen vor. Aber wenigstens konnte er sich seine Zeit selbst einteilen und mußte nicht dauernd in den Laden rennen, wenn das Glöckchen über der Tür zu bimmeln begann.
»Also, ich hoffe, daß du dich mit solchen Bemerkungen zurückhältst, wenn das Kind erst mal bei uns ist«, sagte Eileen. »Es ist schon schlimm genug für sie, daß sie in einem fremden Land leben muß, da brauchst du nicht auch noch über sie herzuziehen.«
»Außerdem stimmt es nicht mal, Dad«, warf Sean junior ein.
»Es stimmt sehr wohl«, widersprach sein Vater. »Trotzdem hat deine Mutter recht. Wenn das Mädchen kommt, passen wir auf, was wir sagen, und behalten das, was wir denken, erst mal für uns. Das ist der Kleinen gegenüber nur recht und billig.«
»Ich brauche das, was ich denke, nicht für mich zu behalten«, meinte Sean junior. »Ich muß nicht dauernd auf die Briten schimpfen, damit ich mich wohl fühle.«
Sean legte Messer und Gabel aus der Hand und beugte sich mit warnend ausgestrecktem Zeigefinger zu seinem Sohn hinüber. Eilig griff Eileen ein.
»Bitte, hört mir mal zu. Ich wollte gerade sagen, wenn sie kommt, wäre das eine Gelegenheit für unsere Familie, die Tischsitten ein wenig zu verbessern. Ihr benehmt euch wie ein Haufen Ferkel, kleckert das Essen aufs Tischtuch und sprecht mit vollem Mund.«
»Ferkel sprechen aber nicht mit vollem Mund«, rief Eamonn. Donal lachte, und als Niamh das hörte, begann sie in ihrem Wagen neben dem Tisch zu krähen und zu gurgeln.
»Sie denkt bestimmt, wir sind schrecklich ungehobelt«, sagte Aisling. Eileen war überrascht, daß sie von dieser Seite Schützenhilfe bekam.
»Wir reden alle gleichzeitig, und keiner hört dem anderen richtig zu«, fuhr Aisling tadelnd fort. Etwas in ihrer Stimme, der schulmeisterliche Ton, brachte die anderen zum Lachen. Aisling wußte nicht, womit sie das verdient hatte, und sah sich verärgert um.
»Was ist daran so komisch?« wollte sie wissen. »Was findet ihr zum Lachen?«
Donal, der neben ihr saß, antwortete: »Sie lachen, weil du recht hast.« Da fühlte sich Aisling gleich besser, und sie kicherte sogar selbst ein bißchen.
Sie mußten schon früh am Bahnhof sein, damit sie nach einer vertrauenswürdigen Person suchen konnten, die sich unterwegs um Elizabeth kümmern würde. Ursprünglich hatte Violet vorgehabt, ihre Tochter bis Holyhead zu begleiten, aber das war ihr dann doch unvernünftig erschienen. Sie hätte den ganzen Weg zurückfahren müssen, und der Zug brauchte unendlich lange, weil er ständig hielt und weil der Treibstoff so knapp war. Dazu kamen natürlich die Kosten für die Fahrkarte – wer wollte in diesen schweren Zeiten Geld zum Fenster hinauswerfen?
George hatte lange hin und her überlegt, ob sie den O’Connors für Elizabeths Unterbringung Geld geben sollten, aber Violet war dagegen. In England bezahlten Evakuierte ihren Gastfamilien auch nichts, denn die Unterbringung war Teil der Kriegsbemühungen. Als George sie darauf hinwies, daß die Iren nicht am Krieg beteiligt waren, hatte Violet die Nase gerümpft und gesagt, das sollten sie aber, und das ändere nichts am Prinzip. Sie hatte Elizabeth fünf Pfund in die Hand gedrückt und ihr geraten, das Geld überlegt auszugeben.
An der Euston Station schaute sich Violet nach einer respektabel wirkenden Dame um, der sie Elizabeth anvertrauen konnte. Es sollte eine Alleinreisende sein, denn wer mit Plaudern beschäftigt war, konnte nicht ordentlich auf ein Kind aufpassen. Mehrere Versuche schlugen fehl. Die eine Frau fuhr nur bis Crewe, die andere wartete auf ihren Begleiter, und eine dritte hustete so stark, daß sie Elizabeth bestimmt mit irgendeiner Krankheit angesteckt hätte. Schließlich entschied sich Violet für eine Frau, die am Stock ging. Violet bot ihr an, daß Elizabeth für sie als Botengängerin und Kofferträgerin fungieren könne. Die Frau war von diesem Vorschlag sehr angetan und versprach, Elizabeth sicher bei dem jungen Mann namens Sean O’Connor abzuliefern, wenn das Schiff in Dunlaoghaire anlegte. Dann zog sich die Frau in eine Ecke des Abteils zurück, damit Elizabeth sich ungestört von ihren Eltern verabschieden konnte.
Mutter küßte sie auf die Wange und schärfte ihr ein, sie solle bitte versuchen, brav zu sein und Mrs. O’Connor nicht zur Last zu fallen. Vaters Lebewohl war sehr förmlich. Elizabeth sah zu ihm auf.
»Auf Wiedersehen, Vater«, sagte sie ernst. Er beugte sich zu ihr herab, um sie zu umarmen, und drückte sie lange an sich. Elizabeth spürte, wie sich ihre Arme um seinen Hals klammerten, aber dann sah sie, daß Mutter bereits die ersten Anzeichen von Ungeduld zeigte, und ließ ihn schnell los.
»Schreib uns ganz viele Briefe, schreib uns und erzähl uns alles«, bat ihr Vater.
»Ja, aber du darfst Eileen nicht um Papier und Briefmarken bitten, das kostet nämlich Geld.«
»Ich habe Geld! Ich habe fünf Pfund!« rief Elizabeth.
»Psst! Das brauchen doch nicht alle Leute am Bahnhof zu erfahren! Sonst wirst du noch ausgeraubt«, warnte Violet.
Elizabeths Gesicht wurde wieder rot und weiß, ihr Herz begann zu pochen, und sie hörte, wie die Waggontüren zuschlugen.
»Es wird bestimmt schön, es wird sicher schön«, stammelte sie.
»So ist’s recht«, lobte Mutter.
»Weine nicht, du bist doch ein großes Mädchen«, mahnte Vater.
Zwei dicke Tränen rannen über Elizabeths Wangen.
»Sie hätte gar nicht geweint, wenn du sie nicht auf die Idee gebracht hättest«, meinte Violet streng. »Sieh bloß, was du jetzt angerichtet hast.«
Der Zug setzte sich in Bewegung, und zwischen all den winkenden Menschen auf dem Bahnsteig standen Vater und Mutter. Stocksteif. Elizabeth schüttelte den Kopf, um die Tränen zu vertreiben, und als sich der Nebel lichtete, sah sie, daß ihre beiden Eltern die Ellbogen fest an den Körper preßten, als hätten sie Angst, einander zu berühren.
Kapitel 2
Donal wollte wissen, ob alle Brüder und Schwestern von Elizabeth gestorben seien. Waren sie umgekommen?
»Sei doch nicht albern«, sagte Peggy. »Natürlich sind sie nicht tot.«
»Wo sind sie denn dann? Warum kommen sie nicht mit?« Donal fühlte sich ausgeschlossen, weil Aisling ihren zukünftigen Gast so beharrlich für sich beanspruchte. Dauernd hieß es: »Meiner Freundin Elizabeth würde das nicht gefallen« oder: »Wenn meine Freundin Elizabeth kommt«. Donal hoffte, daß es irgendwo doch noch ein verborgenes Nest mit weiteren Geschwistern gab, die für ihn da waren.
»Sie ist allein«, erklärte Peggy.
»Niemand ist allein«, protestierte Donal. »Jeder hat doch eine Familie. Was ist mit den anderen passiert?«
Bei den übrigen Geschwistern konnte Eileen keine ähnliche Begeisterung wecken. Lediglich Aisling und Donal waren gespannt. Sean junior nahm ohnehin keine Notiz davon, wer mit ihm im Haus wohnte; Maureen meinte, es würde bestimmt lästig, sich mit noch jemandem herumärgern zu müssen, der so albern war wie Aisling. Eamonn verkündete, er denke gar nicht daran, sich für irgendein gräßliches Mädchen, das er nicht einmal kannte, auch noch zu waschen, und außerdem wasche er sich sowieso – jedenfalls ausreichend. Niamh bekam gerade einen Zahn, war wütend und knallrot im Gesicht und schrie immer wieder lang und laut. Selbst Eileen machte sich hin und wieder Sorgen wegen Violets Kind. Die Briefe klangen ziemlich geschraubt, und das kleine Mädchen war sicher an einen wesentlich kultivierteren Lebensstil gewöhnt – falls die kurzen, knappen und nicht sehr erhellenden Einblicke, die Violet in ihr Leben gewährt hatte, der Wirklichkeit entsprachen.
Sie hoffte nur, daß das Mädchen kein verschrecktes Hühnchen war, das Angst hatte, den Mund aufzumachen. Dann kam sie hier wirklich vom Regen in die Traufe … von den Bombenangriffen in London zu den lärmenden, chaotischen O’Connors. Schwer zu sagen, was für das Kind schlimmer war.
Jedenfalls bestand die Möglichkeit, daß sie durch das Kind ihrer Freundin Violet nach all den Jahren wieder etwas näherkam. Eileen wünschte, sie beide hätten den Kontakt etwas mehr pflegen können. Weiß der Himmel, sie hatte es versucht: Sie hatte oft geschrieben, von dem Leben in Kilgarret erzählt und Violets Tochter kleine Geburtstagsgeschenke geschickt – aber von Violet kam nur gelegentlich eine hastig gekritzelte Postkarte. Es ärgerte Eileen, daß die Nähe zwischen ihnen sich einfach verflüchtigt zu haben schien, denn es war eine sehr tiefe Vertrautheit gewesen. Sie waren beide unter falschen Voraussetzungen auf der Klosterschule gelandet: Violet, weil ihre Familie (irrtümlicherweise) glaubte, eine Klosterschule würde ihrem Kind den nötigen Schliff geben, Eileen, weil ihre Eltern dachten, eine Klosterschule in England wäre auf jeden Fall etwas Besseres als jede Form von katholischer Erziehung in Irland.
Doch jetzt trat Violet wieder in Eileens Leben, und das machte sie froh. In ein, zwei Jahren würde dieser schreckliche Krieg vorbei sein, und vielleicht kamen George und Violet dann sogar einmal zu Besuch und übernachteten in Donellys Hotel auf der anderen Seite des Marktplatzes. Vielleicht dankten sie Eileen dann von Herzen, daß sie wieder Farbe auf die Wangen ihrer Tochter gebracht hatte. Ihre Freundschaft würde neu aufblühen, und Eileen würde mit jemandem über die alten Zeiten in St. Mark reden können. Alle anderen sagten nämlich, sie wollte bloß angeben, weil sie auf eine englische Schule gegangen war.
Am liebsten hätte sie das kleine Mädchen selbst mit dem Bus abgeholt. Ein Tag in Dublin hätte ihr gutgetan. Einmal nicht mit zusammengekniffenen Augen über den Büchern und Rechnungen brüten! Statt dessen in Dunlaoghaire auf das Boot mit Elizabeth warten – oder in Kingstown, wie es manche Leute noch immer nannten, um Sean auf die Palme zu bringen. Sie konnten die Straßenbahn nach Dublin nehmen, und dann konnte Eileen Elizabeth die Stadt zeigen, vielleicht sogar auf Nelson’s Pillar klettern, was sie noch nie getan hatte. Aber das war reine Träumerei. Sie konnte nicht gehen, Sean junior mußte das Mädchen abholen. In letzter Zeit war er so unruhig und fing wegen jeder Kleinigkeit mit seinem Vater Streit an – da war es bestimmt nicht schlecht, wenn er einfach mal einen Tag nicht im Laden war. Am Dienstag sollte er gleich nach der Arbeit den Abendbus nehmen. Übernachten konnte er bei Eileens Cousine, die in Dunlaoghaire eine kleine Pension besaß – ein halbes Dutzend Eier bekam sie als Dankeschön dafür, daß sie Sean junior eine Nacht in ihrem Wohnzimmer schlafen ließ. Sean junior hatte strikte Anweisung, schon am Pier zu stehen, bevor das Boot anlegte, damit das Mädchen auch ja keine Angst bekam, sie würde nicht abgeholt. Wenn er ein zehnjähriges blondes Mädchen mit einem grünen Mantel, einem braunen Koffer und einer braunen Schultertasche erspähte, sollte er ihr seinen Namen sagen. Er sollte sie willkommen heißen und ihr, während sie auf den Bus warteten, Brack mit Butter und Limonade geben. Auf keinen Fall durfte er trödeln und den Bus verpassen. Eileen wußte, daß sich Seans Interesse, ein zehnjähriges Mädchen vom Postschiff abzuholen, sehr in Grenzen hielt. Wenn er dagegen auf eine Gruppe junger Burschen stieß, die sich zur britischen Armee melden wollten, würde er sofort in höchste Aufregung geraten.
Mit den Mahers vereinbarte Eileen, daß sie das Kätzchen am Nachmittag abholen würden, sobald Elizabeth da war, denn dann war für Ablenkung gesorgt, falls die Ankunft des Mädchens nicht ganz glatt lief. Außerdem wollte Eileen, daß sich Elizabeths Ankunft für die Kinder mit der Ankunft des kleinen, schwarzweißen Fellknäuels verband – denn das war garantiert ein Erfolg.
Mrs. Moriarty war eine sehr nette Frau. Sie hatte ein richtiges Picknick mitgebracht und teilte eine Dose Erbsen mit Elizabeth. Gemeinsam löffelten sie das kalte Gemüse aus der Büchse.
»Ich wußte gar nicht, daß man Erbsen auch kalt essen darf«, bemerkte Elizabeth. Ihr eigener kleiner Proviant war vergleichsweise langweilig: sechs kleine, ordentliche Sandwiches ohne Kruste, drei davon mit sehr wenig Käse, die anderen drei mit noch weniger Tomate. Außerdem ein Apfel und zwei Butterkekse, alles in weißes Papier verpackt – und dazu noch eine zusammengefaltete Papierserviette.
»Mutter hat gesagt, das muß für zwei Mahlzeiten reichen, fürs Abendessen und fürs Frühstück«, erklärte sie ernst. »Aber nehmen Sie sich doch bitte ein Sandwich – für die Erbsen.«
Mrs. Moriarty griff zu und verkündete, das Brot sei sehr lecker. »Du hast es aber gut, daß deine Mammy das alles für dich gemacht hat«, meinte sie.
»Na ja, eigentlich habe ich es selbst gemacht, aber meine Mutter hat alles eingepackt«, erwiderte Elizabeth.
Mrs. Moriarty erzählte Elizabeth, daß sie zu ihrem Sohn und seiner Frau (einem ziemlichen Besen!) nach County Limerick fuhr. Seit dem Tod ihres Mannes hatte sie in England gelebt, und sie liebte England – vor allem das riesige London. Sie hatte in einem Gemüseladen gearbeitet, und alle waren lieb und nett gewesen, aber jetzt, mit ihrer Arthritis und den Bomben und allem, hatten sie plötzlich darauf bestanden, sie solle nach Hause kommen. Mrs. Moriarty hatte überhaupt keine Lust dazu. Nach dem Krieg würde es ihr unangenehm sein, und die anderen im Laden würden denken, daß sie davongelaufen war. Trotzdem blieb ihr nichts anderes übrig, denn ihr Sohn und sein Dragonerweib schrieben ihr jede Woche – sie waren sogar eigens angereist, um sie zu überreden: Alle ihre Nachbarn, erzählten sie, hätten geschimpft, sie wären herzlos, wenn sie zuließen, daß ihre Mutter im Bombenhagel von London bei lebendigem Leib verbrannte, und deshalb hatten sie darauf bestanden, daß Mrs. Moriarty umgehend nach Irland kam.
Elizabeth pflichtete ihr bei, daß es unangenehm war, eine Reise zu unternehmen, wenn man es eigentlich gar nicht wollte, und während Mrs. Moriarty eingemachte Birnen austeilte, erzählte ihr Elizabeth von Mutters Freunden, den O’Connors, die in einer dreckigen Stadt lebten, in einem Haus, in dem schreckliche Unordnung herrschte, an einem Marktplatz, wo auch Tiere herumliefen und alles schmutzig machten. Nachdenklich wandte Mrs. Moriarty ein, Elizabeth solle vielleicht ihre Sorge, daß die Stadt so schmutzig sei, für sich behalten, und die Ansichten ihrer Mutter nicht weiterverbreiten, ehe sie sich selbst eine Meinung gebildet hatte. Elizabeth errötete und versicherte, nie im Leben würde sie so etwas in Mrs. O’Connors Gegenwart behaupten – und jetzt tat sie es auch nur, weil Mrs. Moriarty ihre Freundin war und von ihrer schrecklichen Schwiegertochter erzählt hatte.
Um ihre Verschwörung zu besiegeln, teilten sie sich eine Dose dicke, zuckrige Kondensmilch. Dann schlief Elizabeth an Mrs. Moriartys Schulter gelehnt ein und rührte sich nicht, bis alle geweckt und in die kalte Nacht von Holyhead gescheucht wurden. Gepäckträger schrien sich walisische Worte zu, und es herrschte großes Getümmel, während sie darauf warteten, daß man sie aufforderte, auf das Postschiff zu gehen.
»Spricht man in Irland auch so?« erkundigte sich Elizabeth nervös. Sie fühlte sich sehr unsicher zwischen all den Menschen, die in einer unverständlichen Sprache brüllten und lachten. Mutter hätte bestimmt etwas Abschätziges darüber zu bemerken gewußt. Elizabeth versuchte sich vorzustellen, was sie wohl gesagt hätte, aber ihr fiel nichts ein.
»Nein«, antwortete Mrs. Moriarty. »In Irland sprechen wir Englisch. Alles Gute, was wir hatten, haben wir über Bord geworfen – zum Beispiel unsere Sprache und unsere Art, mit dem Leben zurechtzukommen.«
»Und unsere Schwiegermütter«, fügte Elizabeth ernst hinzu.
»Genau«, lachte Mrs. Moriarty. »Tja, wenn sie schon die Schwiegermütter zurückholen, wer weiß, auf was sie sich sonst noch zurückbesinnen«, und sie lehnte sich an Elizabeths Schulter, während sie langsam auf das Postschiff zustrebten, das groß und furchterregend in der Dunkelheit aufragte.
Sean haßte Menschen wie Mrs. Moriarty, die einen am Arm packten und einem aus dem Mundwinkel Vertraulichkeiten ins Ohr flüsterten, als gehörte man gemeinsam zu irgendeinem Geheimbund, in den andere aber nicht eingeweiht waren. Er wich ein Stück zurück, als sie anfing, ihm zuzuzischen, daß das kleine Mädchen von der Reise müde und erschöpft sei, daß die Mutter einen harten Zug um den Mund habe und daß er und seine Familie dem, was sie sagte, nicht allzuviel Bedeutung beimessen sollten.
»Ich glaube, die Leute da drüben winken Ihnen«, sagte er schließlich, um ihr zu entkommen. Ein Mann und eine Frau mittleren Alters riefen: »Mam, Mam, hier sind wir?«
Zum erstenmal, seit sie Sean bestätigt hatte, wer sie war, sah Elizabeth auf. Lange und prüfend musterte sie Mrs. Moriartys Schwiegertochter, die ein starres Willkommenslächeln aufgesetzt hatte.
»Wie ein Besen sieht sie eigentlich nicht aus«, meinte sie nachdenklich. »Vielleicht ist sie ja doch ganz nett.«
Während sie im Licht der frühen Morgensonne zur Bushaltestelle wanderten, bot Sean Elizabeth Brack und Limonade an.
»Mam hat gesagt, das sollst du essen, wenn du Hunger hast«, erklärte er unfreundlich.
»Muß ich?« fragte sie. Ihr Gesicht war noch blasser als ihre Haare, ihre Augen waren rot und ihre Beine dürr wie Stöckchen. Er fand, daß sie ziemlich erbärmlich aussah.
»Nein, gewiß nicht, es war nur eine nette Idee von Mam. Ich esse das Zeug gern selbst, ich mag Brack«, meinte er, und plötzlich war es ihm sehr wichtig, sich seiner Mutter gegenüber loyal zu verhalten.
»Ich wollte nicht …« begann Elizabeth.
»Macht nichts.« Er packte zwei dicke Scheiben Brack aus, die ungleichmäßig mit Butter bestrichen waren, und begann zu essen.
»Ist das Kuchen?« erkundigte sich Elizabeth.
»Es ist Brack, das hab’ ich dir doch gesagt, aber du wolltest es ja nicht.«
»Ich wußte nicht, was es ist.«
»Warum hast du mich dann nicht gefragt?« Er überlegte, was für ein Kind das sein mußte, das noch nie etwas von Brack gehört hatte.
»Ich weiß nicht.«
Schweigend gingen sie zur Haltestelle des Busses nach Bray. Elizabeths Koffer war schwer und zog sie nach unten; die Schultertasche hing quer über ihren mageren Oberkörper. Sie sah aus wie ein Waisenkind.
Seans Gedanken kreisten ständig um den Jungen, dem er am Vorabend im Gästehaus begegnet war. Terry war siebzehn, zu jung, um zur Armee zu gehen, aber er hatte erzählt, daß man immer behaupten könne, die Geburtsurkunde sei beim Brand im Zollamt vernichtet worden. In England wußte keiner, wann dieser Brand stattgefunden hatte. Jetzt saß Terry auf dem Postschiff, das nach England zurückkehrte, dort würde er sich bei der nächsten Rekrutierungsstelle melden, und in spätestens zwei Wochen steckte er in Uniform. Vor lauter Neid hatte Sean die ganze Nacht kein Auge zugetan. Terry hatte von Freunden erzählt, die vor einem Monat zur Armee gegangen waren. Sie bekamen pünktlich ihren Sold, gutes Geld, sie erhielten eine Ausbildung, Drill, lernten den Umgang mit Waffen, alles, was man wissen mußte; bald sollten sie sich einschiffen, aber das war noch geheim. Terry arbeitete ebenfalls für seinen Vater, auf einem kleinen Bauernhof. Er wußte, was es bedeutete, wenn man kein richtiges Geld verdiente, nur ein bißchen Taschengeld und eine sogenannte Ausbildung kriegte. Er wußte, was es hieß, wenn man nicht erwachsen werden durfte, wenn die Mutter fragte, ob man bei der Beichte war, und der Vater einem dauernd in den Ohren lag, man solle dies und jenes im Haus erledigen und der Mutter ein bißchen unter die Arme greifen. Das war doch kein Leben: keine Chance, bald eine Uniform zu tragen …
»Was für eine Uniform trägt dein Papa?« fragte Sean unvermittelt.
Elizabeths kleines Gesicht verfärbte sich, als hätte ihr jemand eine Ohrfeige versetzt.
»Er … ist nicht … er hat kein … weißt du, er mußte nicht in den Krieg. Er ist zu Hause.«
»Warum denn das?« wollte Sean wissen, und sein ohnehin geringes Interesse an dem Mädchen schwand weiter. Nicht einmal über den Krieg konnte sie ihm erzählen!
»Er mußte in der Bank bleiben, glaube ich … Ich glaube, sie brauchten …« In Elizabeths Gesicht arbeitete es heftig, während sie etwas zu erklären versuchte, was sie selbst nie richtig verstanden hatte, was aber, wie sie wußte, zwischen ihren Eltern ein Reizthema war.
»Ich glaube, die Bank brauchte ältere Mitarbeiter mit Beschwerden in der Brust«, sagte sie schließlich.
Sean sah sie gelangweilt an; er war in Gedanken längst wieder bei Terry und beim Militär. In Bray warteten sie auf den Bus nach Wicklow.
»Möchtest du auf die Toilette gehen, bevor der Bus kommt?« fragte er plötzlich. Noch nie in ihrem zehnjährigen Leben hatte jemand Elizabeth eine so direkte und so peinliche Frage gestellt.
»Ähm, ja, bitte«, stotterte sie.
Mit einer Kopfbewegung deutete Sean junior in Richtung der öffentlichen Toiletten.
»Da drüben, aber mach nicht zu lange, der Bus kommt in fünf Minuten.«
Elizabeth hastete hinauf zu den beiden niedrigen Gebäuden. Aber nirgends stand »Damen« und »Herren«! Selbst wenn sie in London mit Mutter unterwegs war, fand sie es ziemlich abenteuerlich, eine öffentliche Toilette zu benutzen. Mutter hatte immer darauf bestanden, daß sie reichlich Toilettenpapier benutzte, um sich vor den Infektionen zu schützen, die überall auf dem Sitz lauerten, aber jetzt war sie ganz allein mit einem kolossalen Problem konfrontiert. Anscheinend gab es hier nur Abkürzungen über den Türen, keine Worte. Über einer stand MNA, über der anderen FIR. Elizabeth überlegte. Sie sah zu Sean hinüber. Er hielt sie sowieso schon für blöd, was würde er dann erst von ihr denken, wenn sie jetzt zurückrannte und ihn fragte, welche Toilette sie benutzen sollte?! Denk nach, Elizabeth! M mußte doch eigentlich Männer bedeuten und F Frauen. Mutig marschierte sie durch die Tür, über der FIR stand.
Als sie eintrat, sah sie vier Männer, die ihr den Rücken zuwandten. Elizabeth überlegte, ob sie vielleicht die Wand anstrichen oder etwas reparierten. Einen Moment zögerte sie, dann ging sie an ihnen vorbei, um den Eingang der Damentoilette zu suchen.
Doch da drehte sich einer der Männer um, und zu ihrem Entsetzen sah Elizabeth, daß seine Hose offenstand. Es war ein alter Mann, ohne Zähne, die Mütze verkehrt herum auf dem Kopf.
»Raus mit dir, Kleine, geh nach Hause und sei nicht so naseweis«, rief er. Jetzt drehten sich die beiden anderen Männer ebenfalls um.
»Na los, raus hier! Wenn du älter bist, kriegst du davon noch genug zu sehen!« rief ein junger Mann, und die anderen lachten. Knallrot, mit klopfendem Herzen, rannte Elizabeth hinaus, wo Sean bereits winkte und schrie, sie solle sich beeilen, da der Bus schon um die Ecke bog.
»Du lieber Himmel, bist du etwa ins Männerklo gegangen?« fragte er, und bevor Elizabeth etwas erwidern konnte, fügte er warnend hinzu: »Erzähl das bloß nicht Mam, sonst haut sie dich windelweich.« Elizabeths brauner Koffer landete mit Schwung auf dem Dachgepäckträger.
»Da steht Cill Maintain!« rief Elizabeth entsetzt. »Da steht nicht Wicklow, das ist der falsche Bus!«
»O Herr im Himmel, jetzt komm endlich rein«, befahl Sean junior. Das Reisen mit einer normalen Zehnjährigen wäre schon schlimm genug gewesen, aber diese hier war offensichtlich auch noch geistig zurückgeblieben.
Als der Bus losfuhr, begann es zu regnen. Sie fuhren durch die grünen Felder, jedes gesäumt von einer Hecke in etwas dunklerem Grün. Elizabeth starrte aus dem Fenster und bot ihre ganze Willenskraft auf, um die Tränen zurückzuhalten und sich bis zur nächsten Toilette zusammenzureißen, wo ihr vielleicht jemand die Bedeutung der Zeichen erklären konnte. Es kam ihr vor, als wäre es bereits Wochen her, seit sie London verlassen hatte, und voll Schrecken wurde ihr klar, daß es noch nicht einmal vierundzwanzig Stunden waren.
Eileen hatte den Laden vorzeitig verlassen, für den Fall, daß der Bus früher kam als erwartet. Sie wollte rechtzeitig da sein, um das Mädchen willkommen zu heißen. Eine kreischende Peggy, eine Aisling, die keinen Ton herausbrachte, ein störrischer Eamonn und ein Donal, den man nicht verstand – das wäre kein guter Anfang für Elizabeths Leben in diesem Land gewesen. Eileen strich sich den Rock glatt und steckte ein paar lose Strähnen zurück. Wie Violet jetzt wohl aussah? Sie hatte immer feines Haar und einen milchweißen Teint gehabt. Vielleicht sah das kleine Mädchen aus wie sie und war nicht mit Sommersprossen übersät wie die O’Connors.
Der Tisch war sorgfältiger gedeckt als sonst; das erste Tischtuch hatte Eileen wieder abnehmen lassen, weil es voller Flecken war – offenbar wollte man das Niveau heben, dachte Peggy verärgert. Da kam Aisling hereingestürmt.
»Du bist ja schon da, Mammy, können wir nicht gleich zu den Mahers gehen und das Kätzchen holen? Dann können wir es der Dings gleich zeigen, wenn sie kommt.«
»Ihr Name ist Elizabeth«, fauchte Eileen. »Nein, das Kätzchen ist für euch beide.«
»Ich weiß«, erwiderte Aisling nicht sehr überzeugend. Eamonn war ihr auf dem Fuß gefolgt.
»Zwei Pfoten für jede von euch«, kicherte er. »Ein Paar für dich, und ein Paar für sie.«
»Ich kriege die Vorderpfoten«, meinte Aisling nachdenklich.
»Das ist nicht fair, dann kriegt sie nur den Po!« Eamonn wunderte sich selbst über seine Kühnheit.
»Sag nicht Po, sonst kriegst du Haue von Mammy«, ermahnte ihn Aisling und blickte aus den Augenwinkeln erwartungsvoll zu ihrer Mutter hinüber.
Doch Eileen hatte nicht zugehört. »Komm her, Aisling, damit ich dir die Haare bürste. Sie sehen aus wie ein Ginsterbusch. Steh still.« Die Bürste lag immer auf dem Kaminsims im Eßzimmer und wurde samstags zu einer gründlichen wöchentlichen Prozedur heruntergeholt. Maureen und Aisling haßten sie und versuchten sich jedesmal zu drücken – die Jungen konnten sich gewöhnlich darauf verlassen, daß ihr Vater sie rettete.
»Hör auf, sie zu schniegeln, Eileen«, sagte er immer. »Schließlich sind sie doch Männer, oder? Laß sie in Ruhe.« Aber für das lange lockige Haar seiner Töchter gab es auch bei ihm kein Erbarmen. Aisling sträubte sich.
»Es ist ja noch schlimmer als vor der Messe«, beklagte sie sich.
»Sag nichts Schlechtes über die Messe, das ist eine Sünde«, sagte Eamonn, froh darüber, seine Schwester bei einem Vergehen ertappt zu haben, das genauso schlimm war wie seines. »Mammy, sie hat gesagt, sie haßt es, sich für die Messe fertig zu machen.«
»Nein, das hat sie nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, sie haßt es, wenn ich ihr die Haare bürste. Aisling würde nichts Schlechtes über Gottes heilige Messe sagen, nicht wahr, Aisling?«
»Nein, Mammy«, meinte Aisling mit gesenktem Blick. Eamonn ärgerte sich. Normalerweise regnete es Schimpf und Schande auf das Haupt des Übeltäters, der es auch nur andeutungsweise wagte, den Namen Gottes zu beleidigen.
Peggy war immer noch mürrisch, denn sie spürte, daß die Zeiten härter wurden.
»Soll ich Donal wecken, Madam? Er sagt, er wird verrückt da oben, wenn die Dings ankommt und er weiß, daß es hoch hergeht. Er sagt, er will nicht, daß die Dings glaubt, er ist …«
»Peggy, Elizabeth White heißt Elizabeth. Sie ist nicht die Dings. Hast du gehört?«
»Ja, Madam. Ich weiß, Madam«, lenkte Peggy erschrocken ein. Die Bürste wurde wieder weggelegt.
»Ich hole ihn jetzt runter.« Eileen durchquerte das Zimmer, doch sie sah dabei ganz automatisch aus dem Fenster. Der Bus mußte angekommen sein. Aus der Richtung von Donellys Hotel, wo der Bus aus Dublin einmal am Tag hielt, strömten Menschentrauben über den Platz. Und da war auch schon Sean, vorneweg, übellaunig einen Stein vor sich her kickend. Ihr großer, gutaussehender, rastloser Sohn war verärgert und unglücklich über irgend etwas. Erfüllt von Sorge um ihn zog sich Eileens Herz zusammen; wie schon so oft.
Ihm folgte ein bleiches kleines Mädchen, das unter der Last seines Koffers fast zusammenklappte. Sie war kleiner und dünner als Aisling, und ihre Haare waren so hell, daß man sie kaum wahrnahm. In dem grünen Mantel wirkte sie noch blasser. Ein Schulhut war mit einem Gummiband unter ihrem Kinn befestigt, und einer ihrer Handschuhe baumelte – ebenfalls an einem Gummiband – aus ihrem Ärmel hervor.
Dort, mitten auf dem Marktplatz von Kilgarret, mit aufgerissenen Augen, die aussahen wie zwei Brandlöcher in einer Decke, stand Elizabeth.
Eileen merkte, daß Aisling völlig verschüchtert war und kaum einen Ton herausbrachte, ganz wie sie es vorausgesehen hatte.
»Nein, geh du hinunter, Mammy«, flehte sie.