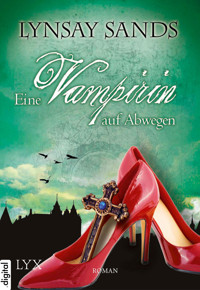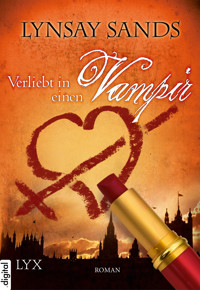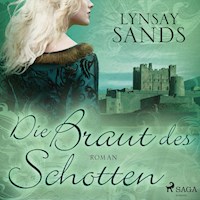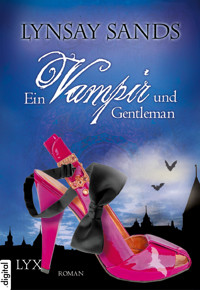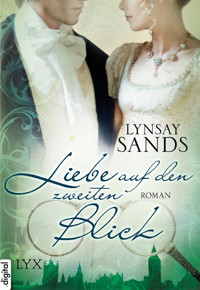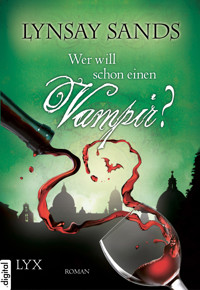9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr Herz schlägt für die Highlands
Als ihr Halbbruder sie für ein paar Pferde verkaufen will, begreift Murine Carmichael, dass sie unter seiner Obhut nicht mehr sicher ist. Sie flieht in die Wildnis, wo sie auf Dougall Buchanan trifft. Der stolze Highlander hatte das schändliche Angebot ihres Bruder empört abgelehnt - nun ist er jedoch umso entschlossener, das Herz der schönen Murine für sich zu gewinnen.
"Eine Geschichte, die ebenso aufregend und großherzig ist wie ihr Held." Kirkus Reviews
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem Buch12345678910111213141516Die AutorinDie Romane von Lynsay Sands bei LYXImpressumLYNSAY SANDS
Ein Highlander zur rechten Zeit
Roman
Ins Deutsche übertragen von Susanne Gerold
Zu diesem Buch
Als ihr Halbbruder sie für ein paar Pferde an einen Schotten verkaufen will, steht für Murine Carmichael fest, dass sie in seiner Obhut nicht mehr sicher ist. Denn dies ist nicht der erste Fehltritt ihres Bruders, der bereits ihre gesamte Mitgift bei einer Wette verloren hat. Zu ihrem Glück lehnt der Highlander Dougall Buchanan das schändliche Angebot ab. Doch Murine ist sich sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich jemand findet, der weniger Anstand besitzt. Sie flieht in die Wildnis, wo sie auf Buchanan und seine Männer trifft. Dieser ist sofort bereit, der schönen und mutigen Dame zur Hilfe zu kommen – erst recht, als er erfährt, dass sie selbst Schottin ist und mit seiner Familie gut bekannt. Und als ihr Leben in Gefahr gerät, erkennt Dougall, dass er alles für Murine tun würde – denn ein Highlander, der für seine Liebe kämpft, fürchtet weder Tod noch Teufel …
1
»Sie kommen!«
Murine sah abrupt von dem Brief auf, den sie schrieb, als ihre Zofe ins Zimmer stürzte. Sie wartete, bis Beth die Tür des Schlafzimmers hinter sich geschlossen hatte, und fragte dann: »Hast du inzwischen erfahren, wer sie sind?«
»Nein.« Beth wirkte verärgert. »Weder die anderen Zofen noch die Mädchen in der Küche scheinen etwas zu wissen, und wenn doch, sagen sie es mir nicht.«
»Oh.« Murine schüttelte enttäuscht den Kopf und wandte sich wieder ihrem Brief zu. Sie presste die Lippen zusammen, als sie ihren Namen unter das Geschriebene setzte. »Eigentlich spielt es keine Rolle. Auf jeden Fall sind es Schotten. Auf dem Rückweg werden sie sicherlich bei den Buchanans oder den Drummonds vorbeikommen und können diesen Brief für mich dort abgeben.« Sie biss sich auf die Lippen, während sie mit dem Pergament herumwedelte, damit es schneller trocknete. »Ich habe noch ein paar Münzen, die ich ihnen als Entschädigung für ihre Mühe geben kann.«
»Höchstwahrscheinlich werden sie die Münzen einstecken und den Brief wegwerfen, kaum dass sie Danvries verlassen haben«, sagte Beth betrübt. »Ich verstehe nicht, warum Ihr nicht einen Diener Eures Bruders mit dieser Aufgabe betraut.«
»Das habe ich schon drei Mal getan und noch immer keine Antwort erhalten«, entgegnete Murine grimmig und spürte, wie ihre Mundwinkel vor Verärgerung zuckten. »Allmählich vermute ich, dass Montrose meine Briefe gar nicht weitergeleitet hat.«
»Aber warum sollte er so etwas tun?«
»Das ist bei meinem Bruder schwer zu sagen«, murmelte Murine unglücklich. »Er ist ein … schwieriger Mann.«
Beth schnaubte. »Er ist ein selbstsüchtiger, gieriger Hundesohn, darauf versessen, sein Leben durch Wetten zu ruinieren, und Eures mit dazu. Aber ich sehe keinen Grund, weshalb er Eure Briefe an Eure Freundinnen zurückhalten sollte.«
»Ich auch nicht«, gestand Murine niedergeschlagen. »Aber wenn er sie ihnen hat zukommen lassen, dann …« Sie presste die Lippen zusammen, nicht bereit, ihre größte Furcht auszusprechen. Wenn Montrose ihre Briefe auf den Weg gebracht hatte, dann hatten Saidh, Jo und Edith sich einfach nur nicht die Mühe gemacht, darauf zu antworten.
Der Gedanke war beunruhigend, und sie machte sich Sorgen, dass sie bei ihrem letzten Treffen irgendetwas gesagt oder getan haben könnte, das die drei Freundinnen gegen sie aufgebracht hatte. Murine hatte sich das Hirn zermartert in dem Versuch, einen Grund für deren Schweigen zu finden. Aber ihr war einfach keiner eingefallen. Ihr Grübeln hatte sie auch zu der Vermutung geführt, dass ihr Bruder die Nachrichten vielleicht gar nicht weggeschickt hatte. Und obwohl sie keine Erklärung dafür hatte, warum er so etwas tun sollte, hoffte sie mittlerweile, dass es so wäre. Dies anzunehmen war besser als zu denken, ihre drei besten Freundinnen könnten sich von ihr abgewandt haben.
»Es müsste jetzt trocken genug sein«, murmelte sie und rollte das Pergament rasch zusammen, ehe sie es versiegelte.
»Wie wollt Ihr das den Schotten geben, ohne dass Euer Bruder es mitbekommt?«, fragte Beth besorgt.
»Ich habe gehört, dass Montrose den Koch angewiesen hat, jede Menge Speisen und Getränke für die Schotten bereitzustellen«, erklärte Murine. Sie schob das Pergament in ihren Ärmel und vergewisserte sich, dass es weder zu sehen war noch zerdrückt wurde. »Ich werde einem der Männer die Nachricht zustecken, wenn Montrose beim Essen abgelenkt ist.«
»Euer Bruder bietet jemandem etwas zu essen und zu trinken an?«, fragte Beth trocken. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich so etwas einmal erlebe. Der Mistkerl ist doch so geizig, dass er an einem so großzügigen Angebot eigentlich ersticken müsste.«
»Vermutlich versucht er, sie mit Bier oder Whisky abzufüllen, damit sie bereit sind, ihm Kredit zu gewähren«, sagte Murine. »Anstelle des Geldes, das sie eigentlich für die Pferde bekommen sollten, die er von ihnen haben will.« Zufrieden stellte sie fest, dass das Pergament in ihrem Ärmel gut aufgehoben war.
»Aye, aber der Herr weiß doch, dass er gar kein Geld hat, um die Pferde zu kaufen. Er hat doch alles verspielt, und Eure Mitgift noch dazu.« Beth klang verbittert.
»Aye«, stimmte Murine ihr bedrückt zu. Das war kein Thema, über das sie gern lange nachdenken wollte. Sie war entsetzt gewesen, als sie davon erfahren hatte. Ihre Situation war ohnehin düster genug, weil sie zwar eine Mitgift, aber keinen Verlobten hatte. Ohne Mitgift würde es allerdings ganz unmöglich sein, jemanden zu finden, der bereit war, sie zu heiraten. Alles sah danach aus, als würde sie den Rest ihres Lebens als alte Jungfer auf Danvries verbringen, abhängig von ihrem selbstsüchtigen Bruder. Und selbst das setzte voraus, dass er ihrer nicht überdrüssig wurde und sie ins Kloster schickte, um sie loszuwerden.
Sie schob den bedrückenden Gedanken beiseite, strich ihr Kleid glatt und reckte die Schultern. Dann ging sie zur Tür. »Komm. Setzen wir uns in der großen Halle ans Feuer, bis sie kommen. Wenn dann das Essen auf dem Tisch steht, nutzen wir das als Vorwand, uns dazuzusetzen. Dann kann ich einem der Männer den Brief zustecken.«
»Man hat mir gesagt, Eure Tiere wären von ausgezeichneter Qualität, und das sind sie in der Tat.«
Dougall wartete geduldig, während Montrose Danvries der Stute über die Flanke strich und dann um das Pferd herumging.
Auf die gleiche Weise nahm Lord Danvries kurz danach den Hengst in Augenschein, begutachtete eingehend den Widerrist und die Beine, die Flanken und den Kopf. Danvries’ Miene zeigte eine Mischung aus Staunen und Bewunderung, als er schließlich neben dem Hengst stehen blieb und ihm die Nüstern rieb. »Genau das hatte ich mir erhofft.«
»Wenn die Pferde Euren Erwartungen entsprechen, sollten wir jetzt über die Bezahlung reden«, schlug Dougall vor.
Danvries versteifte sich, und auf seinem Gesicht spiegelte sich der Widerstreit seiner Gefühle wider. Schließlich setzte er ein breites, falsches Lächeln auf und wandte sich dem Wohnturm zu. »Kommt. Lasst uns hineingehen und etwas trinken.«
»Ich habe es dir doch gesagt«, murmelte Conran, als er zu Dougall trat. »Der Kerl hat kein Geld. Er hat bei der letzten Wette mit dem König alles verloren.«
Dougall seufzte. Ihm entging nicht, mit welcher Genugtuung sein jüngerer Bruder diese Worte gesprochen hatte. Conran hatte schon immer eine Vorliebe für Ich habe es dir doch gesagt gehabt.
»Kommt, Gentlemen«, forderte Danvries seine Gäste auf, ohne sich nach ihnen umzusehen. »Es gibt viel zu besprechen.«
Mit zusammengepressten Lippen sah Dougall dem Mann nach. Danvries hätte ihm eigentlich nur einen Beutel Münzen zuwerfen sollen, und sie hätten sich wieder auf den Weg gemacht. Käufer pflegten nur dann etwas »besprechen« zu wollen, wenn ihnen das Geld fehlte oder sie den Preis herunterhandeln wollten. Obwohl Dougall wusste, dass er seine Zeit verschwendete, wischte er die Einwände seines Bruders mit einer knappen Handbewegung beiseite und folgte dem Engländer zum Wohnturm. Er musste sich nicht umsehen, um zu wissen, dass Conran, Geordie und Alick sich ihm anschlossen. Es war eine lange Reise hierher gewesen, und sie alle waren durstig. Das Mindeste, was Danvries tun konnte, war, dafür zu sorgen, dass sie etwas zu essen und zu trinken bekamen, ehe sie sich auf den Rückweg nach Schottland machten.
»Er wird versuchen, dich reinzulegen«, warnte Conran, der Dougall dicht auf den Fersen folgte. »Verdammte englische Mistkerle. Die meisten von ihnen würden ihre eigene Mutter für einen Silberling verkaufen.«
»Nein«, meldete sich jetzt ihr jüngerer Bruder Geordie zu Wort. »Sie verkaufen ihre Töchter. Die alten Frauen wären keinen Silberling mehr wert. Die vielen Jahre, die sie mit den englischen Mistkerlen zusammengelebt haben, haben sie viel zu bitter gemacht. Die Töchter allerdings sind normalerweise süß und hübsch und gar nicht bitter. Wenn man sie von hier wegschafft, solange sie noch jung genug sind, sind sie fast so gut wie schottische Mädchen. Fast«, wiederholte er, um seine Aussage zu betonen.
»Lord Danvries hat weder eine Mutter noch eine Tochter, also gibt es da nichts zu befürchten«, entgegnete Dougall ungeduldig.
»Aber er hat eine Schwester«, erklärte Conran. Als Dougall sich zu ihm umdrehte und ihn überrascht ansah, nickte er bestätigend. »Eine alte Jungfer, die hier vertrocknen wird, weil Lord Danvries ihre Mitgift verspielt hat.«
»Er hat ihre Mitgift verspielt?«, fragte Geordie überrascht. Dougall sagte nichts dazu.
»Ist so etwas überhaupt erlaubt?«, fragte Alick stirnrunzelnd.
Conran zuckte mit den Schultern. »Nach dem, was ich gehört habe, entsprach es dem Willen ihres Vaters, dass Lord Danvries zu ihrem Vormund ernannt wurde. Deshalb hat er die Verfügungsgewalt über das Geld.«
Dougall schüttelte den Kopf. Sie verfielen in Schweigen, als sie Danvries in die große Halle folgten und die Menschen in Augenschein nahmen, die sich dort aufhielten.
Soldaten aßen am Tisch zu Mittag, Bedienstete waren mit Saubermachen beschäftigt, und eine Lady saß beim Feuer. Im Vorbeigehen streifte kurz Dougalls Blick die Frau, kehrte aber sofort zu ihr zurück. Sie war jung. Nicht mehr in der ersten Blüte ihrer Jugend, eher um die zwanzig, aber sie hatte sich etwas von ihrer jugendlichen Frische bewahrt. Dougall vermutete, dass sie Danvries’ Frau war, was bedeutete, dass er ein verdammt glücklicher Mann sein musste, denn in der dämmrigen Halle schien sie genauso zu strahlen wie das Feuer. Ihr Kleid – hellrosa mit einem weißen Saum – betonte ihre wohlgeformte Gestalt. Goldschimmernde Locken rahmten ihr Gesicht wie eine Art Heiligenschein und fielen ihr weich über Schultern und Rücken. Den Blick hielt sie auf eine Nadelarbeit gesenkt, mit der sie gerade beschäftigt war, aber sie sah kurz auf, als Danvries nach Bier rief. Dougall musterte sie jetzt genauer. Herzförmige Lippen, große Rehaugen und eine gerade, kleine Nase in dem ovalen Gesicht, was sie zu einer der eindrucksvollsten Frauen machte, die er jemals gesehen hatte. Danvries konnte sich eindeutig glücklich schätzen.
»Kommt, setzt Euch.«
Dougall riss sich von dem Anblick der Frau am Feuer los; erst jetzt bemerkte er, dass er stehen geblieben war. Der Engländer hatte längst den Tisch in der großen Halle erreicht, aber er stand immer noch an der Tür, ebenso wie seine Brüder hinter ihm. Eine Spur von Erheiterung zeigte sich in Danvries’ Miene; ganz offensichtlich war er daran gewöhnt, dass Männer seine Frau angafften.
Dougall zwang sich, weiterzugehen und ließ sich am Tisch auf der Bank nieder, auf die Danvries deutete. Sofort fiel ihm auf, dass er von seinem Platz aus die Frau sehen konnte. Die Frauen, berichtigte er sich rasch, denn neben der blonden Herrin der Burg saß eine dunkelhaarige Zofe, die ebenfalls mit einer Nadelarbeit beschäftigt war. Allerdings schien die Schönheit der Lady alles zu überstrahlen und die Zofe regelrecht in den Schatten zu stellen – hatte er doch erst jetzt bemerkt, dass sie überhaupt da war.
»Meine Schwester«, sagte Danvries ruhig.
Seine Schwester? Die Worte hallten einen Moment in Dougall nach, dann verspürte er eine Art Erleichterung, die er sich nicht erklären konnte. Ganz sicher war sie nicht die vertrocknete alte Jungfer, von der Conran gesprochen hatte, aber spielte es für ihn eine Rolle, ob sie Danvries’ Frau oder Schwester war? Das tat es nicht, versicherte er sich selbst, und wandte sich entschlossen seinem Gastgeber zu, hielt aber inne, als er bemerkte, dass Danvries seine Schwester mit einem Blick musterte, in dem eindeutig etwas Berechnendes lag. Es machte Dougall nachdenklich, und er sagte: »Was die Bezahlung der Pferde betrifft …?«
»Ah, ja.« Danvries lächelte etwas angespannt. »Eure Pferde entsprechen natürlich ganz und gar der Qualität, die man mir versichert hat. Lord Hainsworth hat nicht übertrieben, als er von Eurer Fähigkeit berichtete, exzellente Stuten und Hengste zu züchten.«
Dougall nickte. Er wartete auf das »Aber«.
»Allerdings«, begann Danvries, und Dougall musste sich Mühe geben, nicht die Augen zu verdrehen. Aber, allerdings … welches Wort der Mann auch wählte, es war ein »Aber«.
»Allerdings?«, drängte Dougall ihn, als er nicht weitersprach.
»Nun, das Geld für Euch lag bereit, doch dann hatte ich ein bisschen Pech.«
Die Wette mit dem König, dachte Dougall. Das war kein Pech gewesen, sondern Dummheit. Der englische König gewann stets alle Wetten und hatte, welch kluger Schachzug, im Turnier La Bête unterstützt. Dass Danvries gegen La Bête gesetzt hatte, obwohl der Krieger doch noch nie verloren hatte, war einfach … nun, es war schiere Dummheit gewesen. Eine Dummheit, die allerdings nicht Dougalls Problem war, abgesehen davon, dass er diese Reise jetzt vergebens gemacht hatte.
Seufzend stand er auf und nickte. »Ihr wollt die Pferde also nicht.«
»Nein, nein, ich will sie«, entgegnete Danvries rasch. Er packte Dougall am Arm, und sofort sprangen Dougalls Brüder auf. Dougall blickte auf Danvries’ Hand an seinem Arm, und der Mann nahm sie sofort wieder weg. »Verzeiht. Bitte setzt Euch, so setzt Euch doch wieder. Ich möchte die Pferde haben. Natürlich möchte ich das.«
»Ihr könnt sie nur nicht bezahlen«, stellte Dougall klar. Er stand immer noch.
»Nein. Ich meine, aye. Aye, ich kann es«, berichtigte sich Danvries rasch. »Natürlich kann ich es.«
Als Dougall weiterhin stehen blieb und einfach nur abwartete, schlich sich ein Hauch von Gereiztheit in Danvries’ Stimme. »Setzt Euch wieder, damit wir darüber sprechen können. Ich kriege Genickstarre, wenn ich noch lange so zu Euch hochsehen muss.«
Dougall bezweifelte, dass es noch viel zu besprechen gab. Entweder konnte der Engländer die Pferde bezahlen oder nicht. Als in diesem Moment eine Dienerin an den Tisch kam und Bier brachte, ließ er sich wieder auf der Bank nieder. Seine Brüder folgten rasch seinem Beispiel. Sie hatten einen langen, staubigen Ritt hinter sich, und er beschloss, Danvries so viel Zeit zu lassen, wie er brauchte, um sein Bier zu trinken. Wenn der Mann bis dahin nicht in der Lage war, das Geld auf den Tisch zu legen, würde er gehen und die Pferde wieder mitnehmen.
Dougall nickte der Dienerin dankend zu und trank einen Schluck Bier, während sein Blick wieder zu der blonden Frau beim Feuer wanderte. Sie und ihre Zofe unterhielten sich jetzt leise miteinander und sahen immer wieder zum Tisch herüber.
»Ich bin mir sicher, dass ich nur ein paar Wochen brauche, um das Geld zu beschaffen«, verkündete Danvries in diesem Moment und zog damit Dougalls Aufmerksamkeit wieder auf sich.
Schroffe, überlaute Worte, dachte Dougall. Sie sind Ausdruck seiner Angst. Es überraschte ihn nicht, und er nickte bedächtig. »Ich kann die Pferde ein paar Wochen für Euch zurückhalten. Wenn Ihr das Geld habt, könnt Ihr kommen und sie holen. Aber ich kann Euch nichts versprechen. Wenn ihr bis gegen Ende des Monats nicht gekommen seid –«
»Nein, nein«, unterbrach Danvries ihn. »Ihr versteht nicht. Ich brauche sie jetzt. Ich kann unmöglich ohne ein Pferd sein. Ich –«
»Was ist mit Eurem Pferd passiert?«, unterbrach Dougall ihn.
Danvries wandte den Blick zur Seite. Seine Lippen verzogen sich unwillig. Schließlich beugte Conran sich zu Dougall und murmelte: »Sie waren Teil der Wette.«
Dougall seufzte. Der Mann würde vermutlich auch noch sein Leben verspielen. Kopfschüttelnd sagte er: »Ihr habt doch Pferde. Ich habe etwa dreißig im Stall stehen sehen, und –«
»Die gehören meinen Männern, nicht mir«, sagte Danvries steif und fügte dann hinzu: »Ich brauche ein Pferd. Ein Lord ohne Pferd ist wie ein König ohne Land.«
»Und ein Handel ohne Bezahlung ist überhaupt kein Handel«, entgegnete Dougall. Es fiel ihm schwer, Verständnis für den Mann aufzubringen, Mitgefühl mit jemandem zu haben, der sich wissentlich und aus Dummheit um sein Pferd und sein Geld brachte. Zur Zeit des Großvaters dieses Mannes hatte Danvries zu den reichsten Besitztümern Englands gehört. Nach dem Tod des Alten war das ganze Erbe an den jetzigen Danvries gefallen. Wie Dougall zu Ohren gekommen war, hatte der jedoch alles verspielt, indem er das Geld zum Fenster hinausgeworfen und mit verlorenen Wetten durchgebracht hatte. Damals hatte Dougall den Gerüchten nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Im Gegensatz zu seinem Bruder, wie es schien.
»Ihr werdet bezahlt. Ich brauche nur etwas Zeit, um die Mittel zusammenzubekommen«, sagte Danvries beinahe flehend. »Sicherlich könnt Ihr mir für eine kurze Zeit einen Kredit gewähren?«
Dougall musterte den Mann, dann schweifte sein Blick zu der Schwester. Sie starrte auf ihre Nadelarbeit, arbeitete aber nicht daran. Er vermutete, dass sie dem Gespräch lauschte. Für einen kurzen Moment überlegte er, Danvries um ihretwillen den benötigten Kredit zu gewähren. Immerhin kaufte der Mann nicht nur für sich einen Hengst. Die Stute, so vermutete Dougall, war für seine Schwester gedacht. Anscheinend hatte Danvries auch ihr Pferd bei der Wette verloren, und es war eine Schande, dass sie unter dem egoistischen Verhalten ihres Bruders leiden sollte. Doch dann schüttelte Dougall den Kopf. Er gewährte nie einen Kredit. Er bestand stets darauf, dass die Tiere sofort bezahlt wurden, und er hielt nichts davon, diese Vorgehensweise jetzt zu ändern. Ganz besonders nicht bei einem Mann, der sich durchs Spielen so tief in Schulden gestürzt hatte. Dougall bezweifelte, dass es ihm je gelingen würde, sich daraus wieder zu befreien.
»Ich gewähre keine Kredite«, erklärte er ruhig und stand auf.
»Wartet.« Danvries ergriff ihn wieder am Arm. Verzweiflung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Er schaute sich hektisch um, suchte anscheinend nach etwas, das er Dougall geben oder mit dem er ihn davon überzeugen konnte, ihm einen Kredit einzuräumen. Dougall drehte sich der Magen um, als Danvries’ Blick an seiner Schwester hängen blieb. Er würde doch wohl nicht –
»Meine Schwester.«
Dougall zog die Augen zusammen.
»Lasst die Pferde hier, und nehmt sie mit«, sagte Danvries.
»Ich bin im Augenblick nicht auf der Suche nach einer Frau«, sagte Dougall trocken.
»Ich habe nicht gesagt, dass Ihr sie heiraten müsst«, entgegnete Danvries sofort.
Dougall starrte den Mann finster an, dann beschloss er, ihn absichtlich misszuverstehen – in der Hoffnung, dass er sich daraufhin eines Besseren besinnen würde. »Ich soll sie als eine Art Schuldschein mitnehmen? Als eine Geisel, bis Ihr für die Pferde gezahlt habt?«
Danvries zögerte, den Blick immer noch auf seine Schwester gerichtet. Dann wandte er sich wieder Dougall zu, und seine Miene drückte Entschiedenheit aus. »Ihr könnt sie auch als Bezahlung nehmen. So lange, bis Ihr meint, dass der Preis für Eure Pferde abgegolten ist. Natürlich müsst Ihr sie mir irgendwann einmal zurückgeben.«
Dougalls Blick richtete sich auf die beiden Frauen am Feuer, als dort jemand hörbar nach Luft schnappe. Offenbar hatte Danvries’ Schwester sie beobachtet, denn er sah gerade noch das Entsetzen in ihrem Blick, bevor sie abrupt den Kopf abwandte. Wäre Dougall von Danvries’ Angebot angetan gewesen – und wenn er ehrlich war, hatte die Vorstellung, diese Frau in seinem Bett zu haben, durchaus etwas Verführerisches –, hätte spätestens diese Reaktion genügt, um es ihn ablehnen zu lassen. Er hatte noch nie eine Frau in sein Bett gezwungen, und er hatte nicht vor, jetzt damit anzufangen.
Er sah Danvries an, und eine Woge von Abneigung stieg in ihm auf. Dem Mann war das Mädchen so egal, dass er sie als Liebesdienerin verschachern würde, um in den Besitz der Pferde zu kommen. Dougall bezweifelte jetzt, dass eines der Tiere für sie gedacht gewesen war. Die Stute war wohl eher für eine andere Frau bestimmt, Danvries’ Verlobte vielleicht. Sofern er eine hatte. »Mit diesem Angebot beschämt Ihr Eure Schwester, Euch selbst und mich.« Er wandte sich an seine Brüder. »Wir sind hier fertig.«
Er hätte sich nicht die Mühe machen müssen, das zu sagen, denn Conran, Geordie und Alick hatten sich ebenfalls bereits erhoben.
Als die Schotten sich anschickten zu gehen, atmete Murine auf und holte tief Luft. Ihr war, als hätte sie die Luft angehalten, seit ihr Bruder sie den Schotten als Tausch gegen die Pferde angeboten hatte. Ihr war immer noch schwindelig. Auch wenn zwischen ihr und Montrose nur wenig Zuneigung bestand, konnte sie einfach nicht glauben, dass er das tatsächlich getan hatte. Sie waren nicht zusammen aufgewachsen, genau genommen hatten sie erst Zeit miteinander verbracht, seit Montrose nach dem Tod ihres Vaters die Vormundschaft für sie übernommen hatte. Trotzdem war er ihr Bruder, und sie war seine Schwester und sein Mündel, und die Vorstellung, dass er sie jemandem anbot, als wäre sie eine Dirne …
Murine schluckte und erhob sich steif. Sie wollte so schnell wie möglich die Halle verlassen, um nach diesem abscheulichen Tun ihres Bruders jeden Kontakt mit ihm zu vermeiden. Sie schaute zu Beth, die ebenfalls aufgestanden war und bereit war, ihr zu folgen. Erleichtert beeilte Murine sich, die Treppe zu erreichen. Sie hatte kaum die ersten Stufen genommen, als sie Montrose schreien hörte: »Nein. Bitte wartet! Wenn Ihr nicht – ich kann Euch das Geld geben.«
Murine schaute sich um, während sie weiter rasch die Treppe hinaufstieg. Sie sah, dass der Anführer der Schotten angewidert den Kopf schüttelte, während er auf die großen Türen der Halle zuging.
»Noch heute Abend!«, fügte Montrose hinzu, und jetzt klang er eindeutig verzweifelt. »Ihr könnt hier ein gutes Mahl zu Euch nehmen und Euch ausruhen, und heute Nacht habe ich das Geld.«
Murine sah, dass der Schotte an der Tür stehen blieb und sich zu Montrose umdrehte. Er starrte ihn an, als wäre er ein Insekt, das unter einem Stein hervorgekrabbelt war. Als sein Blick dann zu der Stelle glitt, an der sie und Beth gesessen hatten, brachte sie eilig auch die letzten Stufen hinter sich, nur für den Fall, dass er sich umdrehte und sie suchte. Murine sah erst wieder nach unten, als sie sich im Schutz des im Dunkeln liegenden oberen Absatzes befand. Dort blieb sie stehen und schaute in die Halle hinunter, um die Männer genauer zu betrachten. Bis jetzt hatte sie es nicht gewagt, mehr als kurze, verstohlene Blicke auf die Besucher zu werfen. Doch nun konnte sie sich die Schotten genauer ansehen.
Alle vier waren groß und stark und hatten dunkle Haare, aber Murines Blick kehrte wieder zu demjenigen zurück, der ihr Anführer zu sein schien. Sie wusste nicht, warum. Sie alle sahen gut aus, aber aus irgendeinem Grund fand sie ihn unwiderstehlich. Er war ganz offensichtlich wütend und angewidert von dem Vorschlag ihres Bruders, aber das waren die anderen auch. Als er vor wenigen Augenblicken zum Feuer und zu ihr gesehen hatte, war allerdings in seinen Augen noch etwas anderes gewesen. Nicht Mitleid, sondern schlichte Besorgnis und vielleicht sogar Anteilnahme.
»Ich kann Euch noch heute Nacht das Geld geben. Spätestens morgen früh«, wiederholte Montrose und zog damit Murines Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Mein Nachbar und Freund Muller hat schon seit Langem ein Auge auf meine Schwester geworfen. Er wird mir das Geld geben, wenn er dafür die Möglichkeit erhält, Zeit mit ihr verbringen zu dürfen.«
Murine schlug vor Schreck die Hand vor den Mund, um den Schrei zu unterdrücken, der in ihrer Kehle aufstieg. Es war schon schlimm genug, dass ihr Bruder sie, um an Pferde zu kommen, diesen Schotten geben wollte, aber Muller? Ihr drehte sich der Magen um. Der Schotte war so freundlich und ritterlich gewesen, das Angebot auszuschlagen. Muller würde das nicht tun. Er würde die Möglichkeit ergreifen und sich nicht darum scheren, ob sie es wollte oder nicht. Sie würde nichts weiter sein als –
»Ich werde nicht dabei helfen, aus der Lady – Eurer Schwester – eine Hure zu machen.«
Murine zuckte zusammen, als er genau das aussprach, was sie gedacht hatte.
»Die Pferde sind für Euch nicht mehr verkäuflich, ganz egal, ob Ihr Geld habt oder nicht«, fügte der Schotte mit kalter Stimme hinzu.
Als er sich auf dem Absatz umdrehte und den Wohnturm dicht gefolgt von seinen Männern verließ, wünschte Murine sich fast, sie könnte hinter ihnen herlaufen und mit ihnen weggehen. Stattdessen wirbelte sie herum, packte Beth am Arm und drängte sie den Korridor entlang in ihr Zimmer. Sie musste weg von hier, und zwar schnell. Montrose würde keine Zeit verlieren, seinen Plan in die Tat umzusetzen, und wenn Muller kam, um sich seine Beute zu holen, musste sie schon weit weg von hier sein.
Als Murine die Tür ihres Zimmers hinter sich geschlossen hatte, sah sie sich grimmig um. Sie wandte sich an Beth. »Hol mir bitte einen leeren Beutel aus der Küche. Aber achte darauf, dass dich dabei niemand sieht.«
Beth nickte und wartete kaum ab, dass Murine zu Ende gesprochen hatte. Während sie forteilte, hastete Murine zu den Truhen an der Wand, kramte in ihren Sachen und versuchte zu entscheiden, was sie mitnehmen konnte und was nicht. Es würde am besten sein, wenn sie mit leichtem Gepäck reiste. Ein Ersatzkleid, ein Ersatzunterkleid, ein paar Münzen …
Sie presste die Lippen zusammen, als sie daran dachte. Sie hatte nur noch die wenigen Münzen, die sie den Schotten für die Mühe hatte geben wollen, ihren Brief mitzunehmen. Jetzt würde sie ihn selbst überbringen und dafür das Geld benötigen.
Als Beth zurückkehrte, hatte Murine die wenigen Dinge herausgesucht, die sie mitnehmen wollte. Sie hatte das Kleid und Unterkleid sogar schon zusammengerollt und wartete darauf, es in den Beutel zu stecken.
Die Zofe reichte ihr den Beutel, den sie aus der Küche geholt hatte, während sie stirnrunzelnd die wenigen Habseligkeiten betrachtete. »Ihr flieht?«
»Aye«, bestätigte Murine entschlossen.
Beth zögerte, dann fragte sie besorgt: »Seid Ihr sicher, dass das eine gute Entscheidung ist, Mylady?«
Erneut presste Murine die Lippen zusammen. Sie nickte wortlos, während sie das zusammengerollte Kleid in den Beutel stopfte.
»Aber selbst in den besten Zeiten ist das Reisen gefährlich, sogar mit einer großen Gruppe. Und eine Frau allein …« Beth schüttelte den Kopf. »Könnten wir nicht Lady Joan eine Nachricht zukommen lassen? Oder Lady Saidh? Ich bin mir sicher, dass sie Euch eine Eskorte schicken.«
»Montrose schreibt wahrscheinlich gerade in diesem Moment seine Nachricht mit dem Angebot an Muller«, sagte Murine heftig. »Wenn ich jetzt nicht gehe, bin ich spätestens heute Nacht ganz sicher ruiniert.«
»Aber, Mylady«, sagte Beth mit Tränen in den Augen. »Ihr könnt nicht allein reisen. Banditen könnten Euch töten … oder Euch noch Schlimmeres antun.«
Murine verharrte kurz, als sie das hörte. Sie dachte an ihre Brüder Colin und Peter, die zwei Jahre zuvor während einer Reise getötet worden waren, aber dann schüttelte sie den Kopf und schob ein leinenes Unterkleid in den Beutel. »Es gibt Dinge, die sind schlimmer als der Tod, Beth. Und hierzubleiben, wo ich von meinem eigenen Bruder verkauft werde …« Sie schüttelte verbittert den Kopf. »Danke, aber ich denke, ich werde das Risiko einer Reise auf mich nehmen.«
Beth schwieg einen Moment, und widerstreitende Gefühle flackerten in ihrem Gesicht auf. Schließlich straffte sie die Schultern und sagte fest: »Dann begleite ich Euch.«
Murine zögerte. Das Angebot war zweifellos verführerisch. Dann jedoch seufzte sie und schüttelte den Kopf. »Nein, das wirst du nicht tun. Du bleibst hier.«
»Aber –«
»Es ist wichtig für mich, dass du mir hilfst, indem du hierbleibst und vertuschst, dass ich weggegangen bin«, unterbrach Murine sie rasch.
Beth schwieg einen Moment, dann fragte sie unsicher: »Wie soll ich das tun?«
»Bleib hier in meinem Zimmer. Wenn Montrose herkommt und nach mir sucht, behaupte, dass ich schlafe und schicke ihn wieder weg«, erklärte Murine, während sie fertig packte und dann den Beutel zuband. Sie bezweifelte, dass die Täuschung wirklich funktionieren würde. Sie benutzte sie hauptsächlich, um ihre Zofe davon abzuhalten, sich ihr anzuschließen. Auch so bestand nur wenig Hoffnung, dass ihr die Flucht wirklich gelingen würde. Vermutlich würde man sie verfolgen und zurückbringen, noch ehe die Nacht vorüber war. Aber wenn sie tatsächlich davonkam … nun, wie Beth gesagt hatte, es war gefährlich auf der Straße. Es war eine Sache, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um ihre Ehre zu bewahren. Etwas ganz anderes war es, Beths Leben zu riskieren.
»Wohin werdet Ihr gehen?«, fragte Beth besorgt, während sie ihr zur Tür folgte.
»Ich schleiche mich über die Hintertreppe zur Küche und von dort aus zu Henry und dann –«
»Nein, ich meine, wohin werdet Ihr gehen, wenn Ihr Danvries verlassen habt?«, unterbrach Beth sie.
»Oh.« Murine atmete geräuschvoll aus und zuckte dann hilflos mit den Schultern. »Zu Saidh. Buchanan liegt am nächsten, und sie hat gesagt, dass ich nicht zögern sollte, mich an sie zu wenden, wenn ich jemals Hilfe brauchen würde. Und die brauche ich im Augenblick ganz sicher.«
»Aye, die braucht Ihr«, bestätigte Beth ernst. Und dann umarmte sie Murine kurz. »Seid vorsichtig, Mylady, und seht zu, dass Ihr unversehrt bleibt.«
»Das werde ich«, flüsterte Murine, löste sich von der Zofe und zwang sich zu einem Lächeln. »Ich werde nach dir schicken … wenn es mir möglich ist.«
»Oh, macht Euch um mich keine Sorgen. Mir wird nichts geschehen. Passt nur gut auf Euch selbst auf«, sagte Beth tapfer und strich eine Träne beiseite.
Murine drückte ihr sanft den Arm, dann öffnete sie die Tür ihres Zimmers und spähte vorsichtig hinaus. Als sie feststellte, dass die Halle leer war, glitt sie aus dem Zimmer und eilte zur Treppe.
»Ich kann nicht glauben, dass der Mistkerl versucht hat, für ein paar Pferde seine Schwester zu verkaufen.«
Dougall verzog das Gesicht und sah seinen Bruder Conran an, als der sich so empört äußerte. Nach den unerfreulichen Ereignissen bei Danvries waren sie zur Dorfschenke geritten, um dort etwas zu essen, bevor sie sich auf den langen Rückweg machten. Ihre Unterhaltung hatte sich darum gedreht, wem sie die Stute und den Hengst jetzt verkaufen könnten, und was wohl in der Zwischenzeit zu Hause passiert sein mochte. Um Danvries’ Schwester nicht noch mehr zu beschämen, indem sie im Dorf vor aller Ohren über sie sprachen, hatten sie die Sache mit Danvries’ Angebot mit keiner Silbe erwähnt … bis jetzt, da sie weiterritten und sich anschickten, Danvries’ Land hinter sich zu lassen.
»Aye«, bestätigte Dougall ruhig.
»Es scheint dich nicht sonderlich zu überraschen.«
»Die Menschen können mich kaum noch überraschen«, sagte Dougall grimmig, dann fügte er etwas weniger düster hinzu: »Überrascht hat mich allerdings, dass du so freundlich warst, im Dorf nicht darüber zu sprechen, sondern es erst jetzt tust.«
»Das war keine Freundlichkeit«, wiegelte Conran schnell ab. »Ich wollte mir nur nicht das Essen verderben. Ich hätte Verdauungsprobleme bekommen.«
»Oh, aye, natürlich«, pflichtete Dougall ihm amüsiert bei. Er wusste, dass es nicht stimmte. Conran wollte nur einfach nicht gern als weichherzig erscheinen. Andererseits drehte auch ihm sich gerade der Magen um, als sie darüber sprachen.
»Du weißt, dass er versuchen wird, sie an seinen Freund zu verkaufen, seit ihm diese Idee gekommen ist«, sagte Conran mir schwerer Stimme.
»Aye. Er wird sie benutzen, um so viel Geld wie möglich zu bekommen, mit dem er spielen kann«, sagte Dougall angewidert, während er im Geiste die strahlend schöne Frau vor sich sah.
»Sofern sie es zulässt«, meinte Conran mit einem Schulterzucken. »Vielleicht weigert sie sich.«
»Hm«, murmelte Dougall, der bezweifelte, dass sie bei der Sache irgendein Mitspracherecht hatte. Sie war zwar bereits im heiratsfähigen Alter, aber Danvries war ganz offenbar ihr Vormund. »Wieso ist sie eigentlich noch nicht verheiratet?«
Conran zuckte mit den Schultern. »Wie ich schon sagte, er hat ihre Mitgift verspielt.«
»Aye, aber wie ist das möglich? Sie hätte geschützt sein müssen.« Dougall runzelte die Stirn. »Und sie hätte schon als Kind verlobt werden und die Verlobung hätte zu einer Ehe führen müssen.«
»Vielleicht ist ihr Verlobter gestorben«, gab Conran zu bedenken. »Und ich bin mir sicher, dass der König eingeschritten wäre und es Danvries nicht erlaubt hätte, ihre Mitgift zu verspielen – wäre nicht er selbst derjenige gewesen, der die Einsätze eingeheimst hat.«
»Dann wird sie also niemals heiraten«, meinte Dougall nachdenklich.
»Und ihr Leben lang auf die Gnade ihres Bruders angewiesen sein«, bemerkte Conran und schüttelte den Kopf.
»Gütiger Gott«, seufzte Dougall und spürte leichte Gewissensbisse, weil er das Angebot des Mannes ausgeschlagen hatte. Zumindest wäre er nett zu ihr gewesen, und vielleicht hätte sich alles gefügt. Nun, er war mit seiner Pferdezucht ziemlich wohlhabend geworden. Er hatte nur deshalb noch keinen eigenen Besitz, weil sein älterer Bruder Aulay ihn gebraucht hatte, nachdem ihre Eltern gestorben waren und sie beide die jüngeren Brüder und die Schwester hatten großziehen müssen. Eine Mitgift war für ihn nicht unbedingt die Voraussetzung, wenn es um eine Ehefrau ging. Andererseits kannte er die Frau nicht. Sie war zwar sehr hübsch, aber ihr Bruder war ein schwacher Mann und hatte einige schlechte Eigenschaften, zu denen das Trinken und Spielen zählten. Darüber hinaus schien er auch keine allzu große Charakterstärke zu besitzen. Nach allem, was Dougall wusste, könnte das auch auf sie zutreffen. Allerdings erinnerte er sich auch daran, wie sie nach Luft geschnappt hatte, als ihr Bruder sie ihm angeboten hatte.
Dougall schob den Gedanken beiseite. Er hatte keinen Grund, sich schuldig zu fühlen. Er kannte das Mädchen nicht einmal.
»Es ist eine Schande«, sagte Conran ruhig. »So ein hübsches Mädchen.«
Dougall nickte nur. Sie war wirklich hübsch.
»Sie wirkte süß und sittsam«, bemerkte Geordie auf der anderen Seite von ihm, als er schwieg.
»Aye, das stimmt«, seufzte Dougall. »Vielleicht durchkreuzt es ja seine Pläne, dass ich mich geweigert habe, ihm die Pferde überhaupt zu verkaufen, ob er nun das Geld hat oder nicht.«
»Vielleicht im Augenblick«, meinte Conran zweifelnd. »Ich befürchte allerdings, dass er nicht von der Hoffnung lassen wird, du würdest deine Meinung ändern, wenn er dir das Geld zeigt. Auf der anderen Seite könnte er überall Pferde kaufen … wenn er die Mittel dafür hat.«
Dougall hatte kein Interesse, diesen Gesprächsfaden weiter zu verfolgen, daher schwieg er. Er hatte etwas gegen die Vorstellung, dass die Frau trotzdem wie eine billige Dirne verkauft werden könnte. Abgesehen davon hatte er ein Stück voraus auf dem Pfad etwas entdeckt und war abgelenkt durch den Versuch, zu erkennen, was es war.
Conran folgte seinem Blick, als er bemerkte, dass Dougall sich im Sattel aufgerichtet hatte. Er blinzelte. »Sieht aus wie jemand auf dem Rücken eines Pferdes, aber …«
»Aber es ist ein sehr seltsames Pferd«, murmelte Dougall. Es sah klein und breit aus, eine stämmige Kreatur, die sich irgendwie unbeholfen voranbewegte.
»Reitet der da auf einer Kuh?«, fragte Conran überrascht, als sie sich näherten.
»Auf einem Bullen«, berichtigte Dougall ihn, als der Reiter sich im Sattel zurechtrückte und ein Horn in Sicht geriet. »Und wenn ich mich nicht irre, ist der da eine Sie. Denn er oder sie scheint mir ein Kleid zu tragen.«
»Hm«, murmelte Alick hinter ihnen. »Ein rosafarbenes Kleid. So was hat Lady Danvries getragen.«
»Aye, das hat sie«, pflichtete Dougall ihm bei und drängte sein Pferd rascher voran.
»Verdammt«, sagte Murine leise zu sich selbst, als sie das herannahende Pferd bemerkte. Sie hatte die Reiter erst wenige Augenblicke zuvor gesehen und bemerkt, dass es die Schotten waren, denen Montrose Pferde hatte abkaufen wollen. Es hätte schlimmer sein können. Montrose hätte herausgefunden haben können, dass sie geflohen war, und ihr folgen können. Trotzdem war auch das hier schlimm genug. Immerhin waren dies die Männer, an die ihr Bruder sie hatte verkaufen wollen, und die Peinlichkeit und Scham, die mit dem verbunden war, was er getan hatte, überwältigten sie. Lieber wäre ihr gewesen, sie hätte sie nie wiedergesehen.
»Mylady.«
Murine hielt den Blick starr geradeaus gerichtet, in der Hoffnung, dass die Männer sie einfach in Ruhe und weiterreiten lassen würden, wenn sie so tat, als würde sie ihn nicht hören.
»Lady Danvries«, sagte der Mann jetzt etwas lauter, und als sie wieder nicht reagierte, fügte er hinzu: »Euer Bruder hat nicht erwähnt, dass Ihr taub seid, als er Euch mir angeboten hat. Ich hätte es mir natürlich denken können. Er ist offensichtlich ein Betrüger und Mistkerl, also ist es nicht verwunderlich, dass er versucht hat, mir als Tausch für erstklassige Tiere ein mit einem Makel behaftetes Mädchen anzubieten.«
Murine schnappte wütend nach Luft, gab ihre vorgetäuschte Schwerhörigkeit auf und starrte den Mann finster an. »Ich bin nicht mit Makeln behaftet«, schnappte sie. »Und Ihr wärt gut dran gewesen, wenn Ihr mich bekommen hättet, denn ich bin hundertmal mehr wert als Eure Pferde.«
Als er daraufhin einen Mundwinkel und eine Augenbraue hochzog, ging ihr auf, was sie gesagt hatte. »Nicht, dass ich mich auf so einen beschämenden Handel eingelassen hätte.« Sie blickte wieder nach vorn und murmelte: »Mein Bruder hat offensichtlich den Verstand verloren, dass er so tief gesunken ist.«
»Und deshalb seid Ihr weggelaufen, bevor er Euch jemand anderem anbietet, der nicht so ehrenhaft ist wie ich und vielleicht zugreifen würde?«
Murine presste die Lippen vor Missfallen zu einer dünnen Linie zusammen. Das war genau das, was sie tat … oder zu tun versuchte. Aber jetzt machte sie sich Sorgen darüber, dass dieser Mann irgendwie eingreifen und ihre Flucht zunichtemachen könnte.
»Dougall.«
Murine sah sich bei dem Ruf um und riss die Augen auf, als sie sah, dass seine Männer, die sich bisher ein kleines Stück zurückgehalten hatten, jetzt ihre Pferde eilig vorwärtstrieben.
»Was ist, Conran?«, fragte Dougall stirnrunzelnd.
»Reiter«, erklärte der Angesprochene, dabei besorgt zu Murine blickend. »Und ich glaube, es sind Danvries’ Männer, die ihre Lady suchen und zurückbringen wollen.«
Leise fluchend begann Murine, ihren Bullen auf die Bäume zuzulenken, um sich dort zu verstecken. Pferde verstellten ihr jedoch den Weg, als die Männer sie einholten und umringten.
»Dafür reicht die Zeit nicht, Mylady«, sagte Conran mitfühlend. »Sie sind schnell, Ihr würdet es nicht rechtzeitig schaffen.«
»Dann müssen wir für ihren Schutz sorgen«, sagte Dougall grimmig. »Stellt euch um sie herum auf, bedeckt ihre Haare und ihr Kleid. Ich werde mit den Reitern sprechen.«
Murine öffnete den Mund, um dagegen zu protestieren, aber dann landete eine Kappe auf ihrem Kopf, und sie keuchte verblüfft auf.
»Steckt die Haare darunter, Mädchen«, sagte einer.
»Und hier, hängt euch das um, damit Euer hübsches Kleid nicht zu sehen ist«, sagte ein anderer.
Murine wehrte sich nicht, sondern schob unbeholfen die Haare unter die Kappe, dann zog sie das Plaid enger um sich und sah zu den Schotten und den Pferden hin. Ihr Bulle war ein gutes Stück kleiner als die Reittiere der Männer, was half, den Teil ihres Kleides zu verdecken, den das Plaid aussparte. Aber es gab jetzt nur die drei Männer und die beiden reiterlosen Pferde, die sie ihrem Bruder hatten verkaufen wollen.
»Vielleicht sollten wir …« Statt den Vorschlag ganz auszusprechen, warf ihr plötzlich jemand noch ein Plaid zu, das ihren Kopf bedeckte. Dann spürte sie, wie jemand sie wortlos drängte, sich dicht an den Rücken des Bullen zu schmiegen. In dieser Position bekam Murine unter dem schweren Stoff zwar nur mühsam Luft, aber sie achtete nicht weiter darauf, hoffte vielmehr inständig, dass es genügen würde, schloss die Augen und betete.
Dougall schaffte es, den Pfad etwa zwanzig Fuß zurückzureiten, bevor die herannahenden englischen Reiter ihn erreichten. Er hoffte, weit genug entfernt von der Frau zu sein, die seine Brüder zu verstecken versuchten. Sollte dies nicht so sein, gab es nichts, das er tun konnte. Dann mussten sie entscheiden, ob sie für das Mädchen kämpfen wollten oder nicht, und er war sich noch nicht sicher, ob er das tun wollte. Dass sie es dabei mit einer Überzahl an Gegnern zu tun haben würden, spielte keine Rolle. Er und seine Brüder waren erfahrene Kämpfer, die es leicht mit zwanzig schwerfälligen, schlecht ausgebildeten englischen Soldaten aufnehmen konnten. Aber er fragte sich, ob Lady Danvries es wert war, für sie zu kämpfen und zu töten. Sollte sie auch nur ein wenig wie ihr Bruder sein, war sie es ganz gewiss nicht … und genau genommen ging ihn das alles auch gar nichts an. Vermutlich würde er eine spontane Entscheidung treffen müssen.
»Hat Danvries doch noch das Geld für die Pferde aufgetrieben?«, begrüßte er leichthin die Reiter, nachdem diese bei ihm angehalten hatten.
»Nein.« Der Mann an der Spitze des Trupps schaute an Dougall vorbei zu dessen Brüdern. »Wir suchen nach Lord Danvries’ Schwester«, sagte er, als er den Blick wieder auf Dougall richtete. »Sie ist ausgeritten und noch nicht zurückgekehrt. Ihr Bruder macht sich Sorgen.«
»Ausgeritten, sagt Ihr?«, fragte Dougall und gab sich überrascht. »Seid Ihr sicher? Ich hatte es so verstanden, dass sie gar kein Pferd besitzt. Abgesehen davon saß sie in der Halle, als wir ankamen, und ich bin mir sicher, dass sie die Treppe hinaufgegangen ist, bevor wir aufgebrochen sind.«
»Aye.« Der Mann runzelte die Stirn und warf einen Blick zurück auf den Weg, den er gekommen war. »Soviel ich weiß, ist sie nach Euch gegangen. Und bis wir jetzt auf Euch gestoßen sind, ist sie uns nicht begegnet. Sie muss einen anderen Weg genommen haben.«
»Das klingt sinnvoll«, pflichtete Dougall ihm bei und dachte, dass es tatsächlich sinnvoll klang, wenn man nicht wusste, dass er und seine Brüder noch einmal Halt gemacht und etwas gegessen hatten, bevor sie weitergeritten waren, um Danvries’ Land zu verlassen.
Der Mann nickte. »Gute Reise«, sagte er brüsk und wendete sein Pferd in die Richtung, aus der er mit seinen Leuten gekommen war.
»Gleichfalls«, entgegnete Dougall fröhlich und lächelte, während er zusah, wie der englische Soldat und seine Männer davonritten. Er hatte nicht einmal lügen müssen. Bei Gott, waren diese Engländer dumm. Allerdings hatte er jetzt diese Frau am Hals, um die er sich kümmern musste. Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht, als ihm das klar wurde.
Na schön. Dougall schüttelte den Kopf und ritt zurück zu seinen Brüdern.
»Sie haben nach dem Mädchen gesucht, oder?«, fragte Conran, während er zur Seite wich, damit Dougall sein Pferd neben den Bullen der Frau lenken konnte.
»Aye.« Dougall schaute auf Lady Danvries und erwartete, dass sie ihm für seine Hilfe danken würde. Aber sie schien eine wahre Engländerin zu sein, denn sie weigerte sich, ihn auch nur anzusehen. Sie hing noch immer vornübergebeugt auf ihrem Bullen, bedeckt von dem Plaid.
Mit finsterer Miene zog Dougall den Plaid fort und beeilte sich dann, die Frau aufzufangen, als sie vom Rücken des Tieres zu rutschen begann.
»Verflixt«, sagte Conran angewidert, als Dougall die bewusstlose Frau zu sich auf sein Pferd zog, um sie anzusehen. »Sieht so aus, als wäre sie uns gestorben. Das könnte Probleme mit den Engländern geben.«
»Nein, sie ist nur ohnmächtig«, sagte Dougall, während er den Blick von ihrem blassen Gesicht losriss und auf ihre Brust richtete. Er musste sich vergewissern, dass sie noch atmete. Und das tat sie, wenn auch nur schwach.
»Sie kann nicht ohnmächtig sein«, wandte Alick sofort ein. Er stellte sich in die Steigbügel und reckte den Hals, um einen Blick auf die Frau zu werfen. »Wenn das Mädchen mutig genug ist, allein wegzulaufen, gehört sie sicher nicht zu denen, die gleich beim ersten Schreck umfallen.«
»Es sei denn, es war nicht Mut, der dazu veranlasst hat wegzugelaufen«, erklärte Conran.
Alick runzelte die Stirn. »Warum hätte sie es sonst tun sollen?«
»Es mangelt ihr vielleicht an dem Verstand, den Gott den meisten von uns mitgegeben hat«, schlug Geordie vor.
»Oder sie hat ihren Spaß daran, sich von einer halben Armee wieder einfangen zu lassen«, sagte Alick widerstrebend.
»Dieses Mädchen ist nicht verrückt«, fauchte Conran. »Und sie ist auch nicht dumm. Ihr beiden solltet euch schämen, dass ihr so was auch nur für möglich haltet.«
»Na ja, was denkst du denn, warum sie ohnmächtig geworden ist?«
Conran musterte die Bewusstlose kurz und sagte dann: »Nun, vielleicht kränkelt sie. Es ist offensichtlich, dass ihr Bruder sich nichts aus ihrem Wohlergehen macht. Vielleicht ist sie krank geworden.«
»Und vielleicht«, sagte Dougall und rückte die Frau vor sich in eine etwas bequemere Position, »solltet ihr aufhören, euch wie ein paar alte Weiber zu verhalten, damit wir endlich weiterreiten können.«
Conran hob die Brauen. »Heißt das, wir nehmen sie mit?«
»Wir können sie wohl kaum in diesem Zustand am Wegesrand liegen lassen, oder?«, entgegnete Dougall ein wenig verärgert. »Wir behalten sie so lange bei uns, bis sie wieder aufgewacht ist.«
»Und was dann?«, fragte Conran und kniff die Augen zusammen.
»Dann werden wir sie fragen, wohin sie will. Und wenn es auf unserem Weg liegt, werden wir sie dorthin bringen«, beschloss er mit einem leichten Stirnrunzeln. Die Frau entwickelte sich zu einem gewissen Problem, und er war nicht glücklich darüber.
»Und wenn der Ort, zu dem sie unterwegs ist, nicht auf unserem Weg liegt?«, fragte Conran. »Oder was ist, wenn wir bereits daran vorbeigeritten sind, während sie ohnmächtig war?«
»Damit beschäftigen wir uns dann, wenn es so weit ist«, entgegnete Dougall mit erzwungener Geduld. Deutlich gereizter fügte er hinzu: »Im Augenblick wäre es mir am liebsten, wenn ihr eure Hintern bewegt und einfach losreitet.«
»Schon gut, kein Grund, hier rumzubrüllen«, beschwichtigte Conran ihn. »Es ist offensichtlich, dass das Mädchen dich nervt.« Er sah sich suchend um. »Was wird mit dieser seltsamen Kuh?«
Dougall verzog das Gesicht, betrachtete das Tier und zuckte mit den Schultern. »Die lassen wir hier. Vermutlich wird sie zur Burg zurücklaufen. Vielleicht geht man dort ja dann davon aus, dass die Lady gestürzt ist und wird die Wälder von Danvries nach ihr absuchen.«
»Aber dann hat sie nichts, worauf sie reiten kann, wenn sie wieder zu Bewusstsein kommt«, wandte Conran ein.
»Was bedeutet, dass sie wohl mit mir reiten muss«, erwiderte Dougall trocken.
»Aye, aber was ist, wenn ihr Weg sie von uns wegführt? Wie soll sie das ohne Reittier anstellen?«
»Das da ist ein Rindvieh, Conran«, stellte Dougall klar. »Kein Mensch, der einigermaßen bei Verstand ist, würde überhaupt auf die Idee kommen, auf einem Rind zu reiten.« Ungeduldig schüttelte er den Kopf. »Ich werde ihr eines der beiden Pferde geben, die wir verkaufen wollten.«
»Das sind zwei gute Pferde, die eine Menge wert sind«, meinte Conran scharf. »Du denkst doch nicht daran –«
»Ich denke, dass ich es allmählich leid bin, mir deine Einwände anzuhören. Ich will endlich weiterreiten«, fauchte Dougall. »Mach mit dem Vieh, was du willst, aber wir reiten jetzt weiter.«
Er drückte seinem Pferd die Fersen in die Flanken und brachte es zum Galopp, sodass Lady Danvries wie ein Sack Weizen auf und ab hüpfte. Leise fluchend ließ Dougall das Tier langsamer laufen und rückte Lady Danvries zurecht, bevor er wieder schneller ritt. Immer wieder glitt sein Blick zu der Frau, und er fragte sich, was sie wohl getan hätte, wenn er sich zu dem Handel bereit erklärt hätte. War sie schon zuvor angeboten und benutzt worden? Der Gedanke war ihm bisher noch gar nicht gekommen, doch jetzt ging er ihm nicht mehr aus dem Kopf, und aus irgendeinem Grund ärgerte ihn das. Grimmig richtete Dougall seine Aufmerksamkeit auf den Weg vor ihm und spornte sein Pferd an, schneller zu laufen. Dabei hielt er die Frau in seinen Armen noch fester, damit ihr nichts geschah.
2
Lautes Lachen weckte Murine. Sie hörte Stimmen von Männern, die sich unterhielten und dabei ihrer Beschäftigung nachgingen. Sie drehte sich auf den Rücken und sog die frische Luft ein, froh und glücklich darüber, endlich wieder tief durchatmen zu können. Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor, seit sie es das letzte Mal hatte tun können. Im Laufe des Tages war sie mehrmals aufgewacht, immer fest an die Brust eines Mannes gedrückt und unfähig, tief Luft zu holen. Panik hatte sie ergriffen und zusammen mit dem Luftmangel wieder bewusstlos werden lassen. Doch diesmal befand sie sich nicht mehr in dem warmen, luftlosen Kokon, der sie zuvor umfangen hatte. Ja, sie fror sogar ein bisschen, wie sie mit einem Stirnrunzeln bemerkte. Murine öffnete die Augen und sah den Nachthimmel über sich.
Schallendes Gelächter erregte jetzt ihre Aufmerksamkeit. Sie wandte den Kopf und sah zu den Männern hinüber. Ihre Silhouetten hoben sich dunkel von dem kleinen Feuer ab, um das sie saßen. Sie waren alle groß und eindeutig Schotten, wie an ihrer Kleidung unschwer zu erkennen war. Vermutlich waren dies die Männer, die sie vor den Soldaten ihres Bruders versteckt hatten. Sie war sich ganz sicher, dass es deren Anführer gewesen war, der sie auf seinem Pferd festgehalten hatte. Sie glaubte nicht, dass er absichtlich versucht hatte, sie am Atmen zu hindern. Glücklicherweise war sie nicht gestorben, obwohl sie das mehr als einmal befürchtet hatte. Wann immer sie zwischendurch aufgewacht war, hatte der Luftmangel sie sogleich wieder in Ohnmacht fallen lassen.
Als das Lachen versiegte, wandte Murine den Blick von den Männern ab und sah sich um. Sie lag unter einem großen Baum und lehnte mit dem Rücken an dessen Stamm. Irgendwo aus der Dunkelheit drangen Geräusche an ihr Ohr, die unverkennbar von Pferden stammten, und vor ihr befand sich die Feuerstelle mit den Männern. Es war so stockfinster, sodass sie hätte glauben können, blind zu sein. Der Himmel war ganz offensichtlich bewölkt, und das einzige Licht wurde vom Feuer gespendet, was schade war, denn sie hatte das große Bedürfnis, sich zu erleichtern.
Vorsichtig setzte Murine sich auf und verzog dabei leicht das Gesicht, dann erhob sie sich. Es erstaunte sie etwas, dass sie sich so benommen fühlte. Aber nun, sie hatte seit dem Morgen nichts mehr gegessen. Wenn man diese Tatsache berücksichtigte und dann noch den Luftmangel bedachte, unter dem sie fast ständig gelitten hatte, sollte sie eigentlich nicht überrascht sein. Sie streckte eine Hand nach dem Baum aus und stützte sich daran ab, bis die größte Benommenheit von ihr abfiel. Dann tastete sie sich leise und vorsichtig in die Dunkelheit. Sie wandte sich nach links, da die Pferde rechter Hand von ihr waren. Zumindest nahm sie das an, aber in dieser durchdringenden Dunkelheit war es leicht, die Orientierung zu verlieren. Und sie wollte auf keinen Fall die Pferde aufschrecken und am Ende von ihnen niedergetrampelt werden.
Zu ihrer großen Erleichterung stieß sie weder gegen die warme Flanke noch den breiten Hintern eines Pferdes; es war vielmehr die Rinde eines anderen Baumes, die sie plötzlich berührte, sodass sie stehen blieb. Sie tastete sich um den Baum herum, bis das Feuer nicht mehr zu sehen war. Da sie nicht noch weiter gehen und sich womöglich in der Dunkelheit verlaufen wollte, hob sie ihre Röcke hoch und hockte sich an Ort und Stelle hin. Dabei seufzte sie erleichtert. Doch dann stieß etwas Warmes und Feuchtes an ihre Nase und Wange. Murine entfuhr noch ein Schrei des Entsetzens, dann fiel sie um.
Die Männer verstummten abrupt, als der Schrei die Luft zerriss. Dougall wandte den Kopf, und sein Blick suchte instinktiv dort nach Lady Danvries, wo er sie zurückgelassen hatte. Sie war nicht mehr da; der Platz unter dem Baum war leer.
Gleichzeitig mit seinen Brüdern sprang er auf und riss fluchend ein Holzscheit aus dem Feuer. Er nutzte das Scheit als Fackel, als er auf den Baum zuging und dann die Richtung einschlug, aus der er den Schrei gehört hatte. Links von den Pferden, dachte er und wurde langsamer, als in der Dunkelheit plötzlich eine gedämpfte Stimme zu hören war.
»Oh, Henry! Um Himmels willen, du hast mich zu Tode erschreckt. Hör jetzt mit deinen dummen Küssen auf und lass mich in Ruhe.«
Dougall blieb stehen. Henry? Küsse? Hatte Lady Danvries einen Geliebten, zu dem sie auf ihrer Kuh hatte reiten wollen? Wenn dem so war, musste der Mann ihnen gefolgt sein und auf den geeigneten Moment gewartet haben, um sich ihr zu nähern. Anscheinend ist sie nicht so unschuldig wie sie aussieht, dachte er, und war unerklärlicherweise enttäuscht darüber.
Mit zusammengepressten Lippen ging er entschlossen weiter, nur um einen Moment darauf abrupt stehen zu bleiben, als seine Fackel einen Anblick erhellte, den er so schnell nicht vergessen würde. Lady Danvries lag auf der Seite im Gras und wehrte sich gegen ein Tier, das über ihr stand und versuchte, ihr das Gesicht zu lecken, als wäre sie ein schmackhafter Happen. Nein, ein Bulle, berichtigte er sich, als er die Hörner sah, während der Bulle ihn mit funkelnden Augen anstarrte und dabei versuchte, mit seiner großen Zunge über Lady Danvries’ Gesicht zu fahren.
»Sieht so aus, als wäre ihre Kuh uns gefolgt«, bemerkte Conran erheitert hinter ihm. Dougall drehte sich um und stellte fest, dass alle drei Brüder hinter ihm standen und angesichts der sich ihnen bietenden Szene grinsten.
»Oh, Mylaird.« Lady Danvries mühte sich auf die Beine und hielt sich dabei an einem Horn des Tieres fest. Dann strich sie rasch ihr Kleid glatt, bevor sie ihn mit gequälter Miene ansah. »Ich wollte gerade …« Sie machte eine Geste in den Wald, und er meinte zu sehen, dass sie errötete, was aber wegen des fehlenden Lichtes schwer zu sagen war.
»Mit Eurer Kuh auf dem Boden herumtollen«, schlug er vor und spürte das Lächeln, das auf seinen Lippen lag.
»Ganz sicher nicht«, entgegnete sie würdevoll. »Abgesehen davon ist Henry ein Bulle.« Sie drehte sich um und tätschelte dem Tier das Maul, als wollte sie es wegen der Beleidigung beschwichtigen, die es bedeutete, eine Kuh genannt zu werden. »Ich habe ihn aufgezogen, seit er ein Kälbchen war. Er war sehr klein und der Stallmeister glaubte nicht, dass er überleben würde. Aber ich habe ihn mit in die Burg genommen und mich um ihn gekümmert. Und dann ist er zu einem schönen, großen Tier herangewachsen.«
»Macht Ihr Euch über uns lustig?«, fragte Conran plötzlich. Er wirkte gereizt, als er neben Dougall trat.
Lady Danvries runzelte leicht die Stirn. »Nein. Ich habe ihn wirklich selbst aufgezogen, und er ist wirklich ein Bulle.«
»Nein, es geht nicht um Euren Bullen. Es geht darum, wie Ihr sprecht«, sagte Dougall ruhig. Er wusste genau, was Conran zu seiner Frage veranlasst hatte. Ihm selbst war es zwar erst aufgefallen, nachdem sein Bruder die Frage gestellt hatte, aber es stimmte, die Frau sprach wie eine Schottin. Als er sah, dass sie nicht verstand, was er meinte, erklärte er es näher: »Euer Englisch, Lady Danvries. Ihr ahmt unsere Sprache nach.«
Bei seinen Worten riss sie die Augen auf, dann reckte sie stolz die Schultern. »Ich bin keine Engländerin. Und ich heiße auch nicht Danvries. Montrose Danvries ist mein Halbbruder. Ich bin Lady Murine Carmichael. Mein Vater war Beathan, Laird vom Clan Carmichael.«
»Murine Carmichael?« Conran hauchte den Namen fast, als würde es sich um eines der schönsten Weltwunder handeln – eine Vorstellung, die Dougall voll und ganz teilte, als er begriff, wen er da vor sich hatte.
Es war Alick, der es aussprach. »Die Murine von unserer Saidh?«
Murine sah ihn scharf an. »Saidh Buchanan? Ihr kennt sie?«
»Ob wir sie kennen?«, wiederholte Geordie amüsiert. »Aye, das könnte man sagen.«
»Wir sind ihre Brüder«, erklärte Alick. »Ich bin Alick Buchanan, und das hier sind meine älteren Brüder Geordie, Conran und Dougall.«
»Oh«, hauchte Murine, und eine Woge von Erleichterung strömte durch sie hindurch. Bis Alick plötzlich einen Satz nach vorn machte und sie in einer so überschwänglichen Umarmung vom Boden riss, dass sie fast Angst bekam.
»Danke, danke, danke«, rief er glücklich und schwang sie herum.
»Hör auf damit, Alick. Ihr wird noch ganz schwindelig, wenn du sie so herumwirbelst«, knurrte Geordie und folgte Alicks Beispiel, nachdem dieser Murine wieder auf den Boden heruntergelassen hatte. Auch Geordie umarmte sie und hob sie hoch, aber er schwang sie nicht herum. Dafür drückte er sie so fest, dass sie womöglich keine Luft mehr bekam, während er polterte: »Danke, Mädchen. Wir können Euch niemals zurückzahlen, was Ihr für uns getan habt.«