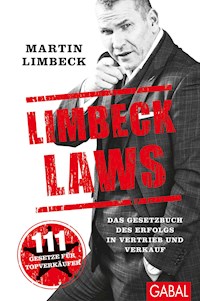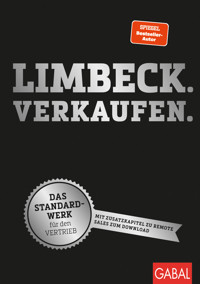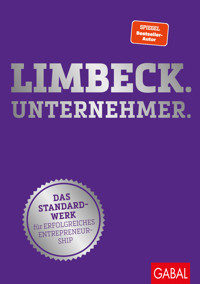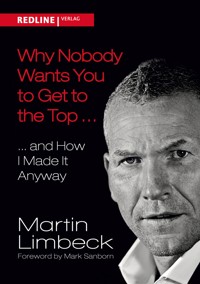7,99 €
Mehr erfahren.
Vom Suchen und Finden des inneren Friedens
»Es heißt, im Moment des Todes zieht das ganze Leben an uns vorbei«, sagte Ego. »Das habe ich auch schon gehört«, antwortete Marc. »Nur zieht mein Leben seit fünfzig Jahren an mir vorbei.« Immer wieder spricht der erfolgreiche Unternehmer Marc mit seinem Hund. Königspudel Ego ist ein ganz besonderer Vierbeiner. Seit Marc denken kann, ist Ego an seiner Seite. Er kennt alle Aufs und Abs in Marcs Leben und ist ein idealer Ratgeber. Jetzt, da Marc auf die Sechzig zugeht, stellen sich ihm die großen Fragen des Lebens. Ego hilft ihm, die Antworten zu finden und sein Leben neu zu gestalten: vom Streben nach äußerem Reichtum zu innerem Frieden. Mal auf sanften Pfoten, mal mit großer Schnauze – aber immer mit viel Geduld für die Widersprüchlichkeiten dieser Menschen, die nicht kapieren wollen, dass die Sache mit dem Glück ganz einfach ist.
- Leben ist mehr als äußerer Reichtum und beruflicher Erfolg
- Das fabelhafte Geschenk für Menschen in der Lebensmitte: von Hund Ego lernen, heißt leben lernen
- Der Hund ist nicht nur der beste Freund des Menschen, sondern im Zweifel auch besser darin, Mensch zu sein
- Altklug, amüsant und immer mit einem wohldosierten Kniff in die Waden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch:
»Es heißt, im Moment des Todes zieht das ganze Leben an uns vorbei«, sagte Ego. »Das habe ich auch schon gehört«, antwortete Marc. »Nur zieht mein Leben seit fünfzig Jahren an mir vorbei.« Immer wieder spricht der erfolgreiche Unternehmer Marc mit seinem Hund. Königspudel Ego ist ein ganz besonderer Vierbeiner. Seit Marc denken kann, ist Ego an seiner Seite. Er kennt alle Aufs und Abs in Marcs Leben und ist ein idealer Ratgeber. Jetzt, da Marc auf die sechzig zugeht, stellen sich ihm die großen Fragen des Lebens. Ego hilft ihm, die Antworten zu finden und sein Leben neu zu gestalten: vom Streben nach äußerem Reichtum zu innerem Frieden. Mal auf sanften Pfoten, mal mit großer Schnauze – aber immer mit viel Geduld für die Widersprüchlichkeiten dieser Menschen, die nicht kapieren wollen, dass die Sache mit dem Glück ganz einfach ist.
Zum Autor:
Immer höher, schneller, weiter: Das war lange Zeit das Motto von Martin Limbeck. Mit Mitte zwanzig hatte er bereits alles, wovon andere ihr Leben lang träumen. Genug war es ihm jedoch noch lange nicht. Es folgte eine beispiellose Karriere: Unternehmer, Bestsellerautor, Millionär. Was er im Laufe der Jahre feststellte: Geld öffnet dir viele Türen und ermöglicht dir und deiner Familie ein angenehmes Leben. Du kannst dir viele materielle Wünsche erfüllen – doch das allein macht dich nicht glücklich, wenn du nicht mit dir selbst im Reinen bist. Daher steht für ihn heute nicht mehr nur sein Beruf im Vordergrund, sondern auch seine Berufung: Er macht sich als Unternehmer für den deutschen Mittelstand stark, tritt als Botschafter von Kinderlachen e.V. für die Bedürfnisse kranker und benachteiligter Kinder in Deutschland ein. Und er genießt es, wann immer möglich Zeit mit seinem erwachsenen Sohn und seinen drei Königspudeln zu verbringen.
MARTINLIMBECK
EIN Hund
namens Ego
und die
groSSen Fragen
des Lebens
Eine Geschichte über wahre Freundschaft, inneren Reichtum und die Suche nach dem Glück
Unter Mitarbeit von Thilo Baum
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
© 2024 Ariston Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Jordan Wegberg
Illustrationen: Elisabeth Andersch
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
unter Verwendung eines Motivs von Elisabeth Andersch
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-32392-9V001
Inhalt
Vorwort
Was bleibt vom Leben?
Auf dem Campingplatz
Ein Leben im ständigen Wandel
Ebbe und Flut
Schlechtes Englisch, gutes Englisch
Alleine oder gemeinsam?
Ein Freund, ein guter Freund
Dicke Hose
Rückschläge
Abschied von den Geistern
Besuch beim Mentor
Der Verlust
Stille
Die Liebe
Der Mensch
Der deaktivierte Verstand
Nachwort
VORWORT
»Weißt du«, sagte Ego zu Marc, »die meisten Leute denken viel zu viel mit dem Kopf.«
Noch vor einigen Jahren konnte Marc wenig mit diesen Sprüchen anfangen, mit denen ihm sein Hund Ego immer wieder kam. Womit sollte ein Mann denn sonst denken, wenn nicht mit dem Kopf? Ach so, klar: mit dem Autoschlüssel und dem Kontostand. Doch geht es darum?
In diesem Buch liest du die Geschichte von Marc. Marc ist Mitte fünfzig, hat eine ganze Menge erreicht in seinem Leben und ist an einem Punkt angelangt, an dem er sich andere Fragen zu stellen beginnt als vorher.
Ist er wirklich bei sich selbst angekommen? Hat ihm seine lange Reise im Außen auch innerlich etwas gebracht?
Die Menschen, mit denen er sich umgibt – sind das wirklich Freunde?
Hat Marc sich befreit? Als Mensch? Als Mann? Ist er er selbst?
Da ist ein tiefes Bedürfnis in Marc, das große Feld der Spiritualität für sich zu entdecken. Er will erkennen, was ihn selbst ausmacht, sein Verhältnis zur Welt und zum Leben, doch ihm fehlt irgendwie der Ansatz. Er weiß, dass hier noch etwas Wichtiges liegt, und das will er finden.
Typische Fragen in Marcs Leben waren bisher: Wie gelingt es ihm, diesen oder jenen Kunden zu überzeugen? Wie organisiert er das Auslandsjahr seines halbwüchsigen Sohnes? Und wie gelingt das beste Tomahawk-Steak?
Es sind Fragen, wie sie sich viele Menschen in Mitteleuropa stellen. Wir leben in einer erfolgsorientierten Kultur, das heißt: Wir wollen in Schule und Ausbildung möglichst gute Abschlüsse haben, wir strengen uns an. Wir setzen uns Ziele, wollen Rechtsanwalt werden oder Chirurgin. Und im Beruf wollen die meisten dann gut performen. Wir sind leistungsbereit und wollen Ziele erreichen.
Auch bei Marc geht es um Ziele, es geht um Wohlstand und Genuss, um Statussymbole wie Autos und Uhren und auch um so etwas wie gehobene Freizeitgestaltung, also Fliegenfischen, mit Boliden auf dem Nürburgring Rennen fahren oder mit anderen Geschäftsleuten bei Bundesligaspielen über Fußball und Geschäfte reden.
Und jetzt – der konkrete Auslöser war der Tod eines nahestehenden Menschen, von dem du später lesen wirst – steht Marc vor viel existenzielleren Überlegungen. Vor Überlegungen, die nicht mehr sein finanzielles Vermögen berühren oder seinen beruflichen Erfolg, sondern das, was den Menschen an sich ausmacht. Am Ende betreffen diese Fragen jeden Menschen, ob er nun mitten im Leben steht oder nicht, ob er nun reich ist oder arm. Jeder Mensch geht den letzten Weg bekanntlich ohne sein angehäuftes Vermögen. Und ohne seine Schulden. Es mag zwar sein, dass die Schulden jemanden ins Grab bringen, aber er nimmt sie nicht mit ins Jenseits.
Und genau darum geht es Marc in diesem Buch. Wer ist er? Also: Wer ist er wirklich? Jenseits seiner Rollen, Namen, Titel, Preise und anderer Etiketten, die sich Menschen so anheften? Wer ist er, einmal losgelöst von seinem Beruf und seinem Erfolg?
In diesem Buch wirst du sehen: Marc ist kein einfacher Typ. Marc ist ein Charakter mit Ecken, Kanten und auch weichen Seiten, die er früher gerne verheimlicht hat. Aber das macht nichts. Wir alle sind Individuen. Menschen haben Macken, Fehler, Defizite, auch wenn sie sie vor anderen gerne verstecken. Niemand dürfte perfekt sein – und von wem du das glaubst, bei dem hast du es erfahrungsgemäß eher mit Inszenierung zu tun als mit Authentizität. Auch perfekt inszenierte Menschen sind oft von nagenden Selbstzweifeln geplagt. Marc hat das irgendwann erkannt und macht sich nun auf den Weg zu seinem wahren Wesen.
Ganz unabhängig von Marc kann dieses Buch vielleicht auch dir die eine oder andere Inspiration mitgeben – über das Leben und die Liebe, die Freundschaft und das Glück. Und lass dir ein Geheimnis verraten: Die Hauptfigur in dieser Geschichte ist im Grunde gar nicht Marc.
Die Hauptfigur bist du.
Der denkende und sprechende Hund
Auch ein Hund spielt in diesem Buch eine Rolle. Dieser Hund heißt Ego.
»Ego« ist Lateinisch und heißt »ich«. Wir kommen später noch zu dem Gedanken, dass in der Spiritualität gern zwischen dem »Ego« und dem »Selbst« unterschieden wird, wobei das Ego im Außen spielt und das Selbst im Innen. In dieser Geschichte ist das alles etwas einfacher: Für Marc ist sein Hund Ego die Verbindung zu seinem Ich.
Und vielleicht denkst du auch an den Philosophen Friedrich Nietzsche, der einmal gesagt hat: »Wo immer ich gehe, folgt mir ein Hund namens Ego.« Dieser Idee folgt Marc und will mithilfe seines Hundes herausfinden, wer sein Ich ist.
Dieses Buch ist übrigens auch dann etwas für dich, wenn du keinen Hund hast. Oder jedenfalls keinen Hund, der sprechen kann. Selbst wenn du lieber Katzen magst, lohnt es sich, dich auf Marcs und Egos Geschichte einzulassen. Denn wie du natürlich schon erkannt hast, ist Ego ein Denkmodell. Modelle können uns helfen, Zusammenhänge zu verstehen.
Und das Buch ist auch etwas für dich, wenn du eine Frau bist. Marc mag hin und wieder ein Macho sein, doch seine Reise zum Verstehen ist nicht geschlechtsspezifisch. Was Marc infolge seiner Gespräche mit Ego erkennt, ist für alle Menschen interessant – denn es ist die Reise zu sich selbst.
Dank seinem Hund Ego versteht Marc am Ende sein inneres Wesen und seine Rolle in der Welt. Das gelingt nicht auf einmal, sondern Marc gewinnt von Episode zu Episode immer weitere Erkenntnisse hinzu. Vielleicht hast du Lust, daran teilzuhaben.
Was bleibt vom Leben?
Marc stand »mitten im Leben«, wie es so schön heißt. Von außen betrachtet galt er vielen als Macher und als Vorbild. Er war ziemlich erfolgreich, hatte mehrere Unternehmen gegründet und ordentlich verdient. In seiner Garage standen diverse feine Exemplare einer schwäbischen Nobelsportwagenmarke, er liebte seine Uhrensammlung und besuchte jedes Finalspiel seiner Lieblingsmannschaft Eintracht Frankfurt, auch wenn es in Liverpool stattfand. Marc flog hin.
Was die meisten Menschen erreichen wollen, hatte Marc erreicht. Haus gebaut, Kind gezeugt und so manchen Obstbaum gepflanzt. Dazu kamen spannende Reisen, etwa auf die Malediven, nach Las Vegas oder New York und auch Grenzerfahrungen wie die Besteigung des Kilimandscharo. Wenn Marc Lust hatte, in Los Angeles shoppen zu gehen oder in Lappland Polarlichter zu bestaunen, dann konnte er das jederzeit machen.
Marc reiste beruflich schon so viel, dass für private Reisen kaum noch Zeit war. Und die Reisen, die er machte, verliefen nach dem Schema Flug-Taxi-Hotel-Seminar-Hotel-Taxi-Flug. Wenn er in einer fremden Stadt ein Seminar gab oder besuchte, sprach im Grunde nichts dagegen, sich diese Stadt auch anzuschauen – aber das Timing ließ es nicht zu.
So lernte er von Deutschland, Österreich und der Schweiz durch seine Geschäftsreisen eine Art Zerrbild kennen. Natürlich verschloss Marc die Augen nicht, aber selbst in New York oder auf Mallorca – in der Seminarszene ein »place to be«, weil es für viele Teilnehmer einfach am preiswertesten erreichbar war – lief ständig Business. Wenn Marc mit seiner »Masterclass«, einer kleinen Gruppe erlesener Premiumkunden, zum Beispiel nach Lappland flog, fragte er sich auf dem Rückflug, warum er das Erlebnis nicht genießen konnte. Nördlich vom Polarkreis den kalten Winter mit Schlittenhunden und Polarlichtern zu erleben, war einzigartig. Und trotzdem empfand Marc eine Art Belanglosigkeit. Er sah das Grün am polaren Himmel wabern, aber irgendwie war er nicht da.
»Du bist nicht gegenwärtig«, sagte sein Hund Ego zu ihm. »Du bist nicht wirklich hier.«
»Ja, vermutlich«, antwortete Marc. »Ich sehe das Polarlicht, aber ich erlebe es nicht.«
Und immer mehr kam Marc auf den Gedanken, dass das Wesentliche im Leben gar nicht so sehr in den exotischen Ecken dieser Welt zu finden war, sondern in ihm selbst.
Überhaupt stellte er sich die Frage: Kann der Sinn des Lebens erreicht sein? Und wenn ja, was kommt danach?
Was Marc empfand, war eine gewisse Leere, obwohl er in der Fülle lebte.
Sollte er einfach gehen?
Marc war bewusst, dass Suizid vor allem unter Männern verbreitet war, die nicht mehr klarkamen. Ob Schulden, familiäre Probleme, Süchte oder traumatische Ereignisse – etwas trat ins Leben, was nicht zu bewältigen war, jedenfalls dachten die Betroffenen das. Einmal war Marc auf der Seite einer Suizidpräventionsorganisation gelandet. Dort las er, dass niemand einem Freund erklären würde, der ideale Ausweg aus irgendeinem Problem sei der Freitod.
Darüber hatte Marc lange nachgedacht. Es stimmte. Niemandem würde er raten, angesichts seiner Probleme einen solchen Schlussstrich zu ziehen.
Marc ging bisher davon aus, dass mit dem Tod alles vorbei war. Hatte jemand den Planeten verlassen, konnte er im Nachhinein keine Fehler mehr korrigieren, und auch die Hinterbliebenen – also sämtliche lebenden Menschen – konnten an ihm nichts mehr wiedergutmachen. Der Tod war für Marc endgültig.
Insofern hing Marc am Leben. Allerdings nicht auf genusssüchtige Art und in der Angst, irgendwas zu verpassen. Er hatte das Leben durchaus ausgereizt und wirklich viel mitgenommen. Er hing am Leben wie an einem Geschenk, bei dem es sich nicht gehört, es in den Mülleimer zu werfen. Vor allem wenn es einen solchen Wert hat wie das Leben auf dieser Welt mitsamt der Chance, tolle Menschen zu treffen, Erfahrungen zu machen, Dinge zu verändern und auch ein wenig zum Guten beizutragen.
So wusste Marc auch, dass die Antworten auf seine Fragen nicht im Jenseits lagen oder in der Religiosität mit der Hoffnung auf einen gütigen und erlösenden Gott. Die Antwort lag bei ihm, im Hier und Jetzt. Es ging darum, aus den gegebenen Umständen – dem Leben – das Beste zu machen.
Dazu musste Marc herausfinden, was das war, das Beste. Und wer er war.
Die Bucketlist
Vor vielen Jahren war Marc in einem Seminar der Begriff der »Bucketlist« begegnet. Gemeint ist damit eine Liste von Dingen, die wir noch tun oder erleben wollen, bevor wir den Eimer umtreten (engl. »to kick the bucket«), also den Löffel abgeben.
Marc wusste, dass viele Leute so eine Liste führten – er hatte keine. Sollte er darauf Lust verspüren, am Lake Winnipeg in Kanada angeln zu gehen, könnte er das tun. Er hatte in seinem bisherigen Leben viele solche Vorhaben umgesetzt.
Marc fragte sich, ob er eine Midlife-Crisis erlebte. Und er fragte sich im gleichen Atemzug: Ist eine Midlife-Crisis nicht eher was für Leute, die ihrer Jugend hinterhertrauern und sich nicht mit der Realität abfinden können? Also etwas für Uncoole?
Marc trauerte seiner Jugend nicht hinterher. Sein Leben war bisher wunderbar gewesen, fand er. Nur fehlte eben etwas. Doch was war das genau?
An diesem Tag saß Marc mit seinem Hund Ego auf einer Bank am See. Auf seiner Bank an seinem See, um genau zu sein. Es war ein warmer, bedeckter Frühsommertag. Da saß also ein gestandener Mann mit Hund am See und fragte sich, ob er eine Midlife-Crisis hatte.
»Es ist doch eigentlich egal, wie du es nennst«, sagte Ego.
»Was verstehst du denn unter einer Midlife-Crisis?«, fragte Marc.
»Na ja, dass sich jemand in der Lebensmitte fragt, wo er steht und wie es weitergeht. Ob er alles richtig gemacht hat und was er versäumt hat. Welche Wünsche offen sind, aus welchen Wünschen nichts wurde und so weiter.«
»Versäumt habe ich eigentlich nichts«, sagte Marc. »Was ich machen wollte, habe ich gemacht. Es gibt vielleicht ein paar Dinge, die ich anders machen würde, aber bei wem ist das nicht so? Wenn ich jetzt abtreten sollte, würde ich sagen: Danke, liebes Universum, es war ein schönes Leben. Jetzt bitte das Dessert.«
Marc stellte sich den Himmel gerne als exklusiven Club vor, der einen Türsteher namens Petrus hatte. In frühen Jahren hatte Marc sein Geld selbst als Türsteher verdient – er entschied, wer reindurfte und wer nicht. Würde Petrus ihn also fragen, was er versäumt habe, würde er am liebsten antworten: gar nichts.
»Aber das wäre nicht die Wahrheit, oder?«, fragte Ego.
»Ich hätte noch ein paar Geschäftsfelder erschließen können, aber wozu?«
»Klingt doch nach dem perfekten Leben, oder? Was willst du mehr?«, fragte Ego.
Für einen Moment fühlte sich Marc geschmeichelt.
»Okay, Marc«, hob Ego an. »Wozu das Gespräch hier? Wenn alles in Butter ist, dann schwing doch ein Steak in den Beefer, gib mir auch was davon ab und genieß deine Erfolge bei einem Glas trockenen Rotwein.«
Genau das hatte Marc auch vor für den Abend – und trotzdem wollte er herausfinden, woher diese Unzufriedenheit kam.
»Darf ich eine Vermutung äußern?«, fragte Ego.
»Nur zu.«
»Vielleicht denkst du eher ans Geschäftliche, obwohl das nicht du selbst bist?«
Marc überlegte.
»Klar, das Privatleben hätte ich bestimmt mehr würdigen können«, sagte Marc. »Ich habe mein Leben bisher schon sehr dem Beruf untergeordnet und das Ganze durch Erfolg kompensiert. Ich hätte auch viel mehr mit meinem Sohn sprechen und unternehmen müssen, als er kleiner war.«
»Das sagen viele am Ende ihres Lebens«, warf Ego ein. »Du kennst ja den Spruch, dass niemand auf dem Sterbebett sagen dürfte: ›Oh, wäre ich doch öfter zur Arbeit gegangen.‹«
»Über den Spruch habe ich mich lange lustig gemacht.«
»Warum eigentlich?«
»Für mich war der Sinn des Lebens immer die Arbeit«, antwortete Marc. »Weil ich mein Ding gemacht habe. Es waren immer meine Projekte, die ich verfolgt habe. Ich habe immer gerne gearbeitet.«
So hatte Marc sein Leben von Anfang an empfunden. Er war immer gerne »ins Büro« gegangen. Auch als er zu Beginn seiner Karriere angestellt gewesen war – als Verkäufer von Kopiergeräten –, war seine Tätigkeit für ihn kein »Job«, sondern die große Freiheit gewesen. Zu seinem Grundgehalt von 1500 Mark kamen Provisionen und als guter Verkäufer machte er so jedes Jahr eine sechsstellige Bilanz.
Viele Menschen fragten sich irgendwann, ob es das gewesen war, und bereuten den Raubbau an ihrem Seelenleben, obwohl sie ihr Ding gemacht hatten.
Und irgendwie ärgerte sich Marc auch. Was sollte das, dass er sich jetzt existenzielle Gedanken über das Leben machte? Unzählige Coachings hatte Marc in seinem Leben durchlaufen, Seminare besucht, Bücher gelesen. Mehrfach hatte er gehört, dass ein Hamsterrad von innen wie eine Karriereleiter aussieht. Den ganzen Persönlichkeitsentwicklungskram rauf und runter durchgekaut. Das hatte irgendwann begonnen, als Marc tiefer in die Seminarszene eingetaucht war. In dieser Branche begegnet man den Achtsamkeitsleuten unweigerlich. Sie lauern an jeder Ecke. Viele waren so achtsam, dass sie alle Menschen umarmten, auch wenn die das gar nicht wollten. Aber gute Trainer und Coaches besuchen nun einmal auch Seminare und lassen sich von Inhalten inspirieren, weil ein wesentliches Prinzip das »lebenslange Lernen« war.
»Midlife-Crisis« war wirklich ein blödes Wort. Es klang nach dem Anfang vom Ende und danach, alles falsch gemacht zu haben. Marc hatte nicht den Eindruck, so vieles falsch gemacht zu haben. Und er hatte auch nicht das Gefühl, dass er irgendwas verpassen würde.
Burn-out?
»Die Frage ist doch auch«, sagte Marc, »ob wir überhaupt aufhören sollen, das zu tun, was wir gerne tun. Hört ein Komponist mit dem Komponieren auf, nur weil er das Rentenalter erreicht? Oder ein Schriftsteller mit dem Schreiben?«
»Oder ein Macher mit dem Machen?«, fügte Ego hinzu.
»Das meine ich. Auf der einen Seite erfüllt dich das, was du tust, und auf der anderen Seite leiden Beziehungen und Freundschaften.«
Wie sehr andere unter seinen Prioritäten gelitten hatten – die Frauen, mit denen er zusammen oder auch verheiratet war, sein Sohn Jannis. Immerhin: Zu jedem Geburtstag seines Sohnes war er da und auch heute noch fuhr er mit Jannis zu jeder Menge Auswärtsspielen der Eintracht, ligabedingt europaweit. Marc redete sich das schön, indem er von »Qualitätszeit« statt von »Quantitätszeit« sprach. Doch selbst wenn er nur für Jannis da sein wollte, machte sein Sohn ihm Vorwürfe – bloß weil er hin und wieder ans Handy ging.
Zugleich erinnerte sich Marc an ein Trennungsgespräch mit einer Frau. Sie hatte ihm vorgeworfen, viel zu wenig für sie da zu sein. Mitten ins Gespräch platzte der Anruf eines Kunden. Kunden bedeuteten Geschäft und waren wichtig. Also war Marc ans Telefon gegangen.
»Und noch etwas leidet«, ergänzte Ego. »Der Bezug zu dir selbst. Also nicht nur die anderen sind betroffen, sondern du selbst auch.«
»Wie meinst du das?«, fragte Marc.
»Du kannst dich auch im Kontakt mit dir selbst ständig unterbrechen lassen«, antwortete Ego. »Dann bist du zwar im Außen bei dir, aber die innere Verbindung verlierst du in dem Moment.«
Marc atmete durch und fragte: »Habe ich einen Burn-out?«
Bisher hielt Marc Burn-outs für ebenso abwegig wie Lebenskrisen. Ein Burn-out war etwas, was nur Menschen bekommen konnten, die einen Job machten, der ihnen nicht lag. Oder Verlierertypen nach dem Motto: »Ist der Job zu hart, bist du zu schwach.«
Jetzt merkte Marc, dass er ähnliche Symptome erlebte: Die Energie fehlte. Die Sinnfrage wurde lauter. Und obwohl Marc seine Arbeit immer gerne gemacht hatte, empfand er nun zunehmend eine Müdigkeit.
Marc stand auf und ging ein paar Schritte an das grasbewachsene Ufer. Ein leichter kühler Wind bewegte das Wasser.
»Vielleicht genügt es ja nicht, einmal im Jahr für den Sohn da zu sein«, rief Ego zum Ufer.
»Frotzelst du jetzt?«, fragte Marc.
»Du sagst zu Petrus, dass du gar nichts bereust«, rief Ego. »Wie Edith Piaf in ihrem Lied ›Non, je ne regrette rien‹, in dem sie auf die Vergangenheit pfeift. Das Gute ist ihr egal, das Böse ist ihr egal, alles ist bezahlt und vergessen. Das singt sie. So würdest du gerne vor deinen Schöpfer treten, mit einer reinen Weste und einem bestellten Hof. Keine Schulden mehr zu tilgen, keine Aufgaben mehr zu erledigen. Weil du ein Ehrenmann bist. Ist es das?«
»Jetzt beruhige dich mal«, sagte Marc.
Ego trabte ans Ufer und setzte sich.
»Du sagst dem Kollegen Petrus und mir, dass dein Leben völlig in Ordnung war und nichts mehr zu erledigen ist? Ich sag dir was. Du erzählst uns, wie du dich gerne sehen würdest, aber nicht, wie du bist.«
Marc schwieg. Der Unterschied zwischen Selbstbild und Fremdbild war ihm bekannt.
»Der Bezug zu dir selbst gelingt nur, wenn du ehrlich gegenüber dir selbst bist«, sagte Ego.
»Okay, Hund. Wie heißt das jetzt, was ich habe? Midlife-Crisis? Burn-out?«
»Es ist völlig egal, wie das heißt«, sagte Ego. »Begriffe sind Etiketten. Lass uns über die Sache reden, nicht über ihre Bezeichnung.«
»Sollte ich nicht wissen, woran ich bin?«
»Das wirst du«, sagte Ego, »aber Begriffe wie ›Krise‹ oder ›Burn-out‹ helfen da nicht weiter. ›Burn-out‹ zum Beispiel beschreibt ein Krankheitsbild. Du bist jedoch nicht in dem Sinne krank oder behandlungsbedürftig. Lass uns also bitte von einem gesunden Menschenbild ausgehen, also davon, dass du die Zukunft durch deine freien Entscheidungen beeinflussen kannst, zu denen du durch sorgfältiges Nachdenken kommst.«
»In der Vergangenheit zu wühlen, bringt ja auch wenig«, sagte Marc. »Die ist vorbei.«
»Wobei die Vergangenheit dir verraten kann, warum du damals so gehandelt hast, wie du gehandelt hast«, gab Ego zu bedenken.
»Mir geht es um diese Leere, Ego«, sagte Marc. »Die Leere, von der ich nicht weiß, was darin fehlt.«
»Das empfinden viele Menschen so«, sagte Ego. »Und doch kann etwas diese Leere füllen.«
»Nur was?«, fragte Marc.
»Das gilt es herauszufinden.«
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
»Was die Gegenwart betrifft«, sagte Ego, »kannst du an jeder Stelle deines Lebens entscheiden, was du tust und was du nicht tust. In die Vergangenheit geblickt, ist das Leben eine Gerade, in die Zukunft ein Strauß an Möglichkeiten. Die Gegenwart kanalisiert diesen Entscheidungsbaum zu einer Historie. Wie ein Serviettenring.«
Marc formulierte für sich einen Gedanken, den er verblüffend fand: Die Vergangenheit ist fix, nur die Zukunft ist flexibel.
»Genau«, bestätigte Ego. »Und die Gegenwart ist der Augenblick, in dem die Zukunft zur Vergangenheit wird. Aus den Möglichkeiten wird dann eine Realität. Und du ziehst den Serviettenring. Darum ist es wichtig, dass du gegenwärtig bist und heute bestimmst, was einmal Vergangenheit sein wird. Damit du in der Zukunft mit Erfüllung darauf zurückblicken kannst, ohne sagen zu müssen, dass du was vergessen oder versäumt hast.«
Marc hatte an diesem Tag das Gefühl, dass in seinem Leben etwas Besonderes beginnen würde.
»Ich mache dir einen Vorschlag«, sagte Ego.
»Und zwar?«
»Wir gehen zum Beginn deines reflektierten Lebens zurück und schauen uns Schritt für Schritt an, wie du warum gedacht und gehandelt hast. Wir bewegen uns dabei bis zur Gegenwart, bis ins Heute. Vielleicht steht am Ende dieser Reise ja die Klarheit, die du dir wünschst und die du für deine Entscheidungen brauchst.«
»Einverstanden«, sagte Marc.
Aus diesem Commitment entstand an diesem Tag ein besonderes Vorhaben in Marcs Leben – ein Strategie-Workshop, wie er ihn zuvor nie erlebt hatte. Gemeinsam mit seinem Hund Ego würde er sich auf eine Reise in die Vergangenheit begeben und die Chance haben, sein Leben zu verstehen. Marc war überzeugt: Er würde seinen inneren Frieden und sein Glück nie im Außen finden, sondern nur in sich selbst.
Auf dem Campingplatz
Als Marc auf die Welt kam, arbeiteten die Beatles gerade an ihrem Song »Strawberry Fields Forever«. Ein Austin Mini Standard kostete 4850 D-Mark. In Zeitschriften machte Telefunken Werbung für einen Anrufbeantworter, der sogar Nachrichten entgegennahm. Jedenfalls, wenn wir ein Tonbandgerät anschlossen.
Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie Epochen erleben. Erst im Rückblick erkennen wir, dass wir Geschichte durchlebt haben. Und erst dann besinnen sich die meisten Menschen darauf, wo sie herkommen.
Das Spannende an Kindheit und Jugend ist, dass wir uns dabei selten von außen sehen. Wir werden, was wir werden, und wir hinterfragen selten, wo wir durch unsere Geburt landen.
»Wann sind wir da?«, fragte Ego. Der Hund lag auf der Rückbank.
»Viertelstunde noch«, antwortete Marc.
Der Gedanke der Herkunft war für Marc mit einem Ort verbunden – mit einem Campingplatz an der niederländischen Grenze. Die Familie lebte üblicherweise in ihrer Wohnung in Essen, doch am Wochenende war das Zuhause ein geräumiger Wohnwagen auf einem Platz für Dauercamper. Für Marc als Kind ein riesiger Abenteuerspielplatz: andere Kinder, viele Möglichkeiten zum Klettern und zum Basteln, wundervoll.
»War dieses Leben im Wohnwagen für dich damals eigentlich Freiheit oder Begrenzung?«, fragte Ego.
»Freiheit«, sagte Marc. »Ganz klar.«
Die Welt, die wir als Kinder erleben, ist groß und klein zugleich. Gehen wir davon aus, dass wir nicht im Elend oder im Krieg aufwachsen, und haben wir keine gewalttätigen Eltern, die uns einsperren, dann kann eine Kindheit auch heute noch paradiesisch sein.
Manche Eltern sagen ja, heute würden sie ihre Kinder nicht mehr frei im Wald herumlaufen lassen, weil alles viel gefährlicher geworden sei. Marc konnte sich allerdings auch sehr gut an Warnungen schon in den Siebzigern erinnern: »Steig nicht zu fremden Leuten ins Auto«, »Lass dir keine Süßigkeiten von Fremden schenken« – das war allgegenwärtig. Und trotzdem waren Marc und auch andere Kinder sehr viel draußen unterwegs.
Marc fand es wichtig, dass er als Kind diese Räuberphase gehabt hatte, in der er ständig an der Luft war. Klettern, Feuer machen, heimlich rauchen, Lager bauen und Schnitzeljagd mit anderen. Wer Tage auf dem Campingplatz zubringt, wird auch einigermaßen wetterfest.
Überhaupt: Wenn Marc an die Siebziger und Achtziger auf dem Campingplatz zurückdachte, dann empfand er den sozialen Umgang damals irgendwie klarer als heute. Du konntest dich auf das verlassen, was jemand sagte.
»Vielleicht kommt es mir auch nur so vor«, sagte Marc zu Ego. »Damals hast du was vereinbart, und das hat dann gegolten. Wenn du heute was vereinbarst, heißt es später, das war ganz anders gemeint.«
»Denkst du, beides hängt zusammen?«, fragte Ego. »Das Draußensein und die Verbindlichkeit?«
»Ich glaube schon«, antwortete Marc. »Das Draußensein sorgt für Erdung. Da erlebst du einfach eine konkrete Wirklichkeit, mit der du umzugehen hast.«
»Und Kinder von Helikoptereltern sind weniger realitätstauglich?«
»Na ja, stell dir vor, du sitzt den ganzen Tag drin und wischst auf dem Smartphone herum. Und wenn du mal rausgehst, bist du in Watte gepackt, weil alle ständig auf dich aufpassen. Da hast du ja gar keine Chance, die konkrete Realität zu erleben.«
Ego dachte ein wenig nach. Als Hund durfte er ständig draußen sein – Marcs riesiges Seegrundstück war ein Paradies. Dort wurde trainiert, und dort durfte Ego auch seine Seele baumeln lassen und den Wildgänsen beim Überflug zuschauen, während Marc auf dem Steg saß, die Angel in den See hängte und Karpfen mit Schwimmbrot angelte. Andere Hunde saßen stundenlang drinnen und durften nur zwei Mal pro Tag raus und um den Block. An der Leine.
»Ich denke einfach«, fuhr Marc fort, »dass die alte Bodenständigkeit verloren geht.«
Marc empfand Nordrhein-Westfalen, speziell Essen, die Bergmannsherkunft seiner Familie, als so etwas wie die Heimat der Ehrlichkeit. Da wurde Klartext gesprochen. Das konnte aus dem Selbstverständnis der Kumpel kommen – da müssen sich alle aufeinander verlassen können. Zugleich war das Ruhrgebiet nicht Bullerbü, der Ton war eher rau. Der Tatort-Kommissar Horst Schimanski, gespielt von Götz George, war so eine Ruhrpottfigur. Ehrlich, zupackend, hart und herzlich, verlässlich. Er nahm kein Blatt vor den Mund.
Elvis, der faule Hund
Mensch und Hund rollten in den Campingplatz ein. Marc parkte seinen Wagen vor dem hölzernen Rezeptionsgebäude und ließ Ego erst mal ins Gebüsch springen.
Ein bulliger Glatzkopf trat aus der Tür. »Hey, Marc!«
Marc und Elvis kannten sich schon seit Jahren. Natürlich gab es die alten Pächter aus Marcs Kindheit nicht mehr, aber den Campingplatz hatte Marc immer wieder besucht, auch nachdem seine Eltern die Zelte dort abgebrochen hatten. So waren Marc und Elvis Freunde geworden. Elvis hieß eigentlich Elmar, aber weil Elmar Gitarre spielte, hatten Freunde ein paar Buchstaben getauscht.
Elvis öffnete den Glaskühlschrank neben der Tür und nahm zwei Flaschen Bier heraus. Er öffnete sie mit dem Feuerzeug und drückte eine Marc in die Hand.
Ego kam aus dem Gebüsch dazu, schnupperte an Elvis’ Jeans und machte sich über den Wassernapf her, der für Hunde auf der Terrasse stand.
»Und? Wie isses?«, fragte Elvis.
»Danke«, sagte Marc.
Beide stießen an.
»Ach, ich wollte mal mit dir quatschen«, sagte Marc. »Passt es bei dir?«
»Nichts los«, sagte Elvis.
Sie setzten sich an einen der Holztische auf der Terrasse.
»Aber das Geschäft läuft, oder?«, fragte Marc.
»Klar. Wie immer die Stammgäste.«
»Cooles Leben«, sagte Marc. »Irgendwas mache ich falsch.«
Elvis schaute Marc erstaunt an. »Na ja, du machst aber auch immer drei Sachen gleichzeitig. Und dann muss es ganz schnell gehen. Jede Idee, die dir in den Kopf kommt, musst du sofort umsetzen. Mich würde das irre machen.«
Marc schwieg. Ego kam dazu und legte sich unter den Tisch.
»Wir können ja mal tauschen«, sagte Marc schließlich.
»Ich will nicht tauschen«, sagte Elvis. »Ich soll mir deinen Stress antun, damit du meine Ruhe genießt? Na danke.«
Freunde sagen einander, was sie denken, dachte Marc.
»Warum hörst du nicht einfach auf?«, fragte Elvis. »Hast doch genug Kohle.«
Marc antwortete: »Die Frage ist: Was ist dann?«
Marc dachte an Heinrich Bölls Geschichte von dem Berater, der dem glücklichen und faulenzenden Fischer am Strand erklärt, wie er reich werden kann, um dann glücklich zu sein und am Strand zu faulenzen. Marc mochte die Geschichte nicht, weil er als ihr Grundmotiv den Egoismus sah. Böll wollte sagen, dass nicht die Arbeit der Sinn des Lebens ist, sondern das Leben der Sinn der Arbeit. Doch Marc sah gar keinen Unterschied zwischen Arbeit und Leben. Böll wollte den Leuten weismachen, dass Leistung unnötig sei, weil wir alle ja auch genügsam leben könnten. Marc dagegen war davon überzeugt, dass wir Werte schaffen sollten, die das Leben anderer Menschen bereichern.
In Marcs Augen war es noch nie darum gegangen, reich zu werden. Wer etwas anbot, was anderen etwas brachte, dem floss das Geld in aller Regel automatisch zu. Erst geben, dann nehmen. So funktionierte Wirtschaft. Für Marc war sein Wohlergehen immer auch das Wohlergehen in seinem Business. Er blühte auf beim Arbeiten.
Marc hatte sich noch nie aufraffen oder dazu zwingen müssen, »zur Arbeit zu gehen«. Er kannte diesen Horror vor dem Montag nicht. Stattdessen tat er, was er konnte und was ihm Spaß machte – Seminare geben und Unternehmen beraten. Ob Sonntag war oder Mittwoch, war für Marc einerlei.
So ein fauler Hund wie der Fischer, der nur an sich selbst dachte, obwohl er auch für andere sorgen könnte, indem er beispielsweise Arbeitsplätze schuf, wollte Marc nie sein.
»Na ja«, sagte Elvis. »Du könntest dich mal auf die faule Haut legen.«
Kurz überlegte Marc, ob Elvis vielleicht dieser Fischer war. Aber Elvis war auch eher ein Macher. Er hielt den Platz hervorragend in Schuss, irgendwo war immer was zu schrauben. Er bekochte seine Gäste gerne und gut. Und er hatte für alle stets ein offenes Ohr.
»Also wenigstens mal für ein paar Wochen«, ergänzte Elvis. »Andere Leute machen Sabbaticals über ein ganzes Jahr.«
Waren Sabbaticals ein Zeichen für Faulheit?
»Die Kunst ist, mal zur Ruhe zu kommen«, sagte Elvis. »Jedenfalls bei dir.«
»Erzähl mir mal, wie du das machst«, sagte Marc. »Du führst ein lockeres Leben und könntest viel mehr machen. Du könntest weitere Wohnwagen aufstellen, das Nachbargrundstück dazukaufen …«
»Ja, das stimmt. Aber so, wie ich es mache, genügt es«, antwortete Elvis. »Ich habe hier meine Dauergäste, ab und zu kommen Touristen, der Laden wirft Geld ab, es passt. Kennst du die Geschichte von dem Berater, der ans Meer kommt und den Fischer trifft, der …«
»Kenne ich«, unterbrach ihn Marc.
»Das ist wichtig«, sagte Elvis. »Du darfst dich vor lauter Arbeit nicht selbst aus den Augen verlieren. Sonst brichst du irgendwann vor deinem Seminarpublikum oder deiner Videokamera zusammen.«
»Wuff«, stimmte Ego zu.
»Und alles ruhiger anzugehen oder Pause zu machen, bedeutet noch lange nicht, dass du dich dann gehen lässt.«
Der Gegenpol
Marc und Ego schlenderten über den Platz. Sie besuchten die Stelle, an der früher der Wohnwagen von Marcs Eltern gestanden hatte.
»Vielleicht ist ja auch das Wort ›Pause‹ nicht treffend«, sagte Ego. »Die meisten Menschen verbinden damit Nichtstun. Faulheit.«
»Ich kann nicht nichts tun«, sagte Marc. Er hatte es mit Meditationen versucht, was für seine Begriffe zwar gar nicht so schlecht klappte, doch am Ende verfolgte er dabei auch ein Projekt, nämlich eine Meditation. Er konzentrierte sich dann dabei darauf, sich auf nichts zu konzentrieren.
Sie setzten sich auf einen Baumstamm.
»Es geht, glaube ich, um den Gegenpol und um den Ausgleich«, sagte Ego.
»Wie meinst du das?«, fragte Marc.
»Der Gegenpol von Aktivität ist nicht die Pause«, sagte Ego, »sondern die Passivität. Also nichts tun, sondern die Dinge geschehen lassen.«
»Na, das ist doch Nichtstun«, sagte Marc.
»Das denke ich nicht«, erwiderte Ego. »Wenn du nichts tust, liegt dein Fokus immer noch auf dir. Du betrachtest dich bei dem, was du unterlässt. Streng genommen ist sogar das, was du nicht tust, ständig da. Weil du nämlich die ganze Zeit darüber nachdenkst, was du nicht tust. Dadurch ist es in deinem Kopf.«
»Krasse Philosophie«, sagte Marc.
»Eigentlich nur ein bisschen Sartre«, antwortete Ego. »Du wartest stundenlang auf jemanden und fragst dich, wo er bleibt – und genau deswegen ist dieser Jemand schon die ganze Zeit da. Jedenfalls in deinem Kopf.«
»Sage ich doch: krasse Philosophie.«
»Jedenfalls: Wenn du die Dinge einfach geschehen lässt, sind deine Wahrnehmung und deine Aufmerksamkeit bei dem, was geschieht. Und nicht bei dem, was du nicht tust.«
»Okay«, sagte Marc und rieb sich die Stirn. »Klingt alles kompliziert.«
»Jedenfalls ist die Frage: Was geschieht? Und was geschieht dabei mit dir? Du hörst auf, Akteur zu sein. Damit öffnest du deinen Blick für die Dinge um dich herum.«
»Aber das ist doch das Außen«, sagte Marc. Marc hatte im Kopf, dass er die Antworten auf seine Fragen im Innen finden würde, nicht im Außen – doch da hatte er zunächst einmal die Rechnung ohne den Hund gemacht.
»Ach, ›außen‹, ›innen‹ – das sind nur Begriffe«, sagte Ego. »Auch wenn die Lösung in deinem Innen liegt, bist du dem Außen ausgesetzt. Nimm zum Beispiel den Jakobsweg.«
»Was meinst du?« Marc kannte natürlich den Jakobsweg, und er hatte natürlich auch Hape Kerkelings Buch Ich bin dann mal weg gelesen, in dem dieser seine Pilgertour beschreibt und dabei mal seine soziale Rolle als Komiker verlässt. Aber worauf wollte dieser neunmalkluge Hund nun schon wieder hinaus? Innen, außen, Jakobsweg?
»Manche Menschen gehen den Jakobsweg, um Abstand zu gewinnen«, hob Ego an. »Abstand zu ihren Problemen zum Beispiel. Sie wollen aus der Distanz draufschauen und machen eine physische Reise im Außen. Und dann merken sie auf der dritten Etappe, dass sie sich selbst auf diese Reise mitgenommen haben und gar keinen Abstand zu sich gewinnen.«
Den Gedanken kannte Marc. Er erinnerte sich daran, dass er auch beim Meditieren oft nicht wirklich zu sich kam. Nur: Wie sollten wir uns von uns selbst lösen?
»Andere erleben den Jakobsweg schon am zweiten Tag als Trance, in der sie Antworten über sich selbst finden«, fuhr Ego fort. »Das gelingt nur durchs Loslassen.«
Marc kannte das. Es war diese Ungeduld, die ihn immer fragen ließ, wann es nun endlich ein Ergebnis gab.
Ego fuhr fort: »Und auch auf dem Jakobsweg warten viele konzentriert darauf, dass endlich etwas Mentales passiert. Sie denken sich: ›Jetzt laufe ich schon drei Tage den Jakobsweg und habe immer noch keine Erleuchtung oder Selbsterkenntnis! Verdammt noch mal, wann wird das denn endlich mal was?‹«
Es geht darum, worum es geht
»Okay, das heißt, dass diese üblichen spirituellen Ansätze nichts bringen, meinst du das?«
»Das kommt darauf an«, erwiderte Ego.
»Worauf denn?«
»Das Einstein-Zitat, wonach du ein Problem nicht mit derselben Methode lösen kannst, mit der du es geschaffen hast, kennst du ja.«
»Klar.«
»Also. Das ist zwar mit Vorsicht zu genießen, aber es ist eine schöne Faustregel. Wenn dein Thema die Getriebenheit ist, der ständige Fokus, das andauernde Anstrengen, dann hat es wenig Sinn, sich zu einer Meditation zu zwingen. Du löst damit das Problem nicht, sondern praktizierst es weiter.«
»Ich zwinge mich zum Meditieren.«
»Genau. Und weil dein Thema die Aktivität ist und es um den Gegenpol geht, sprechen wir bei dir über Passivität. Also über etwas, was du gar nicht magst.«
»Stimmt.«
»Das ist die Nuss.«
Marc überlegte, ob er sich mit seinen bisherigen Überlegungen zum Thema Meditation und Selbstsuche getäuscht hatte. Dabei hatte er so schöne Buddhastatuen im Haus. Er hatte sogar eine Klangschale.
»Es geht um dein Innen«, sagte Ego. »Nur führt eben der Weg dorthin nicht über das Erzwingen, sondern über eine saubere Wahrnehmung.«
»Okay«, sagte Marc. »Ich sollte mich weniger ablenken lassen, richtig?«
»Ja«, antwortete Ego. »Es geht nur um das, worum es geht.«
»Jetzt erzählst du Unsinn«, sagte Marc. »Das ist eine Aussage wie ›1=1‹.«
»Du weißt, was ich meine«, erwiderte Ego. »Der Punkt ist nicht das überfordernde Chaos, um das es nicht geht. Da ist etwas Wichtiges, worum es geht, völlig verschüttet. Und das findest du nur mit einem sinnvoll ausgerichteten Fokus.«
»Das Mikrofon abschalten, den Kopfhörer einschalten.«
»Und dabei stellst du dir immer wieder drei Fragen: Wer bin ich? Was fühle ich? Und: Was brauche ich?«
»Okay«, sagte Marc. »Und wenn ich ein Bier brauche, trinke ich das dann halt?«
»Ich sagte: ›Was brauche ich?‹ Nicht: ›Was will ich?‹.«
»Verstehe.«
Marc stand auf, legte sich rechtwinklig zum Baumstamm auf den Boden, klemmte seine Füße unter den Stamm und begann, einige Sit-ups zu machen.
»Übrigens hattet ihr vorhin bei der Fischergeschichte einen kleinen Denkfehler«, sagte Ego.
»Ach? Welchen denn?«, stöhnte Marc.
»Der Punkt ist, dass der Fischer von der Hand in den Mund lebt«, sagte Ego. »Das macht Elvis nicht.«
»Stimmt«, sagte Marc.
Also der faule Fischer, der gemäßigte Elvis und der getriebene Marc.
»Spirituelle Menschen, die eins sind mit sich selbst, erkennst du nicht unbedingt. Die tragen nicht alle sandfarbene Leinenklamotten und Heilsteine um den Hals.«