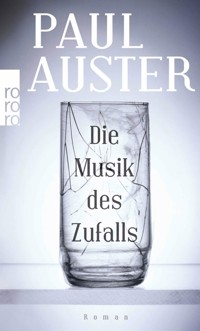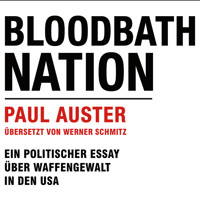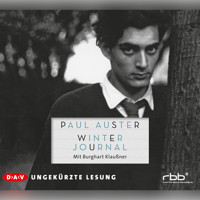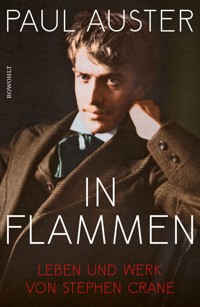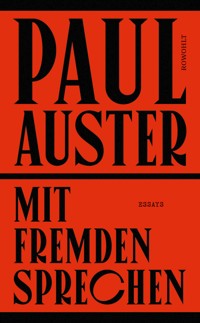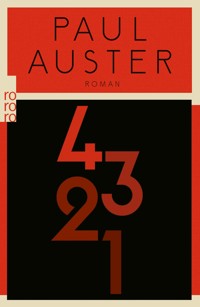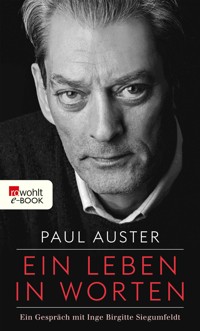
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein einzigartiger Zugang zu Austers Werk Jedes seiner Bücher ist für Paul Auster eine Reise auf einer unbekannten Straße. Zusammen mit der Professorin Inge Birgitte Siegumfeldt hat er sich aufgemacht, diese Reisen noch einmal aus der Rückschau zu betrachten. Drei Jahre lang trafen sich beide zu Gesprächen über Austers Bücher. In einem intensiven, persönlichen Dialog erkunden sie seine großen Romane und die autobiographischen Texte. Auster gibt dabei einen intimen Einblick in seine Arbeit, erzählt amüsante Anekdoten und spricht offen wie selten über Inspirationsquellen und Motivation. Die scharfsinnigen Fragen und Gedanken Siegumfeldts fordern den Autor heraus, und so entsteht ein überraschender, kluger Austausch zweier Literaturliebhaber.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Ähnliche
Paul Auster
Ein Leben in Worten
Ein Gespräch mit Inge Birgitte Siegumfeldt
Aus dem Englischen von Werner Schmitz und Silvia Morawetz
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein einzigartiger Zugang zu Austers Werk
Über Paul Auster
Paul Auster wurde 1947 in Newark, New Jersey, geboren. Er studierte Anglistik und vergleichende Literaturwissenschaften an der Columbia University und verbrachte einige Jahre in Frankreich. Heute lebt er in Brooklyn. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein umfangreiches, vielfach preisgekröntes Werk umfasst neben zahlreichen Romanen auch Essays und Lyrik.
Inge Birgitte Siegumfeldt ist Professorin für zeitgenössische Literatur und Literaturtheorie an der Universität Kopenhagen. Sie arbeitet an einem Buch über Jacques Derrida und plant eine neue Studie zu Paul Austers Werk.
Vorwort
«Niemand kann sagen, wo ein Buch herkommt; am wenigsten derjenige, der es geschrieben hat», schrieb Paul Auster vor fünfundzwanzig Jahren in Leviathan, seinem siebten Roman. Und Auster steht bis heute dazu. Doch wie immer bei ihm gibt es mehr als eine Wahrheit. In den hier versammelten Gesprächen behandeln wir die Ursprünge, die Geburt und das Leben von Austers Romanen und autobiographischen Texten – Bücher, die Millionen von Lesern weltweit in vierzig Sprachen begeistert und herausgefordert haben.
Auster ist einer der meistgelesenen Schriftsteller unserer Zeit. Begonnen hat er in den siebziger Jahren mit Gedichten. Um sein Schreiben zu finanzieren, arbeitete er als Essayist und Übersetzer, 1979 jedoch begann er sich auf Prosa zu konzentrieren, und Mitte der Achtziger, mit dem Erscheinen des innovativen Memoirenbandes Die Erfindung der Einsamkeit und der raffinierten Romane der New-York-Trilogie, sicherte sich dieser Meister der Geschichten und Erklärer des komplizierten Räderwerks ihrer Entstehung einen festen Platz in der internationalen Literaturszene. In den Neunzigern ergab er sich seiner lebenslangen Leidenschaft für den Film: Er schrieb und drehte als Ko-Regisseur zwei Filme mit Wayne Wang, Smoke und Blue in the Face, schrieb und führte Regie bei Lulu on the Bridge und dann, 2007, bei Das Innenleben des Martin Frost.
Heute umfasst sein erzählerisches Werk sechzehn Romane und fünf autobiographische Bücher. Auf die eine oder andere Weise sind sie alle von seinen weiteren künstlerischen Aktivitäten geprägt. Austers Gedichte wurden beschrieben als «spröde wie zerbrochenes Glas … das sich im Fleisch des Lesers einlagert».[1] Diese Neigung zu Transparenz und Zerbrochenheit durchzieht als lyrische Unterströmung fast alle seine Werke. Oftmals setzt sie einen ganz bestimmten Ton und inspiriert eine Reihe wiederkehrender Themen, die wir in den hier vorgelegten Gesprächen erörtern. Filme spielen eine wichtige Rolle in Austers Romanplots, insbesondere im Buch der Illusionen und Mann im Dunkel, und unterschiedliche Blicke auf Gegenstände und Charaktere, wie durch das Objektiv einer Kamera betrachtet, sind in die Texte eingegangen. Auch Übersetzungen spielen gelegentlich eine Rolle in seinen Romanen, zum Beispiel in Unsichtbar – und stets begleitet die Stimme des Kritikers Austers Geschichten und kommentiert die Vorgänge und die Mechanik des Schreibens.
Mehr als vierzig wissenschaftliche Bücher wurden über Austers Werk geschrieben, darunter eine Handvoll ganz ausgezeichneter Untersuchungen, während andere sich damit abmühen, diese vielgestaltige Textmasse in vorgefertigte Kategorien zu zwängen. Wie jedoch unsere Gespräche zeigen, ist für Auster jedes einzelne seiner Bücher eine Reise auf einer unbekannten Straße – für ihn und für den Leser. «Die Melodie eines jeden Buchs unterscheidet sich von der Melodie aller anderen Bücher», sagt er in unserem Gespräch über Sunset Park, und seine Hauptsorge, sein ständiges Ringen gilt der Suche nach der richtigen Weise, eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Regelmäßig steht er kurz vorm Scheitern – oder glaubt dies jedenfalls – und ist angesichts seiner Zweifel wahrhaft demütig. «Ich stolpere wirklich herum», sagt er in unserem Gespräch über Die Erfindung der Einsamkeit. «Ich tappe wirklich im Dunkeln. Ich weiß nicht.» Doch genau dies übersehen Rezensenten und Kritiker von Austers Büchern nicht selten.
Kennengelernt habe ich Paul Auster, nachdem er freundlicherweise meine Einladung zu unserem Doktoranden-Programm TRAMS an der Universität Kopenhagen im Mai 2011 angenommen hatte. Gleich am ersten Tag interviewte ich ihn anlässlich der offiziellen Feier, auf der ihm die Ehrendoktorwürde der Universität verliehen wurde.[2] In der Pause erzählte ich ihm, wie wichtig mir scheint, seine Bücher sehr konzentriert zu lesen und dabei Stil und Wortwahl aufmerksam zu verfolgen. Damit war offenbar eine Basis für weitere Gespräche geschaffen, denn als ich ihm wenige Monate später vorschlug, ein Buch aus einer Reihe solcher Gespräche zu machen, stimmte er zu. «Vielleicht ist es an der Zeit, zu sprechen», sagte er, und wir begannen, was zu einer drei Jahre langen Erkundung der einundzwanzig Prosawerke Austers werden sollte – eins nach dem anderen und aus allen möglichen Perspektiven.
Mit diesen Gesprächen tritt Auster zum ersten Mal in einen ausführlichen Dialog über seine Arbeit ein. Hier liefert er Hintergrundmaterial, das meiste davon weitgehend unbekannt, gibt Auskunft über Inspirationsquellen für seine Geschichten und erörtert die Hauptthemen, die sich durch sein gesamtes Werk ziehen. Wir vergleichen Bewegungen über mehr als dreißig Jahre Schreiben hinweg und gelangen dabei zu neuen und oft überraschenden Einsichten, die, so ist zu hoffen, künftiger Lektüre von Austers Büchern neue Wege eröffnen.
Anfangs hatte der Autor Vorbehalte. Er sträubte sich, sein Schreiben einer intellektuellen Debatte zu unterziehen, denn «dergleichen kommt aus dem Unbewussten und ist kaum das Ergebnis rationaler Überlegungen» (Gespräch über Die Musik des Zufalls). Auch hatte er Sorge, sich zu wiederholen: «Das habe ich schon gesagt. Wo, weiß ich nicht mehr», bemerkte er manchmal. Ich hingegen sorgte mich eher um die Frage, wie wir mit nicht weniger als neunzehn Büchern sowie zwei weiteren Manuskripten[3], die in der Summe eine Zeitspanne von gut dreißig Jahren abdeckten, fertig werden sollten. Besonders wenn man dies in Zusammenarbeit mit dem Autor bewerkstelligen möchte: Paul Auster, bekannt als misstrauisch gegenüber Rezensenten und zurückhaltend gegenüber Kritikern. Einem Autor, der bei einer unserer ersten Besprechungen frustriert bemerkt: «Ein Schriftsteller kann doch nicht seine eigenen Bücher analysieren!» War es möglich, die Innensicht des Autors mit der Außensicht des Lesers auf sinnvolle Weise zusammenzubringen?
Die Zusammenarbeit zwischen Autor und Kritiker ist schon für sich betrachtet ein interessantes Thema. Auster herrscht nicht über sein Werk, er ist kein allwissender Schöpfer, kein Interpret seiner selbst. Fragen interessieren ihn mehr als Gewissheiten – unumstößliche Wahrheiten hat er nicht zu bieten. Kurz, ihm lag aufrichtig an einem offenen Meinungsaustausch – und ich fühlte mich sehr privilegiert, in diesem Austausch seine Gesprächspartnerin sein zu dürfen.
Wie Auster im Prolog erklärt, legt er Wert auf eine klare Unterscheidung zwischen Romanen einerseits und Geschichten, die er aus seinen eigenen Erinnerungen schöpft, andererseits. Im ersten Teil dieses Bandes geht es um die Texte, in denen er sich mit seinem Leben beschäftigt. Unsere Gespräche über diese fünf sehr verschiedenen Bücher fördern zwar eine Menge autobiographisches Material über die Person «Paul Auster» zutage, das sich jedoch nicht als Schlüssel zur Enträtselung des Autors «Paul Auster» oder seiner Schriften verwenden lässt. Vielmehr fügt es seinen Texten eine weitere Ebene hinzu, die anschaulich und subjektiv ist – geformt von einem Gedächtnis, das eine zentrale Rolle spielt in dem, was Auster «eine unversehrte innere Version davon, wer wir sind» nennt (im Gespräch über Die Erfindung der Einsamkeit). Der Autor ist in diesem Sinne selbst als Romanfigur zu betrachten – nicht «realer», nicht ungewöhnlicher und womöglich ebenso wenig Herr des Textes wie die imaginären Erzähler seiner Romane. Das heißt, auch wenn diese fünf Bücher als Lebenserinnerungen gelten können, haben sie keinen Vorrang vor den fiktiven Erzählungen. Tatsächlich könnte man sagen, die autobiographische Erzählung sei unvermeidlich ebenso zweifelhaft wie eine Romanhandlung.
Die von uns unternommene chronologische Aufarbeitung der autobiographischen Bücher gestattet einen Blick auf die Veränderungen, auf die Entwicklung der Selbstbeschreibung des Autors in einem Zeitraum von über dreißig Jahren. Die Erfindung der Einsamkeit ist der erste längere Text aus der Zeit von Austers Übergang von Gedichten zu Prosa. Im ersten Teil, Porträt eines Unsichtbaren, geht es um Samuel Auster, seinen Vater; im zweiten Teil, Buch der Erinnerung, hören wir ein merkwürdiges Stimmenensemble von Dichtern und anderen Künstlern, die einen prägenden Eindruck auf die autobiographische Figur A. hinterlassen haben. Die Erfindung der Einsamkeit war ein bahnbrechendes Genreexperiment und darf als eine Art Genpool für Überlegungen zu Sprache, Erinnerung, Darstellung und zur fortlaufenden Entwicklung des Ich in Austers schriftstellerischem Gesamtwerk gelten. Das autobiographische Element im Roten Notizbuch (1995[4]) ist weniger der Autor selbst als vielmehr das innere Wesen seiner Schriften. Das Buch ist eine ars poetica ohne Theorie und enthält wahre Geschichten über jene Art von wunderbar anmutenden Zufällen, die nach Auster die «Mechanik der Realität» ausmachen. Der ähnlich schnörkellose Text Von der Hand in den Mund (1997) befasst sich mit den Irrungen und Wirrungen des «Künstlers als junger Mann», der sich irgendwie über Wasser zu halten und seine Familie zu ernähren versucht. Die zwei jüngsten autobiographischen Bücher, Winterjournal (2012) und Bericht aus dem Inneren (2013), gehen in eine ganz andere Richtung. Ersteres erforscht die Geschichte der Dinge, die das physische Selbst des Autors geprägt, verändert, genährt oder beherbergt haben, Letzteres die Wendepunkte in der Entwicklung seines Weltverständnisses. Es geht darin, so Auster, um all das, woraus sich ein Mensch zusammensetzt (im Gespräch über den Bericht aus dem Inneren). Beide dieser jüngsten autobiographischen Bücher nähern sich ihrem Gegenstand vermittels der konsequent gehaltenen Perspektive der zweiten Person Singular, die es dem Autor erlaubt, sich selbst von einem Standpunkt aus zu betrachten, der zwischen der Nähe der ersten Person und der Distanz der dritten Person verortet ist. Dies hat den höchst ungewöhnlichen Effekt, dem Leser den Eindruck zu vermitteln, vom Erzähler ins Vertrauen gezogen zu werden, vom Autor beinahe direkt angesprochen zu werden – aber eben nur beinahe.
Der zweite Teil dieses Bandes behandelt die sechzehn Romane des Autors. Sie bilden einen einzigen großen organischen Textkorpus, inspiriert von Austers Beschäftigung mit der Beziehung zwischen Welt und Wort, wobei er nicht selten die literarische Konvention hinter sich lässt und neue Wege der Darstellung erkundet. Wesentlich ist hier wie auch sonst überall seine Treue zum Material sowie eine Neugier, die oft in unerforschte Gebiete führt und so in jedem einzelnen Fall eine andere Art von Geschichte hervorbringt. Zugleich überkreuzen sich in den Texten wiederkehrende Themen, die sich durch das gesamte Œuvre des Autors ziehen. Dies sind Fabel und Mythos, Realismus, Poesie, Komödie und Metafiktion. Immer wieder kommen verschiedene Erzählweisen und Genres zum Einsatz: Memoiren, Märchen, Dystopie, parallele oder alternative Geschichtsschreibung, Krimi, Traumaverarbeitung, Schreiben im Alter, Bildungsroman, Gedichte. Stellenweise erinnern seine Romane an Collagen aus Filmdrehbuch, Zeitungsausschnitten, Interpretation oder Übersetzung von Texten anderer Autoren, Filmanalyse, Bühnenanweisungen, Fußnoten und lyrischen Monologen. Oftmals interagieren die Bücher untereinander durch Anspielungen, Echos, direkte Bezüge und wiederholt auftretende Figuren und bilden so ein dichtes intertextuelles Geflecht aus miteinander verwobenen Themen, Orten, Bewegungen, Motiven und ungelösten Problemen.
Unsere Gespräche kreisen um elf Hauptthemen in Austers Schriften, die wir unter Mithilfe von Austers Frau, der Romanschriftstellerin und Geisteswissenschaftlerin Siri Hustvedt, gemeinsam identifiziert haben:
Sprache und Körper
Das Wort und die Welt
Weiße Räume
Ambiguität
Ausstieg
Abkapselung
Verlassene Dinge
Erzählperspektive
Männerduos
Amerika
Leben als Jude
Weitere wichtige, aber weniger dominante Themen, die wir besprechen, sind Film, Politik, Baseball, die Stadt, Gehen, Stille, Erinnerung und die allmähliche Vervollkommnung weiblicher Figuren.
Aus der sich in diesen Gesprächen ergebenden Fülle an neuem thematisch und chronologisch geordnetem Material ergibt sich eine Reihe neuer Fragen zu Austers Werk, zu Literatur im Allgemeinen, zum Schreiben und Lesen. Ich danke Paul Auster für seine Großmut und Geduld mit all meinen Fragen, seien sie relevant oder irrelevant. Jeden Morgen ab zehn Uhr hat er sich an dem roten Tisch in seiner Wohnung in Brooklyn meine Mutmaßungen und Anmaßungen angehört, meine Deutungen und Missdeutungen seiner Bücher, und sich zum Gespräch darüber bereit erklärt, und dafür danke ich ihm von Herzen.
Inge Birgitte Siegumfeldt
Kopenhagen
Dezember 2014
Prolog:Die Luft reinigen
INGE BIRGITTE SIEGUMFELDT In Ihrem Roman Sunset Park schreibt Morris Heller, einer der Protagonisten, in sein Tagebuch: «Schriftsteller sollten niemals mit Journalisten reden. Das Interview ist eine minderwertige literarische Form, die allein dem Zweck dient, zu vereinfachen, was nicht vereinfacht werden darf.» (S. 279) Wenn Sie Hellers Bemerkung zustimmen – und ich nehme doch an, dass Sie das tun –, warum sind Sie dann einverstanden, ein Gespräch zu führen, das vermutlich die Form eines Interviews annehmen wird?
PAUL AUSTER Heller bezieht sich auf die kurzen, oberflächlichen Interviews, zu denen Schriftsteller von ihren Verlagen vergattert werden – mit Zeitungen und Zeitschriften, Radio, Fernsehen und Internet: den sogenannten Massenmedien. Dabei geht es um nichts als Kommerz, um Werbung für Bücher. Zum Glück sind Sie keine Journalistin. Sie sind eine ernsthafte Leserin, eine Literaturprofessorin, und als Sie mir dieses Projekt vorschlugen, das Sie als «Biographie meines Werks» beschrieben, war ich fasziniert. Unschlüssig natürlich auch, aber fasziniert.
IBS Warum unschlüssig?
PA Aus angeborener Zurückhaltung, nehme ich an. Und weil ich mich nicht für geeignet halte, über meine eigene Arbeit Auskunft zu geben. Ich bin absolut unfähig, mit kritischem Abstand darüber zu sprechen. Die Leute fragen Warum, und ich habe keine Antwort. Sogar die Frage nach dem Wie kann sehr problematisch sein.
IBS Und doch sind Sie hier und reden mit mir.
PA Ja, weil Sie sich einverstanden erklärt haben, das Gespräch auf die Fragen Was, Wann und Wo zu beschränken. Ich hoffe, es wird mir möglich sein, auf diese Art von Fragen adäquat zu antworten. Und vielleicht kommt bei dem Versuch irgendetwas Gutes heraus, vielleicht kann ich selbst dabei etwas Interessantes entdecken.
IBS Sie sagten auch, Sie sehen dieses Projekt als eine Gelegenheit, «die Luft zu reinigen».
PA Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich auf einige bemerkenswerte Missverständnisse, was meine Bücher betrifft, gestoßen bin, große Irrtümer, zu denen ich gern etwas sagen würde. Und dabei rede ich nicht von Dingen wie Geschmack oder Interpretation, sondern von schlichten Tatsachen. Über meine Bücher sind etliche wissenschaftliche Arbeiten erschienen, dazu unzählige Artikel. Manches davon wird mir zugeschickt. Ich lese es nicht. Ich werfe einen kurzen Blick hinein, dann klappe ich das Buch zu und stelle es ins Regal. Vor zwei, drei Jahren jedoch warf ich einen Blick in ein Buch, das eben eingetroffen war, und las darin die völlig verblüffende Behauptung, meine autobiographischen Schriften – Die Erfindung der Einsamkeit, Das rote Notizbuch und Von der Hand in den Mund[5] – seien in Wirklichkeit fiktiv, erdachte Geschichten, Pseudo-Romane. Ich war erstaunt, das zu lesen – und auch betrübt. Ich hatte so viel geistige Anstrengung in die Erforschung dieser erinnerten Erfahrungen gesteckt, so hart daran gearbeitet, beim Schreiben ehrlich zu sein, und das alles in eine Art raffiniertes postmodernes Spiel gewendet zu sehen bestürzte mich. Wie konnte jemand so falschliegen? Und daher möchte ich hier und jetzt ein für alle Mal klarstellen: Meine Romane sind fiktiv, meine autobiographischen Texte sind nicht fiktiv. Um das gleich vorwegzusagen.
IBS Und der zweite Grund?
PA Ich möchte mit den wirren Vorstellungen von meinem angeblichen Einfluss auf Siris[6] Arbeit aufräumen. Seit langem kursieren da diverse Missverständnisse – sowohl in gedruckter Form als auch im Internet –, zum Beispiel, ich hätte sie mit Freud und der Psychoanalyse bekannt gemacht, ihr gesamtes Wissen über Lacan habe sie von mir, ich hätte sie in die Theorien von Bachtin eingeführt, und so weiter. Das alles ist nicht wahr. Als Siris erster Roman herauskam, musste sie sich von einem Journalisten anhören, sie könne das Buch unmöglich geschrieben haben, folglich müsse es von mir sein. Eine hässlichere Beleidigung kann man sich wohl kaum denken. Hatte dieser Mann solche Vorurteile gegenüber Frauen, dass er schlichtweg nicht glauben konnte, eine schöne Frau könne auch noch intelligent und eine begabte Schriftstellerin sein? Das sind die Tatsachen: Ich bin acht Jahre älter als Siri, und als 1981 unser gemeinsames Leben anfing, war sie erst sechsundzwanzig, eine Dichterin, die fleißig an ihrer Doktorarbeit in Anglistik schrieb, und da sie erst 1986 den Abschluss machte und ihr erster Roman erst 1992 erschien, war ich bereits einigermaßen bekannt, als sie die Literaturszene betrat. Das ging manchen Leuten über den Verstand – zwei Schriftsteller in einem Haushalt! –, und damit wurde das Gerücht losgetreten, ich würde in Brooklyn so eine Art Literaturfabrik betreiben. Blanker Unsinn. Siri ist einer der klügsten Menschen, die mir je begegnet sind. Sie ist die Intellektuelle in der Familie, nicht ich, und alles, was ich zum Beispiel über Lacan und Bachtin weiß, habe ich direkt von ihr. Ich selbst habe nur einen kurzen Aufsatz von Lacan gelesen, den Essay über Poes Story Der entwendete Brief in den Yale French Studies zum Poststrukturalismus – und das war 1966. Was Freud und die Psychoanalyse betrifft, kann ich nur lachen. Siri liest Freud, seit sie fünfzehn war, und im Mai dieses Jahres[7] wurde sie eingeladen, die zum 39. Mal stattfindende jährliche Sigmund-Freud-Vorlesung der Wiener Freud-Stiftung zu halten. Meine Güte, sie war erst der zweite Mensch ohne fachärztliche Qualifikation, den man dazu ausgewählt hat. Ihr Buch Die zitternde Frau von 2009 hat bei Medizinern, Neurowissenschaftlern und Psychiatern für solches Aufsehen gesorgt, dass das Komitee der Freud-Stiftung sie einstimmig zur Vortragenden dieses Jahres bestimmt hat.
IBS Ja, ich habe sie vor Akademikern verschiedenster Fachrichtungen reden gehört. Sie ist außerordentlich belesen und sehr beeindruckend. Wenn wir schon mal dabei sind, die Luft zu reinigen: Möchten Sie sonst noch etwas vorab sagen?
PA Nein, ich glaube nicht. Natürlich hätte ich noch mehr, aber ich denke, das reicht erst mal.
IBS Also können wir jetzt über Ihre Arbeit reden?
PA Ja, ja, schießen Sie los.
TEIL EINSAutobiographische Schriften
DIE ERFINDUNG DER EINSAMKEIT (1982): «Alles kommt von innen und bewegt sich nach außen.»
Das Buch, an dem er schreibt, hat keinen Sinn. (S. 220)
INGE BIRGITTE SIEGUMFELDTDie Erfindung der Einsamkeit, ein bahnbrechendes Buch, durchstößt die Grenzen der literarischen Konvention. Sie verarbeiten darin autobiographisches Material zu zwei fesselnden Narrativen, in denen es um Erinnerung, Einsamkeit und Möglichkeiten des Seins in der Welt geht; Themen, die seither Eckpfeiler Ihres Schreibens sind. Was brachte Sie dazu, den ersten Teil, Porträt eines Unsichtbaren, zu schreiben? War es der Tod Ihres Vaters?
PAUL AUSTER Ja, zweifellos war es der Tod meines Vaters, ein Ereignis, das völlig unerwartet und für mich durchaus schockierend kam. Er war sechs- oder siebenundsechzig – sein Geburtsjahr habe ich nie genau erfahren –, also jedenfalls kein alter Mann. Er war sein Leben lang bei guter Gesundheit gewesen. Er trank nicht, er rauchte nicht. Er spielte täglich Tennis. Ich hatte immer angenommen, er werde mindestens neunzig, und nie oder kaum an seinen Tod gedacht. Und doch, plötzlich geschah es. Und warf mein Leben über den Haufen. Die Enttäuschung darüber, dass ich so vieles noch nicht mit meinem Vater ausdiskutiert hatte, drängte mich dazu, über ihn zu schreiben. Plötzlich war er weg, ich konnte nicht mehr mit ihm reden. All die Fragen, die ich hatte stellen wollen, konnten nicht mehr gestellt werden. Aber es ist wichtig, festzuhalten, dass ich, wenn er ein Jahr früher gestorben wäre, das Porträt eines Unsichtbaren wahrscheinlich nicht geschrieben hätte. Zu der Zeit schrieb ich noch Gedichte, ausschließlich Gedichte, und hatte die Idee, Prosa zu schreiben, mehr oder weniger aufgegeben. Aber dann blieb ich mit den Gedichten stecken und konnte überhaupt nichts mehr schreiben. Eine schlimme Zeit für mich. Und eines Tages ging ich, wie im Winterjournal beschrieben, zu dieser Ballettprobe, und etwas geschah mit mir. Eine Offenbarung, eine Befreiung, ein fundamentales Etwas. Unmittelbar darauf schrieb ich Weiße Räume[8], womit ich zufällig in der Nacht fertig wurde, in der mein Vater starb. Ich weiß noch, ich ging um zwei zu Bett, samstagnachts/sonntagmorgens, und dachte, dieser Text, Weiße Räume, sei der erste Schritt hin zu einer neuen Möglichkeit, über das Schreiben nachzudenken. Früh am Morgen, nur wenige Stunden später, klingelte das Telefon. Es war mein Onkel, und er berichtete mir, dass mein Vater in der Nacht gestorben war. Das war das Schockierende. Dieses zufällige Zusammentreffen mit dem Umstand, dass ich zur Prosa zurückgefunden hatte, dass ich spürte, es war mir möglich, Prosa zu schreiben, endlich, nach so vielen Jahren, in denen ich mich damit abgemüht und es schließlich aufgegeben hatte.
IBSWas hat es Ihnen möglich gemacht?
PA Der Text, den ich in dieser Nacht beendet hatte.
IBSWeiße Räume ist also ein entscheidender Wendepunkt in Ihrer Karriere als Schriftsteller?
PA Der Text befreite mich von den Zwängen, die mich seit ein, zwei Jahren blockierten. Ich hatte mir gewissermaßen noch einmal das Schreiben beigebracht. Ich hatte alle Lektionen meiner Ausbildung über Bord geworfen – die mir, muss ich leider sagen, eher Last als Hilfe gewesen waren.
IBS Von welcher Ausbildung sprechen Sie jetzt?
PA Ich spreche von meiner literarischen Ausbildung. Von meinem Studium an der Columbia University und der intensiven Beschäftigung mit Texten, der man sich beim Literaturstudium widmet. Das alles hatte mich so befangen gemacht, dass ich irgendwie glaubte, jeder Roman müsse im Voraus bis ins Letzte ausgearbeitet sein, jede Silbe müsse irgendein philosophisches oder literarisches Echo erzeugen, ein Roman sei eine große Maschine aus Gedanken und Gefühlen, die man in jedem Satz bis zu den Phonemen hinunter analysieren könne. Es war zu viel. Ich hatte nicht erkannt, welch bedeutende Rolle das Unbewusste beim Erfinden von Geschichten spielt. Ich hatte noch keine Ahnung, wie wichtig Spontaneität und plötzliche Eingebungen sind. Ich habe sehr lange gebraucht, zu begreifen, dass fehlende Einsicht in das, was man gerade macht, ebenso nützlich sein kann. Weiße Räume, so gut oder schlecht dieser Text sein mag, war ein wichtiger Schritt für mich. Ich war bereit, mein Schreiben neue Formen annehmen zu lassen, und in gewisser Weise war der Tod meines Vaters ein Vorwand, damit weiterzumachen. Porträt eines Unsichtbaren entstand wie im Fieber. Mein Vater starb Mitte Januar 1979, und etwa Anfang Februar begann ich mit dem Buch. Es ist kein langer Text, und ich brauchte nur zwei Monate dafür. Schlecht beraten, beschloss ich später, ihn auszuweiten und auf eher traditionelle Art umzuschreiben, aber dann verwarf ich diese längere Fassung und kehrte zu der ursprünglichen zurück. Was mich antrieb, war zweifellos eine Kombination aus emotionalem Stress, dem Bedürfnis, etwas über meinen Vater zu sagen, und buchstäblich dem Gefühl, dass er, wenn ich es nicht täte, verschwinden würde. In diesem Moment war ich künstlerisch bereit, die Sache anzugehen. Das ist von wesentlicher Bedeutung.
IBS Und was motivierte den zweiten Teil der Erfindung der Einsamkeit, Das Buch der Erinnerung?
PA Nachdem ich den ersten Teil geschrieben hatte, gab es in meinem Leben noch weitere bedeutende Einschnitte. Ende 1978 musste ich meine erste Ehe als gescheitert ansehen. Nur sechs Wochen später starb mein Vater. Lydia[9] benahm sich mir gegenüber in diesen Wochen sehr rücksichtsvoll. Wir rückten zusammen, um diese schwierige Zeit zu überstehen, hielten aber an dem Plan fest, uns scheiden zu lassen, und im Frühjahr zog ich dann in mein tristes kleines Zimmer in der Varick Street in Manhattan. In den Monaten davor war so viel in meinem Leben zerbrochen, dass ich eine Chronik dieser Ereignisse schreiben wollte. Daraus wurde dann Das Buch der Erinnerung.
IBSPorträt eines Unsichtbaren und Das Buch der Erinnerung unterscheiden sich stark in Tonfall, Stil, Struktur und Perspektive, aber ich finde, gerade dieser Kontrast bereichert die beiden Texte. Wie Sie im Vorgespräch sagten, hatten Sie ursprünglich nicht vor, sie zusammen zu publizieren. Warum dann doch?
PA Ich gab den ersten Teil einem befreundeten Dichter, der einen winzigen Verlag betrieb. Dort sollte es als schmales Bändchen von fünfundsiebzig, achtzig Seiten erscheinen. Das Problem war, ihm fehlte das Geld, und als er es schließlich zusammengekratzt hatte, war Das Buch der Erinnerung fertig. Zwei dünne Bücher wären teurer geworden als ein dickeres. Dann fiel mir der Titel ein: Die Erfindung der Einsamkeit. Das Buch bildet eine Einheit, auch wenn es aus zwei ganz verschiedenen Texten besteht, und im Nachhinein bin ich froh, dass es so gekommen ist. Die zwei Teile stoßen einander ab und scheinen mir als Gespann stärker zu sein, als wenn sie einzeln aufgetreten wären.
I.Porträt eines Unsichtbaren: Das Spektrum eines Menschen
IBS In Porträt eines Unsichtbaren beschreiben Sie Ihren Vater als äußerst distanziert zu den Menschen, die ihm am nächsten standen. Paradoxerweise machen Sie ihn für den Leser gerade dadurch «anwesend», dass Sie ihn vor allem durch seine Abwesenheit charakterisieren.
PA Wie ich in der ersten Hälfte des Buchs ziemlich deutlich mache, war das Merkwürdige an meinem Vater, dass er Schwierigkeiten hatte, eine Beziehung zu den Menschen zu finden, die ihm besonders wichtig waren: seine Frau und seine Kinder. Bei anderen Leuten war es anders. Wenn zum Beispiel ein Freund mitten in der Nacht auf der Straße gestrandet war, rief er meinen Vater an, weil er wusste, dass er kommen würde. Er war auch großzügig und verständnisvoll gegenüber seinen ärmeren Mietern und seinem Neffen, meinem Cousin, um den er sich viele Jahre lang kümmerte. Mein Vater hatte ein gutes Herz und ein starkes Verantwortungsbewusstsein, auch wenn es ihm schwerfiel, dies den Menschen gegenüber, die ihm am nächsten waren, zum Ausdruck zu bringen. Vor kurzem schrieb mir eine Frau, die in den letzten Jahren seines Lebens in seiner Nachbarschaft gewohnt hatte: «Sie können sich nicht vorstellen, wie freundlich Ihr Vater nach unserem Einzug hier zu uns war.» Er hat ihren kleinen Kindern Geschenke gekauft – Schneeanzüge. Das hat mich sehr bewegt.
IBS Schon sehr merkwürdig.
PA Genau das wollte ich in dem Buch zum Ausdruck bringen. Das ist die «verwirrende Kraft des Widerspruchs» (S. 95): Er war dies, und er war das. Man sagt das eine, und es ist wahr, aber auch das Gegenteil ist wahr. Menschen sind nicht berechenbar, sie lassen sich kaum in Worte fassen. Die Auseinandersetzung mit all den verschiedenen Aspekten einer Person kann sehr verwirrend sein.
IBS Aber hat diese Verwirrung nicht etwas Dynamisches? Ich meine, empfindet man nicht das Bedürfnis, die verschiedenen Aspekte zusammenzusetzen?
PA Das hört sich an, als hätte ich versucht, eine Art Frankenstein’sches Monster zu erschaffen [lacht]. Nein. Ich glaube, die einzige Metapher, die ich in Zusammenhang mit der Bandbreite verschiedener Persönlichkeiten innerhalb einer Person verwendet habe, ist das Spektrum. Davon bin ich überzeugt: Jeder Mensch ist ein Spektrum. Den größten Teil unseres Lebens verbringen wir in der Mitte, aber es gibt Augenblicke, in denen wir zu den Außenrändern abdriften, und je nach Situation, abhängig von Stimmung, Alter und äußeren Umständen, wechseln wir auf dieser Skala die Farbe.
IBS Ja, das Bild vom Spektrum leuchtet ein. Und denken Sie, es gibt etwas, das ein Individuum zusammenhält? So etwas wie eine Trägersubstanz?
PA Falls ja, dann wäre es das Ich-Bewusstsein.
IBS Freut mich, dass Sie nicht «Identität» gesagt haben.
PA Identität ist das, was in meinem Pass steht. Nein, ich weiß nicht einmal, was Identität in diesem Zusammenhang bedeutet. Irgendwann, vielleicht im Alter von fünf, sechs Jahren, erlebt man einen Augenblick, in dem man etwas denkt und gleichzeitig auf einmal in der Lage ist, sich zu sagen, dass man es denkt. Zu dieser Dopplung kommt es, wenn wir anfangen, über unser Denken nachzudenken. Sobald man das kann, ist man imstande, sich selbst seine eigene Geschichte zu erzählen. Wir alle haben eine unversehrte innere Version davon, wer wir sind, und die erzählen wir uns immer wieder, an jedem Tag unseres Lebens.
IBS Und sie verändert sich ständig.
PA Ja, sie verändert sich, die Geschichte wandelt sich. Natürlich schreiben wir sie ständig um. Schon aus Selbstschutz neigen wir dazu, das Schlimmste wegzulassen. Oliver Sacks, der Neurologe, arbeitete mit hirngeschädigten Patienten, die die Fähigkeit verloren hatten, sich diese Geschichte selbst zu erzählen – Siri weiß mehr darüber als ich. Der Faden ist abgeschnitten, und dann besitzen sie keine Persönlichkeit mehr. Sie sind kein «Ich» mehr. Sie sind fragmentierte Wesen. Ich glaube, was Menschen zusammenhält, ist diese innere Erzählung. Nicht «Identität». Immer wieder lese ich, meine Romanfiguren suchen nach Identität, aber ich habe keine Ahnung, was das heißen soll.
IBS Gesucht wird tatsächlich fast immer …
PA Aber nicht Identität.
IBS Sondern Verstehen?
PA Oder eine Möglichkeit, zu leben, eine Möglichkeit, sich das Leben möglich zu machen.
IBS Mit seinen Widersprüchen?
PA Ja.
IBS Wenn das Ich als Geschichte geformt ist, spielt dann nicht auch Erfindung mit hinein? Wir denken uns etwas aus, das wir von uns glauben wollen.
PA Allerdings – und manche von uns täuschen sich mehr als andere.
IBS [Lacht]
PA Manche Leute können eine halbwegs wahre Geschichte von sich selbst erzählen. Andere sind Phantasten. Ihr Eindruck von dem, wer sie sind, steht in so krassem Gegensatz zu dem, wie der Rest der Welt über sie denkt, dass man sie nur noch bemitleiden kann. Man erlebt das immer wieder: die alternde Frau, die sich immer noch für zwanzig hält und gar nicht mitbekommt, wie lächerlich sie auf andere wirkt. Oder der mittelmäßige Dichter, der sich für ein Genie hält. Es ist peinlich, mit solchen Leuten zusammen zu sein. Dann gibt es das andere Extrem: Leute, die sich innerlich herabsetzen. Oft sind sie viel interessanter, als sie denken, und werden von anderen bewundert. Trotzdem machen sie sich vor sich selber schlecht. Fast naturgemäß sind die Guten streng mit sich – und die nicht so Guten halten sich für die Besten [lacht].
IBS Lag es vielleicht an solchen Selbstzweifeln, dass Ihr Vater so ungern mit seinem Namen unterschrieb? Ich denke an die frappierende Stelle in Porträt eines Unsichtbaren:
Er konnte nicht einfach den Stift aufs Papier setzen und seinen Namen schreiben. Als wollte er den Augenblick der Wahrheit unbewusst hinausschieben, begann er stets mit einem leichten Schwenk, mit einer kreisenden Bewegung ein paar Zentimeter über dem Papier, wie eine Fliege, die in der Luft herumsummt und ihren Landepunkt einkreist, bevor er dann zur Sache kam. (S. 48)
Für mich ist dies das Bild eines Mannes, der so sehr von sich selbst distanziert ist, dass es ihn sogar beunruhigt, sich auf seinen Namen festzulegen.
PA Ich finde das eher lustig. In den Fünfzigern gab es in Amerika eine beliebte Fernsehsendung, The Honeymooners, mit einem Komiker namens Jackie Gleason und seinem Sidekick, gespielt von Art Carney, der immer erst nach irrwitzigen Handverrenkungen etwas unterschreiben konnte. Mein Vater machte es ähnlich, wenn auch nicht so übertrieben. Ich fand das immer liebenswert, und seltsam.
IBS Ich hatte den Eindruck, diese von Ihnen geschilderte Abneigung, seinen Namen zu Papier zu bringen, sei vielleicht ein weiteres Zeichen für die «Unsichtbarkeit» des Porträtierten – um den Titel mit dem Mann zu verbinden, oder umgekehrt, oder, allgemeiner gesagt, einen Zusammenhang zwischen Namen und Figur herzustellen.
PA Na ja, wenn es einen solchen Zusammenhang gibt, habe ich ihn nicht bewusst hergestellt. Seltsamerweise kommen fast alle Figuren in meinen Romanen bereits mit ihrem Namen zur Welt. Ich kann mich nur an einen einzigen Fall erinnern, wo ich den Namen des Protagonisten nachträglich geändert habe. Jim Nashe, der Held der Musik des Zufalls, trug ursprünglich den alten New-England-Namen Coffin. Ich schrieb den ganzen Roman mit Nashe als Coffin, und erst als ich fertig war, ging mir auf, dass ich es zwar nicht symbolisch gemeint hatte …
IBS … aber jeder hätte es so verstanden.
PA Absolut, jeder hätte es so verstanden, und daher habe ich den Namen geändert. Sonst ist mir das nie passiert. Alle meine anderen Figuren haben den Namen behalten, mit dem sie geboren wurden.
IBS Das heißt also, Sie konstruieren so gut wie nie einen Zusammenhang zwischen den Namen der Figuren und der Rolle, die sie in der Geschichte spielen? Es liegt Ihnen nichts daran, die Künstlichkeit der Fiktion und die Tatsache, dass die Protagonisten nur Produkte Ihrer Phantasie sind, zusätzlich herauszustreichen?
PA Jede fiktive Figur ist ein Phantasieprodukt.
IBS Eben. Ich stelle mir vor, dass viele Leser sich fragen, warum Sie einer Figur einen bestimmten Namen gegeben haben, besonders dann, wenn manche davon so offensichtlich bedeutungsschwanger zu sein scheinen.
PA «Weh dem, der Symbole sieht», wie Beckett in Watt[10] schrieb. Ich fürchte, meist kommt das aus dem Unbewussten, aus dem Bauch. Der Theaterregisseur Peter Brook hat einmal etwas gesagt, das mich sehr beeindruckt hat: «Ich versuche in meiner Arbeit, die Nähe des Alltäglichen mit dertanz des Mythischen zu vereinigen. Denn ohne Nähe wird man nicht bewegt, und ohne Distanz wird man nicht überrascht.» Das ist wunderbar formuliert. Prägnant und präzise, und vielleicht bin ich deshalb so empfänglich dafür, weil es auch meiner Vorstellung von Kunst entspricht.
IBS Diese Dualität spielt weit in die Beziehung zwischen inneren und äußeren Dimensionen Ihres Porträts des Vaters, Ihres Vaters, in Die Erfindung der Einsamkeit hinein, oder?
PA Das will ich hoffen.
IBS Gegen Ende von Porträt eines Unsichtbaren sagen Sie: «Wenn ich in dieses Schweigen trete, wird mein Vater für immer verschwunden sein.» (S. 100) Ist Ihnen das so vorgekommen? Ich hätte gedacht, das Schreiben über die Toten erhält die Menschen am Leben. Wie die Erinnerung, in der, wie Sie sagen, die Dinge ein zweites Mal geschehen. Oder kann man etwas nur ins Leben zurückholen, wenn man darüber schreibt? Und dann verschwindet es?
PA Ich wusste nicht, was passieren würde, stellte mir aber etwas dergleichen vor. Während ich an dem Buch arbeitete, stand mein Vater mir sehr lebendig vor Augen, und das Schreiben schien den Schmerz über seinen Tod ein wenig zu lindern. Aber als das Buch fertig war, war es, als ob ich es nie geschrieben hätte. Alles war genau wie vorher. Die Anfertigung des Porträts hatte keine Lösung gebracht. Schreiben ist keine Therapie.
IBS Also geht es um den Prozess des Schreibens, nicht um das Ergebnis?
PA Ja, denn während ich an dem Buch schrieb, versuchte ich ständig, alle Seiten meines Vaters gleichzeitig darzustellen, und es ermutigte mich jedes Mal, wenn ich wieder etwas Positives an ihm entdeckte. Er hatte schließlich sehr gute Eigenschaften, und ich glaube, wenn er unter anderen Umständen aufgewachsen wäre, hätte sich ein ganz anderes Leben für ihn ergeben. Er war stark von seinem Umfeld geprägt. Die Geschichte seiner Einwanderung, die verrückte Mutter, die Ermordung seines Vaters, als er ein kleiner Junge war, die ständigen Umzüge der Familie – all das hat ihn gelehrt, sich zu verstecken. Er kann einem schon leidtun. Mir jedenfalls tut er sehr leid.
IBS Es war sicher schwer, der Sohn eines Mannes zu sein, der sich so abseits gehalten hat.
PA Ich war nicht einmal halb so alt wie heute, als ich dieses Buch geschrieben habe, und Tatsache ist, dass ich noch immer ständig an meinen Vater denke. Wie ich im Winterjournal schreibe, träume ich auch ziemlich oft von ihm. In diesen Träumen unterhalte ich mich mit ihm, und auch wenn ich mich nicht an Einzelheiten erinnern kann, so weiß ich, dass es immer freundliche Unterhaltungen sind. Ich wünschte, er hätte noch erleben können, wie gut es mir gelungen ist, für mich selbst zu sorgen – nach einem so holprigen Anfang.
IBS Sie hätten es gerngehabt, dass er Ihre Erfolge miterlebt hätte.
PA Ja, natürlich.
IBS Wie war das mit Ihrer Großmutter? Sie sagten gerade, sie war verrückt. In Porträt eines Unsichtbaren erscheint sie als sehr starke Frau, die ihre vier Söhne mit eisernem Griff beherrschte.
PA Sie hatte vier Söhne und eine Tochter. Meine Tante Esther, das älteste der Auster-Kinder, war die Mutter des Neffen, den mein Vater später unter seine Fittiche genommen hat. Sie hatte ein trauriges Leben. Ihre Mutter, meine Großmutter, war ein grausamer Mensch.
IBS Erinnern Sie sich an sie?
PA Lebhaft. In der Familie erzählte man sich, sie habe ihre Söhne mit einem Besen auf den Kopf geschlagen, wenn sie sich über sie ärgerte.
IBS Woher stammte sie?
PA Aus Stanislaw, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte. Galizien, heute im Westen der Ukraine, nicht weit von Polen. Soweit ich weiß, kam sie mit vierzehn nach Amerika. Als Waisenkind. Nachdem sie meinen Großvater geheiratet hatte, kehrten die beiden mehrmals nach Europa zurück. Die Realität der Immigration ist sehr viel komplexer als der Mythos davon. Zum Beispiel wurde mein Onkel, der nächstältere Bruder meines Vaters, in London geboren. In jungen Jahren hat meine Großmutter in einer Hutfabrik an der Lower East Side gearbeitet, glaube ich. Über ihre Familie weiß ich nicht viel. Ihr Name war Perlmutter, ein gewöhnlicher jüdischer Name. Sie war ungebildet und hat nie richtig Englisch gelernt.
IBS Aber sie war keine Analphabetin?
PA Nein, sie hat den Jewish Daily Forward in Jiddisch gelesen.
IBS Und auch Jiddisch gesprochen, nehme ich an?
PA Ja. Vor einigen Jahren ist etwas Komisches passiert. Siri und ich waren beim Begräbnis eines Cousins von mir. Eine Cousine war auch da, das älteste von neun Enkelkindern, eine Frau, die ich immer sehr gemocht habe, Jane Auster …
IBS Jane Auster!
PA Ja, meine Cousine Jane. Jedenfalls waren wir auf dem Friedhof, wo die meisten Angehörigen meines Vaters begraben sind. Wir gingen dann alle zum Grab unserer Großmutter, und Jane, eine freimütige und sehr humorvolle Frau, sah auf das Grab und sagte: «Weißt du, Grandma, ich habe dich immer gehasst. Du warst der schlimmste Mensch, der mir je begegnet ist. Du warst böse, und ich hatte Angst vor dir. Und obendrein warst du die schlechteste Köchin aller Zeiten. Du konntest ums Verrecken keine anständige Mahlzeit auf den Tisch bringen.» Das löste die Spannung, und alles lachte. Nein, sie war grausam, meine Großmutter. Auch ich hatte Angst vor ihr. Ich habe mich ihr nie verbunden gefühlt.
IBS Hatten ihre Söhne nicht auch Angst vor ihr?
PA Schon, aber sie waren ihr gegenüber immer loyal.
IBS Aus Angst?
PA Nein, wegen des Mordes an meinem Großvater. Sie hielten zusammen.
IBS Sie wussten also alle davon?
PA Einer meiner Onkel war Augenzeuge. Meine Tante Esther muss zu der Zeit achtzehn gewesen sein. Ja, sie wussten es, alle wussten es. Sie haben es bloß keinem erzählt. Sie haben alle den Mund gehalten und das Geheimnis nie verraten. Bis zu diesem seltsamen Zufall, den ich in Die Erfindung der Einsamkeit schildere, als mein Cousin (der kürzlich verstorbene) im Flugzeug neben einem Mann saß, der von Kenosha, Wisconsin, zu reden anfing. Da kam die Geschichte schließlich ans Licht.
IBS Wie gesagt finde ich das Porträt Ihres Vaters sehr lebendig, weil es Ihnen gelingt, seine «Abwesenheit» so «anwesend» zu machen. Dennoch erklärt der Ich-Erzähler – erklären Sie –, es sei nötig, «gleich von Anfang an zu erkennen, dass dieses Projekt zum Scheitern verurteilt ist» (S. 34). Warum Scheitern?
PA Weil ich nicht glaube, dass man irgendeinen Menschen vollständig erfassen kann. Man versucht es, aber wie wir bereits festgestellt haben, lässt sich das Rätsel eines Menschen schlicht nicht lösen. Schreiben bedeutet in gewisser Weise immer Scheitern. Um noch einmal Beckett zu zitieren: «Nochmals gescheitert. Besser gescheitert.»[11] Besser scheitern – ja, so soll es sein. Man macht weiter – und scheitert besser.
IBS Können Sie das erläutern? Warum ist Schreiben zum Scheitern verurteilt?
PA Weil man niemals erreichen kann, was man zu erreichen hofft. Manchmal kommt man dem nahe, und andere finden Gefallen daran, aber man selbst, der Autor, wird immer das Gefühl haben, gescheitert zu sein. Man weiß, man hat sein Bestes getan, aber das Beste ist nie gut genug. Vielleicht schreibt man deswegen immer weiter. Um das nächste Mal ein wenig besser zu scheitern.
IBS Diese Reflexionen über die Prozesse und die Mechanik des Schreibens, die Sie in das Porträt eines Unsichtbaren einschalten, sind in meinen Augen ein weiterer Grund dafür, warum das Buch so gut ist. Diese Art von Meta-Kommentaren beansprucht den Leser auf eine Weise, wie traditionelle autobiographische Texte es nicht tun. Zum Beispiel hier:
Ich habe das Gefühl, ich versuche irgendwo hinzugelangen, als wüsste ich, was ich sagen wollte, aber je weiter ich gehe, desto stärker wird meine Überzeugung, dass der Weg zu meinem Ziel gar nicht existiert. Ich muss ihn mir selbst bahnen, und das bedeutet, dass ich mir nie sicher sein kann, wo ich mich eigentlich befinde. Als würde ich mich im Kreis bewegen, den einen Weg ständig wiederholen, in viele Richtungen zugleich gehen. Und selbst wenn mir wirklich ein kleiner Fortschritt gelingt, bin ich noch längst nicht überzeugt, dass er mich dorthin bringen wird, worauf ich zuzusteuern glaube. Dass man in der Wüste herumirrt, bedeutet noch lange nicht, dass irgendwo ein Gelobtes Land existiert. (S. 51)
PA In diesem Buch habe ich meinen Weg beim Schreiben gefunden. Und das spiegelt sich im Text wider. Mir lag immer daran, die innere Mechanik meines Schreibens offenzulegen – oder das jedenfalls zu versuchen –, weil mir der Denkprozess genauso interessant scheint wie seine Ergebnisse.
IBS Nicht zuletzt deswegen sagt man, Ihr Werk sei postmodern.
PA Das verstehe ich nicht.
IBS Weil ein konventionelles Kunstwerk sich als geschlossene Einheit darstellt; es lebt von seiner eigenen Schönheit und Wahrheit und erreicht einen mehr oder weniger passiven Adressaten.
PA Und wir verheimlichen alle unsere Zweifel!
IBS Ja, weil wir gemeinsam vorgeben, die Geschichte sei real: Autor und Leser.
PA Mir liegt nichts daran, etwas vorzugeben. Aber noch einmal: «Postmodern» verstehe ich nicht.
IBS Das ist bloß ein Etikett.
PA Mag sein. Aber für mich haben derlei Etikettierungen etwas Arrogantes, dahinter steckt eine Selbstsicherheit, die ich geschmacklos finde, wenn nicht geradezu verlogen. Ich versuche, mich angesichts meiner Verwirrungen in Bescheidenheit zu üben, und ich möchte meinen Zweifeln keinen Stellenwert verleihen, den sie nicht verdienen. Ich stolpere wirklich. Ich tappe wirklich im Dunkeln. Ich weiß nicht. Und wenn das – was ich Aufrichtigkeit nennen würde – als postmodern gilt, also gut, meinetwegen, aber es ist nicht so, dass ich jemals ein Buch schreiben wollte, das sich wie John Barth oder Robert Coover anhört.
IBS Nein, nein, darauf wollte ich keineswegs hinaus. Ich verstehe, was Sie über Aufrichtigkeit sagen. Sie ist das Fundament Ihres Schreibens, sie macht Ihre Texte so beziehungsreich und anregend. Dieser erstaunliche Satz in der Passage, die wir eben gelesen haben: «Dass man in der Wüste herumirrt, bedeutet noch lange nicht, dass irgendwo ein Gelobtes Land existiert.» Ist das ein Kommentar zum Schreibprozess im Allgemeinen, oder gilt das speziell für die Arbeit an diesem bestimmten Porträt?
PA Nein, das ist eine allgemeine Feststellung. Sie gilt nicht nur fürs Schreiben, sondern für jedes menschliche Unterfangen. Man tastet nach etwas. Auch Wissenschaftler irren «in der Wüste» herum, wenn sie ein wissenschaftliches Problem zu lösen versuchen. Und es ist nicht gesagt, dass sie die Lösung finden werden. Manchmal muss man ein wenig in die Irre gehen.
IBS Eine Reise auf etwas zu, aber man weiß nicht, wohin sie einen führt?
PA Man hat nicht die leiseste Ahnung.
IBS Und keine Richtschnur?
PA Nein, nein. Keine Methode.
IBS Nun, man hat nicht den Eindruck, dass Sie «in der Wüste» herumgeirrt sind, als Sie Die Erfindung der Einsamkeit schrieben. Das Buch wird im Allgemeinen als innovativer und eleganter Vorstoß gegen die Konventionen von Biographie und Autobiographie gewertet. Aus dem, was Sie über Ihre Motivation für dieses Buch gesagt haben, kann ich also nicht schließen, dass Sie sich vorgenommen hatten, einem literarischen Genre neue Impulse zu geben?
PA Nein, aber wie soll ich sagen … Die Erfindung der Einsamkeit war eine Folge der Erkenntnisse, zu denen ich beim Nachdenken darüber gekommen war, wie ich schreiben könnte. Ich hatte erkannt, dass alles von innen kommt und sich nach außen bewegt. Niemals umgekehrt. Die Form kommt nicht vor dem Inhalt. Der Stoff selbst findet die ihm gemäße Form, während man daran arbeitet. Ich hatte also noch kein Rezept, bevor ich anfing, sondern fand es erst beim Schreiben. Das schien mir unerlässlich. Mir lag nichts daran, anders zu sein, ich wollte nur herausfinden, wie ich sagen könnte, was ich zu sagen hatte. Und wenn das Ergebnis nicht mit den Konventionen des Genres übereinstimmt, dann ist es eben so.
IBS Im Porträt eines Unsichtbaren kommt erstmals das Thema zur Sprache, das wir «Verlassene Dinge» genannt haben, womit Sie die Bedeutung hervorheben, die der Hinterlassenschaft eines Verstorbenen beigemessen wird, wie so oft in Ihren Büchern:
Gegenstände sind träge: Bedeutung haben sie nur in ihrem funktionalen Bezug auf das Leben, welches sich ihrer bedient … Und doch sagen sie uns etwas; sie stehen dort nicht als Gegenstände, sondern als Überbleibsel von Gedanken, von Bewusstsein, als Embleme der Einsamkeit, in der ein Mensch ihn selbst betreffende Entscheidungen fällt. (S. 19)
Im Land der letzten Dinge spielt buchstäblich inmitten verlassener Dinge; in Stadt aus Glas sammelt Stillman kaputte Gegenstände, die er in der Gosse findet, und benennt sie neu; anderswo sichten Ehemänner wie besessen die Kleiderschränke ihrer verstorbenen Frau; ein Vater spielt mit den Sachen seiner toten Söhne …
PA Im Buch der Illusionen, ja.
IBS Überall! Dinge, die kaputt sind oder keinen Besitzer mehr haben.
PA Abgekoppelte Dinge, ja. Verlorene Gegenstände. Auch in Sunset Park. Miles, der verlassene Gegenstände fotografiert. Bings Klinik für kaputte Dinge. Stimmt. Das ist also ein wiederkehrendes Motiv. Und?
IBS Warum diese Vorliebe für Aufgegebenes, für Herrenloses? Wo kommt die her?
PA Ich weiß es nicht genau. Vielleicht kommt das aus dem Bauch. Im Porträt hatte es sicher mit unmittelbarem Erleben zu tun. Mein Vater gehörte zu der Generation von Männern, die Krawatten trugen, und offenbar bewahrte er jede Krawatte auf, die er jemals besessen hatte. Als er starb, hatte er gut hundert in seinem Schrank. Dann ist man mit all diesen Krawatten konfrontiert, die gewissermaßen einegeschichte seines Lebens darstellen. Was soll man damit machen? Entweder wirft man sie weg, oder man gibt sie in die Kleidersammlung, aber wer will denn eine Krawatte aus dem Jahr 1943? Das war schon sehr bitter. Und das einzige Mal, dass ich geweint habe. Als ich vom Tod meines Vaters erfuhr, habe ich nicht geweint, auch nicht bei der Beerdigung. Nein. Aber als ich die Krawatten zum Auto trug, um sie wegzuschaffen, brach ich in Tränen aus. Ich hatte hundert Krawatten im Arm. Alles, was von ihm übrig war. Mein Interesse an diesen verlassenen Dingen, wie Sie das nennen, beruht also nicht auf Gedanken oder Vorstellungen über Gegenstände, sondern schlicht auf den Erfahrungen mit solchen Dingen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Vielleicht ist das der Ursprung der Theorie über Gegenstände in Filmen, die ich später in Mann im Dunkel entwickelt habe. Die großen Filmemacher verstehen es, Gegenstände mit menschlichen Gefühlen aufzuladen und mit ihnen Geschichten zu erzählen.
IBS Und Sie tun das in Ihren Büchern.
PA Na ja, nicht so gut wie manch andere. In meinen Filmen ist es mir nie gelungen.
IBS Denken Sie an die Stelle im Buch der Illusionen, wo David Zimmer die Baseball-Karten sortiert …
PA Und die Spielsachen und Legosteine …
IBS Das ist eine der bewegendsten Szenen des Buchs. Man sieht förmlich die Jungen auf dem Fußboden spielen, auch wenn sie kaum beschrieben werden. Da haben Sie exakt diese Wirkung erzielt: verlassene Dinge, die ihre abwesenden Besitzer, wenn auch nur für einen Moment, wieder zum Leben erwecken.
PA Nur um ihre Abwesenheit noch deutlicher zu machen. Das macht die Sache tragisch, oder wenn nicht tragisch, so doch bitter.
IBS Sie werden dadurch doppelt abwesend.
PA Ja.
IBS In diesem Zusammenhang sind Fotos sehr wichtig, weil sie den Abwesenden in zweidimensionalen Momentaufnahmen wieder aufleben lassen. Ich denke an das Trickfoto in Porträt eines Unsichtbaren, das die fehlende Verbindung Ihres Vaters mit der Welt so wirkungsvoll zum Ausdruck bringt, dass man meint, es sei eigens dazu erdacht, das Porträt abzurunden: der unheimliche Mangel an Anwesenheit, das Fehlen von Kommunikation:
… als säße er dort nur, um sich selbst zu beschwören, sich selbst von den Toten zurückzuholen, als habe er sich durch seine Vervielfältigung versehentlich selbst zum Verschwinden gebracht. Er sitzt fünfmal dort, doch liegt es im Wesen der Trickfotografie, dass die verschiedenen Ausgaben seiner selbst keinen Blickkontakt miteinander haben können. Jeder Einzelne ist dazu verurteilt, immerzu ins Leere zu starren, als lasteten die Blicke der anderen auf ihm, doch ohne etwas zu sehen, ohne je etwas sehen zu können. Es ist ein Bild des Todes, das Porträt eines Unsichtbaren. (S. 50)
PA Haben Sie das Bild gesehen? Es hängt hier an der Wand.
IBS Ich war mir nicht sicher, ob es ein echtes Foto ist.
PA Ich will es Ihnen zeigen. [Er steht auf und zeigt auf ein Foto an der Wand.] Es ist faszinierend, wie gleichgültig wir gegenüber Familienfotos anderer Leute sind. Sie sagen uns nichts. Sie sind uns egal. Aber wenn die Fotos unsere eigene Familie zeigen, sind sie voller Bedeutung. Das ist für jeden etwas sehr Privates.
IBS Wegen der Erinnerungen, die sich damit verbinden.
PA Ja, und weil sie den Beweis liefern, dass der eigene Vater tatsächlich einmal ein Baby war.
II.Das Buch der Erinnerung: Die Sprache und der Körper
IBS Etwas zurückholen, mit Hilfe von Dingen, bei denen es sich um Worte, Fotos oder Erinnerungen handeln kann, das ist das Thema des zweiten Teils von Die Erfindung der Einsamkeit. Das Buch der Erinnerung ist eine Sammlung von Charakterskizzen, zusammengehalten von zwei Absätzen – dem ersten und dem letzten –, die identisch sind.
PA Bis auf den ersten Satz und das letzte Wort. Der Anfang lautet:
Er legt ein leeres Blatt Papier vor sich auf den Tisch und schreibt. Es war. Es wird nie wieder sein.
Und das Buch endet mit:
Er nimmt ein neues Blatt Papier. Er legt es vor sich auf den Tisch, nimmt seinen Federhalter und schreibt.
Es war. Es wird nie wieder sein. Erinnere dich.
IBS Erinnerung wird hier zum übergeordneten Prinzip. Der Autor erinnert sich, während er in seinem einsamen Arbeitszimmer auf und ab schreitet. Könnten wir sagen, dass er in gewissem Sinne diesen kahlen Raum mit seinem sich bewegenden Körper füllt, so wie er das leere Blatt Papier mit Worten füllt? Mit Gedanken, Gefühlen und Bildern, die sich über das Blatt bewegen? Genau wie in Weiße Räume befinden wir uns in diesen viereckigen leeren Räumen, die den Rahmen so vieler Ihrer Geschichten bilden?
PA Ich denke, das gilt für dieses Buch und einige andere, die ich später geschrieben habe. Aber noch einmal, das geschah unbewusst. Ich hatte das nicht geplant. Ja, ich wusste kaum, was ich da tat. Ich versuchte eine Struktur für das Buch zu entwickeln, einen musikalischen Rhythmus für die kleinen Prosablöcke, die da ständig aneinanderstießen. Wiederholen, und dann weiter, damit der Leser nie vergisst, dass wir uns immer noch in diesem Augenblick befinden. Das war schwierig. Ich hatte dazu eine Zeichnung angefertigt, die später irgendwo abgedruckt wurde.[12]