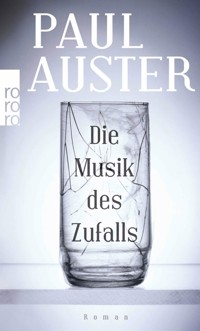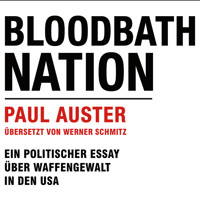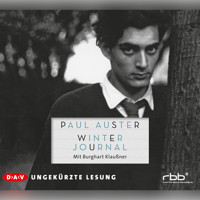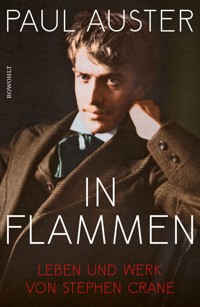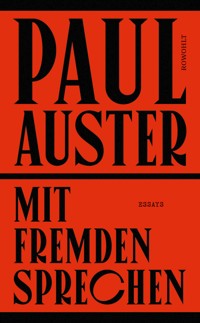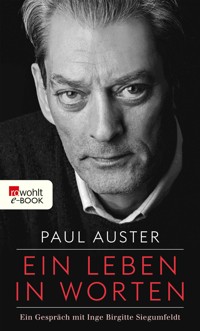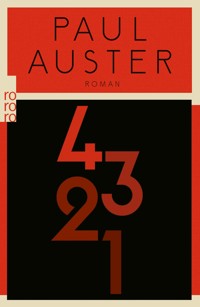19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der neue Roman von Paul Auster nach seinem großen Bestseller «4321» – ein weises Buch über die Liebe und eine Mut machende, tröstliche Betrachtung der letzten Lebensjahre, die sich der Endlichkeit alles Irdischen stoisch bewusst ist. Professor Seymour T. Baumgartner, unter Freunden Sy, ist ein über siebzigjähriger emeritierter Phänomenologe aus Princeton, der sich dem Schreiben philosophischer Bücher und, zunehmend, seinen Jugendreminiszenzen widmet: seiner kleinbürgerlichen Herkunft aus Newark; der schwierigen Ehe der Eltern, dem Collegebesuch und einem Studienaufenthalt in Paris; schließlich der wie ein Blitz einschlagenden Liebe zur Übersetzerin und Dichterin Anna, mit der er die glücklichsten Jahre verbrachte, bevor sie vor zehn Jahren einem Badeunfall zum Opfer fiel. Annas Tod hat ein tiefes Loch in seinem Leben hinterlassen, das aller Pragmatismus, alle Selbstironie nicht füllen kann. Denn Anna war wirklich das, was man seine bessere Hälfte nennt. Eines Tages, um sich zu trösten, wagt Sy sich endlich in ihr Arbeitszimmer, das er seit ihrem Tod nicht betreten hat. «Einer der großen Autoren unserer Zeit» San Francisco Chronicle «Auster ist ein Zauberer.» The New York Review of Books
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Ähnliche
Paul Auster
Baumgartner
Roman
Über dieses Buch
Professor S.T. Baumgartner, unter Freunden Sy, ist ein über siebzigjähriger emeritierter Phänomenologe aus Princeton, der sich dem Schreiben philosophischer Bücher und, zunehmend, seinen Jugendreminiszenzen widmet: seiner kleinbürgerlichen Herkunft aus Newark; der schwierigen Ehe der Eltern, dem Collegebesuch und einem Studienaufenthalt in Paris; schließlich der wie ein Blitz einschlagenden Liebe zur Übersetzerin und Dichterin Anna, mit der er die glücklichsten Jahre verbrachte, bevor sie vor zehn Jahren einem Badeunfall zum Opfer fiel.
Annas Tod hat ein tiefes Loch in seinem Leben hinterlassen, das aller Pragmatismus, alle Selbstironie nicht füllen können. Denn Anna war wirklich das, was man seine bessere Hälfte nennt. Eines Tages, um sich zu trösten, wagt sich Sy endlich in ihr Arbeitszimmer, das er seit ihrem Tod nicht betreten hat …
Eine Mut machende, tröstliche und optimistische Betrachtung der letzten Lebensjahre, die sich des baldigen Endes stoisch bewusst ist.
Vita
Paul Auster wurde 1947 in Newark, New Jersey, geboren. Er studierte Anglistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University und verbrachte nach dem Studium einige Jahre in Frankreich. International bekannt wurde er mit seinen Romanen Im Land der letzten Dinge und der New-York-Trilogie. Sein umfangreiches, vielfach preisgekröntes Werk umfasst neben zahlreichen Romanen auch Essays und Gedichte sowie Übersetzungen zeitgenössischer Lyrik. Am 30. April 2024 ist Paul Auster im Alter von 77 Jahren gestorben.
Werner Schmitz ist seit 1981 als Übersetzer tätig, u. a. von Malcolm Lowry, John le Carré, Ernest Hemingway, Philip Roth und Paul Auster. 2011 erhielt er den Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis. Er lebt in der Lüneburger Heide.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel «Baumgartner» bei Grove Atlantic, Inc., New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Baumgartner» Copyright © 2023 by Paul Auster
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-01877-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Baumgartner
1
Baumgartner sitzt an seinem Schreibtisch im ersten Stock, in einem Zimmer, das er je nach Laune als Arbeitszimmer, Cogitorium oder seinen Bau bezeichnet. Stift in der Hand, befindet er sich mitten in einem Satz im dritten Kapitel seiner Monografie über Kierkegaards Pseudonyme, als ihm einfällt, dass das Buch, aus dem er zitieren muss, um den Satz zu beenden, noch unten im Wohnzimmer ist, wo er es gestern vor dem Zubettgehen hat liegen lassen. Auf dem Weg nach unten, um das Buch zu holen, entsinnt er sich, dass er seiner Schwester versprochen hat, sie heute früh um zehn anzurufen, und da es gerade kurz vor zehn ist, will er gleich in die Küche gehen und den Anruf erledigen, bevor er das Buch aus dem Wohnzimmer holt. Plötzlich bleibt er abrupt stehen, denn aus der Küche schlägt ihm beißender Geruch entgegen. Da brennt etwas, denkt er, geht zum Herd und sieht, einer der vorderen Brenner ist noch an, eine winzige Flamme frisst sich beharrlich in den Boden des kleinen Aluminiumtopfs, in dem er sich vor drei Stunden seine zwei weich gekochten Frühstückseier bereitet hat. Er stellt das Gas aus und nimmt, ohne groß nachzudenken, das heißt, ohne sich einen Topflappen oder ein Handtuch zu schnappen, den ruinierten, glühenden Eierkochtopf vom Herd und versengt sich die Hand. Baumgartner schreit vor Schmerz. Den Bruchteil einer Sekunde später lässt er den Topf unter lautem Geschepper zu Boden fallen, stürzt jaulend zur Spüle, dreht das kalte Wasser auf, hält die rechte Hand unter den Hahn und lässt den kühlen Strom drei oder vier Minuten lang über seine Haut fließen.
In der Hoffnung, Blasen an Fingern und Handfläche verhütet zu haben, trocknet Baumgartner seine Hand vorsichtig mit einem Geschirrtuch, wartet kurz, krümmt die Finger, klopft noch ein paarmal leicht mit dem Tuch auf die Hand und fragt sich plötzlich, was er überhaupt in der Küche macht. Bevor ihm einfällt, dass er seine Schwester anrufen wollte, läutet das Telefon. Er nimmt ab und brummt ein zurückhaltendes Hallo. Meine Schwester, denkt er, als er sich endlich erinnert, warum er hier ist, und da es längst nach zehn ist und er sie nicht angerufen hat, geht er davon aus, dass es sich bei der Person am anderen Ende der Leitung um Naomi handelt, die streitsüchtige jüngere Schwester, die ihm garantiert als Erstes vorwerfen wird, dass er wieder einmal, wie immer, vergessen habe, sie anzurufen, doch sobald die Person am anderen Ende sich meldet, wird klar, es ist nicht Naomi, sondern ein Mann, ein Unbekannter mit einer fremden Stimme, der stotternd um Verzeihung bittet, dass er zu spät komme. Zu spät für was?, fragt Baumgartner. Um Ihren Zähler abzulesen, sagt der Mann. Ich sollte um neun vorbeikommen, wissen Sie nicht mehr? Nein, Baumgartner weiß es nicht mehr, er kann sich an keinen Augenblick in den vergangenen Tagen oder Wochen erinnern, in dem ihm bewusst gewesen wäre, dass der Zählerableser seines Stromversorgers sich für heute um neun angesagt hätte, und so beruhigt er den Mann, er brauche sich keine Sorgen zu machen, er werde den ganzen Tag zu Hause sein, doch der andere, offenkundig jung, unerfahren und übereifrig, besteht darauf, ihm zu erklären, dass er gerade keine Zeit habe zu erklären, warum er nicht pünktlich gekommen sei, aber es gebe einen guten Grund dafür, etwas, woran er nichts ändern könne, und dass er so schnell wie möglich kommen werde. Gut, sagt Baumgartner, bis dann. Er legt auf und betrachtet seine rechte Hand, die von der Verbrennung zu pochen begonnen hat, entdeckt jedoch bei genauerem Hinsehen weder Blasen noch sich abschälende Hautstellen, nur eine allgemeine Rötung. Nicht schlimm, denkt er, damit kann ich leben, und dann spricht er sich in der zweiten Person an: Du blöder Esel, noch mal Glück gehabt.
Er sagt sich, er sollte jetzt Naomi anrufen, auf der Stelle, um ihr zuvorzukommen, doch gerade als er zum Hörer greifen und ihre Nummer wählen will, klingelt es an der Tür. Ein tiefes Stöhnen entringt sich seiner Brust. Schon summt das Freizeichen in seiner Hand, aber er legt wieder auf, kickt missmutig den verschmorten Topf beiseite und macht sich auf den Weg zur Haustür.
Seine Stimmung hebt sich, als er die Tür öffnet und die UPS-Botin erblickt, Molly, die häufig bei ihm klingelt und im Lauf der Zeit so etwas wie … ja was? für ihn geworden ist. Nicht direkt eine Freundin, aber inzwischen doch mehr als eine bloße Bekannte, wenn man bedenkt, dass sie seit fünf Jahren zwei- bis dreimal pro Woche zu ihm kommt, und die Wahrheit sieht so aus, dass der einsame Baumgartner, dessen Frau vor knapp zehn Jahren gestorben ist, heimlich in diese stämmige Frau in den Dreißigern, von der er nicht einmal den Nachnamen weiß, verknallt ist, denn obwohl Molly schwarz ist und seine Frau das nicht war, ist etwas in ihren Augen, das ihn immer, wenn er sie sieht, an seine tote Anna denken lässt. Jedes Mal geht es ihm so, aber was genau er da bemerkt, kann er nicht sagen. Wachheit vielleicht, auch wenn es viel mehr ist als das, eher etwas, das man als strahlende Wachheit bezeichnen könnte oder, wenn es das nicht ist, ganz einfach als die Kraft einer leuchtenden Persönlichkeit, menschliche Lebendigkeit in all ihrer vibrierenden Pracht, die in einem komplizierten, verschränkten Tanz von Gefühlen und Gedanken von innen nach außen strömt – so etwa, falls das einen Sinn ergibt, aber egal wie man nennen will, was Anna hatte, Molly hat es auch. Nur deshalb bestellt Baumgartner ständig Bücher, die er nicht braucht und niemals aufschlägt und irgendwann der örtlichen Bücherei spenden wird – allein zu dem Zweck, ein oder zwei Minuten in Mollys Gesellschaft zu verbringen, wenn sie bei ihm klingelt und die Bücher bringt.
Guten Morgen, Professor, sagt sie und schenkt ihm ihr leuchtendes Lächeln wie einen Segen. Mal wieder ein Buch für Sie.
Danke, Molly, sagt Baumgartner und nimmt lächelnd das schmale braune Päckchen entgegen. Wie geht’s Ihnen heute?
Es ist noch früh – zu früh für eine Antwort –, aber bis jetzt sind die Hochs höher als die Tiefs tief. Es ist nicht leicht, an einem so herrlichen Morgen Trübsal zu blasen.
Der erste schöne Frühlingstag – der beste Tag des Jahres. Genießen wir ihn, solange wir können, Molly. Man weiß nie, was als Nächstes passiert.
Wohl wahr, sagt Molly und lässt ein zustimmendes Kichern hören. Bevor ihm eine clevere oder witzige Erwiderung einfällt, mit der sich die Unterhaltung verlängern ließe, hebt sie zum Abschied die Hand und entschwindet zu ihrem Lieferwagen.
Auch das zählt zu den vielen Dingen, die Baumgartner an Molly mag. Sie lacht über alle seine lahmen Bemerkungen, auch die allerschwächsten, die totalen Blindgänger.
Er geht in die Küche zurück und legt das ungeöffnete Buchpäckchen auf den Stapel anderer ungeöffneter Buchpäckchen in einer Ecke neben dem Tisch. Der Turm ist inzwischen so hoch, dass zu befürchten ist, ein oder zwei mehr von diesen hellbraunen Umschlägen werden ihn zum Einsturz bringen. Baumgartner nimmt sich vor, noch heute die Bücher von ihren Papphüllen zu befreien und die nackten Exemplare in den am wenigsten gefüllten der mit ungewünschten Büchern gepackten Kartons zu stopfen, von denen bereits mehrere auf der Veranda stehen und irgendwann der Bücherei geschenkt werden sollen. Ja, ja, sagt sich Baumgartner, ich weiß, das habe ich mir schon das letzte Mal versprochen, als Molly hier war, und davor auch schon, aber diesmal meine ich es wirklich ernst.
Er sieht auf die Uhr, es ist Viertel nach zehn. Reichlich spät, denkt er, aber vielleicht noch nicht zu spät, Naomi anzurufen und ihr zuvorzukommen, ehe sie ihn mit unflätigen Beschimpfungen überhäuft. Er greift nach dem Telefon, doch gerade als er den Hörer abnehmen will, läutet der kleine weiße Teufel schon wieder. Wieder nimmt er an, es sei seine Schwester, und wieder liegt er falsch.
Ein zitterndes Stimmchen antwortet seinem gebrummten Hallo mit einer kaum vernehmbaren Frage: Mr. Baumgartner? Die Stimme klingt so jung und so elend, dass ihn ein heißer Schrecken überläuft, als arbeiteten alle Organe in seinem Körper plötzlich doppelt so schnell wie normal. Er fragt, wer da spricht, und die Stimme antwortet Rosita, und sofort ist ihm klar, Mrs. Flores muss etwas zugestoßen sein, der Frau, die zum ersten Mal nach Annas Beerdigung bei ihm putzen kam und seither zweimal die Woche die Böden wischt, die Teppiche saugt, die Wäsche macht und zahllose andere Haushaltsdinge erledigt, sodass er in den vergangenen neuneinhalb Jahren nicht in Schmutz und Unordnung versunken ist, die gute und zuverlässige und meist schweigsame, verschlossene Mrs. Flores mit ihrem Mann, dem Bauarbeiter, und drei Kindern, zwei erwachsenen Söhnen und der kleinen Rosita, einer dünnen Zwölfjährigen mit prächtigen braunen Augen, die jedes Jahr an Halloween bei ihm auftaucht und sich ihre Tüte Süßigkeiten abholt.
Was ist, Rosita?, fragt Baumgartner. Ist deiner Mutter etwas passiert?
Nein, sagt Rosita, nicht meiner Mutter. Meinem Vater.
Die aufgestaute Anspannung der Kleinen entlädt sich in heftigem Schluchzen, und Baumgartner muss eine Weile warten. Da sie versucht, sich zusammenzureißen und nicht vollkommen die Kontrolle zu verlieren, geht ihr bebender Atem in abgehackten Stößen. Baumgartner reimt sich zusammen, eigentlich sollte Mrs. Flores an diesem Nachmittag zu ihm kommen, und da Frühlingsferien sind und ihre Tochter nicht in der Schule ist, hat sie Rosita aufgetragen, Mr. Baumgartner wegen des Notfalls anzurufen, während sie selbst sich um ihren Mann kümmert, was auch immer ihm zugestoßen sein mag.
Als das Stöhnen und Schluchzen sich ein wenig gelegt hat, stellt Baumgartner die nächste Frage. Die Bruchstücke ihres Berichts von dem, was ihre Mutter ihr erzählt hat, die es selbst von jemand anderem gehört hat, setzt er sich so zusammen: Mr. Flores sollte eine Küche umbauen, und als er vor wenigen Stunden im Keller des Kunden mit seiner Kreissäge Kanthölzer zurechtschnitt, eine Arbeit, die er schon Hunderte, wenn nicht Tausende Male getan hatte, gelang es ihm irgendwie, sich zwei Finger der rechten Hand abzuschneiden.
Baumgartner sieht die zwei abgetrennten Finger in das Sägemehl auf dem Fußboden fallen. Er sieht das Blut aus den entblößten Stümpfen fließen. Er hört Mr. Flores schreien.
Schließlich sagt er: Keine Sorge, Rosita. Ich weiß, das hört sich schrecklich an, aber die Ärzte kriegen das hin. Deinem Vater werden die Finger wieder angenäht, und bis im Herbst die Schule losgeht, ist er wieder vollkommen in Ordnung.
Wirklich?
Ja, wirklich. Versprochen.
Weil die Kleine allein im Haus ist und weil sie sich, seit ihre Mutter zum Krankenhaus geeilt ist, in einem Zustand lähmender Panik befindet, redet Baumgartner noch zehn Minuten lang weiter auf sie ein. Gegen Ende des Gesprächs gelingt es ihm, ihr so etwas wie ein Lachen zu entlocken, und als sie aufgelegt haben, bleibt dieses kümmerliche kleine Lachen bei ihm, denn er ist sich ziemlich sicher, es wird sich als das einzig Wichtige erweisen, was er an diesem Tag zustande gebracht haben wird.
Trotzdem ist Baumgartner erschüttert. Er zieht einen Stuhl heran und setzt sich; den Blick auf den schwarzen Kreis eines alten Kaffeetassenflecks gerichtet, lässt er die Szene vor seinem inneren Auge ablaufen. Angel Flores, ein erfahrener Zimmermann von achtundvierzig Jahren, ist im Begriff, etwas zu tun, was er im Lauf vieler Jahre schon oft und einwandfrei getan hat, und plötzlich und unerklärlicherweise passt er einmal kurz nicht auf und fügt sich eine schwere Verletzung zu. Wie kann das sein? Was hat seine Konzentration gestört, was hat ihn abgelenkt von der Arbeit an der Säge, simpel genug, wenn man sich konzentriert, aber gefährlich, wenn man es nicht tut? Hatte ihn ein Mitarbeiter irritiert, der in dem Augenblick die Treppe herunterkam? War ihm ungewollt ein Gedanke durch den Kopf gegangen? War eine Fliege auf seiner Nase gelandet? Hatte er plötzlich Bauchschmerzen bekommen? Hatte er gestern Abend zu viel getrunken, oder hatte er sich, bevor er das Haus verließ, mit seiner Frau gestritten …? Plötzlich kommt ihm die Idee, dass Mr. Flores sich genau in dem Augenblick, als er, Baumgartner, sich die Hand an dem Topf verbrannte, die Finger abgeschnitten haben könnte. Jeder der beiden ist selbst schuld an seinem Unglück, auch wenn das Unglück des einen weit größer war als das des anderen, und doch, in beiden Fällen …
Die Türglocke reißt ihn aus seinen Grübeleien. Verdammt, sagt er, steht langsam auf und schlurft zur Haustür. Die lassen einen hier nicht mal zum Denken kommen.
Baumgartner öffnet die Tür, und vor ihm steht der Zählerableser, ein großer, kräftiger Bursche Ende zwanzig oder Anfang dreißig im blauen Firmenhemd des Stromversorgers, auf der linken Brusttasche das Logo der PSE&G und darunter leuchtend gelb gestickt der Name des Mannes, der in dem Hemd steckt: Ed. Soweit Baumgartner das beurteilen kann, drückt Eds Miene zugleich Hoffnung und Verzweiflung aus. Komische Kombination, denkt er, und als Ed den Mund zu einem vorsichtigen Lächeln verzieht, mutet dies gar noch verwirrender an – als sei der Zählerableser schon halb darauf gefasst, dass ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen wird. Um die Befürchtungen des Mannes zu zerstreuen, bittet Baumgartner ihn ins Haus.
Danke, Mr. Boom Garden, sagt der Mann und tritt über die Schwelle. Sehr freundlich von Ihnen.
Eher amüsiert als eingeschnappt von der Verunstaltung seines Namens, schlägt Baumgartner vor: Können wir uns nicht mit Vornamen anreden? Ihren kenne ich bereits – Ed. Also, wenn’s Ihnen recht ist, lassen Sie den Mister weg und sagen einfach Sy zu mir.
Sigh?, sagt Ed. Was ist das denn für ein Name?
Nein, nicht sigh wie Seufzer – bloß Sy. S-Y. Kurz für Seymour, das ist der lächerliche Name, den meine Eltern mir verpasst haben. Ich gebe zu, Sy ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber immer noch besser als Seymour.
Sie also auch, wie?, sagt der Zählerableser.
Ich auch was?, sagt Baumgartner.
Laufen mit einem Namen rum, der Ihnen nicht gefällt.
Was stört Sie denn an Ed?
Gar nichts. Was mich nervt, ist mein Nachname.
Ach? Und der lautet wie?
Papadopoulos.
Nichts dran auszusetzen. Ein schöner griechischer Name.
Mag sein, wenn man in Griechenland lebt. Aber in Amerika lacht man darüber. In der Schule haben mich die anderen Kinder ausgelacht, und früher, als ich noch Baseball in der Minor League gespielt habe, haben die Zuschauer immer gelacht, wenn mein Name über die Lautsprecher kam. Da kann man schon, wie sagt man noch gleich, Komplexe kriegen.
Warum ändern Sie den Namen nicht, wenn er Sie so stört?
Das kann ich nicht. Das würde meinem Vater das Herz brechen.
Baumgartner beginnt, sich zu langweilen. Wenn er diesem mäandernden Gefasel nicht auf der Stelle ein Ende macht, wird Papadopoulos ihm als Nächstes die komplette Lebensgeschichte seines Vaters auftischen oder von den Höhen und Tiefen seiner Karriere im Minor-League-Baseball erzählen, weshalb er, Sy, kurz für Seymour, abrupt das Thema wechselt und sich bei Ed erkundigt, ob er nicht mal einen Blick auf den Zähler im Keller werfen möchte. Hier nun erfährt er, dies ist der erste Tag des jungen Mannes in seinem Job, und der Zähler unten wird der erste sein, den er als Angestellter der Public Service Electric & Gas Company ablesen wird, was erklärt, warum er nicht zur verabredeten Zeit gekommen ist – nicht durch eigene Schuld, wohlgemerkt, sondern weil ein paar altgediente Zählerableser der Gesellschaft ihm am Morgen – seinem ersten Morgen in dem Job! – einen Streich gespielt und den Benzintank seines Transporters geleert haben, sodass er zwar noch eine halbe Meile weit fahren konnte, dann aber mitten auf einer in der Hauptverkehrszeit völlig verstopften Straße liegen geblieben war, was seine beschämende Verspätung zur Folge hatte. Es tue ihm leid, sagt er, so schrecklich leid, ihm solche Unannehmlichkeiten zu bereiten. Wäre er doch nur so klug gewesen, die Tankanzeige zu kontrollieren, bevor er sich auf den Weg machte, dann hätte er es rechtzeitig geschafft, aber diese dämlichen Witzbolde mussten ihm ja ihren Streich spielen, nur weil er der Neue war, und bestimmt konnten sie es gar nicht abwarten, wie ihn sein Vorgesetzter deswegen zusammenstauchen würde. Noch einmal so ein Klops, und er werde auf Bewährung gesetzt. Noch zweimal, und man werde ihn wahrscheinlich feuern.
Inzwischen könnte Baumgartner schreien. Wie ist dieses bullige Plappermaul bloß hier reingekommen, fragt er sich, und wie lässt sich dieser hartnäckige Redestrom abstellen? Und dennoch, trotz seiner zunehmenden Gereiztheit und ganz gegen seinen Willen empfindet er Mitleid mit diesem gutmütigen Einfaltspinsel, und statt tief Luft zu holen und aus vollem Hals loszubrüllen, gibt Baumgartner ein leises, fast unhörbares Stöhnen von sich und geht ihm voran zu der Tür, die in den Keller führt.
Da unten, sagt er, hinten links, doch als er den Lichtschalter für den Keller drückt, bleibt es dort dunkel. Verdammt, sagt Baumgartner, reißt sich aber zusammen, genau wie die kleine Rosita sich vorhin am Telefon zusammengerissen hatte, um nicht zu weinen; anscheinend ist die Glühbirne da unten kaputt.
Kein Problem, sagt Ed, ich habe eine Taschenlampe. Gehört zu meiner Ausrüstung.
Gut. Dann werden Sie ihn ja finden.
Kann sein, kann nicht sein, sagt der Ableser-Novize. Möchten Sie nicht lieber mit runterkommen und mir zeigen, wo er ist? Nur dieses eine Mal, damit ich Ihnen nicht noch länger zur Last falle.
Baumgartner denkt, Ed Papadopoulos hat Angst im Dunkeln, oder jedenfalls vor dunklen Kellern, besonders in alten Häusern wie diesem, mit Spinnweben, die von der Decke hängen, und Rieseninsekten, die auf dem Boden herumkrabbeln, und weiß Gott was für unsichtbaren Gegenständen, die den Weg zum Zähler versperren, und obwohl er weiß, dass Naomi todsicher genau in dem Augenblick anrufen wird, wenn er unten die letzte Stufe erreicht hat, lässt Baumgartner sich überreden und geht dem anderen voraus nach unten.
Die Kellertreppe ist morsch und altersschwach, auch so etwas, das zu reparieren Baumgartner sich fest vorgenommen hat, ohne es bisher zu tun, auch wenn er seit Jahren immer wieder denselben Entschluss fasst, denn an die Treppe denkt er nur dann, wenn er in den Keller geht, und kaum ist er wieder oben und schließt die Tür, hat er sie auch schon vergessen. Jetzt, ohne Beleuchtung von der Decke, als einzige Lichtquelle von hinten Eds Taschenlampe, greift Baumgartner vorsichtig nach dem splittrigen Holzgeländer, doch sobald er ein wenig fester zupackt, sticht es ihm wie tausend Nadeln in die versengte Handfläche – ganz so, als verbrenne er sich abermals. Seine Hand zuckt zurück, und da es links kein Geländer gibt, hat er nichts mehr, woran er sich festhalten kann, aber schließlich lebt er in diesem Haus seit vielen Jahren und kennt die Treppe, also wagt er den ersten Schritt in die Tiefe, verfehlt das Brett um einen Zentimeter, verliert im Dunkeln das Gleichgewicht und stürzt, stößt sich einen Ellbogen an, dann den anderen, und schlägt mit dem rechten Knie auf dem harten Betonboden auf.
Zum zweiten Mal an diesem Morgen schreit Baumgartner vor Schmerz.
Der Schrei verrinnt zu einem lang gezogenen Stöhnen, während sein verkrümmter Körper sich auf dem feuchten Boden windet. Dass seine Glieder sich bewegen, spürt er nicht, aber er weiß, er ist noch bei Bewusstsein, denn ihm jagen zahllose Gedankenfetzen durch den Kopf, unklare, verschwommene Gedanken, womit sie, nimmt er an, als echte Gedanken disqualifiziert sind und in die Kategorie von Halbgedanken oder Nichtgedanken gehören, nur dass er trotz der rasenden Schmerzen in seinen Ellbogen und im rechten Knie keinen Schmerz im Kopf bemerkt, was bedeuten könnte, dass sein Schädel den Sturz ohne ernsthafte Beschädigung überstanden hat, was wiederum bedeuten könnte, dass der Unfall ihn am Ende nicht zu einem sabbelnden, sabbernden Idioten machen wird, reif für den Gnadenschuss. Dann aber, als Ed über ihm steht und ihm mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchtet, findet Baumgartner nicht die Worte, ihm zu sagen, er solle das Licht woanders hinhalten, er bringt nur ein Stöhnen zustande und hebt schützend die rechte Hand vor seine Augen. Dass er seine Gedanken nicht artikulieren kann, beunruhigt ihn, ja, es macht ihm Angst. Bestätigt es doch, dass in seinem Hirnkasten doch noch manches durcheinander, falls nicht sogar für immer zerbrochen oder vielleicht auch nur fürs Erste noch irgendwie durch die Schmerzen miteinander verklebt ist, die, außer in seinem Kopf, in verschiedenen Teilen seines Körpers wüten, am stärksten in seinem rechten Ellbogen, der förmlich in Flammen auszubrechen schien, als er die Hand hob, um seine Augen zu schützen, die Hand, die er sich am Morgen verbrannt hat und die jetzt immer noch schmerzt, zweifellos weil er sich bei seinem Flug Richtung Betonboden unmittelbar vor dem Aufprall mit den Händen abgefangen hat.
Heilige Scheiße, sagt Ed. Alles in Ordnung?
Nach einer langen Pause bekommt Baumgartner endlich ein paar Worte über die Lippen. Schwer zu sagen, sagt er. So erfreut er registriert, dass er die Sprache nicht verloren hat, sind die Schmerzen noch zu stark, als dass er in Jubel ausbrechen könnte. Immerhin bin ich nicht tot, fährt er fort. Das ist ja schon mal was, nehme ich an.
Allerdings, sagt der Zählerableser, das ist schon eine ganze Menge. Aber sagen Sie, Sy, wo tut es weh?
Während Baumgartner die zerschlagenen Stellen seines Körpers aufzählt, schlüpft Ed in die Rolle des Sportmediziners, veranschlagt sorgfältig den möglichen Schaden an den diversen verletzten Muskeln, Sehnen und Knochen und fragt Baumgartner nach beendeter Bestandsaufnahme, ob er die Kraft hat, sich vom Boden helfen und die Treppe hinaufführen zu lassen.
Versuchen wir’s, sagt Baumgartner. Ob ich es schaffe, werden wir früh genug sehen.
Und so zieht Ed Papadopoulos, ein Fremder, der Baumgartners Haus vor gerade einmal zehn Minuten betreten hat, den alten Mann mit der rechten Hand vom Boden hoch, die Taschenlampe in der Linken, schlingt den rechten Arm fest um Baumgartners Rippenkasten und macht sich an die mühselige Arbeit, ihn die schmale, wacklige Treppe hinaufzubugsieren. Alles tut ihm weh, stellt Baumgartner fest, aber am schlimmsten schmerzt das Knie, es schmerzt so sehr, dass schon der leiseste Druck im Stehen ihm als gellendes Jaulen durch die Knochen fährt, ein Jaulen, das dem schrillen Missklang von vierzig rolligen Rotluchsen gleichkommt, und doch, ermutigt von Eds fürsorglichem Eifer und zuverlässig starkem Arm, nimmt Baumgartner sich vor, sein Bestes zu tun und sich nicht zu beschweren, das Jaulen und Kreischen standhaft und in stoischem Schweigen zu ertragen. Selbst als Ed weitschweifig von seiner eigenen Knieverletzung vor vier Jahren zu erzählen beginnt, einem Meniskusriss, der ihn fast die ganze Saison außer Gefecht gesetzt und schließlich seine Baseballkarriere beendet hatte, gibt Baumgartner keinen Ton von sich, allenfalls ein gelegentliches Grunzen, und auch kein Wort und keinen Schrei, als Ed erzählt, wie nach auskurierter Verletzung sein Fastball kein Tempo mehr und sein Curveball keinen Biss mehr gehabt hatte, und das war’s, tschüs, Alter, war nett, dich kennenzulernen, und nicht einmal, als Baumgartner wehrlos die Geschichte der gescheiterten Träume und der nie getrunkenen Tassen Kaffee des Ex-Werfers über sich ergehen lassen muss, eine langatmige Geschichte, die sich über die ganzen vier Minuten erstreckt, die es bis zum oberen Ende der Treppe braucht, nimmt er Ed nichts übel, vielmehr klammert er sich geradezu an das Gerede des Zählerablesers als lästige, aber willkommene Ablenkung von seinen Schmerzen.
Oben angekommen, humpelt Baumgartner, weiter von Ed gehalten, ins Wohnzimmer, wo sein Beschützer ihn vorsichtig aufs Sofa manövriert und ihm zwei bestickte Kissen als Kopfstütze unterlegt. Wir sollten Eis auf das Knie legen, sagt der junge Mann, und ehe Baumgartner ihm sagen kann, dass die Eismaschine im Kühlschrank kaputt ist, hat Ed das Zimmer verlassen. Baumgartner hört, wie das Eisfach geöffnet und wieder geschlossen wird. Sekunden später taucht Ed wieder auf, er wirkt verwirrt und verärgert zugleich. Kein Eis, sagt er und klingt dabei so unglücklich wie ein Kind, dem soeben klar geworden ist, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, oder wie ein jugendlicher Suchender, dem soeben klar geworden ist, dass es Gott nicht gibt, oder wie ein Sterbender, dem soeben klar geworden ist, dass es für ihn kein Morgen mehr gibt.
Machen Sie sich nichts draus, sagt Baumgartner, mir geht’s gut.
Na, ich weiß ja nicht, sagt der Zählerableser. Sie sehen ziemlich angeschlagen aus, Sy. Die Haare völlig zerzaust, die Hose zerrissen und schmutzig. Wir sollten Sie ins Krankenhaus bringen und röntgen lassen. Nur um sicherzugehen, dass nichts gebrochen ist.
Niemals, sagt Baumgartner. Kein Krankenhaus, kein Röntgen. Ich brauche nur ein wenig Ruhe, bis ich mich berappelt habe. Dann bin ich im Handumdrehen wieder auf den Beinen.
Wie Sie meinen, sagt Ed und mustert seinen Patienten von oben bis unten, während kleine unsichtbare Rädchen in seinem Kopf zu kreisen beginnen. Ich will Ihnen aber wenigstens ein Glas Wasser bringen, okay?
Vielen Dank. Ein Glas Wasser wäre wunderbar.
Anderthalb Minuten später nimmt Baumgartner das Wasser entgegen, und Ed lässt sich unvermittelt auf dem Fußboden nieder und beugt sein Gesicht dicht an Baumgartners heran. Sagen Sie mir, Sy, fragt er, welches Jahr haben wir?
Baumgartner hält mitten im Trinken inne, schluckt das restliche Wasser in seinem Mund runter und sagt: Was ist das denn für eine Frage?
Tun Sie mir einfach den Gefallen, Sy. Welches Jahr haben wir?
Na, dann wollen wir mal. Wenn wir 1906 und 1687 ausschließen können, dazu noch 1777 und 1944, dann müssen wir 2018 haben. Was meinen Sie? Kommt das hin?
Ed erwidert lächelnd: Volltreffer.
Zufrieden?
Noch zwei oder drei – nur so zum Spaß.
Baumgartner stöhnt genervt auf und überlegt, ob er Ed eins auf die Schnauze geben oder aus Höflichkeit weiter mitspielen soll. Er schließt die Augen, am Scheideweg zwischen grantigem altem Knacker und ätherischem Weisen, und meint schließlich: Na schön, Doktor. Nächste Frage.
Wo sind wir?
Wo? Na, hier natürlich, wo wir immer sind – jeder und jede von uns eingeschlossen in seinem oder ihrem Hier, vom Tag unserer Geburt bis zum Tag unseres Todes.
Das stimmt schon, aber ich denke eher an so etwas wie die Stadt, wo wir sind. An den Ort auf der Landkarte, wo wir zwei uns jetzt befinden.
Ja, wenn das so ist. Wir sind in Princeton, stimmt’s? Princeton, New Jersey, um genau zu sein. Eine schöne, aber langweilige Stadt, finde ich, aber das ist nur meine Meinung. Und was meinen Sie?
Ich weiß nicht. Ich war hier noch nie. Sieht ganz nett aus, aber ich lebe hier nicht so wie Sie und kann nicht viel dazu sagen.
Baumgartner hätte nicht übel Lust, Ed bei den nächsten Fragen weiter auf den Arm zu nehmen, bringt es aber nicht übers Herz. Die unerschütterliche Freundlichkeit des jungen Mannes erstickt jeden Impuls, sich über ihn lustig zu machen, und nachdem das kleine Frage-und-Antwort-Spiel beendet ist und der Zählerableser sich überzeugt hat, dass sein Patient weder eine Gehirnerschütterung hat noch irgendwelche lebensbedrohlichen Symptome zeigt, sagt Baumgartner zu ihm, er habe bereits genug von seiner Zeit beansprucht, Ed solle sich lieber mal auf den Weg machen, er habe heute doch sicher noch mehr Zähler abzulesen, was Ed plötzlich daran erinnert, dass er in dem Durcheinander nach Baumgartners Treppensturz ganz vergessen hat, den Zähler unten abzulesen, und so schnappt er seine Taschenlampe und eilt aus dem Zimmer, um seinen ersten Auftrag als offizieller Mitarbeiter von PSE&G auszuführen.