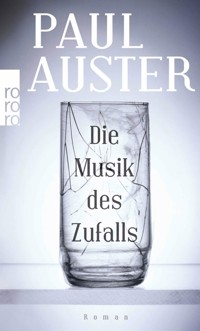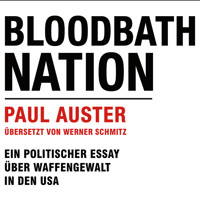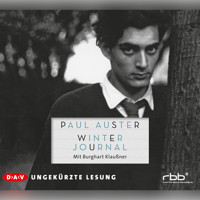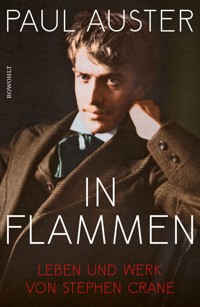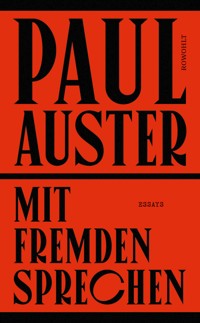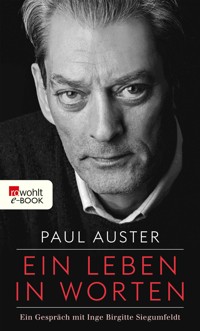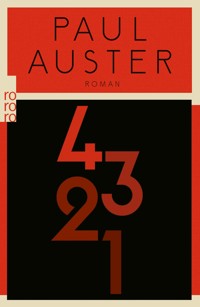9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
«‹Die Erfindung der Einsamkeit› ist ein überraschend leicht lesbares Buch von existentieller Wucht und beispielloser Wahrhaftigkeit ... Paul Auster, dessen Vorfahren aus Österreich kamen, erinnert an einen Robert Musil, der Hammett und Chandler gelesen hat.» (Klaus Modick, Süddeutsche Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Ähnliche
Paul Auster
Die Erfindung der Einsamkeit
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Porträt eines Unsichtbaren
Wenn du die Wahrheit suchst, sei offen für das Unerwartete, denn es ist schwer zu finden und verwirrend, wenn du es findest.
Heraklit
An einem Tag ist noch das Leben da. Zum Beispiel ein Mann, bei bester Gesundheit, nicht einmal alt, nie krank gewesen. Alles ist, wie es war, wie es immer sein wird. Er lebt von einem Tag zum anderen, kümmert sich um seine Angelegenheiten, träumt nur von dem Leben, das vor ihm liegt. Und dann kommt plötzlich der Tod. Der Mann stößt einen leisen Seufzer aus, sackt auf seinem Stuhl zusammen, und das ist der Tod. Sein plötzliches Eintreten lässt keinen Raum für Gedanken, gibt dem Verstand keine Chance, nach einem vielleicht tröstlichen Wort zu suchen. Uns bleibt nichts anderes als der Tod, die unwiderrufliche Tatsache unserer Sterblichkeit. In einen Tod nach langer Krankheit können wir uns fügen. Selbst einen Unfalltod können wir dem Schicksal zuschreiben. Aber wenn ein Mensch ohne ersichtlichen Grund stirbt, wenn ein Mensch einfach stirbt, weil er ein Mensch ist, bringt uns das so nahe an die unsichtbare Grenze zwischen Leben und Tod, dass wir gar nicht mehr wissen, auf welcher Seite wir uns befinden. Leben wird Tod, und es ist, als hätte dieser Tod dieses Leben schon immer besessen. Tod ohne Vorankündigung. Soll heißen: das Leben hört einfach auf. Und es kann jederzeit aufhören.
Die Nachricht vom Tod meines Vaters erreichte mich vor drei Wochen. Es war Sonntagmorgen, und ich machte meinem kleinen Sohn Daniel gerade in der Küche das Frühstück. Meine Frau lag noch oben im Bett, warm unter der Steppdecke, und genehmigte sich den Luxus einiger zusätzlicher Stunden Schlaf. Winter auf dem Land: eine Welt aus Schweigen, Holzrauch und Helligkeit. Ich war in Gedanken ganz mit dem Text beschäftigt, den ich am Abend zuvor geschrieben hatte, und ich dachte schon an den Nachmittag, wenn ich mich wieder an die Arbeit machen könnte. Dann läutete das Telefon. Ich wusste sofort, dass das nichts Gutes verhieß. Niemand ruft am Sonntagmorgen um acht Uhr an, wenn er keine unaufschiebbare Nachricht hat. Und unaufschiebbare Nachrichten sind immer schlechte Nachrichten.
Ich konnte keinen einzigen erhebenden Gedanken fassen.
Noch ehe wir unsere Taschen packten und zu der dreistündigen Fahrt nach New Jersey aufbrachen, wusste ich, ich würde über meinen Vater schreiben müssen. Ich hatte keinen Plan, keine präzise Vorstellung davon, was das bedeutete. Ich kann mich nicht einmal erinnern, mich dazu entschlossen zu haben. Es war einfach da, eine Gewissheit, eine Verpflichtung, die sich mir in dem Augenblick auferlegte, da ich die Nachricht empfing. Ich dachte: Mein Vater ist weg. Und wenn ich nicht schnell handle, wird sein ganzes Leben mit ihm verschwinden.
Wenn ich jetzt, selbst aus diesem kurzen Abstand von nur drei Wochen, daran zurückdenke, empfinde ich das als ziemlich eigenartige Reaktion. Ich hatte mir immer vorgestellt, der Tod würde mich betäuben, vor Kummer lähmen. Doch jetzt, nachdem es geschehen war, vergoss ich keine Tränen, hatte ich nicht das Gefühl, die Welt um mich her würde einstürzen. Auf eine seltsame Weise war ich ungewöhnlich bereit, diesen Tod trotz seines plötzlichen Eintretens zu akzeptieren. Was mich beunruhigte, war etwas anderes, etwas, das mit dem Tod oder meiner Reaktion darauf nichts zu tun hatte: die Erkenntnis, dass mein Vater keine Spuren hinterlassen hatte.
Er hatte keine Frau, keine Familie, die auf ihn angewiesen war, niemanden, dessen Leben sich durch seine Abwesenheit geändert hätte. Vielleicht ein kurzer Augenblick des Schreckens bei den wenigen Freunden, Ernüchterung, mindestens ebenso sehr durch den Gedanken an den launischen Tod wie durch den Verlust ihres Freundes, gefolgt von einer kurzen Zeit der Trauer, und dann nichts mehr. Am Ende würde es so sein, als hätte er niemals gelebt.
Schon vor seinem Tod war er abwesend gewesen, und die Leute, die ihm am nächsten standen, hatten diese Abwesenheit längst zu akzeptieren und darin sein eigentliches Wesen zu sehen gelernt. Nun, da er tot war, würde es der Welt nicht schwerfallen, mit der Tatsache zurechtzukommen, dass er für immer weg sein würde. Seine Lebensweise hatte die Welt auf seinen Tod vorbereitet – war eine Art vorweggenommener Tod gewesen –, und falls und wenn man sich seiner erinnerte, dann nur undeutlich, allenfalls undeutlich.
Bar jeder Leidenschaft, weder für eine Sache noch eine Person noch eine Idee; unfähig oder nicht willens, sich unter gleich welchen Umständen zu offenbaren, war es ihm gelungen, sich vom Leben fernzuhalten, jegliches Eintauchen in den Daseinsstrom zu vermeiden. Er aß, er ging zur Arbeit, er hatte Freunde, er spielte Tennis, aber trotz alledem war er abwesend. Er war im tiefsten, im unabänderlichsten Sinn ein Unsichtbarer. Unsichtbar für andere, und höchstwahrscheinlich auch unsichtbar für sich selbst. Als er noch lebte, habe ich ihn ständig gesucht, habe ich mich ständig bemüht, den abwesenden Vater zu finden, und jetzt, da er tot ist, glaube ich noch immer nach ihm suchen zu müssen. Der Tod hat nichts geändert. Nur dass mir jetzt die Zeit knapp geworden ist.
Fünfzehn Jahre lang hatte er allein gelebt. Beharrlich, unzugänglich, als wäre er der Welt gegenüber immun gewesen. Er schien kein Mensch zu sein, der Raum für sich beanspruchte, sondern eher ein Block undurchdringlichen Raums in Gestalt eines Menschen. Die Welt prallte von ihm ab, zerschellte an ihm, blieb zuweilen an ihm hängen – aber nie drang sie zu ihm durch. Fünfzehn Jahre lang hatte er ganz allein in einem riesigen Haus gespukt, und in diesem Haus war er gestorben.
Kurze Zeit hatten wir dort als Familie gelebt – mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich. Nach der Scheidung meiner Eltern brach alles auseinander: Meine Mutter fing ein neues Leben an, ich wechselte aufs College, und meine Schwester wohnte bei meiner Mutter, bis auch sie zum Studieren fortging. Nur mein Vater blieb. Aufgrund einer Klausel im Scheidungsvertrag, nach der meiner Mutter noch immer ein Anteil an dem Haus gehörte und ihr im Falle eines Verkaufs die Hälfte des Erlöses zustand (was meinen Vater vom Verkaufen abhielt), oder aus irgendeiner insgeheimen Weigerung heraus, sein Leben zu ändern (um der Welt nicht zu zeigen, dass die Scheidung ihn auf eine Weise berührt hatte, mit der er nicht umzugehen vermochte), oder schlicht aus Trägheit, aus einer gefühlsbedingten Lethargie, die ihn hinderte, irgendeine Initiative zu ergreifen, blieb er ganz allein in einem Haus wohnen, in dem sechs oder sieben Menschen Platz gehabt hätten.
Es war ein beeindruckendes Gebäude: alt, solide, im Tudorstil gebaut, mit bleigefassten Fenstern, einem Schieferdach und Räumen von fürstlichen Ausmaßen. Der Kauf war für meine Eltern ein großer Schritt gewesen, ein Zeichen wachsenden Wohlstands. Es lag im besten Viertel der Stadt, und wenngleich das Leben dort (besonders für Kinder) nicht angenehm war, stellte sein Prestigewert einen guten Ausgleich für die tödliche Langeweile dar, die dort herrschte. Angesichts der Tatsache, dass mein Vater den Rest seines Lebens in diesem Haus verbrachte, ist es schon eine Ironie, dass er sich anfangs geweigert hatte, dorthin zu ziehen. Er lamentierte über den Preis (ein Dauerthema), und als er schließlich nachgab, geschah es nur widerwillig und schlecht gelaunt. Dennoch zahlte er in bar. Alles auf einen Schlag. Keine Hypotheken, keine monatlichen Raten. Das war 1959, und seine Geschäfte gingen gut.
Immer ein Gewohnheitsmensch, brach er frühmorgens zur Arbeit auf, schuftete den ganzen Tag, und wenn er dann (falls er nicht noch in die Nacht hinein arbeitete) nach Hause kam, legte er sich vor dem Abendessen zu einem kurzen Nickerchen hin. Irgendwann während unserer ersten Woche in dem neuen Haus, noch bevor wir richtig eingezogen waren, unterlief ihm ein kurioser Irrtum. Anstatt nach der Arbeit zu dem neuen Haus zurückzufahren, fuhr er, wie er es jahrelang getan hatte, direkt zum alten, parkte seinen Wagen in der Einfahrt, ging durch die Hintertür ins Haus, stieg die Treppe hoch, betrat das Schlafzimmer, legte sich aufs Bett und schlief ein. Er schlief etwa eine Stunde. Überflüssig zu sagen, dass die neue Hausherrin, als sie bei ihrer Heimkehr einen fremden Mann in ihrem Bett entdeckte, nicht wenig überrascht war. Doch im Gegensatz zu Goldlöckchen sprang mein Vater nicht auf und lief davon. Die Verwirrung war bald beigelegt, und alle hatten etwas zu lachen. Ich muss noch heute darüber lachen. Und trotzdem, ich kann mir nicht helfen, aber im Grunde ist das für mich eine traurige Geschichte. Dass ein Mann versehentlich zu seinem alten Haus zurückfährt, ist eine Sache; eine ganz andere aber ist es, denke ich, wenn ihm gar nicht auffällt, dass alles darin sich verändert hat. Selbst im erschöpftesten oder zerstreutesten Kopf gibt es noch einen Winkel, der rein animalisch zu reagieren vermag und dem Körper ein Gefühl davon vermittelt, wo er sich befindet. Man müsste schon praktisch bewusstlos sein, um nicht zu sehen oder zumindest zu spüren, dass das Haus sich völlig verändert hat. «Gewohnheit», wie eine von Becketts Figuren sagt, «stumpft mächtig ab.» Und wenn der Geist unfähig ist, auf physische Erscheinungen zu reagieren, was wird er dann erst tun, wenn er mit psychischen Erscheinungen konfrontiert wird?
Im Lauf dieser letzten fünfzehn Jahre hat er fast nichts in dem Haus verändert. Er hat keinerlei neue Möbel angeschafft, er hat keinerlei Möbel entfernt. Die Wände behielten dieselbe Farbe, Töpfe und Pfannen wurden nicht ersetzt, selbst die Kleider meiner Mutter wurden nicht weggeworfen – sondern in einem Wandschrank auf dem Dachboden verstaut. Gerade die Größe des Hauses sprach ihn davon frei, irgendwelche Entscheidungen über die darin befindlichen Dinge treffen zu müssen. Nicht dass er an der Vergangenheit hing und versuchte, das Haus als Museum zu konservieren. Im Gegenteil, er schien gar nicht zu merken, was er da tat. Nicht die Erinnerung leitete ihn, sondern Nachlässigkeit, und wenn er auch all die Jahre in diesem Haus weiterlebte, so doch im Grunde nur wie ein Fremder. Mit der Zeit hielt er sich immer weniger darin auf. Er nahm fast alle Mahlzeiten in Restaurants zu sich, arrangierte seine gesellschaftlichen Verpflichtungen so, dass er jeden Abend unterwegs war, und benutzte das Haus praktisch nur noch zum Schlafen. Vor einigen Jahren erwähnte ich ihm gegenüber einmal, wie viel Geld ich im vorangegangenen Jahr mit meinem Schreiben und Übersetzen verdient hatte (allenfalls ein Hungerlohn, aber mehr als je zuvor), worauf er amüsiert erwiderte, dass allein seine Ausgaben in Restaurants einen höheren Betrag ausmachen würden. Was ich damit sagen will: Das Haus, in dem er wohnte, war nicht der Mittelpunkt seines Lebens. Sein Haus war nur einer von vielen Haltepunkten in einem rastlosen, unvertäuten Dasein, und dieses Fehlen eines Zentrums machte ihn zu einem ewigen Außenseiter, zu einem Touristen in seinem eigenen Leben. Man hatte nie das Gefühl, dass er einen festen Platz haben könnte.
Dennoch scheint mir das Haus wichtig, wenn auch nur insofern, als es vernachlässigt wurde – symptomatisch für einen Geisteszustand, der sich, ansonsten unzugänglich, in den konkreten Abbildern unbewussten Verhaltens offenbarte. Das Haus wurde zur Metapher des Lebens meines Vaters, zur exakten und getreuen Darstellung seines Innenlebens. Denn obwohl er das Haus in Ordnung hielt und mehr oder weniger so bewahrte wie einst, war es einem allmählichen und unausweichlichen Prozess der Auflösung ausgesetzt. Er war ein ordentlicher Mensch, er legte immer alles an seinen Platz zurück, nur pflegte er nichts, machte nie etwas sauber. Die Möbel, besonders in den Zimmern, die er selten betrat, waren bedeckt mit Staub und Spinnweben, Zeichen völliger Vernachlässigung; der Küchenherd war so verkrustet mit verkohlten Essensresten, dass nichts mehr daran zu retten war; im Speiseschrank verkam so manches jahrelang auf den Regalen: Mehlpackungen voller Ungeziefer, vergammelte Kräcker, Zuckertüten, die sich in feste Blöcke verwandelt hatten, Sirupflaschen, die sich nicht mehr öffnen ließen. Wenn er sich einmal selbst eine Mahlzeit zubereitete, erledigte er gleich im Anschluss gewissenhaft den Abwasch – aber nur mit Wasser, nie mit einem Spülmittel, so dass sämtliche Tassen, Untertassen und Teller mit einem schmuddeligen Fettfilm überzogen waren. Im ganzen Haus: Die Springrollos, die ständig herabgezogen blieben, waren so fadenscheinig geworden, dass sie beim leichtesten Zug zerrissen. Wasser tropfte von den Decken und machte Flecken auf die Möbel, die Heizung gab nie genug Wärme ab, die Dusche funktionierte nicht. Das Haus wurde schäbig, es zu betreten deprimierend. Man hatte das Gefühl, ins Haus eines Blinden zu kommen.
Seine Freunde und Angehörigen spürten, wie verrückt sein Leben in diesem Haus war, und bedrängten ihn immer wieder, es zu verkaufen und woandershin zu ziehen. Doch stets gelang es ihm, sie mit einem unverbindlichen «Mir gefällt es hier» oder «Das Haus passt gut zu mir» abzuwimmeln. Am Ende jedoch hat er sich tatsächlich zum Umzug entschlossen. Ganz am Ende. Bei dem letzten Telefongespräch, das wir miteinander geführt haben, zehn Tage vor seinem Tod, erzählte er mir, das Haus sei verkauft, am 1. Februar, also in etwa drei Wochen, werde er ausziehen. Er wollte wissen, ob ich irgendetwas aus dem Haus gebrauchen könne, und ich erklärte mich bereit, am ersten freien Tag, der sich ergeben würde, mit meiner Frau und Daniel bei ihm vorbeizukommen. Er starb, bevor wir eine Gelegenheit fanden, ihm diesen Besuch abzustatten.
Es gibt, wie ich erfuhr, nichts Schrecklicheres, als sich mit den Sachen eines Toten abgeben zu müssen. Gegenstände sind träge: Bedeutung haben sie nur in ihrem funktionalen Bezug auf das Leben, welches sich ihrer bedient. Wenn dieses Leben endet, ändern sich die Dinge, selbst wenn sie dieselben bleiben. Sie sind da und doch nicht da: greifbare Gespenster, dazu verdammt, in einer Welt weiterzuleben, der sie nicht mehr angehören. Was soll man zum Beispiel von einem Schrank voller Kleider halten, die stumm darauf warten, wieder von jemandem getragen zu werden, der niemals mehr die Tür aufmachen wird? Oder von Kondompäckchen, die sich in randvollen Schubladen zwischen Unterwäsche und Strümpfen finden? Oder von einem Elektrorasierer im Badezimmer, an dem noch die Bartstoppeln von der letzten Rasur haften? Oder von einem Dutzend leerer Tuben Haarfärbemittel, die in einem ledernen Reisekoffer versteckt sind? – Da kommen plötzlich Dinge ans Licht, die man gar nicht sehen, gar nicht wissen will. Das hat etwas Schmerzliches, und auch etwas Entsetzliches. Für sich selbst bedeuten diese Dinge nichts, wie die Kochgeräte irgendeiner untergegangenen Zivilisation. Und doch sagen sie uns etwas; sie stehen dort nicht als Gegenstände, sondern als Überbleibsel von Gedanken, von Bewusstsein, als Embleme der Einsamkeit, in der ein Mensch ihn selbst betreffende Entscheidungen fällt: ob er sich das Haar färben soll, ob er dieses oder jenes Hemd tragen soll, ob er leben oder sterben soll. Und dann die Sinnlosigkeit all dessen, sobald der Tod eingetreten ist.
Jedes Mal wenn ich eine Schublade aufzog oder meinen Kopf in einen Schrank steckte, kam ich mir wie ein Eindringling vor, wie ein Einbrecher, der in den geheimen Gedanken eines Menschen wühlt. Ständig erwartete ich, mein Vater würde hereinkommen, mich ungläubig anstarren und fragen, was zum Teufel ich da zu suchen hätte. Es schien mir nicht fair, dass er keinen Einspruch erheben konnte. Ich hatte kein Recht, in sein Privatleben einzudringen.
Eine hastig notierte Telefonnummer auf der Rückseite einer Visitenkarte mit dem Aufdruck: H. Limeburg – Mülltonnen aller Art. Fotos von den Flitterwochen meiner Eltern in Niagara Falls, 1946: meine Mutter, wie sie für einen dieser komischen Schnappschüsse, die niemals komisch sind, nervös auf einem Stier sitzt, und plötzlich das Gefühl, wie unwirklich die Welt schon immer gewesen ist, sogar in ihrer Vorgeschichte. Eine Schublade mit Hämmern, Nägeln und über zwanzig Schraubenziehern. Ein Aktenschrank, vollgestopft mit ungültigen Schecks aus dem Jahr 1953 und den Karten, die ich zu meinem sechsten Geburtstag bekommen hatte. Und dann, ganz unten in einer Schublade im Badezimmer: die Zahnbürste mit Monogramm, die einmal meiner Mutter gehört hatte und nun seit über fünfzehn Jahren nicht mehr berührt oder angesehen worden war.
Die Liste ist unerschöpflich.
Bald wurde mir klar, dass mein Vater so gut wie nichts getan hatte, um sich auf seinen Weggang vorzubereiten. Die einzigen Anzeichen für den bevorstehenden Umzug, die ich im ganzen Haus entdecken konnte, waren ein paar Kartons mit Büchern – belanglose Bücher (veraltete Atlanten, eine fünfzig Jahre alte Einführung in die Elektronik, eine Lateingrammatik von der Highschool, alte Gesetzbücher), die er für einen wohltätigen Zweck hatte spenden wollen. Ansonsten: nichts. Keine leeren Kisten, die auf Ladung warteten. Keine Möbelstücke, die verschenkt oder verkauft worden wären. Keine Vereinbarungen mit einer Umzugsfirma. Es war, als hätte er es einfach nicht über sich bringen können. Anstatt das Haus zu räumen, hatte er sich schlicht den Tod gewünscht. Der Tod war ein Ausweg, die einzige legitime Fluchtmöglichkeit.
Für mich gab es freilich kein Entrinnen. Die Sache musste erledigt werden, und es gab niemand anderen, der sie erledigen konnte. Zehn Tage lang habe ich seine Sachen durchgesehen, das Haus leergeräumt und für die neuen Besitzer fertig gemacht. Das war eine fürchterliche, aber auch seltsam komische Zeit, eine Zeit rücksichtsloser und absurder Entscheidungen: verkaufen, wegwerfen, verschenken. Meine Frau und ich kauften dem achtzehn Monate alten Daniel eine große hölzerne Rutsche und stellten sie im Wohnzimmer auf. Er genoss das Chaos: stöberte in den Sachen, setzte sich Lampenschirme auf den Kopf, warf Pokerchips im Haus herum, rannte durch die riesigen Räume der sich langsam leerenden Zimmer. Abends lagen meine Frau und ich unter monolithischen Bettdecken und sahen uns im Fernsehen irgendwelche Schundfilme an. Bis auch der Fernseher verschenkt wurde. Es gab Probleme mit dem Heizkessel, und wenn ich vergaß, Wasser nachzufüllen, schaltete er sich aus. Als wir eines Morgens aufwachten, war die Temperatur im Haus auf fünf Grad abgesunken. Zwanzigmal am Tag ging das Telefon, und zwanzigmal am Tag erklärte ich irgendeinem Anrufer, dass mein Vater gestorben sei. Ich war nur noch Möbelhändler, Spediteur und Überbringer schlechter Nachrichten.
Das Haus glich allmählich der Bühne für eine abgedroschene Sittenkomödie. Verwandte stürzten herein, baten um dieses Möbelstück oder jenes Essgeschirr, probierten die Anzüge meines Vaters an, kippten Kisten aus und schnatterten wie die Gänse. Auktionsveranstalter kamen, um die Ware zu begutachten («Keine Polstermöbel, die sind keinen Pfifferling wert»), rümpften die Nase und schritten davon. Müllmänner stampften mit schweren Stiefeln herein und schleppten Berge von Abfall hinaus. Der Wassermann las den Wasserzähler ab, der Gasmann las den Gaszähler ab, die Ölmänner lasen den Ölstand ab. (Einer von ihnen – ich weiß nicht mehr welcher –, dem mein Vater im Lauf der Jahre viel Ärger gemacht hatte, sagte mir mit brutaler Komplizenschaft: «Ich sag das nicht gern» – er meinte das Gegenteil –, «aber Ihr Vater war ein widerlicher Schweinehund.») Die Grundstücksmaklerin kam, um für die neuen Besitzer ein paar Möbel zu kaufen, und nahm am Ende einen Spiegel für sich selber mit. Die Inhaberin eines Kuriositätenladens erstand die alten Hüte meiner Mutter. Ein Schrotthändler rückte mit seinen Gehilfen an (vier Schwarze namens Luther, Ulysses, Tommy Pride und Joe Sapp) und schleppte alles weg, was noch übrig war: angefangen bei einem Satz Hanteln bis hin zu einem kaputten Toaster. Als es vorbei war, war nichts mehr übrig. Nicht einmal eine Postkarte. Nicht einmal ein Gedanke.
Wenn es für mich in diesen Tagen einen einzelnen besonders schlimmen Augenblick gab, dann war es der, als ich im strömenden Regen über den Vorderrasen ging, um einen Armvoll Krawatten meines Vaters auf dem Lastwagen einer Wohltätigkeitsorganisation abzuladen. Es müssen über hundert Krawatten gewesen sein, und viele davon kannte ich noch aus meiner Kindheit: die Muster, die Farben, die Formen, die sich so deutlich wie das Gesicht meines Vaters in mein frühestes Bewusstsein geprägt hatten. Dass ich die jetzt wegwarf wie einen Berg Müll, war mir unerträglich, und in dem Moment, da ich sie in den Wagen warf, war ich den Tränen am nächsten. Das Wegwerfen dieser Krawatten schien mir die Idee des Begrabens stärker zu verkörpern als der Anblick des Sarges selbst, als er in die Erde gesenkt wurde. Endlich hatte ich begriffen, dass mein Vater tot war.
Gestern kam eins der Nachbarmädchen, um mit Daniel zu spielen. Ein Mädchen von etwa dreieinhalb Jahren, das vor kurzem gelernt hat, dass auch die großen Leute einmal Kinder gewesen sind und dass sogar seine Mutter und sein Vater Eltern haben. Irgendwann nahm sie den Hörer vom Telefon und spielte ein Gespräch, dann drehte sie sich zu mir um und sagte: «Paul, das ist dein Vater. Er will mit dir sprechen.» Es war schaurig. Ich dachte: Am anderen Ende der Leitung sitzt ein Gespenst, und er will tatsächlich mit mir sprechen. Es dauerte eine Weile, bis ich etwas sagen konnte. «Nein», platzte ich schließlich heraus. «Das kann nicht mein Vater sein. Er wollte heute nicht anrufen. Er ist irgendwo anders.»
Ich wartete, bis sie aufgelegt hatte, und ging dann aus dem Zimmer.
In seinem Schlafzimmerschrank hatte ich mehrere hundert Fotos gefunden – in verblassten braunen Umschlägen verstaut, auf die schwarzen Seiten welliger Alben geklebt, lose in Schubladen verstreut. Aus der Art ihrer Aufbewahrung schloss ich, dass er sie niemals angesehen und wohl vergessen hatte, dass sie überhaupt noch da waren. Ein sehr großes Album, kostspielig in Leder gebunden und mit einem in Gold geprägten Titel auf dem Umschlag – Unser Leben: Die Austers –, war innen vollständig leer. Jemand, vermutlich meine Mutter, hatte sich einmal die Mühe gemacht, dieses Album zu bestellen, doch niemand hatte sich je darum gekümmert, es zu füllen.
Zu Hause grübelte ich über diesen Bildern mit einer Faszination, die an Besessenheit grenzte. Ich fand sie unwiderstehlich, kostbar; für mich waren das heilige Reliquien. Es schien, als könnten sie mir Dinge erzählen, die ich vorher nicht gewusst hatte, als könnten sie irgendeine bis dahin verborgene Wahrheit enthüllen; intensiv betrachtete ich jedes einzelne, vergegenwärtigte mir die kleinsten Einzelheiten, die belanglosesten Schatten, bis alle diese Bilder ein Teil von mir geworden waren. Ich wollte nicht, dass irgendetwas verlorenginge.
Der Tod nimmt dem Menschen seinen Körper. Im Leben sind der Mensch und sein Körper synonym; im Tod gibt es den Menschen, und es gibt seinen Körper. Wir sagen: «Dies ist der Körper von X», als ob dieser Körper, der einmal der Mensch selbst gewesen ist und nicht etwas, das ihn darstellte oder ihm gehörte, sondern eben dieser Mensch X, mit einem Mal keine Bedeutung mehr besäße. Wenn jemand ein Zimmer betritt und man ihm die Hand schüttelt, hat man nicht das Gefühl, man schüttelt seine Hand oder seinem Körper die Hand, sondern man schüttelt ihm die Hand. Der Tod ändert das. Dies ist der Körper von X, nicht: Dies ist X. Die Syntax ist völlig anders. Jetzt sprechen wir nicht mehr von einem, sondern von zwei Dingen, womit wir sagen wollen, dass dieser Mensch auch weiterhin existiert, aber nur noch als Idee, als eine Anzahl von Bildern und Erinnerungen in den Köpfen anderer Leute. Was den Körper anbetrifft, so ist der nur mehr Fleisch und Knochen, nichts als ein Haufen Materie.
Die Entdeckung dieser Fotos war für mich wichtig, weil sie die physische Anwesenheit meines Vaters in der Welt aufs neue zu bestätigen schienen und mir die Illusion vermittelten, dass er noch da war. Die Tatsache, dass ich viele dieser Bilder, besonders die aus seiner Jugend, noch nie gesehen hatte, ließ das eigenartige Gefühl in mir entstehen, dass ich ihn jetzt erst kennenlernte, dass ein Teil von ihm erst jetzt ins Dasein träte. Ich hatte meinen Vater verloren. Zugleich aber hatte ich ihn gefunden. Solange ich diese Bilder vor Augen hatte, solange ich ihnen meine volle Aufmerksamkeit zuwandte, war es, als wäre er noch lebendig, selbst im Tode noch. Oder wenn schon nicht lebendig, so doch zumindest nicht tot. Oder noch genauer, irgendwie in der Schwebe, eingeschlossen in ein Universum, das nichts mit dem Tod zu tun hatte, zu dem der Tod überhaupt keinen Zutritt hatte.
Die meisten dieser Bilder erzählten mir nichts Neues, doch halfen sie mir, Lücken zu füllen, Eindrücke zu bestätigen, Beweise zu finden, wo es vorher keine gegeben hatte. Zum Beispiel gibt eine Reihe von Schnappschüssen aus seiner Junggesellenzeit, wahrscheinlich über mehrere Jahre hinweg entstanden, genauen Bericht von gewissen Aspekten seiner Persönlichkeit, die in den Jahren seiner Ehe verschüttet gewesen waren und die ich erst nach seiner Scheidung wahrzunehmen begonnen hatte: mein Vater als Possenreißer, als Lebemann, als fröhlicher Gesell. Ein Bild ums andere zeigt ihn in Gesellschaft von Frauen, meist zweien oder dreien, die alle komische Posen einnehmen, sich in den Armen halten, zu zweit auf seinem Schoß sitzen oder ihm einen theatralischen Kuss geben, niemand anderem zuliebe als demjenigen, der das Bild aufnimmt. Im Hintergrund: ein Berg, ein Tennisplatz, vielleicht ein Swimmingpool oder eine Holzhütte. Bilder, die von gemeinsamen Wochenendausflügen mit seinen unverheirateten Freunden in verschiedene Urlaubsorte in den Catskills stammten: Tennis spielen, sich mit Mädchen amüsieren. So lebte er, bis er vierunddreißig wurde.
Ein solches Leben passte zu ihm, und ich kann verstehen, wieso er nach dem Zerbrechen seiner Ehe wieder damit angefangen hat. Für einen Mann, der das Leben nur an der Oberfläche erträglich findet, ist es ganz natürlich, wenn er sich damit zufriedengibt, den anderen nicht mehr als diese Oberfläche zu bieten. Da sind wenig Ansprüche zu erfüllen, und Engagement ist nicht erforderlich. Die Ehe hingegen schlägt die Tür zu. Dann ist das Dasein auf einen engen Raum beschränkt, in dem man fortwährend gezwungen ist, sich zu offenbaren – und damit ständig in sich hineinzublicken, seine eigenen Tiefen zu erforschen. Wenn die Tür offensteht, gibt es nie Probleme: Man kann jederzeit die Flucht ergreifen. Man kann unerwünschten Konfrontationen mit sich oder mit anderen aus dem Weg gehen, indem man sich einfach aus dem Staub macht.
Mein Vater verfügte über schier unbegrenzte Fähigkeiten, sich Leuten zu entziehen. Da die Sphäre des anderen für ihn unwirklich war, unternahm er seine Ausflüge dorthin mit einem Teil von sich, den er für gleichermaßen unwirklich hielt, mit einem zweiten Ich, das er als Schauspieler ausgebildet hatte, der ihn in der schalen Komödienwelt der Allgemeinheit vertreten musste. Dieses Stellvertreter-Ich war im wesentlichen ein Schalk, ein hyperaktives Kind, ein Erfinder von Lügengeschichten. Es konnte nichts ernst nehmen.
Da nichts für ihn zählte, erlaubte er sich die Freiheit zu tun, was er wollte (sich in Tennisklubs einschleichen, einen Restaurantkritiker spielen, um eine Gratismahlzeit zu ergattern), und eben der Charme, mit dem er seine Siege errang, machte diese Siege wertlos. Eitel wie eine Frau verhehlte er die Wahrheit über sein Alter, erfand Geschichten über seine geschäftlichen Transaktionen, sprach von sich selbst nur indirekt – in der dritten Person, als erzählte er von einem Bekannten («Ein Freund von mir hat ein gewisses Problem; was würden Sie ihm raten? …»). Wann immer es ihm zu brenzlig wurde, wann immer er meinte, er sei zu nahe daran, sich zu verraten, entwand er sich mit einer Lüge. Am Ende geschah das ganz automatisch, und er log um des Lügens willen. Sein Grundsatz war es, so wenig wie möglich zu sagen. Wenn die Leute nie die Wahrheit über ihn erfuhren, konnten sie sie später auch nicht gegen ihn verwenden. Mit dem Lügen konnte er sich Schutz erkaufen. Wenn er vor den Leuten erschien, sahen sie also nicht ihn, sondern eine Person, die er erfunden hatte, ein künstliches Wesen, das er manipulieren konnte, um andere zu manipulieren. Er selbst blieb unsichtbar, ein Puppenspieler, der von einem dunklen, abgelegenen Platz hinter dem Vorhang die Schnüre seines Alter Ego bediente.
In den letzten zehn oder zwölf Jahren seines Lebens hatte er eine feste Freundin; das war die Frau, die ihn in der Öffentlichkeit begleitete und die Rolle seiner offiziellen Lebensgefährtin spielte. Ab und zu war (auf ihr Betreiben) vage von Ehe die Rede, und jedermann glaubte, sie sei die einzige Frau, mit der er etwas zu tun habe. Nach seinem Tod jedoch meldeten sich auch noch andere Frauen. Diese hatte ihn geliebt, jene hatte ihn angebetet, eine andere hatte ihn heiraten wollen. Die feste Freundin war entsetzt, als sie von diesen anderen Frauen erfuhr: Mein Vater hatte sie ihr gegenüber nie mit einem Wort erwähnt. Jeder hatte er eine andere Rolle vorgespielt, und jede glaubte, ihn ganz für sich allein besessen zu haben. Wie sich herausstellte, hatte keine von ihnen ihn richtig gekannt. Es war ihm gelungen, sich ihnen allen zu entziehen.
Einsam. Doch nicht im Sinne von Alleinsein. Nicht einsam wie Thoreau zum Beispiel, der freiwillig ins Exil ging, um herauszufinden, wer er war; nicht einsam wie Jona, der im Bauch des Wals um Erlösung betete. Einsam im Sinne von zurückgezogen. Um sich nicht sehen zu müssen, um sich nicht von anderen betrachten lassen zu müssen.
Es war schwer, mit ihm zu reden. Entweder war er abwesend (und das war er meistens), oder er überfiel einen mit einer schrillen Witzigkeit, die nur eine andere Form der Abwesenheit darstellte. Es war, als versuchte man sich einem senilen alten Mann verständlich zu machen. Man redete, und es kam keine Antwort, oder eine unpassende, die lediglich zeigte, dass er gar nicht richtig zugehört hatte. Wann immer ich in den letzten Jahren mit ihm telefonierte, redete ich am Ende mehr als gewöhnlich, wurde aggressiv geschwätzig, plauderte in dem vergeblichen Streben vor mich hin, seine Aufmerksamkeit zu fesseln und ihm eine Reaktion zu entlocken. Hinterher kam ich mir jedes Mal wie ein Idiot vor, weil ich mich so angestrengt hatte.
Er rauchte nicht, er trank nicht. Kein Hunger nach sinnlichen Genüssen, kein Durst auf intellektuelle Erquickung. Bücher langweilten ihn, und es gab nur wenige Filme oder Theaterstücke, bei denen er nicht einschlief. Sogar auf Parties konnte man ihn beobachten, wie er darum kämpfte, die Augen offenzuhalten, und nicht selten schlief er dann doch in einem Sessel ein, während um ihn herum die Gespräche schwirrten. Ein Mann ohne Bedürfnisse. Man hatte das Gefühl, nichts könnte je in ihn eindringen, er habe keinerlei Lust auf irgendetwas, das die Welt zu bieten hatte.
Hochzeit mit vierunddreißig. Scheidung mit zweiundfünfzig. In gewisser Weise hat es Jahre gedauert, in Wirklichkeit waren es aber nur ein paar Tage. Er war nie ein verheirateter Mann, nie ein geschiedener, sondern lebenslang ein Junggeselle, der zufällig zwischendurch mal verheiratet war. Obwohl er sich seinen äußeren Pflichten als Ehemann nicht entzog (er war treu, er versorgte Frau und Kinder, er nahm alle seine Verantwortlichkeiten auf sich), war es ganz offenkundig, dass er sich für diese Rolle nicht eignete. Er hatte einfach kein Talent dafür.
Meine Mutter war gerade einundzwanzig, als sie ihn heiratete. Während der kurzen Zeit seiner Werbung hatte er sich anständig verhalten. Keine dreisten Annäherungsversuche, nichts von den atemlosen Attacken des brünstigen Männchens. Gelegentlich hielten sie sich an den Händen oder tauschten einen höflichen Gutnachtkuss aus. Nie hat einer dem anderen ein Liebesgeständnis gemacht. Zum Zeitpunkt der Hochzeit waren sie kaum mehr als Fremde.
Schon bald erkannte meine Mutter ihren Fehler. Noch ehe die Flitterwochen vorbei waren (diese Flitterwochen, so ausführlich dokumentiert auf den Fotos, die ich gefunden habe: eins zum Beispiel, wo die beiden zusammen auf einem Felsen am Rand eines vollkommen stillen Sees sitzen, hinter ihnen führt ein breiter Streifen Sonnenlicht zu dem im Schatten liegenden Kiefernhang, mein Vater hält meine Mutter in beiden Armen, und die zwei sehen einander zaghaft lächelnd an, als hätte der Fotograf sie einen Augenblick zu lang in dieser Pose verharren lassen), noch ehe also die Flitterwochen vorbei waren, wusste meine Mutter, dass diese Ehe nicht funktionieren würde. Tränenüberströmt ging sie zu ihrer Mutter und sagte, sie wolle ihn verlassen. Irgendwie gelang es ihrer Mutter, sie dazu zu überreden, zurückzugehen und es wenigstens einmal zu versuchen. Und dann, noch bevor der Staub sich gelegt hatte, merkte sie, dass sie schwanger war. Und plötzlich war es zu spät, noch etwas zu unternehmen.
Manchmal denke ich daran: wie ich in Niagara Falls, diesem Urlaubsort für Flitterwöchner, gezeugt worden bin. Nicht dass es eine Rolle spielte, wo es passiert ist. Aber der Gedanke an diese mit Sicherheit leidenschaftslose Umarmung, an dieses blinde pflichtbewusste Gefummel zwischen kalten Hotelbettdecken, hat mir noch jedes Mal demütigend bewusst gemacht, was für ein Zufallsprodukt ich bin. Niagara Falls. Oder das Hasardspiel zweier Körper, die sich vereinigen. Und dann ich, ein zufälliger Homunculus, der wie ein wilder Draufgänger in einem Fass den Wasserfall hinunterstürzt.
Etwas mehr als acht Monate später, am Morgen ihres zweiundzwanzigsten Geburtstags, wachte meine Mutter auf und sagte meinem Vater, das Baby wolle heraus. Lächerlich, gab er zurück, das Kind ist erst in drei Wochen fällig – sprach’s, fuhr zur Arbeit und ließ sie ohne Auto allein.
Sie wartete. Dachte, er könnte ja recht haben. Wartete noch ein wenig, rief dann eine Schwägerin an und bat sie, sie in die Klinik zu fahren. Meine Tante blieb den ganzen Tag bei meiner Mutter und rief meinen Vater alle paar Stunden an, er solle kommen. Später, lautete seine Antwort, ich habe noch zu tun, ich komme, wenn ich Zeit habe.
Kurz nach Mitternacht zwängte ich mich, mit dem Steiß voran und zweifellos schreiend, in die Welt hinaus.
Meine Mutter wartete auf das Erscheinen meines Vaters, aber er kam erst am nächsten Morgen – begleitet von seiner Mutter, die ihr Enkelkind Nummer sieben begutachten wollte. Ein kurzer nervöser Besuch, und dann wieder ab an die Arbeit.
Natürlich hat sie geweint. Schließlich war sie jung, und sie hatte nicht erwartet, dass es ihm so wenig bedeuten würde. Aber derlei konnte er nie begreifen. Weder am Anfang noch am Ende. Es war ihm nie möglich, dort zu sein, wo er war. Zeit seines Lebens war er immer irgendwo anders, zwischen hier und da. Aber niemals richtig hier. Und niemals richtig da.
Dreißig Jahre später wiederholte sich dieses kleine Drama. Diesmal war ich dabei, und ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen.
Nach der Geburt meines Sohnes hatte ich gedacht: Das wird ihm doch sicher Freude machen. Freut es nicht jeden, Großvater zu werden?
Ich hatte sehen wollen, wie er über das Baby in Verzückung geriet; er sollte mir beweisen, dass er trotz allem fähig war, einmal Gefühle zu zeigen – dass er trotz allem Gefühle hatte wie alle anderen Menschen. Und wenn er Zuneigung zu seinem Enkel zeigen konnte, würde er damit nicht indirekt Zuneigung zu mir zeigen? Man hört nie auf, sich nach der Liebe seines Vaters zu sehnen, auch nicht, wenn man längst erwachsen ist.
Doch der Mensch ändert sich nicht. Insgesamt hat mein Vater seinen Enkel nur drei- oder viermal gesehen, und niemals war er in der Lage, ihn von der Tag für Tag in die Welt gesetzten unpersönlichen Masse von Babies zu unterscheiden. Daniel war gerade zwei Wochen alt, als er ihn zum ersten Mal erblickte. Ich kann mich lebhaft an den Tag erinnern: ein sengendheißer Sonntag Ende Juni, Hitzewellenwetter, die Landluft grau vor Feuchtigkeit. Mein Vater fuhr mit seinem Auto vor, sah meine Frau das Baby zum Schlafen in den Kinderwagen legen und kam her, um hallo zu sagen. Er stieß seinen Kopf für eine Zehntelsekunde in den Kinderwagen, richtete sich wieder auf und sagte zu ihr: «Ein schönes Baby. Na dann viel Glück», worauf er ins Haus schritt. Ebenso gut hätte er über das Baby irgendeines Fremden in der Schlange im Supermarkt sprechen können. Für den Rest seines Besuchs damals würdigte er Daniel keines Blickes mehr.
All dies lediglich als Beispiel.
Unmöglich, in die Einsamkeit eines anderen einzudringen, das wird mir jetzt klar. Falls wir einen Menschen, wenn auch nur in Maßen, überhaupt jemals richtig kennenlernen können, dann allenfalls insoweit, als er bereit ist, sich zu offenbaren. Jemand mag sagen: Mir ist kalt. Oder aber er sagt gar nichts, und wir sehen ihn zittern. In jedem Fall wissen wir, dass ihm kalt ist. Was aber, wenn einer nichts sagt und auch nicht zittert? Wo alles verhärtet ist, wo alles hermetisch und ausweichend ist, kann man nur noch beobachten. Doch ob man aus dem Beobachteten schlau wird, ist eine ganz andere Sache.
Ich möchte keinerlei Mutmaßungen anstellen.
Er hat nie von sich erzählt, schien im Grunde gar nicht zu wissen, dass es da irgendetwas zu erzählen gab. Als hätte sein Innenleben sich sogar ihm selbst entzogen.
Er konnte nicht darüber sprechen, und deshalb ging er schweigend darüber hinweg.
Aber wenn es nichts als Schweigen gibt, ist es dann nicht anmaßend von mir, zu sprechen? Andererseits: Hätte es irgend etwas über dieses Schweigen hinaus gegeben, würde ich dann überhaupt das Bedürfnis zu sprechen gehabt haben?
Meine Wahlmöglichkeiten sind begrenzt. Ich kann stumm bleiben, oder ich kann von Dingen sprechen, die nicht zu verifizieren sind. Zum allermindesten will ich die Tatsachen festhalten, sie so aufrichtig wie möglich darlegen und sie sagen lassen, was immer sie zu sagen haben. Doch selbst die Tatsachen erzählen nicht immer die Wahrheit.
Er war nach außen hin so unerbittlich neutral, sein Verhalten war so wenig vorhersehbar, dass alles, was er tat, überraschend kam. Man konnte gar nicht glauben, dass es einen solchen Menschen gab – der keine Gefühle hatte, der so wenig von anderen verlangte. Und wenn es einen solchen Menschen nicht gab, dann bedeutet das, dass da ein anderer war, ein Mensch, der sich in dem verbarg, den es gar nicht gab; und demnach geht es um das Kunststück, ihn zu finden. Vorausgesetzt, dass er dort zu finden ist.
Gleich von Anfang an zu erkennen, dass dieses Projekt zum Scheitern verurteilt ist.