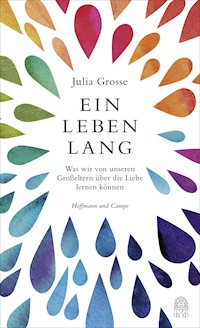
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Mehr als siebzig Jahre lang waren Julia Grosses Großeltern ein Paar. Ihre Liebe erschien ihr als das Maß aller Dinge. An ihnen hat sie jede ihrer Beziehungen gemessen und sich immer wieder gefragt: Wie hält man eine so tiefe Verbundenheit über ein ganzes Leben aufrecht? Besonders in einer Zeit, in der es zahlreiche Beziehungsmodelle gibt, die längst nicht alle einen Ewigkeitsanspruch haben. Und was für Wege gab es neben dem ihrer Großeltern? Um diese Fragen zu beantworten, ist Julia Grosse quer durch Deutschland und bis nach New York gereist. Sie hat Liebespaare getroffen, die auch nach vielen Jahren, tiefen Einschnitten und gemeisterten Krisen in der Gewissheit leben, ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Herausgekommen sind hinreißende Porträts die zeigen, dass die Liebe zwar nicht immer wie im Märchen verläuft, dass man aber trotz allem gemeinsam glücklich bis ans Lebensende sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Julia Grosse
Ein Leben lang
Was wir von unseren Großeltern über die Liebe lernen können
Hoffmann und Campe
Für B.
»I want you in my life till the day I die, baby.«
D’Angelo, Higher
Einleitung
Ich schreibe ein Buch über das Geheimnis lebenslanger Liebe. Über erfüllte Zweisamkeit bis ins hohe Alter und wie (und ob) so etwas überhaupt möglich ist.
Ein Buch über die Suche nach der ewigen Liebe zu schreiben, ist natürlich riskant. Ich denke beim Begriff »ewige Liebe« schnell an Herzsymbole, an Treue-Tattoos auf Schulterblättern und pathetische Schwüre aus Powerballaden. Für mich ist das eher befremdlich. Die Idee oder die Erwartungshaltung, ein Leben lang zufrieden zu zweit zu sein, als Lebensgemeinschaft oder Ehepaar, wirkt für viele inzwischen ohnehin überholt. Es gibt unzählige Formen und Konstruktionen des Zusammenseins, sie sind flexibel und haben zum Teil gar nicht mehr den Anspruch auf das »Bis-dass-der-Tod-euch-scheidet«. Und überhaupt lebt es sich, im Unterschied zu früheren Zeiten, für viele Menschen heute bestens allein, die Bindung an einen Partner ist immer seltener abhängig von ökonomischen und sozialen Aspekten.
Und doch: Das Thema der niemals endenden, schmerzerfüllten Suche nach der wahren Liebe bestimmt bis heute unsere globale Kultur. Pop, Holly- und Bollywood, Liebeslyrik. Die zärtliche Verbundenheit mit einem Menschen ist eines der wichtigsten, mächtigsten Gefühle in unserer Brust. Umfragen stellen zwar einen Trend zu individualisierten Lebensformen fest, zeigen aber auch, dass die Sehnsucht nach der einen, großen Liebe nach wie vor dominiert. »Etwas Rätselhaftes scheint der Liebe anzuhaften, etwas, das man nicht ganz genau wissen und nur unzulänglich erklären kann. Dies allerdings trifft auch auf den Urknall zu oder die Frage, wie das Wetter in zwei Wochen sein wird. Und dennoch erregen Urknalltheorie und Wettervorhersage die Dichter und ihr Publikum weit weniger als alles, was mit der Liebe zu tun hat«[1], schreibt Patrick Süskind in seinem Essay »Über Liebe und Tod«. Und diese Erregung und Faszination, von denen er spricht, stellt sogar gesundheitliche Vorteile in Aussicht: So lebt es sich aus medizinischer Sicht in stabilen, glücklichen Beziehungen angeblich länger, man esse gesünder, altere besser.
Grund dafür, dass zumindest ich mich jenseits der Klischees und Herzsymboliken mit diesem Thema beschäftige, sind meine Großeltern. Meine Übervorbilder für eine funktionierende Langzeitbeziehung. Ich wurde durch ihre Bilderbuchehe verwöhnt und von diesem Märchen mit Happy End eingelullt. Paul und Irmels liebevolle Partnerschaft hat mir in Bezug auf Liebesbeziehungen eine ordentliche Gehirnwäsche verpasst. Wie im Guten, so im Schlechten. Die beiden waren 70 Jahre lang ein Paar. 70 Jahre! Das sind 25550 Tage. Oder 613200 Stunden, in denen man vielen Menschen begegnet, mit einigen davon eine Weile sehr eng verbunden ist und sich von anderen wieder trennt. Wie aber ist es, wenn man diese ganze Zeit mit ein und demselben Partner verbringt? Ihn 70 Jahre lang begehrt, respektiert, ein ganzes Leben lang gemeinsam mit ihm wächst, ihm vertraut, mit ihm trauert, genießt, aber eben auch altert, schwächer wird und sich schließlich für immer von ihm verabschieden muss. So war es bei meinen Großeltern, die beide im majestätischen Alter von 99 Jahren gestorben sind.
Ich bin mit meinem Partner seit über zehn Jahren zusammen. Und im Kontext heutiger Erwartungen an Zweisamkeit ist das eine lange Zeit. Man wird Experte genannt oder Beziehungsmethusalem. Doch die Vorstellung, dass mein Partner und ich das Ganze noch weitere fünf Jahrzehnte so munter fortführen, ohne uns irgendwann miteinander zu Tode gelangweilt oder komplett zerstritten und entfremdet zu haben, fühlt sich bizarr an.
Natürlich möchte ich mit meinem Mann auch jenseits der Rente und des stressigen Alltags ein wunderbares Leben verbringen. Aber wie bewältigen wir den Weg dahin?
Die Beziehung meiner Großeltern war geradezu unmenschlich, und die Zugewandtheit und Liebe der beiden zueinander so groß, dass keiner aus der Familie mitzuhalten vermochte. Meine Mutter und ihre Zwillingsschwester wurden mit der Erwartungshaltung groß, dass die Ehe, die sie später führen würden, mindestens genauso unfassbar toll sein müsse. Was natürlich zum Scheitern verurteilt war. Denn das, was meine Großeltern uns allen vorlebten, war Fluch und Segen zugleich. Kein Mittelmaß, keine Kompromisse, dafür totale Zuneigung und Toleranz. Streiten wegen Haaren im Waschbecken? Wäre meinen Großeltern viel zu trivial gewesen. Wieso sollte man mit seinem Seelenverwandten und partner in crime über weltliche Überflüssigkeiten wie leere Zahnpastatuben diskutieren? Haben Romeo und Julia auch nicht getan. In der Zeit, in der andere sich angifteten, gingen meine Großeltern lieber auf Kreuzfahrt. Oder tanzten auf irgendeinem Ball. Mein Großvater stets im Anzug, sie mit ihrem schönen Schmuck. Ihre komplett überfüllten Schmuckschatullen waren für mich das Tor zur Glückseligkeit und der frühkindliche Einstieg in den Konsumwahn. Die beiden fuhren nach Jersey, Griechenland oder Italien, wanderten in den Bergen und feierten jeden Geburtstag groß. Und ich, als Kind und Jugendliche, beobachtete ihr Glück und nahm mir vor, es genauso gut zu machen wie sie. Ich empfand es deshalb schon ziemlich früh als reine Zeit- und Energieverschwendung, mit Jungs zu gehen, bei denen ich mir nicht vorstellen konnte, das große Los gezogen zu haben. Während meine Freundinnen auf Partys knutschten, suchte ich nach dem Einen. Und wirkte dabei wie eine der tragischen, uncoolen Figuren, deren trauriger Suche nach der Liebe wir uns im Deutschunterricht viele gelbe Reclam-Hefte lang widmeten. Wenn mir nicht sofort beim ersten Anblick eines jungen Mannes das Herz bis zum Hals schlug vor Begeisterung, war das Ganze ohnehin schon zum Scheitern verurteilt. Wenn er schön war, aber beim Öffnen des Mundes dieses Bild in sich zusammenfiel, hatte sich das Thema ebenfalls erledigt. Und er musste mich natürlich auf Händen tragen. Er mich, niemals ich ihn. Das hatte mir mein Großvater jahrelang eingebläut. Nicht, weil er den alten Patriarchen spielte. Eher sah er in meiner Oma seine persönliche Greta Garbo, die man anzubeten hatte.
Dass ich vor zehn Jahren dann tatsächlich den Partner für etwas richtig Ernsthaftes gefunden habe, schob ich auf die gute »Ausbildung« durch meine Großeltern. Andere Beziehungsmodelle, die ja irgendwie auch funktionierten, kamen für mich überhaupt nicht infrage. Beziehungen, in denen man sich zwar mochte, aber nicht mehr verliebt war? Unvorstellbar! Eine Partnerschaft, in der man nicht stundenlang am Tisch saß und angeregt diskutierte? Bemitleidenswert! Konstellationen, in denen man das klassische Rollenmodell durchzog? Beängstigend!
Allerdings musste ich mit den Jahren feststellen, dass meine Strategie einen gewaltigen Haken hatte. Denn die perfekte Beziehung meiner Großeltern zu imitieren, bedeutet nämlich nicht nur Stress, sondern entpuppte sich auch über kurz oder lang als Ding der Unmöglichkeit. Es ging mir irgendwann nur noch auf die Nerven. Mein Partner verdrehte die Augen, wenn ich jedes Mal eine Panikattacke bekam, sobald wir uns stritten. Streiten! Das hatten meine Großeltern in siebzig Jahren kein einziges Mal getan. Und dass es gesund für die Beziehung sei, hielten sie natürlich für ein Gerücht.
Mit der Zeit war ihr Glück offenbar auch für mich zur Anstrengung, zur Herausforderung geworden, die mich total hemmte. Die beiden waren, ohne dass es ihnen überhaupt in dieser Konsequenz bewusst war, Vorbilder, die in meinen Gedanken lange Zeit als drohender Liebesknigge über mir und meiner Beziehung schwebten. Wenn ich es nicht schaffte wie sie, dann konnte ich es gleich vergessen.
Doch dann starben sie plötzlich. Ganz dicht nacheinander, beide kurz vor ihrem 100. Geburtstag, als hätten sie Einfluss darauf gehabt.
Das ist erst wenige Jahre her. Und natürlich will ich ebenfalls 99 Jahre alt werden und im exakt gleichen Moment wie mein Partner von der Bank kippen, wie Philemon und Baucis. Doch bis dahin ist hoffentlich noch ein bisschen Zeit, und ich merke, dass ich meinen eigenen Weg finden muss, mein Glück zu halten und zu genießen. Als mein Mann und ich uns kennenlernten, war alles fast surreal passend. Beide gleich sozialisiert, mein Vater, der Naturwissenschaftler, seine Mutter, die Psychoanalytikerin. Bei ihm wie bei mir zu Hause lief Beethoven ebenso wie Harry Belafonte. Auch die Tatsache, dass wir als Afro-Deutsche die gleichen Erfahrungen teilten, bedeutete ein tiefes Verstehen ohne Worte. Das alles waren für mich Steine für jenes Fundament, auf dem ich innerlich unsere Beziehung aufbaute. Wie gemacht für einander, die Tollsten! So einen passenden Menschen konnte ich doch unmöglich noch einmal finden. Und das empfinde ich bis heute so.
Dennoch ist Streit inzwischen zur Routine geworden, und wir vergessen leicht, uns als Paar zu pflegen. Dass Pflege überhaupt zum partnerschaftlichen Vokabular gehört, war mir nie wirklich klar gewesen, bei meinen Großeltern sah immer alles so leicht aus. Effortless. Und auch ich habe ja meinen perfekten Mitspieler gefunden, mit dem alles wunderbar läuft in Momenten, in denen wir beim Koreaner sitzen oder in Südtirol wandern. Definitiv nichts ist wunderbar, wenn wir streitend und verspätet im Stau stecken, hinten plärrt das eine Kind, während sich das andere spontan übergeben muss. Das sind die Situationen, in denen mir die Vorstellung des glücklichen Kreuzfahrt-Ehelebens meiner Großeltern lächerlich vorkommt. Wie gelingt die Pflege in jenen Momenten, in denen die Beziehung von den unattraktiven Seiten des Alltags durchzogen wird? Und bin ich irgendwann nicht zu alt, um an den oberen Stellen unseres Paar-Fundaments das Moos abzukratzen? Oder lässt man es dann einfach wachsen und bleibt entspannt, weil gar nicht alles perfekt sein muss?
»Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden«, heißt es in Hermann Hesses oft zitiertem Gedicht »Stufen«[2]. Man pflegt einander und arbeitet an sich und der Beziehung ein Leben lang, denn alles, was lebendig ist, befindet sich permanent in Bewegung und Veränderung. Dieser Fakt ist tröstlich. Das Leben und die Partnerschaft meiner Großeltern im klassischen Nachkriegswohlstand, mit Zweireiher samt Einstecktuch, eleganten Faltenröcken zu beigen Rollkragenpullovern, auf denen die langen Goldketten glitzerten, das war eben ihr Weg gewesen. Es ist nicht meiner. Mein Weg beinhaltet weder Kreuzfahrten noch täglich einen Strauß Blumen von meinem Mann. Ich werde die Partnerschaft, wie meine Großeltern sie gelebt haben, immer bewundern. Doch seit sie nicht mehr da sind, hat sich eine wachsende Neugierde und auch Ungeduld in mir breitgemacht. Wenn das, was sie erlebt haben, phantastisch, aber längst nicht der einzige Weg ist, eine erfüllte Beziehung zu führen, möchte ich die vielen diversen Spielarten der Liebe, der Zuneigung anderer über lange Zeit liierter Paare dringend kennenlernen. Nicht um die Geschichte meiner Großeltern zu entzaubern. Sondern um mich von ihrer Übermacht zu befreien und neue Vorbilder und Variationen des glücklichen Zusammenlebens kennenzulernen. Wie man zum Beispiel streitet und dabei trotzdem nonchalant und zufrieden sechzig Jahre lang eine gute Partnerschaft führt.
Dies ist kein Handbuch für die Liebe, randvoll mit praktischen Antworten. Doch es lässt einen die Idee von Partnerschaft, die Situation der eigenen Beziehung vielleicht neu betrachten. Die folgenden Geschichten sollen Fragen aufwerfen: Wie bereitet man sich auf die verschiedenen Phasen des Lebens vor, und wie durchquert man sie möglichst unbeschadet, von den frühen Jahren des gemeinsamen Wachsens bis zu Schicksalsschlägen im Alter? Wie haben andere das vor uns gemacht?
In den vergangenen Monaten habe ich viele Paare getroffen, die meine Großeltern sein könnten und die zum Teil seit über siebzig Jahren ihr Leben miteinander verbringen. Und dabei immer noch sehr zufrieden und glücklich wirken und ihren ganz eigenen Weg gegangen sind. Um sie zu finden, streckte ich meine Fühler in alle Richtungen aus: Freunde schwärmten von dem Onkel und der Tante als Ausnahmepaar der Familie, ich arbeitete mich tapfer durch unzählige Diamanthochzeitsanzeigen in der Lokalpresse und schrieb Senioreneinrichtungen von München bis New York an.
Es ist also eher eine Spurensuche. Bei Paaren wie den Baumanns, bei denen die Beziehung erst im hohen Alter wie ein schöner Frühling neu aufblühte, da ihm bewusst geworden ist, dass er zu lange nicht für sie da gewesen ist. Ich war bei den Angiamas im Süden Londons, wo täglich nach wie vor diskutiert wird, bis es qualmt, beide aber eine Bergmassiv sprengende Einheit sind, sobald sie gemeinsam beten. Oder die Gülers, die bereits im Kindesalter wussten, dass sie einander eines Tages heiraten müssen, sich später mit sieben Kindern in der schwäbischen Alb eine Existenz aufbauten und nie bewusst den Satz »Ich liebe dich« zueinander gesagt haben.
Meine Großeltern
1Das machtvolle Herz
You need more than Gerhard Richter hangin’ on your wall
A chauffeur-driven limousine on call
To drive your wife and lover to a white tie ball
you need love
I believe that we can achieve the love that we need
I believe, call me naive
Love is for free
Pet Shop Boys, »Love Etc.«
Wie aus einem spätromantischen Gesellschaftsgemälde von Carl Spitzweg kamen mir meine Großeltern immer vor. Der Mann aus Germering war technisch brillant gewesen, doch wollte ihn die damalige Kunstwelt nie wirklich in ihre Ränge aufnehmen. Porträts wie die des armen, erfolglosen Poeten, der in seinen Kleidern im Bett liegt, hängen bis heute in Wartezimmern deutscher Allgemeinärzte. Mein Vater fand das Bild immer pfiffig. Ich fand es altbacken und trivial. Und obwohl das Leben meiner Großeltern im Grunde wenig mit diesen weltabgewandten Darstellungen gemein hatte, kamen mir stets diese verträumten Spitzweg-Szenen in den Sinn, wenn ich die beiden zusammen sah. Wie Spitzweg war Paul und Irmel alles Derbe fremd. Fast hundertjährig sitzen sie an ihrem kleinen Wohnzimmertisch, an dem sie täglich ihren Friesentee trinken, die Oberkörper gerade nach vorn gebeugt. Sie lächeln einander an. Es herrscht dieselbe herzerwärmende Stimmung wie in diesen unterschätzten Gemälden, die das beschauliche Leben der Bürger ihrer Zeit einfangen. Meine Oma legt ihre dünn gewordenen Hände auf die noch dünneren meines Opas und sagt ihm mit ihrer weichen Stimme, wie lieb sie ihn habe. Mein Opa nickt und fügt hinzu, er liebe sie wie am ersten Tag. Woraufhin meine Oma ihre Hand noch etwas fester auf die meines Großvaters drückt. Ich sitze mit meiner Mutter und meinem Bruder auf der Couch in der anderen Ecke des Zimmers und unterhalte mich. Wir beachten die beiden, deren Anblick Außenstehende wohl spontan zu Tränen rühren würde, gar nicht mehr. Derartige Szenen gehörten für uns zur Tagesordnung, außerdem war Publikum ohnehin unerwünscht.
Im Universum meiner Großeltern war das Glück zu zweit so innig und eng, dass kein Blatt Papier mehr zwischen sie passte. Wir alle, der Rest der Familie, hatten uns über die Jahre an diese intensive Verbundenheit gewöhnt, waren verdammt zu Statisten auf Lebenszeit, die an dieser Liebesszene immer und immer wieder teilhaben durften. Und manchmal auch mussten, denn es gab sicher auch Momente, in denen einer von uns es gehasst hat, diesen Anblick der perfekten Liebe, während zu Hause die Ehe den Bach hinunterging oder zumindest der Haussegen gehörig schief hing. So etwas konnte an schlechten Tagen das Unbehagen an den eigenen Lebensumständen noch verstärken. An anderen Tagen war es wiederum gerade dieses ewige Turteln meiner Großeltern, ihre Wärme, die den Raum erfüllte und uns allen das Gefühl, ja, sogar die Hoffnung, gab, dass die Welt am Ende doch ein ziemlich schöner Ort war.
Die beiden lernten sich 1938 auf dem Fest einer gemeinsamen Freundin kennen, die bei meiner Geburt schon lange nicht mehr lebte und von der ich immer phantastische Geschichten gehört hatte. Gretel Sauvage. Schon der Name klang geheimnisvoll. »Eine echte Bohemienne!«, sagte meine Mutter stets andächtig. Gretel war Malerin, und ich hatte jahrelang ein düsteres Ölbild von ihr im Flur meiner Studentenwohnung hängen, ohne zu ahnen, dass es von der großen Unbekannten stammte. Sie war freier als viele andere Nachkriegsspießer. Cooler. Kreativer. Und eben auch eine Freundin meiner Großeltern. Für meinen Opa war am Abend des Festes schon alles klar: Diese junge Zahnarzthelferin aus Mühlheim mit den großen braunen Locken und wasserblauen Augen, meine Oma, sollte seine Frau werden. Mit ihrer Fröhlichkeit, diesen bezaubernden Grübchen und dem runden, gut durchbluteten Gesicht war sie ihm schon aufgefallen, als er zur Tür eintrat. Und meine Oma, nun, die war auch interessiert – aber zu der Zeit nicht nur vergeben, sondern noch verheiratet. Mit einem Mann, den ich mir immer wie einen weißblonden großen Schauspieler in den frühen Ufa-Studios vorstellte. Irgendwie verwegen.
Herr B., wie wir ihn in meiner Familie mit höflicher Zurückhaltung nannten, war bereits vor Jahren aus Deutschland ausgewandert und wollte unbedingt, dass meine Oma mit ihm auf einer Plantage irgendwo in der Südsee lebte. Doch sie wollte nicht. Und traf, dank Gretel, an jenem Abend im Jahre 1938 nun Paul, eher Typ Heinz Rühmann, klein, mit rötlichem, lichter werdendem Haar, dicker Brille und seit Jahren als Prokurist in derselben Süßwarenfirma tätig. Doch eben auch blitzgescheit, zum Fürchten gebildet und mit perfekten Manieren, die Adolph Knigge leuchtende Augen beschert hätten. So hätte er sich wohl lieber die hilfsbereiten Hände abgehackt, als einer Frau nicht in den Mantel zu helfen oder ihr die Tür aufzuhalten. Dass meine Tochter heute weiß, wie man das Besteck legt, wenn man einen Nachschlag wünscht, ist das Benimmerbe meines Großvaters.
Dieser kluge, zuvorkommende Mann hatte aber auch etwas Glück, denn der braungebrannte Plantagenbesitzer war weit weg und mehr ein Phantom als ein echter Partner an der Seite meiner Oma. Mein Großvater dagegen war real. Ein perfekter Gentleman, der bereit war, für die Frau seines Lebens zu kämpfen. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, meine Oma so lange zu umwerben, bis er sie überzeugt hatte, und wich ihr ab da nicht mehr von der Seite. Selbst der Zweite Weltkrieg konnte seiner privaten Offensive nichts anhaben: Die Familienlegende besagt, dass er sich der Wehrpflicht entzog, indem er vor der Musterung Zigarre rauchte, Espresso trank und wie der Teufel mit dem Fahrrad fuhr, um wenig später mit bedenklichem Herzrasen vor dem Arzt zu sitzen. Seitdem hatte mein Opa jedenfalls einen amtlich diagnostizierten Herzfehler – mit dem er 99 Jahre lang bei bester Gesundheit lebte.
Umwerben, für jemanden kämpfen, jemandem nicht mehr von der Seite weichen. Schon allein diese Verben! Nicht nur, dass sie heute völlig aus der Zeit gefallen klingen. Man tut diese Dinge auch einfach gar nicht mehr. Damals warteten Paare, getrennt durch Kriege oder die Suche nach Arbeit, manchmal Monate, nicht selten Jahre aufeinander. »Ich werde auf dich warten«, schnürt heute noch jedem die Brust im Kinosessel zusammen. Weil es diesen Glauben an das Absolute damals anscheinend noch gab. Vielleicht gehörten meine Großeltern einer immer weiter verblassenden Zeit an. Mein Opa warb und wartete. Nach zwei Jahren ließ meine Oma sich von Herrn B. scheiden, um zu ihrer neuen Liebe zu stehen. Der Moment, in dem er sie und ihr Herz gewonnen hatte, inmitten des Zweiten Weltkriegs, blieb für meinen Opa wohl das Wertvollste, was er besaß.
Bald siebzig Jahre waren sie verheiratet und haben in der Zeit nicht viele Tage ohne einander verbracht (ich habe den einen tatsächlich nie ohne den anderen gesehen – nur einmal, als ich mit meiner Oma allein im Skiurlaub war) und haben sich in all der Zeit im Grunde auch kein einziges Mal ernsthaft gestritten. Angeblich. Nur einmal, als meine vergnügte Oma aus dem feinen Restaurant, in das sie manchmal gingen, einen Aschenbecher mitgehen ließ. Da hat sich mein akkurater westfälischer Großvater fürchterlich aufgeregt und darauf bestanden, dass sie ihn zurückbrachte. Aber das war eine derartige Ausnahme, dass meine Mutter sie mir heute immer noch als unglaubliche Anekdote erzählt.
Was mich an den beiden immer fasziniert hat, ist die Tatsache, dass ihnen selbst nach siebzig Jahren Ehe nie die Themen ausgegangen sind. Manchmal saßen sie da und wanderten gemeinsam in Gedanken ihre Reisen nach, die sie in den vergangenen vierzig Jahren quer über den Globus gemacht hatten. Mit dem Kreuzfahrtschiff in die Karibik, nach Spanien oder ganz zu Anfang mit den beiden Töchtern im Käfer nach Italien. In den Dutzenden von Fotoalben, voller Sorgfalt angelegt, sieht man den Käfer mit Münsteraner Kennzeichen 1959 am Gotthardpass. Meine Großmutter mit Sonnenbrille, im Hintergrund schimmern die Hügel weiß. Auf den Fotos rennen meine Mutter und ihre Zwillingsschwester durch den Schnee und werfen Schneebälle, in Blusen zu gebräunter Haut, gerade noch hatten die vier unter Mailands Glasarkaden Espresso getrunken. Meine Oma trägt auf den Fotos gestreifte Röcke und ihr Kopftuch in Grace-Kelly-Manier, mein Opa sieht in seinem leichten, hellen Leinenanzug neben den schicken Italienern mitnichten aus wie ein kleinkarierter Deutscher.
Diese alten Fotos vermochten mir als Enkelin eine Ahnung davon zu geben, mit welcher Herzenslust die beiden in den Urlaub fuhren. Als seien es kleine Fluchten, um sich endlich einmal ungeniert in Schale werfen zu können. Zwar taten sie das in Münster auch, doch wirkte ihr Glamour in den Metropolen viel natürlicher. Auf ihren Kreuzfahrten, Jahrzehnte bevor man auf Aidas in Jeans zum Dinner gehen konnte, liebten sie es, ihre Abendgarderobe auszuführen, den Smoking und das Cocktailkleid mit Perlenkette. Ein gerahmtes Foto der beiden in ihren frühen Achtzigern, strahlend und die Wangen rot vom Tanzen und Champagner, habe ich immer bewundert. Sollte ich jemals ein Kreuzfahrtschiff betreten, dann ausschließlich ihnen zu Ehren!
Tatsächlich habe ich meinen Großvater nie in Jeans, Shorts, in Hausschlappen oder einem normalen Pullover gesehen. Ich hatte immer den Eindruck, der Anzug war für ihn mehr als eine Uniform aus seinen Berufsjahren. Er zog ihn an und schob sich das Einstecktuch in die Brusttasche, weil er sich darin gefiel – und weil er wusste, dass es meiner Oma gefiel. Später saßen seine Anzüge nicht mehr so gut wie früher. Sie waren ihm in den letzten Jahren ein wenig zu groß geworden, sein Körper wirkte zwischen den breiten Schultern der Jacke ganz zierlich.
Wozu also diese ganze Etikette? Mein Opa war fast hundert Jahre alt und hätte sich in Jogginghose so richtig entspannt auf dem Sofa ausstrecken können. Doch beide haben in ihrem Leben nie Freizeitkleidung besessen, und mein Großvater hat auch bis zum letzten Tag darauf verzichtet. Meine Oma konnte sich gerade noch mit einem eleganten »Hausanzug« anfreunden, ansonsten sah ich auch sie stets in Röcken zu Seidenblusen mit schönen, ständig wechselnden Ketten und Broschen.
Dass die beiden sich zu Hause anziehen wie andere fürs Restaurant, habe ich nie als oberflächliche Maskerade empfunden. Für sie war es ein Ausdruck gegenseitigen Respekts, sich jeden Tag aufs Neue für den anderen zu schmücken. Denn war nicht das alltägliche Zusammensein mit dem anderen an sich schon ein Fest? Mich hat diese Einstellung sehr geprägt. Schon als Kind habe ich mich stundenlang mit dem Modeschmuck behängt, den mein Opa seiner Frau mitgebracht hatte, kiloweise funkelnde, glitzernde, glänzende Schönheiten. Unvergesslich ist der Tag, als meine Oma der Krokotaschen, Ringe, Ketten und Ohrringe im Schrank überdrüssig wurde. Sie liebte ihren Schmuck und ihre Accessoires, doch darüber definieren würde sie sich nie. Und so kamen meine Mutter und meine Tante in den Genuss des Schmucks, der nun ausgedient hatte. Ganz nach einer weiteren Regel ihrer Beziehung: erst der Partner, dann die Kinder.
Man lebt eine schöne Beziehung, man sperrt sie nicht wie einen Pokal in die Vitrine. Das war stets die Maxime, nach der sie lebten. Mit dieser grandiosen Attitüde trug meine Oma ihre Pelzmäntel, benutzten die beiden ihr hauchdünnes chinesisches Porzellan, anstatt es im Schrank, wohl behütet, verstauben zu lassen. Die Tassen hatten zwar mit den Jahren viele sauber geklebte Sprünge, doch das störte niemanden, weil man ihre Geschichte liebte. Für ihre Freunde taten sie alles und waren umgeben von tollen, gutherzigen Menschen. Der Inbegriff von Spießigkeit war für meine Großeltern Menschen, die am Tisch beisammensaßen, um sich über andere aufzuregen und zu lästern, anstatt lebendig über Ausstellungen oder Außenpolitik zu diskutieren. Freunde von ihnen kamen aus Köln, andere aus England, ein enger Vertrauter meines Opas aus Amsterdam. Auf manchen Fotos ihrer frühen Feste sieht man meinen Opa lächelnd im Arm einer guten Freundin, meine Oma drückt derweil einem nach Hause eingeladenen Koch, der den Gästen das damalige Trendgericht Käsefondue zubereitete, einen Kuss auf.
Beim Anblick dieser Bilder habe ich mich immer gefragt, ob es in einer so offenen, weltläufigen Beziehung auch Eifersucht gab. Als Kind stellte ich mir meine Oma in meiner Phantasie immer vor wie eine Mischung aus Marlene Dietrich und Sophia Loren, die mit Karobluse und hochgekrempelten Ärmeln zwischen den Handwerkern, die im Haus waren und Pause machten, saß und sang. Und die jede Tanzfläche mit ausladenden Schritten und wallendem Rock stürmte. Meine Mutter war diejenige, die es irgendwann gewagt hat, meinen Großvater nach Treue und Eifersucht zu fragen, erntete aber nur mattes Augenrollen: »Treue ist doch selbstverständlich. Oder gar kein Thema, wenn du so willst. Man muss lockerlassen, nicht so klammern. Wir haben zum Beispiel immer viel und gern gefeiert. Da haben wir durchaus auch mit anderen geschäkert. Und am Ende des Abends gingen wir beide glücklich zusammen nach Hause. Wenn man dem anderen vertraut, gibt es keine Eifersucht.«
Etwas pathetischer als mein Großvater formuliert es der Psychologe Peter Lauster in seinem Bestseller Die Liebe. Psychologie eines Phänomens: »Klammere dich nicht an das, was du liebst: Sei frei und lasse das, was du liebst, in Freiheit.«[3] Diesen Satz werden 99 % von uns lesen und denken: Und wie genau soll das im Alltag aussehen?
Was ich früher nie nachvollziehen konnte, war, wenn mein Opa behauptete, dass er sich selbst dann freue, seine Irmel glücklich zu sehen, wenn er gar nicht dabei oder Auslöser ihrer guten Laune war, etwa bei den Skiurlauben, die meine Oma mit ihren Freundinnen verbrachte. Die lückenlose Dokumentation in den unzähligen, kiloschweren Fotoalben zeigt, wie meine Oma mit ihren Freundinnen und Urlaubsbekanntschaften in Sonnenliegen im Schnee entspannt, daneben die handgeschriebenen Zeilen: »So ein Tag, so wunderschön wie heute …« Ein besonderer Moment also, und das ohne meinen Opa! Sie bewerteten und verglichen nicht, was mehr Spaß machte, die Zeit mit oder ohne einander. Wenn meine Oma in Momenten glücklich war ohne ihn, bezog mein Opa das keine Sekunde auf sich und ihre Ehe. Eher im Gegenteil. Einmal sagte er: »Wer dem anderen nicht gönnen kann, dass er schöne Stunden allein verbringen kann, nimmt sich selbst viel zu wichtig.«
Das mag sicher stimmen. Und doch würden die meisten von uns bei so viel Spaß, den der Partner ohne uns hätte, irgendwann zuschnappen wie ein pawlowscher Hund. Wir wären irritiert, verletzt und eifersüchtig. Na, toll, mit mir lacht er nie so viel! Er braucht mich anscheinend nicht, denkt das gekränkte Ego. Mein Großvater aber sah es genau andersherum: Er freute sich über die hervorragende Laune seiner Frau, denn die würde, da war er ganz logisch denkender Kaufmann, dann ja auch wieder in die Beziehung fließen. Angst, dass meine Oma mit dem Skilehrer durchbrennen könnte, hatte er nicht. Die Freude, die sie ohne ihn hatte, und das ist entscheidend, empfand er in keiner Weise als Bedrohung für ihre Beziehung.
Und doch, mich hatte immer sehr interessiert, welche Rolle Treue für diese beiden Freigeister spielte und wie sie die bei aller Toleranz definierten. Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Beim Kuss? Denn den drückt meine Oma auf einem weiteren Foto ihrer vielen ausgelassenen Feste einem Mann auf den Mund, der definitiv nicht mein Großvater ist. Dass diese Szene 1960 anscheinend kein Auslöser für Streit gewesen ist, unterstreicht die Tatsache, dass die Fotos nicht in Omas Nachtschrank lagen, sondern ordentlich eingeklebt und für alle sichtbar in den legendären Fotoalben. Ich fand diese Bilder immer irritierend. Warum küsst meine Oma einen anderen Mann auf den Mund und dokumentiert das auch noch im Fotoalbum?
Würde ich meinen Mann eine andere Frau küssen lassen, während ich daneben säße? Wohl eher nicht. Mein Opa dagegen entspannte zur selben Zeit auf dem Sofa und unterhielt sich angeregt mit einer anderen Frau. Er lächelte, die Zigarette in der Hand, und war das Gegenteil des gehörnten Ehemanns, dem die Frau auf der Nase herumtanzt. Er wusste: Wir sind ein Team. Und ich will meinen Partner zu nichts zwingen, ihm nichts vorschreiben. Warum? Weil ich ihn liebe und ihm vertraue. In Sachen Toleranz spielten meine Großeltern definitiv in der Profiliga.
Ob sie sich in den Jahrzehnten ihrer Ehe nicht doch einmal in jemand anderen verliebt hatten? »Eigentlich nicht«, sagte meine Großmutter. »Und wenn es vorkam, dass sich ein Mann in mich verliebte, ich erinnere mich gerade an einen Arzt während meiner Kur, dann hat mir das vielleicht geschmeichelt, aber beeindruckt hat es mich eigentlich nie. Wir wussten immer, was wir aneinander haben.«
Mein Opa fügte schließlich einen Satz hinzu, den ich mir eingeprägt habe: »Das Wissen darum, was wir aneinander haben, und dem anderen Gewissheit darüber zu geben, ist sehr wichtig.«
Das Wort Treue haben meine Großeltern nie wirklich in den Mund genommen, und hätte ich die beiden gefragt, was sie von freier Liebe und offenen Beziehungen halten, hätte mein Großvater garantiert das Gesicht verzogen. Er war ein konservativer Liberaler, FDP-Wähler zu Zeiten von Politikern wie Hans-Dietrich Genscher und Hildegard Hamm-Brücher. Der Grund, warum sie sich so lange Zeit begehrten, war der Spaß, den sie miteinander hatten. Jenes Wissen darüber, was man am anderen hat, haben die beiden gefeiert, gestärkt, gepflegt. Das Ergebnis dieser Pflege begreife ich heute als den Schlüssel zu ihrer Beziehung: Es gab in ihrer Ehe kein drängelndes Ego, das Partnern in fast jeder Beziehung irgendwann wie ein Teufel im Nacken sitzt und raunt: »Die Welt ist voller toller Männer und Frauen. Was machst du hier seit Jahren? Geh raus und lass dir diese Freiheit nicht nehmen!« Eine Freiheit, die meine Großeltern schlau genutzt haben. Denn sie wollten frei sein. Aber gewiss nicht voneinander, sondern miteinander.
Sie haben es siebzig Jahre lang geschafft zu respektieren, dass der andere ein eigenständiger Mensch ist. Das bedeutete für die beiden natürlich nicht, dass mein Opa nächtelang in Kneipen unterwegs war und meine Oma immer allein in den Urlaub fuhr. Freiheit war bei meinen Großeltern eher eine Idee von gegenseitigem Respekt, die über allem stand. Sie benutzten auch nie das Wort Freiheit, sondern sprachen von Toleranz. »Toleranz ist immer das Wichtigste in unserer Ehe gewesen. Lass den anderen, wie er ist. Zerr’ nicht ewig an ihm herum, damit er sich ändert«, war der Rat meiner Oma. Dem anderen Raum zu lassen, war nichts, was man sich abringen musste, beide verstanden das als Selbstverständlichkeit.
Denn im Grunde ist es ja so: Ein Mensch ist bereit, sein Leben mit einem anderen zu verbringen. Da man nur ein Leben hat, ist das an sich schon die größte und schönste Geste, die man machen kann. Sein Leben zu teilen, war für meine Großeltern die Basis, auf der sie siebzig Jahre lang ihre Beziehung wachsen ließen. Meine Großmutter wusste, dass sie die große Liebe und Traumfrau meines Opas war. Umgekehrt wusste er, dass er ihr Fels in der Brandung war, auf den sie sich bis an ihr Lebensende verlassen konnte. Mit Mitte Neunzig, als meine Oma bereits begann, dement zu werden, bereitete und brachte mein Opa ihr jeden Tag das Frühstück. Und sie sagte ihm mehrmals in der Stunde, dass sie ihn liebe wie am ersten Tag. Mein Opa sagte: »Wir haben uns vorgenommen, bis ans Ende unseres Lebens zusammen zu sein. Sollte man es sich da nicht so lange wie möglich schön machen?«
Die fast beißend perfekte Harmonie zwischen den beiden, die mich so sehr an Spitzweg-Romantik erinnerte, verlagerte sich in den letzten Monaten ihres Lebens in ein Seniorenheim, in das sie gemeinsam zogen. Es funktionierte zu Hause einfach nicht mehr, weil es am Ende mein 99-jähriger Opa war, der sich um meine 99-jährige Großmutter kümmerte, nebenher noch Wäsche wusch und das Abendessen kochte. Auf der Station waren beide natürlich von Anfang an eine herzzerreißende Sensation in einem oft eher traurigen Heimalltag aus Tod und Einsamkeit. Sie wirkten wie der lebende Beweis dafür, dass es die Liebe, die ewige, noch gibt. Man konnte die verklärte Sehnsucht an den Blicken der jungen Pflegerinnen regelrecht ablesen. Nach genau so etwas suchten auch sie.
Auch hier saßen meine Großeltern jeden Tag beisammen, an einem kleinen Tisch in einem übersichtlichen Zimmer mit zwei Betten und einer Terrasse, redeten, hielten einander an den Händen. Sie versuchten, so zu tun, als sei alles beim Alten.
Mir tat dieser Anblick weh. Zwei Menschen, die auf ein bald hundertjähriges Leben zurückblicken konnten, die im Grunde nur noch sich hatten, da ihre Freunde und Geschwister schon lange gestorben waren. Nach über fünfzig Jahren in der geliebten Wohnung am Münsteraner Aasee, wo sie so viele Feste, Feiern und Geburtstage erlebt und genossen hatten, saßen sie nun in einem Zimmer, das sie nicht kannten, in einem Haus, mit dem sie nichts verbanden. Ohne die eigene Vergangenheit, ohne die Möbel, die Drucke und Ölbilder, von denen ich jedes aus dem Gedächtnis malen könnte. Der Busen meiner Oma, der unter ihren schicken Blusen durch den fünfziger Jahre Bullet-BH zeitlebens wie Zuckertüten hervorlugte, verschwand irgendwann mit dem Verlust von Gewicht nach und nach unter ihren beigen Hausanzügen. Für meinen Opa war sie dennoch die schönste Frau auf Erden. Doch plötzlich musste er sie teilen, vierundzwanzig Stunden mit wechselndem Personal, mit immer wieder neuen Gesichtern. Alles wurde mit einem Mal so fremd.
Ausgerechnet diese zwei im Heim! Diese siebzig Jahre lang vor Kraft strotzende, niemals kranke, feierfreudige Bastion der Leichtigkeit.
Meine andere Oma, eine langjährige Witwe, deren Mann nach seiner Kriegsrückkehr früh an einem Herzinfarkt gestorben war, liebte ich natürlich ebenfalls sehr. Doch es lag auch immer etwas Einsames in der Luft in ihrem Haus direkt am Wald, wenn wir sie besuchten. Ich hatte als Kind wahnsinnige, fast panische Angst vor dem Tod. Einfach für immer zu verschwinden, gruselte mich zutiefst. Bei meiner Oma am Wald musste ich oft an den Tod, an das Altwerden denken. Bei meinen Großeltern am Aasee hingegen kam ich vor lauter Ablenkung und Lebendigkeit gar nicht erst auf düstere Gedanken. Hier feierte man das Jetzt, und wenn mein Bruder und ich abends im Gästezimmer im Bett lagen und in der Ferne das Heulen der Krankenwagensirenen hörten, fühlte ich mich wie in einer richtigen Großstadt, in der etwas passierte.
Und dann ist es plötzlich mein fideler, kleiner, zäher Opa mit integriertem Hörgerät in der dicken Brille, der als Erster stirbt. Ganz schnell, nur wenige Wochen vor seinem 100





























