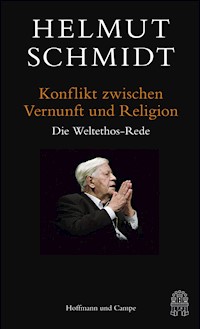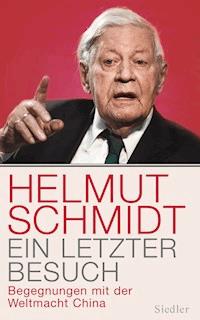
5,99 €
Mehr erfahren.
Helmut Schmidt hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er China für eine entscheidende Weltmacht des 21. Jahrhunderts hält. Warum gerade wir Deutschen vor dem Reich der Mitte nicht Angst, wohl aber Respekt haben sollten und was Europa von der viertausendjährigen chinesischen Kultur lernen kann – das sagt er in seinem neuen Buch mit der ihm eigenen Klarheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
HELMUT SCHMIDT
Ein letzter Besuch
BEGEGNUNGEN MIT DER
WELTMACHT CHINA
GESPRÄCH MIT LEE KUAN YEW
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Das Gespräch zwischen Helmut Schmidt und Lee Kuan Yew wurde im Mai 2012 im Shangri-La Hotel Singapur geführt. Moderation: Matthias Naß Redaktion: Thomas Karlauf
Das Nachwort von Matthias Naß erschien erstmals unter dem Titel »Vier Freunde« im ZEIT magazin vom 19. Juli 2012. Der Abdruck geschieht mit freundlicher Genehmigung durch DIE ZEIT, Hamburg.
Copyright © 2013 by Siedler Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
Karten und Grafiken: Peter Palm, Berlin
Reproduktionen: Aigner, Berlin
ISBN 978-3-641-10585-3V002
www.siedler-verlag.de
Inhalt
HELMUT SCHMIDT
Begegnungen mit der Weltmacht China
HELMUT SCHMIDT und LEE KUAN YEW
Gespräch im Mai 2012 in Singapur
MATTHIAS NASS
Vier Freunde
Helmut Schmidt, Henry Kissinger,George Shultz und Lee Kuan Yew
ANHANG
Dokumentation eines Gesprächs zwischen Helmut Schmidt und Deng Xiaoping im Mai 1990 in Peking
Zeittafel Chinesische Geschichte
Bildnachweis
HELMUT SCHMIDT
Begegnungen mit der Weltmacht China
Im Mai des Jahres 2012 bin ich – inzwischen 93 Jahre alt – ein letztes Mal nach Ostasien gereist. Das Motiv war, zwei alte Freunde noch einmal zu treffen, nämlich Lee Kuan Yew in Singapur und Zhu Rongji in Peking. Der eine hat als Ministerpräsident dreißig Jahre lang die Geschicke Singapurs bestimmt, der andere war als Ministerpräsident der Volksrepublik China Vorgänger von Wen Jiabao.
Ich habe Lee Kuan Yew im Laufe der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bei einem Besuch in Singapur kennengelernt. Daraus hat sich im Laufe der späten achtziger und neunziger Jahre durch Vermittlung des früheren amerikanischen Außenministers George Shultz eine Freundschaft entfaltet, die bis heute anhält. In meinem 1996 erschienenen Buch »Weggefährten« habe ich Lee Kuan Yew ein ausführliches Porträt gewidmet, in dem ich meine Bewunderung für seine Lebensleistung zum Ausdruck brachte.
Bei der Vorbereitung meiner Reise kam mir die Idee, die Gespräche mit Harry Lee aufzeichnen zu lassen und, falls sich die Mitschriften als substantiell erwiesen, anschließend ein kleines Buch zu veröffentlichen. Mein Freund war mit diesem Vorschlag einverstanden. Wir hatten uns in den vergangenen Jahren wiederholt über eine Reihe gemeinsamer, uns beide interessierender Themen unterhalten und dabei immer wieder festgestellt, dass wir trotz unterschiedlicher Perspektiven – Harry aus der Sicht eines vom Konfuzianismus geprägten Asiaten, ich aus europäischer Sicht – in vielen Punkten übereinstimmen und die Welt auf ähnliche Weise sehen.
Die Gespräche, die wir am 5., 6. und 7. Mai 2012 im Shangri-La Hotel in Singapur führten, wurden moderiert von meinem Freund Matthias Naß, der Lee seit fast zwanzig Jahren kennt und auch einige Interviews mit ihm geführt hat. Er sorgte dafür – wie ich in der anschließenden Pressekonferenz etwas flapsig bemerkte –, dass alle Fragen angeschnitten und keine gelöst wurde. In Wirklichkeit war der Wiederaufstieg der Weltmacht China das zentrale Thema, das uns am meisten beschäftigte und auf das wir immer wieder zurückkamen.
Dieses Buch setzt an vielen Stellen gemeinsames Wissen voraus, auch und gerade da, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Um dem Leser das Verständnis der Gespräche mit Lee Kuan Yew zu erleichtern, will ich in dieser Einleitung einige der Voraussetzungen benennen. Dabei greife ich auf Erfahrungen zurück, die ich mir in einem halben Jahrhundert intensiver Beschäftigung und auf mehr als einem Dutzend Reisen nach China und in den Fernen Osten erworben habe. Der im Anhang abgedruckte Text »Vier Freunde« von Matthias Naß stellt meine Freundschaft mit Harry Lee noch in einen ganz besonderen persönlichen Zusammenhang. Wenn wir uns treffen, sind nämlich zwei amerikanische Freunde im Geist mit dabei: George Shultz und Henry Kissinger.
Beide sollen an dieser Stelle deshalb auch kurz zu Wort kommen. Zunächst George Shultz, der in seinen 1993 erschienenen Erinnerungen »Turmoil and Triumph« schrieb, dass China mit Recht stolz sein könne auf seine jahrtausendealte Kultur. »Das chinesische Volk ist unendlich begabt. Auch unter dem Kommunismus hat es große Leistungen vollbracht. Je freier die Chinesen werden, desto großartiger werden sie ihre Fähigkeiten entfalten.« Ganz ähnlich urteilte Henry Kissinger in seinem jüngsten China-Buch: »Die zeitliche Dimension der Vergangenheit Chinas gestattet es den chinesischen Führern, den Mantel einer nahezu endlosen Geschichte zu benutzen, um ihr Gegenüber zu einer gewissen Bescheidenheit zu veranlassen.«
Schon in den sechziger Jahren habe ich geahnt, dass China wieder zu einer Weltmacht aufsteigen würde. Deshalb unternahm ich 1971 eine größere Reise nach Ostasien. Deutschland hatte damals keine diplomatischen Beziehungen mit China; deshalb musste ich als damaliger Bundesverteidigungsminister das Land von außen betrachten. Ich habe damals auf China mit japanischen, (süd)koreanischen, thailändischen und australischen Augen geschaut. Am Ende jener Reise stand für mich fest: China wird den Weg zurück zur Weltmacht finden.
Deshalb habe ich Bundeskanzler Willy Brandt gedrängt, diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China aufzunehmen. Dies fiel ihm nicht sonderlich schwer, weil gleichzeitig die Annäherung zwischen den USA und China in Gang kam. Deutschland und die Volksrepublik China haben 1972 diplomatische Beziehungen hergestellt, sieben Jahre vor den Vereinigten Staaten von Amerika.
Zu jener Zeit war der Kalte Krieg zwischen West und Ost noch in vollem Gange. Man verfolgte in Washington, in London oder Paris Willy Brandts Ostpolitik mit Skepsis, sogar mit Misstrauen. Die Zeitungen schrieben vom Weltkommunismus und unterstellten ein gleichgerichtetes Zusammenspiel zwischen Peking und Moskau. Man sprach von China als Rotchina und von Taiwan als von Formosa. Gleichzeitig liefen viele Studenten in den USA, in Paris, aber auch in Frankfurt und Berlin mit roten Fahnen und mit Mao-Buttons auf der Brust herum und schwärmten von Maos ekelhafter Kulturrevolution.
Als Bundeskanzler reiste ich zum ersten Mal im Oktober 1975 auf Einladung des Ministerpräsidenten Zhou Enlai nach Peking. Weil Zhou schon sehr krank war, wurde ich am Flughafen von seinem Stellvertreter Deng Xiaoping empfangen, den ich in den folgenden anderthalb Jahrzehnten noch zwei weitere Male zu ausführlichen Gesprächen getroffen habe. Das Straßenbild in Peking zur Zeit meines ersten Besuches habe ich nicht vergessen. Massen von Menschen waren auf unbeleuchteten Fahrrädern unterwegs, alle einheitlich in baumwollenen blauen, bisweilen auch grauen »Mao-Anzügen«, kaum jemals ein Auto. Bei dem Gespräch mit Mao Zedong, das etwa drei Stunden dauerte, saß Deng Xiaoping dabei, ohne ein einziges Wort zu sagen. Drei Jahre später habe ich begriffen, dass es Deng möglicherweise das Leben gekostet hätte, wenn er in seinem anschließenden langen Gespräch mit mir auch nur in einem oder zwei Punkten von der Linie Mao Zedongs abgewichen wäre.
Die schweren Fehler Mao Zedongs, der sogenannte »Große Sprung nach vorn«, auch seine Vergehen im Zuge der »Großen Proletarischen Kulturrevolution«, waren mir damals schon deutlich, auch seine menschliche Rücksichtslosigkeit, ja Brutalität. Zugleich besaß er offensichtlich eine sehr große Autorität. Mao hatte erkennbar einen Schlaganfall hinter sich, er hatte nicht mehr viel Lebenszeit vor sich. Im Westen der Welt fürchtete man, die sogenannte Viererbande würde Maos Erbe antreten. Tatsächlich ist es dann ganz anders gekommen.
Was mich damals schon faszinierte, war das Bewusstsein von der viertausendjährigen Geschichte der chinesischen Zivilisation und ihrer ungebrochenen Vitalität. Ganz im Gegensatz zu den untergegangenen Zivilisationen der alten Ägypter, der alten Perser, der alten Griechen, der Römer, der Mayas oder Inkas hat sich die chinesische Kultur über die Jahrtausende gehalten.
Anders als in den allermeisten anderen Hochkulturen der Weltgeschichte hatte es in China niemals eine das ganze Volk umfassende Religion gegeben. Zwar gab es buddhistische, später islamische und christliche Einflüsse, aber es kam fast nie zu religiös aufgeladenen Machtkämpfen. Der Konfuzianismus – ähnlich auch der Taoismus – war und ist keine Religion. Sondern im Kern ist er eine umfassende Ethik, die von der Familienethik über die Gesellschaftsethik bis zur Staats- und Herrschaftsethik reicht.
Ich hatte auch ein zweites Charakteristikum der chinesischen Geschichte begriffen: Kaum jemals hat ein chinesischer Kaiser mit Gewalt seine Macht territorial ausgedehnt. Militärische Eroberungen kamen in der chinesischen Geschichte nur sehr selten vor. Obwohl die Schiffe des Admirals Zheng He, die zu Beginn des 15. Jahrhunderts zu langen Expeditionen aufbrachen, zwanzigmal so groß waren wie einhundert Jahre später die Schiffe von Vasco da Gama oder Kolumbus, ist diese Flotte nicht zur Eroberung fremder Länder eingesetzt worden. Das Reich der Mitte – »Middle Kingdom« – war sich selbst genug. Auswärtige Mächte mussten ihre Unterwürfigkeit durch Kotau bezeugen, durch Tribute und Geschenke. Fremde Eroberer wie der Mongole Dschingis Khan oder die Mandschus, die sich selbst zum Kaiser machten, wurden ziemlich mühelos sinisiert und eingeschmolzen.
Bis ans Ende des europäischen Mittelalters ist China wissenschaftlich und technologisch den Europäern ihrer Zeit hoch überlegen gewesen. Die Chinesen konnten längst mit beweglichen Lettern Bücher drucken, sie konnten Stahl, Schießpulver, Kanonen und Granaten herstellen, sogar Raketen. Zugleich wurde das Land mit Hilfe des Konfuzianismus regiert. Der Weg in die Herrschaftsklasse und an die Spitzen der politischen Beamtenschaft führte über Bildung und Ausbildung, insbesondere über Kenntnisse der ererbten Literatur. Wer aufsteigen wollte, musste ein umfangreiches, höchst kompliziertes System von literarischen Prüfungen bestehen. Die persönliche Herkunft spielte keine entscheidende Rolle. Sozialer Aufstieg war in China immer möglich. Wohl aber spielten in Chinas Gesellschaft der Rang als Mandarin und der Respekt vor den Hierarchien von Mandarinen die entscheidende Rolle.
Mit dem Ende der Ming-Dynastie begann in der Mitte des 17. Jahrhunderts der allmähliche Niedergang der bisherigen kulturellen Hochphase. Entscheidend war der zunächst noch langsame außenpolitische Machtverfall. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts zwangen die europäischen Mächte China zur Öffnung seiner Hafenstädte. Sie errichteten eine Reihe von Quasi-Kolonien, in den Hafenstädten »Konzessionen« genannt. Am Ende des ersten Japanisch-Chinesischen Krieges 1894/95 verlor China die Insel Taiwan (damals noch portugiesisch Formosa genannt), es verlor auch seine Vorherrschaft über die Koreanische Halbinsel.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dankte der letzte Kaiser von China ab, die Japaner drangen nach Korea und später, in den dreißiger Jahren, in die chinesische Mandschurei vor. Sie eroberten auch Shanghai und Nanjing; gleichzeitig herrschte Bürgerkrieg zwischen den Truppen der Nationalpartei Kuomintang und der Roten Armee der Kommunisten. Der Bürgerkrieg endete mit der Ausrufung der Volksrepublik China im Oktober 1949 durch Mao Zedong.
*
Diese Grundlinien der chinesischen Geschichte waren mir bewusst, als ich mich am 31. Oktober 1975 auf den Weg zu Mao machte. Ich habe den Verlauf des Gesprächs mit ihm in meinem Buch »Menschen und Mächte« ausführlich geschildert und will hier nichts wiederholen. Betonen muss ich jedoch, dass mir bei jenem ersten Besuch die innere Situation und das ökonomische Potential des chinesischen Volkes nicht wirklich klar geworden sind. Mao und die sogenannte Viererbande beherrschten die öffentliche Meinung, sie beherrschten insbesondere die Medien und die Kommunistische Partei. Die Monotonie, mit der Maos Denken auf allen Ebenen nachgebetet wurde, war erdrückend. Sie provozierte geradezu die Frage, die ich mir stellte: Was denken die Menschen wirklich?
Diese Frage wurde dann wenigstens teilweise beantwortet durch den durchschlagenden Erfolg der evolutionären Entwicklungen, die Deng Xiaoping von 1978 an ins Werk setzte. Als ich sechs Jahre später ein zweites Mal nach China kam, erschien mir der von Deng eingeschlagene Weg der Reformen bereits als nicht mehr umkehrbar.
Schon damals, Mitte der achtziger Jahre, nannte ich Deng den »großen Motor, der China antreibt zu Realismus und Pragmatismus«. Auch wenn durchaus Zweifel an der Kontinuität des Reformprozesses angebracht waren, so gab es für mich doch keinerlei Zweifel an dem Reformwillen des Mannes an der Spitze, der sich mit Zhao Ziyang zudem einen sehr tüchtigen Pragmatiker zur Durchführung der Vorhaben geholt hatte.
Deng hat sich wenig um den ideologischen Überbau gekümmert. Er war ein begnadeter Pragmatiker mit einem untrüglichen Gespür für das Machbare und dem unbedingten Willen, das Machbare auch tatsächlich durchzusetzen. Die unmöglichen Herausforderungen überlassen wir anderen, lautete seine Linie; was möglich ist, packen wir sofort an. Sein Satz »Die Wahrheit ist in den Tatsachen zu suchen« stand als eine Art Leitmotiv über seinen Reformen. Wahrscheinlich hielt er an der Idee des Kommunismus vor allem deshalb fest, weil er mit seiner Hilfe soziale Gerechtigkeit herstellen wollte.
Ein Geniestreich war die Errichtung von Sonderwirtschaftszonen. Damit konnte er Schwerpunkte setzen an Orten, an denen die Reformen am ehesten auf fruchtbaren Boden fielen. Deng hat diese Zonen in Hafenstädten errichten lassen, weil dort der Anschluss an die Weltwirtschaft leichter zu bewerkstelligen war. Außerdem wohnten dort Familien, in denen die Handelstradition noch nicht ganz verschüttet war, Familien, die über Generationen Seehandel betrieben und auf Taiwan, in Hongkong oder in Singapur Verwandte und Bekannte hatten. Die Sonderwirtschaftszonen waren so klein und überschaubar, dass das Experiment jederzeit hätte abgebrochen werden können. Heute ist China fast zur Gänze eine einzige Sonderwirtschaftszone geworden.
Deng kümmerte sich im Wesentlichen um die Rahmenbedingungen. Er integrierte die verschiedenen Tendenzen innerhalb der Parteiführung und gab die großen Linien vor, die tatsächliche Umsetzung überließ er anderen, allen voran Zhao Ziyang. Der größte Unterschied zwischen Deng und Zhao bestand darin, dass Zhao wirtschaftliche und gleichzeitig einige politische Reformen durchführen wollte, was Deng für falsch hielt, weil es seiner Meinung nach im Chaos enden musste. Die Entwicklung in der Sowjetunion Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre, Gorbatschows gleichzeitige Einführung von Perestroika und Glasnost, hat ihm im Nachhinein recht gegeben.
Ich habe Zhao Ziyang bei meinem Besuch 1984 kennengelernt. Er besaß einen ähnlich beeindruckenden wirtschaftlichen Sachverstand wie später Zhu Rongji, einer seiner Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten; unter den damaligen Staats- und Regierungschefs der Welt fand man kaum einen, der über ökonomische Zusammenhänge so gut Bescheid wusste. Ob es um die Reform des Preissystems oder um die Geldpolitik der Zentralbank ging, um den Zustand der Weltwirtschaft oder um die Rohstoffprobleme der Entwicklungsländer: Über jedes Thema war Zhao bestens unterrichtet, seine Urteile waren begründet und ausgewogen.
Wie man denn die Leitungskader nach Jahrzehnten der Unselbständigkeit an größere Eigenverantwortung gewöhnen wolle, fragte ich ihn damals, und seine Antwort war verblüffend einfach. Entweder seien die Leiter der Betriebe fähig, aber die Strukturen verkrustet, dann würden die Strukturen geändert. Oder aber die Leiter der Betriebe seien nicht geeignet, dann würden eben andere Mitarbeiter in die Führungspositionen aufsteigen. Seine Aufgabe sehe er darin, die Fähigsten an die Spitze zu bringen.
Die ökonomische, die soziale und die politische Entwicklung Chinas hat im Juni 1989 durch die Tiananmen-Tragödie vorübergehend eine tiefgreifende Unterbrechung erfahren. Als die sogenannten Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens schließlich mit militärischen Mitteln niedergeschlagen wurden, haben die Medien und die öffentliche Meinung im Westen das Ereignis mit der Unterdrückung einer generellen Freiheitsbewegung gleichgesetzt.
Aber jugendlicher Protest ist zunächst allgemein ein Generationenkonflikt, ein Aufstand von Jungen gegen die Alten. Am Anfang waren junge Leute mit Zustimmung und Hilfe von Zhao Ziyang in Sonderzügen der Staatseisenbahn nach Peking gekommen. Zhao wollte – ähnlich wie in Russland Michail Gorbatschow – eine offenere Gesellschaft. Die Demonstrationen verliefen zunächst friedlich.
Dann jedoch kam es zum Staatsbesuch des russischen Präsidenten, der nur durch einen Hintereingang in die »Große Halle des Volkes« gelangen konnte. Dieser große Gesichtsverlust veranlasste die Parteiführung zum Eingreifen. Sie hatte jedoch keinerlei Bereitschaftspolizei zur Verfügung, sondern nur ihr Militär. Die Zahl der toten Zivilisten und Soldaten ist ungewiss (die im Westen genannten Zahlen sind übertrieben); dem Westen erschien das Vorgehen als Ausdruck des rücksichtslosen Machtstrebens der Kommunistischen Partei. Die Tiananmen-Tragödie war ohne Zweifel dem Willen zur unbedingten Wiederherstellung der kommunistischen Staatsmacht geschuldet. Sie hat zugleich die Autorität von Deng Xiaoping unterhöhlt.
Als ich im Mai 1990, ein Jahr nach Tiananmen, Deng zu einem dritten und letzten langen Gespräch besuchte, stimmte er mir zu, als ich sagte, China habe einen großen Prestigeverlust erlitten. Zugleich erklärte er: »Wir müssen die unsere Schlüsse daraus ziehen. Die Ursache hat in der Partei gelegen, sogar bei hohen Vertretern in der Parteiführung.« Er hat die Schuld nicht anderen in die Schuhe geschoben, sondern eingeräumt, dass er die Parteispitze nicht im Griff hatte. Er gab auch zu, dass man die junge Generation vernachlässigt habe. Allerdings warnte er davor, die Bedeutung der Ereignisse zu überschätzen, die »Politik der vier Modernisierungen« sei nicht beeinträchtigt worden (mein Gespräch mit Deng ist im Anhang dieses Buches dokumentiert).
1992 hat Deng mit seiner legendären fünfwöchigen Propagandareise durch den Süden des Landes seine Autorität wiederherstellen können. Nunmehr hielt er wieder alle Fäden in der Hand. Heute weiß man, Deng Xiaoping war nicht nur der erfolgreichste kommunistische Führer, sondern in meinen Augen auch einer der erfolgreichsten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts überhaupt – Erfolg definiert als die Veränderung des eigenen Landes zum Guten.
*
Wenn man sich die innerlich und äußerlich zerrissene Situation Chinas während fast der gesamten ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor Augen führt, wenn man sich zusätzlich die Ära Mao Zedongs mit ihren zig Millionen Hungertoten und den ungezählten Opfern der so genannten Kulturrevolution vor Augen hält, dann grenzt der ökonomische Wiederaufstieg des Landes an ein Wunder. Niemand im Westen hat noch zu Zeiten von Tiananmen einen solchen Aufstieg vorausgesehen.
Zwar hatten die Vereinten Nationen 1971 die Volksrepublik China als alleinige rechtmäßige Vertretung Chinas anerkannt und die taiwanesische Regierung in Taipeh gezwungen, den ständigen Sitz im Sicherheitsrat an Peking abzutreten. Zwar haben die Amerikaner die Volksrepublik China 1979 anerkannt (bei gleichzeitiger Bewahrung des Sonderstatus von Taipeh). Viel wichtiger für die Bedeutung des Landes ist jedoch der Umstand, dass China heute eine ökonomische Weltmacht ist, deren Währungsreserven sich auf über 3000 Milliarden Dollar belaufen – was in der Weltgeschichte ohne Beispiel ist.
Friede und Stabilität in Ostasien werden heute vom Machtgleichgewicht zwischen Amerika und China aufrechterhalten. In Ost- und Südostasien breiten sich Sorgen vor China aus. Der Streit um mehrere kleine Inselgruppen trägt in ähnlicher Weise zur Beunruhigung bei wie vor Jahren der Streit um Taiwan. Dazu kommt sowohl in Japan als auch in China ein Wiederauferstehen nationalistischer Tendenzen. Dabei ist der ökonomisch absolut erfolglose Staat Nordkorea, auf den die Chinesen herabblicken, zugleich Chinas Schutzwall gegen Japan, vor allem aber gegen die amerikanische Präsenz auf dem asiatischen Festland; Peking fürchtet, dass der Einfluss Washingtons im Falle einer Wiedervereinigung Koreas bis an die Grenze zu China reichen würde.
Neben diesen für China mit hohem Prestige verbundenen außenpolitischen Fragen darf allerdings nicht übersehen werden, dass die eigentlichen Probleme des Landes im Innern liegen. Die Bevölkerungszahl steigt weiter, wenn auch nicht ganz so schnell wie in großen Teilen Asiens. Aber noch vor der Mitte des 21. Jahrhunderts wird China 1,5 Milliarden Menschen zählen, und die Mehrheit von ihnen wird auch dann wahrscheinlich noch in ländlichen Verhältnissen leben. Das Bevölkerungswachstum wird sich also trotz der von Mao eingeleiteten Ein-Kind-Politik fortsetzen. Weil die produktiven Jahrgänge aufgrund der Ein-Kind-Politik ausgedünnt sind, ergeben sich große Schwierigkeiten beim Aufbau einer umfassenden nationalen Altersversorgung.
Ein zweites großes Problem betrifft die enormen Unterschiede im Lebensstandard, die sich im Laufe der letzten 25 Jahre zwischen den Küstenprovinzen und dem Landesinneren, insbesondere in Zentralchina, Tibet und Xinjiang, herausgebildet haben. Die Spannungen zwischen Arm und Reich sind unübersehbar. Weite Teile des Landes leiden unter mangelnder Infrastruktur, es fehlt dort noch immer an Eisenbahnen und Autostraßen. Weil die Menschen in ihren Dörfern nicht mehr gebraucht werden, zieht es sie in die aufstrebenden Provinzen entlang der Küste, wo sie Arbeit zu finden hoffen.
Heute gibt es zwischen hundert und zweihundert Millionen so genannte Wanderarbeiter – die Schätzungen schwanken. Diese Wanderarbeiter kommen bestenfalls bei Verwandten unter, ansonsten schlafen sie auf den Baustellen. Sie werden ausgebeutet, haben kaum Rechtsschutz und keine Alterssicherung. Das sorgt für erhebliche soziale Spannungen, und das Problem ist der chinesischen Führung voll bewusst.
Auf der anderen Seite sind diese Wanderarbeiter nicht nur eine große Belastung für die Städte, sondern in ihnen stecken auch enorme Reserven für China. Es muss das Ziel der chinesischen Führung sein, die in der Landwirtschaft überflüssig gewordenen Arbeitskräfte in andere Beschäftigungen zu bringen. Die Entstehung von riesenhaften Großstädten (vier Städte von jeweils 40 Millionen sind geplant!) schafft zusätzliche psychologische Probleme, die sich aus den Bedingungen einer Massengesellschaft ergeben.
Mit der Industrialisierung Chinas sind zwei weitere Probleme entstanden. Zum einen ist China in hohem Maße angewiesen auf den Import von Rohstoffen, insbesondere auch von Öl und Gas. Zum anderen sind die Umweltprobleme – man denke an den ewigen Smog über Peking und anderen Städten – ungelöst.
Die sozialen Konflikte, die sich aus den hier skizzierten Entwicklungen ergeben, könnten die ökonomische Stabilität Chinas durchaus gefährden. Insgesamt scheint mir die innenpolitische Situation des Landes jedoch erstaunlich stabil. Die vielen tausend Demonstrationen, die es in China Jahr für Jahr gibt und die von der Regierung auch publizistisch nicht unterdrückt werden, richten sich gegen lokale Missstände, sie richten sich nicht gegen das Regime der Kommunistischen Partei.
Dabei erweist sich die kommunistische Ideologie als weitestgehend unbrauchbar für die Lösung der realen Probleme. Hier ist ein ideologisches Vakuum entstanden. Deswegen scheint es mir zunehmend wahrscheinlicher, dass die chinesische Führung auf Prinzipien des Konfuzianismus zurückgreifen wird – angepasst an die Erfordernisse des heutigen China.
Gleichwohl wird die Kommunistische Partei alles tun, ihre unumschränkte Herrschaft aufrechtzuerhalten. Dieses System der Einparteienherrschaft ist vielen Amerikanern und Europäern zutiefst suspekt, es widerspricht den politischen Traditionen des Westens. Im Lichte der chinesischen Geschichte aber erscheint mir die politische Stabilität, die dieses System gewährleistet, als zweckmäßig, ja wohltuend – sowohl für das chinesische Volk als auch für seine Nachbarn.
Im Zuge der marktwirtschaftlichen Neuerungen wird sich die autoritäre politische Struktur zweifellos wandeln. Deutliche Zeichen eines sich allmählich entwickelnden Rechtsstaates sind bereits erkennbar. Man muss der weiteren Entfaltung jedoch Zeit lassen. Jeder Versuch, von außen einzugreifen und den Prozess zu beschleunigen, könnte großes Unheil auslösen.
*
Was hat der Westen in näherer Zukunft von China zu erwarten? Auch wenn sich der wirtschaftliche Aufschwung verlangsamen wird, dürfte China weiterhin ein überdurchschnittliches wirtschaftliches Wachstum verzeichnen, ein schnelleres Wachstum jedenfalls, als es irgendein Land in Europa oder Nordamerika erreichen kann. Der durchschnittliche Lebensstandard wird steigen. Dennoch wird China noch einige Jahrzehnte auf dem Niveau eines Schwellenlandes bleiben.
Einerseits werden wir uns darauf einstellen müssen, dass in den Naturwissenschaften und im Bereich der neuen Technologien die Chinesen schnell aufrücken werden. Andererseits soll man die Bedeutung des chinesischen Marktes nicht überschätzen. Nicht alle 1,3 Milliarden Chinesen werden sich morgen ein in Europa oder nach europäischen Maßstäben gefertigtes Auto kaufen können. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Mehrheit der heute lebenden Chinesen im Laufe ihres Lebens sich überhaupt kein Auto wird leisten können.
Außenpolitisch wird China vorsichtig bleiben und keinem Konflikt mit einer anderen Weltmacht Vorschub leisten oder dazu Anlass bieten. Im Hintergrund steht dabei die zweitausend Jahre alte Tradition, sich als ein großes Reich zu betrachten, das Expansion und Eroberung nicht nötig hat. Zugleich wird Peking darauf drängen, dass China respektiert wird, und insbesondere auf dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen beharren. Etwaige Provokationen wird man gelassen abwehren.
Wenn man die militärische Verteidigung oder die Militäretats Chinas und der Vereinigten Staaten überhaupt vergleichen kann – was sehr schwierig ist, weil Bezugsgrößen wie Kaufkraft oder Immobilienpreise nicht standhalten –, dann ist der chinesische Rüstungsetat ungefähr bei einem Fünftel oder einem Sechstel des amerikanischen, wobei ich die Kosten für den Einsatz in Irak und Afghanistan nicht einrechne.
Wie soll sich der Westen mit Blick auf China verhalten, wie soll er auf die Herausforderung reagieren? Drei Punkte sind aus meiner Sicht für ein friedliches und kooperatives Nebeneinander unabdingbar. Erstens: Verzicht auf westliche Überheblichkeit, stattdessen Respekt gegenüber der ältesten Kulturnation der Welt. Zweitens: Volle Einbeziehung Chinas als gleichberechtigter Partner in alle multinationalen Organisationen, in denen globale Fragen – Wirtschaft, Finanzen, Klima, Abrüstung – verhandelt werden. Drittens: Keine Widerstände gegen die zu erwartende Annäherung Taiwans an die Volksrepublik China und die daraus sich ergebende friedliche Wiedervereinigung.
Vor allem müssen die westlichen Politiker begreifen, dass harter Wettbewerb und politische Zusammenarbeit sich keineswegs gegenseitig ausschließen. Ich erinnere an das Beispiel Japans. 1868 erlebte das bis dahin von der Welt abgeschottete Japan die Meiji-Restauration. Die Öffnung des Landes für die westliche Welt führte dazu, dass Japan 1914, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, industriell und militärisch auf gleicher Höhe mit dem Westen war. Trotz dieses neuen Konkurrenten haben die Europäer ihren Lebensstandard heben und zugleich den Sozialstaat begründen können. Das heißt, der Aufstieg Japans zu einer wirtschaftlichen Weltmacht hat uns nicht geschadet. Auch der Wiederaufstieg Japans nach dem Zweiten Weltkrieg hat uns nicht geschadet, genauso wenig wie der Aufstieg Südkoreas, Taiwans, Hongkongs oder Singapurs.
Dass ein ökonomisch bisher unwichtiges Land plötzlich zum erfolgreichen Wettbewerber wird, haben wir also schon öfters erlebt. Der Westen kann den weiteren ökonomischen und technologischen Aufstieg Chinas nicht verhindern, schon gar nicht, indem er sich der politischen Zusammenarbeit verweigert oder politischen Druck auszuüben versucht.
Als Europäer möchte ich auf die Errungenschaften der europäischen und nordamerikanischen Aufklärung nicht verzichten. Aber ich sehe, dass andere Nationen ohne diese Tradition nicht nur lebensfähig sind, sondern auch glänzende ökonomische Fortschritte erzielen, welche gegenwärtig unsere ökonomischen Fortschritte übertreffen. Daraus ergibt sich für mich als Konsequenz, dass die Europäer wieder verstärkt forschen und lernen müssen. Vieles von dem, was Europäer heute an technologischen Spitzenleistungen hervorbringen, werden die Chinesen bald ebenso herstellen können – und darüber hinaus billiger.