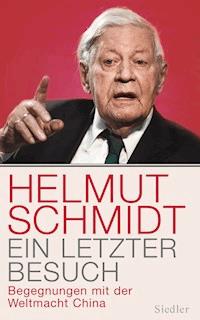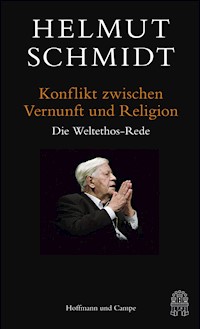2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Helmut Schmidts sehr persönliche Erinnerungen an seine Kanzlerjahre
Helmut Schmidt blickt wenige Jahre nach dem Ende seiner Amtszeit auf seine Kanzlerjahre zurück. Er knüpft seine Beobachtungen und Betrachtungen an konkrete Begegnungen – Gespräche hinter den Mauern des Kreml, Treffen im Palast des Himmlischen Friedens, Auseinandersetzungen im Oval Office des Weißen Hauses.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorrede
Dieses Buch enthält Erinnerungen und Bewertungen aus dem Umgang mit den drei überragenden Weltmächten Sowjetunion, USA und China. Es ist kein Versuch zu einer Autobiographie, denn politische Selbstbespiegelungen sind mir immer suspekt gewesen. Ihrer Natur nach stellen sie eine Verführung für den Autor dar, sich selbst fehlerlos zu sehen oder sich doch jedenfalls in besserem Lichte erscheinen zu lassen, als es dem späteren Urteil der Geschichte entsprechen kann. Allerdings haben mich Erinnerungen von Politikern wie Künstlern häufig sehr interessiert, sie haben mich zum Denken, zur kritischen Überprüfung, zur Ergänzung oder Korrektur meiner bis dahin gewonnenen Urteile angeregt.
In den nachfolgenden drei Hauptstücken schildere ich persönliche Eindrücke von Russen, Amerikanern und Chinesen und besonders meine Erfahrungen mit ihren Staatsmännern. Ich versuche, sowohl ihre als auch meine Sicht solcher Probleme darzustellen, die mein Land oder auch mich betrafen und zum Teil noch heute betreffen. Dabei sind in einigen wenigen Fällen Wiederholungen oder eine abermalige Behandlung des Themas unvermeidlich, weil der Gegenstand etwa in Washington und Moskau von gleicher Bedeutung war.
Vor allem während der Jahre meiner Zugehörigkeit zur Bundesregierung habe ich ein faszinierendes Kaleidoskop menschlicher und politischer Begegnungen erlebt: mit Staatsoberhäuptern, Regierungschefs und Ministern, mit Künstlern und Wissenschaftlern, aber auch mit Menschen, die nie im Rampenlicht gestanden haben. Es wird oft von der Einsamkeit führender Politiker oder Staatslenker geschrieben. Das Wort gibt aber nur die halbe Wahrheit wieder; denn tatsächlich habe ich in meinen Regierungsjahren viel Freundschaft erfahren, und noch häufiger habe ich ernsthafte Partnerschaft erlebt.
Gegenwärtig vollziehen sich in allen drei Weltmächten große, zum Teil erschütternde Umbrüche. Sie rechtfertigen den Versuch, aus der Sicht deutscher Interessen jene Epochen darzustellen und zu bewerten, die Mitte der achtziger Jahre in Moskau, in Washington und in Beijing an ihr Ende gelangt sind oder zu Ende gehen werden. Es ist durchaus ungewiß, ob die Veränderungen im Inneren der drei Weltmächte tatsächlich auch wesentliche Veränderungen der Welt bringen werden. Die Aussichten auf einen dauerhaft umprägenden Erfolg Gorbatschows erscheinen mir bisher noch ungewiß. Die Aussichten auf vertragliche Rüstungsbegrenzung und vereinbartes Gleichgewicht zwischen Moskau und Washington stehen unter dem deutlichen Vorbehalt des Machtverfalls Reagans und des in kurzer Frist bevorstehenden Endes seines Amtes. Sein Nachfolger wird schwerlich ein welterfahrener Stratege sein; er wird neben unbewältigten außenpolitischen Aufgaben vor allem diejenigen Probleme übernehmen müssen, welche sich aus der ungeheuren Auslandsverschuldung der USA ergeben.
In Beijing wird die Autorität Deng Xiaopings angesichts seines hohen Lebensalters nicht mehr lange für Stetigkeit des Reformkurses sorgen können. Nicht der ökonomische Riese Japan, sondern die weltwirtschaftlich einstweilen ziemlich unbedeutende Volksrepublik China wird weltpolitisch immer stärker ins Gewicht fallen – aber ihr zukünftiger Kurs ist nicht eindeutig zu erkennen. Wer die Chancen der Zukunft abschätzen will, der muß die Faktoren kennen, welche die Gegenwart bestimmen; ob und wieweit sie in die Zukunft hineinwirken, kann er freilich nur ahnen.
Ich beanspruche nicht, eine Art selbsterlebter Weltgeschichte meiner Zeit zu liefern. Vielmehr möchte ich etwas von dem weitergeben, was ich von ausländischen Gesprächspartnern gelernt oder verstanden zu haben glaube. Ich stütze mich dabei nicht auf amtliche Akten oder auf (inzwischen geöffnete) Archive, auch nicht auf Publikationen meiner Gesprächspartner. Ich bin kein Historiker. Die hier geschilderten Dialoge und Analysen beruhen auf erhalten gebliebenen eigenen Notizen. Sie wollen kein objektives Geschichtsbild ausbreiten, sondern vielmehr die Eindrücke, von denen ich ausging oder glaubte ausgehen zu sollen, und ebenso die Eindrücke und Urteile, zu denen ich gelangte.
Meine Subjektivität zu verleugnen oder meine deutsche und meine sozialdemokratische Identität zu verdrängen, wäre unnatürlich. Dies ist der persönlich bestimmte Bericht eines Mannes, der am Ende des Ersten Weltkrieges geboren wurde, der als Jugendlicher – seines Elternhauses wegen – kein Nazi geworden ist, der gleichwohl als wehrpflichtiger Soldat im Zweiten Weltkrieg glaubte, übergeordnete patriotische Pflichten erfüllen zu müssen. Dies Buch gibt Einsichten und Erfahrungen eines Mannes wieder, der als Kriegsgefangener, sechsundzwanzig Jahre alt, dank des hilfreichen Einflusses sehr viel älterer Kameraden zum Sozialdemokraten wurde und relativ spät im Leben – dank der westlichen Alliierten, vor allem Englands und Amerikas – erstmals selbst Demokratie erlebte.
Von Kants kategorischem Imperativ und von Marc Aurels Selbstbetrachtungen bin ich stärker geprägt worden als von Lassalle, Engels oder Marx; am stärksten aber formten mich ältere sozialdemokratische Zeitgenossen und Freunde. Die welterfahrenen Bürgermeister Max Brauer, Wilhelm Kaisen, Ernst Reuter und Herbert Weichmann und die Führer der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion Fritz Erler, Carlo Schmid und Herbert Wehner haben mich außenpolitisch erzogen; und was ich ökonomisch gelernt habe, verdanke ich zuallermeist Heinrich Deist, Karl Klasen, Alex Möller und Karl Schiller. Allerdings, muß ich hinzufügen, haben manche Frauen und Männer in den Führungen von Unternehmen und Gewerkschaften, in Wissenschaft und Publizistik, unter den Beamten und Soldaten sowie in den anderen Bundestagsfraktionen meiner Zeit – CDU, CSU und FDP – Einfluß auf mein Urteil und mein Handeln gehabt.
Ausländische Vorbilder und Beispiele haben mich ebenfalls stark beeinflußt. Ich habe die internationale Szenerie in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre als junger und unbedeutender Abgeordneter betreten – meiner hamburgischen Umwelt entsprechend als ein Anglophiler. Ende der fünfziger Jahre wurde mir dann immer deutlicher, wie eng unser Schicksal mit dem der Vereinigten Staaten verzahnt ist. In den sechziger Jahren habe ich die deutsch-französische Freundschaft als unerläßliche Vorbedingung einer europäischen Friedensordnung erkannt. Diese Friedensordnung ist mir in all den Jahren als das Wichtigste erschienen.
Die Geschichte des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung hat es so gefügt, daß das deutsche Volk sich im geographischen Zentrum Europas entwickelt hat. Anders als viele der anderen Völker Europas lebt es weder auf einer Insel oder Halbinsel noch hinter natürlichen Barrieren, sondern in einem offenen, flachen Land, das vergleichsweise dicht besiedelt ist. Wir Deutschen haben mehr fremde Völker zu Nachbarn als irgendein anderes Volk in Europa. Auf der ganzen Welt werden höchstens Rußland und China von ähnlich vielen Nachbarn umgeben; aber Rußland und China sind Riesenreiche. Deutschland hingegen ist klein, und die deutsche Nation ist heute als Folge von Hitlers total geführtem und total verlorenem Kriege geteilt. Auschwitz und Holocaust werden im Bewußtsein unserer Nachbarn noch sehr lange ihre Schatten werfen – auf alles, was die nachgeborenen Deutschen unternehmen.
Ich war immer von dem natürlichen Recht jedes Volkes auf Selbstbestimmung überzeugt. Wenn je im Laufe des nächsten Jahrhunderts wir Deutschen wieder zueinanderfinden sollten, so wird dies allerdings nicht gegen den Willen unserer Nachbarn geschehen können, nicht ohne deren Vertrauen in den verläßlichen Willen und in die stetige Fähigkeit der Deutschen zu friedlicher Nachbarschaft.
Wenn Deutsche und Russen von guter, vertrauensvoller Nachbarschaft noch eine ziemliche Wegstrecke entfernt sind, so trifft nicht uns allein die Schuld. Viele Völker Europas, nicht nur wir Deutschen, fühlen sich von der sowjetischen Besetzung der östlichen Hälfte Europas bedroht – das gilt zumal für die osteuropäischen Völker. Das expansive Sicherheitsstreben der Sowjetunion wie auch ihr Streben nach internationaler Ausbreitung der kommunistischen Ideologie hat Unsicherheit und latente Bedrohung geschaffen; aus dieser Situation erwuchs die atlantische Allianz Westeuropas mit Nordamerika. Umgekehrt sehen sich manche Russen ebenfalls bedroht – zu Unrecht, jedenfalls soweit sie Deutschland als mögliche Gefahrenquelle ansehen. Dennoch verstehe ich die Sowjetrussen durchaus, denn sie haben in Hitlers Krieg zwanzig Millionen Menschen verloren. Die Völker der Sowjetunion wünschen sich den Frieden genauso wie wir; diesen Wunsch teilen auch ihre kommunistischen Führer.
Wir Deutschen brauchen, jener latenten Bedrohung wegen, das Bündnis mit anderen demokratisch geordneten Staaten, mit den Vereinigten Staaten von Amerika und mit unseren westeuropäischen Freunden. Zugleich aber müssen wir um gute Nachbarschaft mit den Sowjets, mit den Polen und den anderen Anrainern in der östlichen Hälfte des Kontinents bemüht sein. Diese doppelte Aufgabe ist ungeheuer schwierig. Sie unbeirrbar zu verfolgen, weckt von Zeit zu Zeit Argwohn gegen uns Deutsche – mal im Osten, mal im Westen. Auch davon wird in diesem Buche zu berichten sein.
Seit Beginn der siebziger Jahre ist die Bundesrepublik nicht länger mehr ein politischer Zwerg. Unser Sechzig-Millionen-Staat hat nicht nur eine der großen, der leistungsfähigsten Volkswirtschaften der Welt entwickelt, er hat in den siebziger Jahren auch gelernt, eine seinem Gewicht und seiner geographischen und geschichtlichen Situation entsprechende politische Rolle in der Welt zu spielen. Dies war kein einfacher Prozeß. Viele Staatslenker, auch außerhalb unserer unmittelbaren geographischen Nachbarschaft, haben dabei geholfen – wie sie umgekehrt auch unsere Hilfe in Anspruch genommen haben.
Ich habe mir in über drei Jahrzehnten parlamentarisch-politischer Arbeit – in mehr als acht Kanzlerjahren, in dreizehn Jahren der Zugehörigkeit zur Bundesregierung und auch seither – immer Mühe gegeben, zur Verständigung zwischen den Völkern beizutragen. Die Aufgabe bleibt riesenhaft und stellt sich für jede Generation erneut. Denn der Frieden wird nicht ein für allemal hergestellt, er muß vielmehr immer wieder neu gestiftet werden. Ihm in meiner Generation zu dienen, habe ich als meine wichtigste Pflicht angesehen. Ich weiß: meine Gesprächspartner jenseits der Grenzen sahen ihre Aufgabe nicht viel anders. Dennoch führen Interessenkonflikte, Fehlinterpretationen eigener und fremder Interessen, aber auch innenpolitische Zwänge immer wieder zu gefährlicher Zuspitzung. Deshalb ist es nötig, die Interessen, die Ängste und die Hoffnungen der anderen Völker und ihrer Regierungen zu erkennen. Wer von Feindbildern ausgeht, der kann den Frieden nicht stiften. Wer mit den anderen nicht redet und wer ihnen nicht zuhört, der kann sie nicht verstehen. Dies Buch ist vor allem ein Ergebnis des Gesprächs mit den Staatsmännern der Weltmächte. Ich bin ihnen dankbar.
Außerdem liegt mir am Herzen, für Anregungen und Kritik meinen Dank denjenigen auszusprechen, die mir bei der Korrektur des Manuskriptes geholfen haben, nämlich Kurt Becker, Willi Berkhan, Klaus Bölling, Gerd Bucerius, Jens Fischer, Manfred Lahnstein, Ruth Loah, Hans Matthöfer, Lothar Rühl, Eugen Selbmann, Manfred Schüler, Horst Schulmann, Walter Stützle und meiner Frau. Nicht alle Kritik habe ich aufgenommen; die Verantwortung für Fehler und Mängel in Erinnerung und Urteil fällt allein auf mich.
Ich habe das Manuskript 1984 begonnen und habe es – anderer laufender Arbeiten wegen – erst jetzt abschließen können. Ich hoffe, noch Zeit genug zu haben, in einem weiteren Band meine Eindrücke im Umgang mit den Staaten Europas und seinen Staatslenkern vorzulegen, vor allem mit dem Blick auf Frankreich und auf Europa als Ganzes.
Hamburg, im April 1987
Helmut Schmidt
Mit den Russen leben
Im Mai 1973 traf ich in der damaligen Amtswohnung des Bundeskanzlers Brandt zum ersten Mal den sowjetischen Generalsekretär Breschnew. Das war der Beginn eines sehr besonderen und persönlichen Verhältnisses zwischen einem emotionalen, zugleich aber der politischen Kalkulation durchaus fähigen Großrussen und einem zwar kühlen, aber keineswegs emotionsfreien Norddeutschen. Brandt gab ein kleines, eher privates Abendessen für vielleicht zehn oder zwölf Personen. Da sich Brandt und Breschnew – wie auch die beiden Außenminister Scheel und Gromyko – in den vorangegangenen Jahren schon mehrfach begegnet waren, verlief die Unterhaltung locker und informell, wenngleich sie natürlich konsekutiv, das heißt absatzweise gedolmetscht und deshalb vielfach unterbrochen werden mußte. Konsekutive Übersetzung schafft unvermeidlich Zwangspausen, in denen man Zeit hat, seine Gedanken sorgfältig zu ordnen. Das Gespräch verliert dadurch an Spontaneität, gewinnt aber zugleich an Klarheit.
Im Laufe des Abends geriet Breschnew-ob kalkuliert oder aus einer momentanen Stimmung heraus, blieb mir unklar – in einen Monolog über die Leiden der Völker der Sowjetunion während des Zweiten Weltkrieges. Besonders die Menschen in der Ukraine, wo er selber als Generalmajor Politkommissar der 18. Armee gewesen war, hätten unsäglich gelitten. Breschnew steigerte sich in eine bewegte und bewegende Schilderung immer neuer Details der Verluste, der Greuel des Krieges und auch der völkerrechtswidrigen, verbrecherischen Untaten der Deutschen, die er ständig »die faschistischen Soldaten« oder »die faschistischen Invasoren« nannte.
Ich hatte den gleichen Krieg miterlebt; ich wußte, wie recht er hatte; ich wußte auch, wie sehr er im Recht war, so zu reden – obgleich er an einigen Stellen zu übertreiben schien. Ähnlich muß es Willy Brandt und den anderen anwesenden Deutschen gegangen sein, denn wir alle hörten Breschnew respektvoll eine sehr lange Zeit zu. Es lag ihm daran, dies war uns deutlich, seinen Gastgebern die große Wende fühlbar zu machen, die große Selbstüberwindung, die es ihn und die Russen gekostet hatte, sich zur Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland, zum Moskauer Gewaltverzichtvertrag und zum Viermächteabkommen über Berlin zu entschließen – und zum Besuch in Bonn, bei den ehemaligen Feinden.
Ich selbst dachte bei Breschnews Schilderungen an meine eigene Kriegszeit, die inzwischen mehr als drei Jahrzehnte zurücklag. Ich erinnerte mich an den Geruch im brennenden Sytschewka, an die Leichen an den Straßenrändern; meine Batterie hatte immer wieder Befehl bekommen, mit 2-cm-Flakgeschützen die Dörfer in Brand zu schießen, um feindliche Widerstandsnester an den Dorfrändern auszuräuchern. Ich erinnerte mich an mein verständnisloses Entsetzen, als ich einmal in einem rückwärts gelegenen Versorgungsstützpunkt die unmenschlichen Bedingungen eines Gefangenentransportes erlebte, und an den Kommissarbefehl, dessen Vollzug wir zwar nicht miterleben mußten, von dessen Durchführung, nämlich der Erschießung der gefangenen Kommissare, wir jedoch wußten. Ich dachte an unsere Scheu vor jeder persönlichen Berührung mit kriegsgefangenen russischen Soldaten; mir fiel die gegenseitige Angst wieder ein, welche deutsche Soldaten und russische Zivilbevölkerung voreinander hatten, als wir nach Einbruch des Winters 1941 schließlich doch Zuflucht in den Häusern suchten, um zu schlafen – die Deutschen auf dem Fußboden und die Russen auf dem Ofen. Ich erinnerte mich an unsere eigenen Ängste; an mein tiefes Erschrecken über die grauenhaften Schreie eines an einer schweren Unterleibsverwundung sterbenden Kameraden. Aus dem Vergessen stieg wieder meine panische Angst, als wir im Dezember 1941 bei Klin abgeschnitten und eingekesselt waren und uns die Gefangenschaft bevorzustehen schien. Breschnew hatte recht: Der Krieg war schrecklich gewesen, und wir Deutschen hatten ihn in sein Land getragen.
Aber er hatte zugleich unrecht in seiner Einseitigkeit; nicht nur deutsche, auch russische Soldaten hatten Greueltaten an ihren damaligen Feinden begangen. Und er hatte unrecht, wenn er in den ehemaligen deutschen Soldaten Faschisten sah. Die große Masse deutscher Soldaten, ihre Unteroffiziere, Offiziere und Generale waren sowenig Nazis gewesen wie die große Masse unserer damaligen Feinde Kommunisten; auf beiden Seiten hatte man geglaubt, seinem Vaterland dienen und es verteidigen zu müssen. Seit langem wußte man, daß die Oberbefehlshaber hier wie dort rücksichtslos waren. Breschnew klagte allein Hitler an; wußte er nicht oder wollte er nicht wissen, daß auch Stalin manchen seiner Feinde hatte umbringen lassen? Ich dachte keineswegs daran, die beiden Männer miteinander zu vergleichen; auch hatte Breschnew keine Veranlassung, über sowjetische Kriegsverbrechen zu reden. Gleichwohl entschloß ich mich, ihm zu widersprechen.
Nein, eigentlich nicht zu widersprechen, aber doch ihm und seiner Begleitung die andere Seite des Krieges vor Augen zu führen. Breschnew hatte vielleicht zwanzig Minuten gesprochen. Ich begann leise und zurückhaltend, aber ich sprach fast genauso lange. Willy Brandt ließ den ehemaligen deutschen Soldaten gewähren, der noch vor kurzem Inhaber der Befehls-und Kommandogewalt über die Bundeswehr gewesen war.
Ich räumte ein, wie sehr Breschnew im Recht sei, aber ich widersprach dem Wort von den faschistischen Soldaten. Ich schilderte die Lage meiner Generation: Nur wenige von uns seien Nazis gewesen und hätten an den »Führer« geglaubt, es seien Ausnahmen gewesen; die meisten von uns hätten es jedoch als Pflicht empfunden, die Befehle ihrer militärischen Vorgesetzten zu befolgen; diese hätten im übrigen ebenso gedacht, auch von ihnen seien die wenigsten Nazis gewesen. Während meiner acht Jahre in der Wehrmacht hatte ich in der Tat keinen einzigen überzeugten Nationalsozialisten als Vorgesetzten oder Kommandeur gehabt. Wohl aber war ich zum Patrioten erzogen worden.
Ich erinnerte Breschnew an jene Offiziere, die einerseits als Patrioten gegen den Feind, andererseits aber gegen Hitler gekämpft hatten, bereit zum Hochverrat, nicht aber zum Landesverrat. Ich sprach vom Sterben in den zerbombten Städten, vom Elend auf der Flucht und während der Vertreibung; davon, daß wir an der Front oft wochenlang nicht wußten, ob unsere Eltern, Frauen und Kinder zu Hause noch lebten. Während wir nachts Hitler und den Krieg verfluchten, erfüllten wir tagsüber als Soldaten unsere Pflicht. Ich machte unseren sowjetischen Gästen die Schizophrenie deutlich, in der wir jungen deutschen Soldaten den Krieg durchgestanden und durchlitten hatten.
Handschriftliche Notiz Breschnews während seines Bonner Besuches im Mai 1973; Breschnew bittet den Finanzminister Helmut Schmidt um »Bewilligung zusätzlicher Mittel, damit wir weitertrinken können«.
Ob dies alles für Breschnew neu war, habe ich nicht erkennen können; wohl aber konnte ich sehen, daß er seinerseits aufmerksam zuhörte. Wahrscheinlich hat jener Austausch bitterer Kriegserinnerungen wesentlich zu dem gegenseitigen Respekt beigetragen, der unser Verhältnis in den Jahren zwischen 1974, dem Jahr meines ersten Besuches bei ihm, und 1982 gekennzeichnet hat, dem Jahr seines Todes und meines Ausscheidens aus dem Amt des Bundeskanzlers. In diesen acht Jahren sind wir noch zwei- oder dreimal auf jenes erste Gespräch im Mai 1973 zurückgekommen. Als ich im Sommer 1980 während einer ziemlich dramatischen Begegnung im Kreml einmal die Bemerkung machte: »Herr Generalsekretär, ich habe Sie niemals belogen«, unterbrach Leonid Breschnew mich spontan, indem er einwarf: »Das ist wahr.«
Zur Zeit der oben geschilderten Unterhaltung im Jahre 1973 hatte ich zwei Jahrzehnte Bundespolitik hinter mir; ich hatte mir als Abgeordneter des Bundestages, als Fraktionsvorsitzender und als Verteidigungsminister ein Bild von der Welt erarbeitet, das die historische Entwicklung Rußlands ebenso einschloß wie die gegenwärtige machtpolitische Rolle der Sowjetunion. Weder die im Jahre 1967 von der Atlantischen Allianz beschlossene doppelte Gesamtstrategie des Westens à la Harmel noch Richard Nixons Rüstungsbegrenzungspolitik gegenüber der Sowjetunion nach 1968 noch Willy Brandts Ostpolitik seit Beginn seiner Kanzlerschaft im Herbst 1969 waren für mich neuartige Überlegungen gewesen. Im Gegenteil: ich hatte schon lange ähnliche Vorstellungen vertreten – in Reden im Bundestag und auf Parteitagen meiner Partei, in zwei Büchern über Strategie und als Mitglied des Ministerrates des Nordatlantischen Bündnisses.
Ich war seit langem ein überzeugter Verfechter der doppelten Notwendigkeit, sowohl die weitere Expansion der Sowjetunion durch gemeinsame Verteidigungsfähigkeit des Westens einzudämmen als auch – auf der Basis der so hergestellten eigenen Sicherheit – mit der Sowjetunion zu kooperieren, und zwar nicht nur auf dem Felde der Rüstungsbegrenzung und des wirtschaftlichen Austausches, sondern hoffentlich eines Tages auch auf der kulturellen Ebene. Mit einem Wort: Ich vertrat eine Gesamtstrategie des Gleichgewichts und des Interessenausgleichs zwischen West und Ost.
Als ich im Oktober 1974 im Rahmen einer Verabredung, die noch Brandt und Breschnew getroffen hatten, das erste Mal als Bundeskanzler die Hauptstadt der Sowjetunion besuchte, wird es in Moskau gewiß sorgfältig erarbeitete Dossiers über die Auffassungen des neuen Bundeskanzlers gegeben haben. Man hatte gewiß geprüft, wo und wann der junge Kriegsoffizier im Verband der ersten Panzerdivision 1941 und 1942 eingesetzt worden war und ob er sich dabei möglicherweise etwas hatte zuschulden kommen lassen. Man hatte gewiß Aufzeichnungen über einen privaten Urlaubsbesuch, den ich – zusammen mit meiner Frau Loki, meiner Tochter und meinem Mitarbeiter Wolfgang Schulz – im Sommer 1966 in Moskau und Leningrad gemacht hatte.
Es war eine interessante Reise gewesen: Am Steuer meines Opel-Rekord, ausgestattet mit teuren Intourist-Gutscheinen, war es von Nürnberg über Prag, Breslau, Warschau nach den beiden russischen Metropolen und zurück über Helsinki gegangen, insgesamt 5000 Kilometer. Die sowjetischen Polizisten entlang der offiziellen Route notierten jeweils unser Eintreffen und berichteten umgehend telefonisch, was uns nicht verborgen blieb; sie haben sicherlich auch über die Gegenstände unseres Interesses und über unsere Gesprächspartner berichtet. Mir sind die erzenen Tore der Kathedrale im Kreml von Nowgorod und vor allem die städtebauliche Schönheit Leningrads in besonders guter Erinnerung: die hellen Mittsommernächte in der sehr europäisch wirkenden Stadt am Finnischen Meerbusen, ihre schönen Kanäle und Kais – und natürlich der nahezu unvergleichliche Kunstreichtum der Eremitage.
Das sowjetische Außenministerium hatte dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD durch einige sorgfältig ausgesuchte sowjetische Journalisten in ausführlichen Gesprächen auf den Zahn fühlen lassen; schließlich hatte es ein dreistündiges Gespräch mit dem damaligen stellvertretenden Außenminister Semjonow gegeben. Semjonow war später zu meiner Kanzlerzeit Botschafter in Bonn; er versteht viel von deutscher Kunst, von deutscher Geschichte und von deutschen Interessen. Er hatte das Gespräch 1966 immer wieder auf die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes gebracht und den Gedanken wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Westen angesprochen. Ich war darauf eingegangen, hatte den Schwerpunkt des Gesprächs aber auf die Stabilisierung eines strategischen Gleichgewichts in Europa gelegt und auf Gewaltverzichtvereinbarungen der Bundesrepublik mit der Sowjetunion und den einzelnen osteuropäischen Staaten. Die Grenzen der DDR hatte ich dabei einbezogen; besonders an diesem Punkt zeigte sich Semjonow interessiert, ließ sich aber zu keiner Stellungnahme verlocken.
Es muß also 1974 in Moskau genug zuverlässige Quellen über meine Auffassungen der wechselseitigen Interessenlage gegeben haben. Sicher lagen entsprechende Aufzeichnungen auch aus dem Jahre 1969 vor, als meine engen Freunde Alex Möller, Egon Franke und ich, damalige Führungspersonen der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, zu einem quasi-offiziellen Besuch in Moskau gewesen waren. 1969 war ein Wahljahr; die große Koalition in Bonn neigte sich dem Ende zu, die außenpolitischen Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundeskanzler Kiesinger und Außenminister Brandt wurden zunehmend unüberbrückbar. Wir hielten einen Regierungswechsel und eine Übernahme der Kanzlerschaft durch Willy Brandt für denkbar und wollten sondieren, ob sich danach eine Möglichkeit für eine Normalisierung des Verhältnisses zwischen Bonn und Moskau eröffnen ließ. 1969 hatten die Moskauer Gesprächspartner höheren Rang als drei Jahre zuvor. Es waren mehrere wichtige ZK-Mitglieder sowie Mitarbeiter des Politbüros und des Außenministeriums dabei gewesen, darunter Valentin Falin, der spätere Botschafter in Bonn, ein Mann mit konzeptioneller Begabung. Vor allem aber hatte uns Gromyko im Spiridonow-Palais zu einem ausführlichen Gespräch empfangen; da Gromyko damals dem Politbüro noch nicht angehörte, waren wir außerdem von dem Politbüro-Mitglied Poljanskij empfangen worden.
Abb 30 Im Sommer 1966 unternahm Helmut Schmidt eine private Reise durch den Westteil der Sowjetunion.
Das Photo zeigt ihn zusammen mit Frau Loki und Tochter Susanne vor der Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz.
Abb 31 Auf dem Markt in Nowgorod.
In der Moskauer U-Bahn.
Im Gespräch mit Gromyko hatte ich praktisch die spätere Ostpolitik der Regierung Brandt/Scheel skizziert, ohne zu wissen, ob es je eine solche Regierung geben würde. Ich hatte zur Eröffnung deutlich gemacht, die Deutschen würden nie auf die Hoffnung verzichten, in einem Hause zu leben; sie seien überzeugt, vor der Geschichte dieses Recht zu besitzen. Aber angesichts der tatsächlichen Lage seien wir bereit, auf der Grundlage der Gleichberechtigung Verträge mit der DDR zu schließen, darunter einen völkerrechtswirksamen Gewaltverzichtvertrag, der alle Grenzen der DDR einschließe. Gromyko hatte sich dazu nicht geäußert, statt dessen hatte er vor allem von West-Berlin gesprochen: in dieser Hinsicht seien unsere Standpunkte grundsätzlich verschieden.
Im ganzen hatte das Gespräch viele aktuelle und prinzipielle Fragen der internationalen Politik behandelt. Am Ende hatte Gromyko von den Deutschen mehr Elastizität und Flexibilität gefordert, und ich hatte geantwortet: »Elastizität kann dann eine Tugend sein, wenn sie mit festen moralischen Prinzipien gepaart ist. Aber politische Vorteile bringt sie nur dann, wenn beide Partner Elastizität zeigen.« Das Gespräch mit Poljanskij war ähnlich verlaufen, wenn auch kursorischer.
Alle Äußerungen wurden auf beiden Seiten sorgfältig festgehalten und gewiß für das »Dossier Schmidt« ausgewertet, das Leonid Breschnew bei meinem fünf Jahre später stattfindenden ersten amtlichen Besuch studiert haben dürfte.
In diesem Dossier wird wohl auch mein Buch über die »Strategie des Gleichgewichts« aus dem Jahre 1969 eine Rolle gespielt haben, in dem ich unter anderem die machtpolitische und militärische Rolle der Sowjetunion gegenüber ihren eigenen Verbündeten (unter der Kapitel-Überschrift »Breschnew-Doktrin«), gegenüber dem Westen und speziell gegenüber Deutschland analysiert und Schlußfolgerungen für die Außen- und Verteidigungspolitik meines eigenen Landes gezogen hatte. Schließlich werden die sowjetischen Militärs meine Zielsetzungen, Handlungsweisen und Äußerungen während der drei Jahre meiner Amtszeit als Verteidigungsminister studiert haben.
Ich war entschieden für die Festigung des westlichen Bündnisses und für innere Reform und Stärkung der Bundeswehr eingetreten. Ich hatte für jedermann nachlesbar zum ersten Mal ein umfangreiches »Verteidigungs-Weißbuch« veröffentlicht, das mein Freund Theo Sommer an der Spitze des Planungsstabes auf der Hardthöhe nach vielen Informations- und Diskussionskonferenzen mit Vertretern der Truppe wie der militärischen Führung erarbeitet hatte.
Schließlich hatte ich mich in den turbulenten Ratifikationsdebatten des Bundestages im Frühjahr 1972 über die Ostverträge der Regierung Brandt/Scheel vehement für die Ratifikation eingesetzt und ihre Notwendigkeit aus meiner gesamtstrategischen Sicht der Sowjetunion begründet. Vermutlich paßte ich 1974 für die Beraterstäbe in Moskau weder in die Klischees vom angeblichen deutschen »Militarismus« oder »Revanchismus«, noch kann ich ihnen als ein Mann des »Appeasement« oder der Anpassung erschienen sein. Wahrscheinlich hatten sie eine im großen und ganzen zutreffende Einschätzung meiner Vorstellungen.
Gewiß hatten die Sowjets noch präzisere Bilder von meinem Amtsvorgänger Willy Brandt, von dessen Außenminister Walter Scheel und von Brandts Unterhändler, dem damaligen Staatssekretär Egon Bahr. Daß Scheel in das Amt des Bundespräsidenten aufrückte und Bahr in meinem ersten Kabinett Bundesminister wurde, mögen sie als Zeichen deutscher Kontinuität gesehen haben. Das Ausscheiden Brandts gab ihnen gleichwohl ein politisches Rätsel auf, zumal sie den neuen Außenminister Hans-Dietrich Genscher kaum kannten.
Einer der entscheidenden Faktoren für die Bonner Ostpolitik war seit 1969 der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner; dreizehn Jahre lang hat er sich, in Übereinstimmung mit seinem freidemokratischen Kollegen Wolfgang Mischnick und engstens assistiert von seinem außenpolitischen Mitarbeiter, meinem Freunde Eugen Selbmann, für den stetigen Fortgang der deutschen Ostpolitik eingesetzt. Besonders an unserer Politik gegenüber Moskau und Ost-Berlin hat Wehner einen hohen Anteil, den allerdings weder die Sowjets noch die öffentliche Meinung in Deutschland in vollem Umfang erkennen konnten.
Am 21. und 22. August 1969 führte die Spitze der SPD-Bundestagsfraktion in Moskau sondierende Gespräche über die Möglichkeit einer Normalisierung des Verhältnisses zwischen den beiden Staaten.
Von links: Helmut Schmidt, Alex Möller und Egon Franke. Rechts der damalige Moskaukorrespondent der ARD, Lothar Loewe.
Abb 10 Am Nachmittag des 21. August wurde die Delegation von Außenminister Gromyko empfangen.
Von links: Möller, Selbmann, Schmidt, der Dolmetscher, Gromyko.
Herbert Wehner war als Politiker eine unerhörte Allroundbegabung. Jean Monnet, Henry Kissinger, später Erich Honecker und manch anderer Beobachter der deutschen Politik haben das verstanden. Er hatte als ehemaliger deutscher Kommunist nach 1933 in Moskau unter der stalinistischen Ära sehr gelitten, hatte sich losgesagt und war nach 1945 – von Kurt Schumacher mit großem Vertrauen empfangen – als Sozialdemokrat nach Deutschland zurückgekehrt. Ich habe ihn 1946 als Redakteur des »Hamburger Echos« kennengelernt und bin ihm von 1953 an im Bonner Parlament täglich begegnet. Er war es, der im Juni 1960 – nach geistiger Vorbereitung durch Fritz Erler, Carlo Schmid, durch ihn selbst und andere – die außenpolitischen Vorstellungen meiner Partei endgültig auf den Boden der inzwischen vollzogenen Tatsachen stellte: Nordatlantikpakt, Europäische Gemeinschaft, Bundeswehr.
Wehners innere Bindung an die Werte des Westens, an die Werte der demokratischen Gesellschaft und der Freiheit des einzelnen, konnte kein anständiger Beobachter in Zweifel ziehen – allerdings haben einige innenpolitische Gegner immer wieder versucht, seine Glaubwürdigkeit herabzusetzen. Wehners Temperament und zeitweilige Schroffheit boten dafür bisweilen Anlässe; vor allem auf der Rechten mißtraute man seinem beharrlichen Eintreten für einen Ausgleich mit der Sowjetunion und seinem stetigen Engagement für Schritte in Richtung auf eine dereinstige Vereinigung der Deutschen unter einem gemeinsamen Dach. Konrad Adenauer hatte ihm Respekt entgegengebracht; ich hingegen – trotz einiger heftiger Auseinandersetzungen – liebte diesen Mann; er erschien mir als Garant einer lebenskräftigen Synthese aus einer sozialen, demokratischen Innenpolitik und einer auf den engen Zusammenhalt mit dem Westen gegründeten Ostpolitik. Als ich 1969 Verteidigungsminister werden sollte, habe ich zur Bedingung gemacht, daß Wehner – bis dahin Bundesminister – an meiner Stelle den Vorsitz der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion übernahm. Ich wollte sicher sein, den Rücken frei zu haben. Ich habe mich in dieser Erwartung nicht getäuscht.
Herbert Wehner konnte notfalls mit dem Holzhammer arbeiten, aber zugleich besaß er ein hohes Einfühlungsvermögen für andere, besonders für Menschen in Not. Er soll einmal über Rußland gesagt haben, er liebe dieses Land, weil es soviel erleiden mußte. Er mag 1969 und noch 1974, zur Zeit meines ersten Moskauer Besuches als Bundeskanzler, der sowjetischen Führung als Abtrünniger suspekt gewesen sein; wahrscheinlich hat man in Moskau wie in Ost-Berlin erst später seine Bedeutung für unsere Ostpolitik verstanden. Ich hingegen wußte: Wehners ostpolitische Vorstellungen waren schon klar gewesen, bevor Willy Brandt die seinigen entwickelte und bevor dessen damaliger Berliner Mitarbeiter Egon Bahr in der ersten Hälfte der sechziger Jahre vom »Wandel durch Annäherung« sprach. Ich habe in der ganzen Zeit meiner Kanzlerschaft meine Politik jede Woche mit Herbert Wehner abgestimmt, besonders intensiv meine Ostpolitik – und ich habe mich immer auf ihn verlassen können.
Russisch-sowjetische Kontinuität
Meine Vorstellungen von der Sowjetunion in den sechziger und siebziger Jahren unterscheiden sich nur in aktuellen Details, nicht aber grundsätzlich von meinem heutigen Urteil. Mir sind Außenpolitik und Gesamtstrategie der Sowjetunion in vielerlei Hinsicht immer als eine geradlinige Fortsetzung und Ausfächerung der Politik des alten Rußland vom 16. über das 17. bis zum 18. und 19. Jahrhundert erschienen. Grob vereinfacht gesagt, für mich waren und sind drei Viertel der Moskauer Gesamtstrategie russischtraditionell, ein Viertel kommunistisch.
Lenin – und ebenso Stalin – haben Iwan IV., den »Schrecklichen«, vermutlich zu Recht als den eigentlichen Begründer des absolutistisch-zentralistisch regierten großrussischen Staates betrachtet. Iwan IV., 1530 geboren, nahm 1547 den Zarentitel an und führte den ersten russischen Eroberungskrieg über die alten Grenzen des Kiewer Reichs hinaus, der mit dem Sieg über die tatarischen Wolgafürstentümer Kazan und Astrachan endete. Damit begann die Geschichte der Reichserweiterungen, die eine weitgehende Russifizierung der fremden Völkerschaften mit sich brachte, auch Zwangsumsiedlungen, etwa um Nowgorod, Twer oder Pskow (Pleskau) fest unter Botmäßigkeit zu bringen. Das brutale Instrument der Zwangsumsiedlung hat nicht Stalin erfunden; Peter I. und Katharina II. haben vorher das gleiche getan. Die russische Expansion richtete sich auf das Baltikum, auf die Ostsee also, dann auf Polen, die Schwarzmeerküste, schließlich den Balkan; auch Konstantinopel, der Bosporus und die Dardanellen lagen oft im Blickfeld. Zugleich hatte man den Kaukasus im Auge, die untere Wolga, das Kaspische Meer, Taschkent und Samarkand, Turkestan und Afghanistan. Am Horizont lockten die unermeßlichen Weiten des nördlichen Asiens bis an den Pazifik und über die Beringstraße hinaus Alaska, dann mongolische, chinesische, schließlich japanische und ganz zum Schluß auch deutsche Gebiete. Neuerdings sind politische Stützpunkte im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika hinzugekommen.
Ob unter Iwan IV., Peter I. oder Katharina II., unter Stalin, Chruschtschow oder Breschnew: trotz mancher Rückschläge ist der russische Drang zur Expansion nie wirklich erloschen. Ihm liegt ein moskauzentrischer Messianismus zugrunde, welcher der russischen Staatsidee inhärent geblieben ist. Als Konstantinopel 1453 von den Türken erobert wurde und damit das oströmische Zentrum der Christenheit verlorenging, erklärte sich Moskau zum »Dritten Rom« – »… und ein viertes Rom wird es nicht geben«. Die Heilsgewißheit erschien in anderer Form in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als moskauzentrischer Panslawismus und erneut im 20. Jahrhundert als weltrevolutionärer moskauzentrischer Kommunismus.
Entweder die Wendung zum humanistischen und liberalen Geist Westeuropas oder aber eine bewußte Hingabe an den russischen Messianismus – mit all seinen Gefahren: so ließe sich die Alternative Rußlands im 19. Jahrhundert umschreiben. In der Literatur vertritt Turgenjew die erste, Dostojewski die zweite, die Hauptströmung russischen Denkens – obgleich die Obrigkeit ihn erst zum Tode verurteilte und dann nach Sibirien verbannte.
Vor einer vergleichbaren Frage stehen auch die heutigen Dissidenten in der Sowjetunion. Aber alle Russen, die sich angesichts dieser Frage für die Freiheit der Person und die Unverletzlichkeit ihrer Würde, für die Herrschaft des Rechts und für die offene Gesellschaft entschieden haben, welche die Unterordnung des einzelnen unter einen kollektiven Willen ablehnen und seine Grundrechte höher bewerten als den Anspruch des Staates oder seiner Herrscher – alle diese Russen waren bisher immer eine Minderheit, eine politisch zumeist bedeutungslose Randgruppe. Es erscheint mir fraglich, ob sich dies unter Gorbatschow wesentlich ändern kann – sosehr ich es hoffen möchte.
Die europäische Aufklärung, die Ideen des Rechtsstaates und der Demokratie haben die politische Entwicklung Rußlands nur wenig beeinflußt. Peter der Große hat – ähnlich wie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Meiji-Tenno in Japan – sein Land zielstrebig der westeuropäischen Wissenschaft und Technik geöffnet; aber er hat – ähnlich wie Meiji-Tenno – den Geist seines Volkes nicht entscheidend verändert; er wollte sich des westlichen Beispiels vielmehr bedienen, um den damaligen europäischen Großmächten ebenbürtig zu werden.
Der russisch-sowjetische Expansionsdrang läßt sich mit dem gleichen Recht als Imperialismus begreifen, wie man das im Falle anderer Weltreiche getan hat, ob es die Imperien der Portugiesen, der Spanier oder der Engländer, das antike Rom oder die USA gewesen sind, deren Errichtung weitestgehend auf unfriedlicher Landnahme beruhte. Wenn im Westen vom sowjetischen Imperialismus die Rede ist, so ist die moralische Verurteilung unüberhörbar. Zur Zeit der Entstehung früherer Weltreiche hat es aber eine solche moralische Verurteilung kaum gegeben; die Unterwerfung fremder Völker und die Auslöschung ihrer Staaten wurden weniger als Schuld der Eroberer begriffen, sondern vielmehr als unabwendbares Schicksal. Als meine Generation in der Schule von Alexander dem Großen, von Caesar, von Karl dem Großen oder von Napoleon hörte, kam es den Lehrern nicht in den Sinn, die legendären Eroberer als Verbrecher gegen die Menschlichkeit darzustellen; im Gegenteil: sie wurden eher heroisiert. Das gleiche galt für die Eroberung des ursprünglich indianisch besiedelten Nordamerika durch die Weißen. Und niemand wäre auf den Gedanken gekom men, den Athener Staatsmann Perikles oder den Philosophen-Kaiser Marcus Aurelius dafür zur Rechenschaft zu ziehen, daß sie an der Spitze von Staaten standen, die ohne Eroberungen und ohne Sklaverei gar nicht denkbar sind. Die philosophische, sittliche und rechtliche Verurteilung der Eroberung fremder Staaten und ihrer Völker ist relativ jungen Datums. Die kurzlebigen Weltreichträume der Japaner, Mussolinis und Hitlers wären anderthalb Jahrhunderte zuvor – wenn mit ihnen nicht unvorstellbare Verbrechen verbunden gewesen wären – durchaus nicht so entschieden verurteilt worden, wie das unter den Bedingungen der dreißiger und vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts der Fall sein mußte. Seither gelten unverhüllte globale Herrschaftsansprüche in der ganzen Welt als unerlaubt, ja als verbrecherisch.
Der Pantheon Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Erste Auflage Pantheon-Ausgabe November 2011
Copyright © 2011 by Pantheon Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München, Lektorat: Thomas Karlauf, Berlin Karten: Peter Palm, Berlin Satz: Ditta Ahmadi, Berlin Reproduktionen: Mega-Satz-Service, Berlin
eISBN 978-3-641-08262-8
www.pantheon-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe