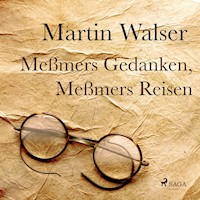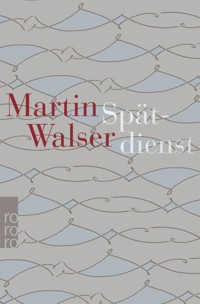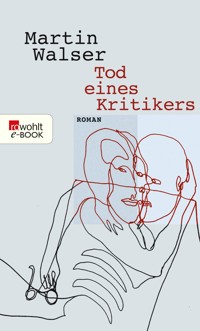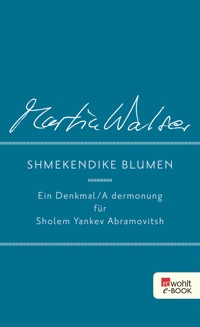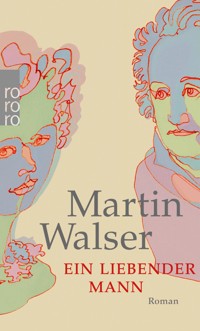
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Bis er sie sah, hatte sie ihn schon gesehen. Als sein Blick sie erreichte, war ihr Blick schon auf ihn gerichtet. Das fand statt am Kreuzbrunnen, nachmittags um fünf, am 11. Juli 1823 in Marienbad.» Mit diesen Sätzen beginnt Martin Walsers Roman über Goethes letzte Liebe. Der 73-jährige Geheimrat – seit dem Tod seiner Ehefrau Christiane Witwer und so berühmt, dass sein Diener Stadelmann heimlich Haare von ihm verkauft – liebt die 19-jährige Ulrike von Levetzow. 54 Jahre Altersunterschied trennen die beiden, aber Goethe sagt sich: «Meine Liebe weiß nicht, dass ich über siebzig bin. Ich weiß es auch nicht.» Blicke werden getauscht, Worte gewechselt, die beiden küssen einander auf die Goethe' sche Art. Er sagt: Beim Küssen kommt es nicht auf die Münder, die Lippen an, sondern auf die Seelen. «Das war sein Zustand: Ulrike oder nichts.» Doch sein Alter holt ihn ein. Auf einem Kostümball stürzt er, und bei einem Tanztee will sie ein Jüngerer verführen. Der Heiratsantrag, den er Ulrike trotzdem macht, erreicht sie erst, als ihre Mutter mit ihr nach Karlsbad weiterreisen will. Goethe schreibt die «Marienbader Elegie». Zurück in Weimar, lässt ihn die eifersüchtige Schwiegertochter Ottilie nicht mehr aus den Augen. Martin Walsers neuer Roman erzählt die Geschichte einer unmöglichen Liebe: bewegend, aufwühlend und zart. Die Glaubwürdigkeit, die Wucht der Empfindungen und ihres Ausdrucks – das alles zeugt von einer Kraft und (Sprach-)Leidenschaft ohne Beispiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Martin Walser
Ein liebender Mann
Roman
Über dieses Buch
«Bis er sie sah, hatte sie ihn schon gesehen. Als sein Blick sie erreichte, war ihr Blick schon auf ihn gerichtet. Das fand statt am Kreuzbrunnen, nachmittags um fünf, am 11. Juli 1823 in Marienbad.» Mit diesen Sätzen beginnt Martin Walsers Roman über Goethes letzte Liebe. Der 73-jährige Geheimrat – seit dem Tod seiner Ehefrau Christiane Witwer und so berühmt, dass sein Diener Stadelmann heimlich Haare von ihm verkauft – liebt die 19-jährige Ulrike von Levetzow. 54 Jahre Altersunterschied trennen die beiden, aber Goethe sagt sich: «Meine Liebe weiß nicht, dass ich über siebzig bin. Ich weiß es auch nicht.» Blicke werden getauscht, Worte gewechselt, die beiden küssen einander auf die Goethe‘ sche Art.
Er sagt: Beim Küssen kommt es nicht auf die Münder, die Lippen an, sondern auf die Seelen. «Das war sein Zustand: Ulrike oder nichts.»
Doch sein Alter holt ihn ein. Auf einem Kostümball stürzt er, und bei einem Tanztee will sie ein Jüngerer verführen.
Der Heiratsantrag, den er Ulrike trotzdem macht, erreicht sie erst, als ihre Mutter mit ihr nach Karlsbad weiterreisen will. Goethe schreibt die «Marienbader Elegie». Zurück in Weimar, lässt ihn die eifersüchtige Schwiegertochter Ottilie nicht mehr aus den Augen.
Martin Walsers neuer Roman erzählt die Geschichte einer unmöglichen Liebe: bewegend, aufwühlend und zart.
Die Glaubwürdigkeit, die Wucht der Empfindungen und ihres Ausdrucks – das alles zeugt von einer Kraft und (Sprach-)Leidenschaft ohne Beispiel.
Vita
Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schrifststeller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2009
Covergestaltung Alexander Buxhoeveden, Alissa Walser,
Alexander Buxhoeveden u. Alissa Walser
Coverabbildung Alissa Walser
ISBN 978-3-644-00031-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Ulrike von Egloff-Colombier
Eins
1.
Bis er sie sah, hatte sie ihn schon gesehen. Als sein Blick sie erreichte, war ihr Blick schon auf ihn gerichtet. Das fand statt am Kreuzbrunnen, nachmittags um fünf, am 11. Juli 1823 in Marienbad. Hundert feine Gäste promenierten, das Glas mit dem jedes Jahr noch mehr gerühmten Wasser in der Hand, und wollten gesehen werden. Goethe hatte nichts dagegen, gesehen zu werden. Aber er wollte gesehen werden als jemand, der mehr im Gespräch war als auf der Promenade. In diesen Julitagen war er immer mit dem Grafen Sternberg im Gespräch. Gut zehn Jahre jünger als Goethe und Naturforscher. Goethe war es gewohnt, obwohl er es nicht gewohnt werden konnte, dass so gut wie alle Naturwissenschaftler für seine Farbenlehre im besten Fall ein spöttisches Bedauern erübrigten. Begegnete er einem, der die Farbenlehre gelten ließ, konnte er sich vor Freundlichkeit, Dankbarkeit, Rührung jeder Art oft fast nicht mehr beherrschen. Kaspar Graf Sternberg war so ein Naturwissenschaftler, hatte ein Buch über die Flora der Vorzeit geschrieben, das heißt, er konnte lesen, was die Steine bewahrt hatten. Und Steine waren inzwischen Goethes liebstes Forschungsfeld. Aber jetzt, in diesen Julitagen, war es noch ein anderer Umstand, der den Grafen über alle Naturwissenschaft hinaus für Goethe anziehend machte. Im vergangenen Jahr hatten beide in dem als Kurhotel betriebenen Palais des Grafen Klebelsberg gewohnt. Und die Levetzows wohnten da auch. In Amalie von Levetzows Salon hatten sie sich kennengelernt. Wir kennen uns doch, hatte Goethe gerufen, wir kennen uns schon aus Vorzeiten. So hatte er auf Sternbergs Buchtitel angespielt und war auf den Grafen fast eilig zugegangen und hatte ihn umarmt. Das fiel auf, weil er sonst, wenn eine Bekanntschaft zu machen war, stehen blieb und dem anderen oder der anderen Gelegenheit gab, sich ihm zu nähern. Wir haben beide den Donnersberg bestiegen, bei Teplitz droben, Baronin, und ein jeder von einer anderen Seite, und sind, das haben wir einander geschrieben, beide auf der Zinne angekommen. Sie seien überhaupt zwei Reisende, hatte der Graf gesagt, die, aus zwei verschiedenen Welt- und Geschichtsgegenden kommend, einander begegnet seien und, als sie ihre Erfahrungen verglichen, gesehen hätten, dass es ein Vorteil sei, auf verschiedenen Wegen zu ein und demselben Ziel zu gelangen.
Jetzt, auf der Promenade, ließ Goethe sich vom Grafen Sternberg berichten, dass der schwedische Chemiker Berzelius gerade festgestellt habe, das vulkanische Gestein in der Auvergne sei erstaunlich eng verwandt mit dem hier auf dem Kammerbühl.
So ein Gespräch schützt die Sprechenden, wo auch immer es stattfindet. Es war Goethe, der heute mehr als einmal über das Gespräch hinausschaute. Goethe war kurzsichtig, aber Brillen fand er entsetzlich, das wusste in seinen Kreisen jeder Brillenträger und nahm seine Brille ab, wenn er von Goethe empfangen werden wollte. Brillen verstimmen mich, hatte er gesagt, und was der berühmte Dichter sagte, wurde weitergesagt. Er hätte die, die er suchte, von weitem nicht erkannt, aber Amalie von Levetzow mit ihren Töchtern Ulrike, Amalie und Bertha, die in diesem Jahr neunzehn, sechzehn und fünfzehn Jahre alt waren, diese Gruppe würde er auf jede Entfernung und in jeder noch so bunt bevölkerten Promenade ausmachen. Das geschah. Obwohl das Verhältnis der Gestalten zu einander sich geändert hatte. Ulrike war jetzt die größte, deutlich größer als ihre Mutter.
Ohne des Grafen Vortrag über die Verwandtschaft der Steine der Auvergne und des Kammerbühls zu unterbrechen, lenkte er sich und den Grafen auf die Levetzow-Gruppe zu und begegnete Ulrikes Blick. Sie hatte ihn entdeckt, als er sie noch nicht entdeckt gehabt hatte.
Ihn durchschoss eine Bewegung, eine Welle, ein Andrang von innen, im Kopf war es Hitze. Er spürte, dass es ihm schwindlig werden könnte. Er versuchte durch Ausatmen die wie im Krampf erstarrte Stirn- und Augenpartie zu lockern, zu lösen. Er durfte, nachdem man einander ein Jahr lang nicht gesehen hatte, das Wiedersehen doch wohl nicht mit einer Grimasse aus Staunen, Schmerz und Bestürzung feiern.
Also. Die Begrüßung. Die junge Mutter war deutlich lebhafter als jede ihrer Töchter. Ulrikes steter Blick, kannte er den noch vom vergangenen Jahr? Ihr und sein Blick blieben in einander. Als es nicht mehr auszuhalten war, als endlich etwas gesagt werden musste, sagte er: Bitte, begreifen Sie, liebe Umstehende, ich studiere nicht nur Steine, sondern auch Augen. Was verändert Augen mehr, von außen ein anderes Licht oder von innen eine andere Stimmung? Ulrikes Augen sind, weil uns das Wetter gerade eine dicke Kumuluswolke vor die Sonne schiebt, in diesem Augenblick – und ist das nicht ein köstliches Sprachangebot: Augenblick – sind in diesem Augenblick dabei, von Blau nach Grün zu wandern. Wenn die Wolke bleibt, haben wir es mit einer grünäugigen Ulrike zu tun. Graf Sternberg, dieses Doppelphänomen, ob die äußere Ursache oder eine innere überwiegt, sollte uns interessieren. Herzlich willkommen, gnädige Frau, und ihr, das liebenswürdigste Trio der Welt, herzlich willkommen.
Die sechzehnjährige Amalie, die am ehesten, was Rederaschheit angeht, der Mutter glich, sagte: Wir sind überhaupt kein Trio, wir sind Einzelne, wenn’s recht ist, Herr Geheimrat.
Und ob mir das recht ist, sagte Goethe und sah wieder zu Ulrike hin. Ulrike schaute immer noch so ruhig, so fest, wie sie ihn empfangen hatte. Er blieb in ihrem Blick. Er spielte den Augenforscher. Aber das war er nicht. Das mochten die anderen glauben. Ulrike glaubte das nicht. Und er glaubte das auch nicht. Sie schaute ihn an, nur um zu zeigen, dass sie ihn anschaue. Bevor er das Blick-Thema verließ, sagte er noch: Ulrike, manche Männer werden Ihnen später blaue Augen attestieren, andere werden sagen, Ihre Augen seien grün. Ich sage: Lassen Sie sich, bitte, nicht festlegen.
Er nahm ihn nachher mit sich auf sein Zimmer, diesen Blick. Man hatte gegessen mit einander, geplaudert, die Erinnerung an das vergangene Jahr und an das Jahr davor wieder wachgeplaudert. Im vorvergangenen Jahr, dieses miserable Wetter, da hat es doch einen Monat lang nur geregnet. Ohne die tausend Einfälle des Herrn Geheimrat hätte man das gar nicht ausgehalten. Mit seinen Steindarbietungen ist er allerdings nur bei Amalie angekommen. Extra ein Zimmer hat er gehabt mit Tischen nur für die Steine, die der Diener Stadelmann aus der ganzen Gegend zusammenklopft. Amalie ist heute noch ein bisschen beleidigt, weil der Herr Geheimrat für Ulrike zwischen die Steine ein Pfund Schokolade gelegt hat, um ihr die Steine attraktiv zu machen.
Und zwar ganz frisch aus Wien geholte Schokolade, sagte die Baronin, von der berühmten Konditorei Panel!
Und noch mit einem Gedicht, sagte Bertha, die auch zu Wort kommen musste.
Ach, sagte er, ein Gedicht.
Sie kann es noch, sagte Frau von Levetzow.
Bevor Goethe noch sagen konnte, bitte, sag es mir doch, trug Bertha das, was sie ein Gedicht genannt hatte, geradezu kunstvoll vor:
Genieße dieß nach deiner eignen Weise,
Wo nicht als Trank, doch als beliebte Speise.
Ich möchte immer noch wissen, warum es hier Granitblöcke gibt, die von ockergelben Adern durchzogen sind, sagte Amalie, um wieder auf ihr Interesse für Steine aufmerksam zu machen.
Bravo, sagte Goethe, bravo.
Der Graf empfahl sich. Er wolle, was er vorher mit Goethe über Vulkanismus und Neptunismus gesprochen habe, noch ein wenig ordnen. Winkte allen zu, verneigte sich und ging.
Goethe sah ihm nach. Drei solche, und ich würde dem lieben Gott Komplimente machen.
Was ist Vulkanismus, rief Amalie ganz schnell und schaute dabei nicht den an, den sie fragte, sondern ihre Schwester Bertha, der sie zuvorgekommen war.
Dann frag ich, was Neptunismus ist, rief Bertha, die ihre um zwei Jahre ältere Schwester in allem übertreffen wollte.
Und ich, sagte Goethe, sag euch allen, dass die Gelehrten sich streiten, ob die Erdoberfläche, wie wir sie heute haben, durch Feuer gebildet wurde, das sich dann in die Tiefen zurückzog und durch Vulkane immer noch auf seine frühere Rolle aufmerksam macht, oder durch Wasser, das sich allmählich zurückzog, dass die Meere entstanden.
Und Sie, fragte Ulrike, was denken Sie.
Ich denke, dass man, was man zur Zeit nur durch Vermutung entscheiden kann, nicht entscheiden soll. Aber da man unwillkürlich doch immer irgendwohin tendiert, gesteh ich, ich bin ein wankelmütiger Neptunist.
Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, sagte Ulrike ziemlich heftig. Und sagte es nur zu Goethe. Wieder mit dem Blick.
Goethe fragte, ob er mehr sagen solle, als er wisse.
Da es sich um Naturwissenschaft handle, sagte sie, und nicht um Lyrik, dürfe Entschiedenheit erwartet werden.
Oh, sagte Goethe, unsere Ulrike führt nicht weniger als die Kritik der reinen Vernunft im Schilde.
Die Mutter: Sie müssen wissen, dass sie in Straßburg inzwischen Contresse Ulrike heißt.
Für Amalie eine Gelegenheit zu beweisen, dass sie inzwischen alles mitkriege: Comtesse und contre, ist ja alles französisch in dieser Schule.
Goethe sagte, zu einer Schule, die zu solchen Entdeckungen fähig sei, gratuliere er, und gab jetzt zu, wie glücklich es ihn mache, wieder im Kreis der Familie zu sitzen und plaudern zu dürfen. Das sei in Weimar, wo bei ihm immer auf Bedeutendes gelauert werde, ausgeschlossen.
Woran der Herr Geheimrat nicht ganz unschuldig ist, sagte Ulrike.
Zugegeben, Contresse, sagte Goethe. Dort ist mein Leben mehr Theater als Leben.
Und hier, fragte Ulrike.
Hier, sagte er und sprach nicht weiter, sah einfach Ulrike an, und sie schaute ihn an und sagte:
Ja, hier?!
Hier, sagte er, merke ich wieder, dass ich zwei Weimarer Winter lang darunter gelitten habe, zu wenig zu wissen von den Levetzows.
Die aber vor zwei Jahren, sagte die immer redebereite Amalie, von Ihnen noch viel weniger wussten. Das wollen wir nicht vergessen, dass unsere ältere Schwester, die doch immerhin schon siebzehn Lenze zählte, im ersten Jahr gleich zugegeben hatte, von Goethe keine Zeile gelesen zu haben. Dafür aber, o Graus, jede Menge Schiller.
Auf dem französischen Internat in Straßburg, sagte Ulrike, habe ich eben aus dem Deutschen nur den Ehrenbürger der Französischen Revolution vorgesetzt bekommen.
Und Goethe: Ich habe mir gestattet, euch daran zu erinnern, dass ich als Muster für die Jugend weniger tauge als Schiller, Gellert, Hagedorn und Geßner.
Und Ulrike: Und die Franzosen, haben Sie gesagt, sind mehr für Idylle und Stilisierung als für Natur und Wirklichkeit.
Ja, sagte Goethe, deshalb ist Salomon Geßner dort viel bekannter als hier, der passt da hin.
Aber Voltaire auch, sagte jetzt Ulrike.
Und den hat, sagte er, nicht mein Freund Schiller, sondern den habe ich übersetzt.
Sogar zweimal, sagte Ulrike, Zaire und Mahomet.
Keine ganz tollen Stücke, sagte Goethe.
Seit ich jetzt Bücher von Ihnen lese, sagte Ulrike, quält es mich, dass ich in keinem Augenblick weiß, wer Sie sind. Immer dieses allerhöchste Geflunker. Wunderbar wird da geredet, gedacht, gefühlt, aber wer ist er? Das möchte sie endlich doch wissen. Das nämlich sei die Wirkung, wenn man ihn lese, dass in einem eine belästigende, eine gemeine Neugier wachse, ihn, wie er selber, wie er wirklich sei, kennenzulernen. Dass er in eine Art Reichweite komme, dass man, wenn man Lust habe, nach ihm greifen könne. Ja, berühren wolle man ihn. Aber wer ist er?
Aber dafür ist Scott prima, platzte Bertha herein.
Stimmt, sagte Ulrike. Scott nicht kennenzulernen tut nicht weh.
Und Bertha, die offenbar nicht so genau wusste, um was es im Augenblick ging, sagte, sobald es in diesem Sommer wieder regne, werde wieder vorgelesen. Und zwar Scott. Sie hat den Schwarzen Zwerg dabei.
Die Mutter ergänzte, dass Bertha, was Goethe ihr letztes Jahr über das Vorlesen gesagt habe, noch und noch übe.
Jetzt Bertha zu ihren Schwestern: Mich hat er einen holden Herankömmling genannt. Und dass ich beim Vorlesen immer ganz tief anfangen soll und dann steigern.
Das war heute zu hören, sagte Goethe.
Und Bertha intonierte sofort noch einmal: Wo nicht als Trank, doch als beliebte Speise.
Ja, rief Goethe, die Speise nicht, weil sie den Schluss bildet, abfallen lassen, sondern hinauf und hinaus mit ihr, beliebte Speise, beides gleich stark und höher als jedes andere Wort.
Mich hat Exzellenz nichts als kritisiert, sagte Ulrike ganz ruhig. Sie mischte sich nie jäh ein, kam aber immer, wenn sie es wollte, zu Wort.
Ja, rief Bertha, du müsstest mehr Energie und Darstellungslebhaftigkeit entwickeln.
Ich will ja auch kein Tieck werden, sagte Ulrike.
Amalie: Was soll denn das wieder?
Und Ulrike: Kein Vortragskünstler.
Amalie holte sich das Wort zurück: Dass der Geheimrat kein Muster für die Jugend ist, haben wir mitgekriegt.
Und Goethe: Jetzt sei er aber gespannt.
Ja, Ihr Spiel, sagte Amalie, einer schlägt ein Thema vor, der Nachbar muss daraus eine Erzählung machen, aber jeder hat das Recht, ein Wort einzuwerfen, das in die Erzählung hineingenommen werden muss. Und welches Wort haben Sie Ulrike in ihre Erzählung geworfen? Strumpfband, Herr Geheimrat. Ulrikchen wurde rot …
Stimmt nicht, dazu ist es nicht gekommen, rief Ulrike, weil der Herr Geheimrat, als ihm dieses Wort passiert war, sofort dazufügte: Strumpfband-Orden.
So, als habe er nie etwas anderes vorgehabt, sagte Amalie, wir wissen Bescheid.
Weil es ihm doch nicht recht war, im Kreis dieser zukunftsreichen Töchter als ganz unvorbildlich zu gelten, sagte er eher vor sich hin als in den Kreis hinein, er habe keinen Tabak geraucht, nie Schach gespielt, alles vermieden, was einem die Zeit raubt.
Und Ulrike: Das klang, als bedauerten Sie, so vorbildlich gelebt zu haben.
Wenn er schließlich im Schoß der paradiesischen Familie Levetzow gelandet sei, sagte er, könne nicht alles, was er gemacht habe, falsch gewesen sein.
So war das hingegangen.
Eigentlich hatte er nur Gelegenheiten gesucht, ihrem Blick zu begegnen. Das wusste er, als er dann über der Straße drüben in seinen bescheidenen Räumen, die er liebte, am Fenster stand und hinüberschaute ins recht gewaltige Klebelsberg’sche Kurhotel, hinüber zu den Fenstern im zweiten Stock, hinter denen Ulrike jetzt stand, saß, lag, las, dachte … Wie konnte er leben mit diesem Blick? Wahrscheinlich war es schon im vergangenen Jahr zu spät gewesen. Er war krank geworden im letzten Winter, schwer krank. Er hatte ihr geschrieben. Sie hatte geantwortet. Es war etwas. Aber was es war, hatte er erst heute erlebt. Ihre paar Briefe waren schon so gewesen, dass er sie niemandem zeigen durfte. Seine Briefe an sie waren immer nur zur Hälfte dem Schreiber John diktiert worden. Jedes Mal musste er selber noch etwas dazuschreiben, was keinerlei Inhalt zeigen durfte, aber verraten sollte, was durch Inhaltslosigkeit verheimlicht wurde. Es durfte nie an Ulrike allein, es musste immer auch an die Mutter geschrieben werden. Und doch und doch, das war alles erträglich. Einem weiteren Sommergeplänkel ließ sich entgegensehen. Dann dieser Blick, der alles veränderte. Da musste Sesenheim auftauchen, Friederikes bloße Mädchenhaftigkeit. Augen, in denen es heftig zuging, aber alles immer so schnell wechselnd, als müsse jede Stimmung, wenn sie deutlich werden will, sofort verlassen werden. Friederikes Mund wusste so wenig, was er tat, dass du ganz von selbst ihre Ignoranz und Neugier durch die deine ergänztest. Und Charlotte Buff, die große Sentimentale, die das Universum in einen Seufzer fasste und es darin untergehen ließ. Er steigerte, was sie in ihm geweckt hatte, ins Allergrößte. Werthers Lotte. Mit Recht beschwerte sie sich nachträglich über das, was er in der Novelle aus ihr gemacht hatte. Werthers Lotte, das war er, genau so wie Werther. Und Christiane, das große Gefühl, das sich nicht zu groß war für jede Anpassung. Es gab keine Situation, die sie nicht durch Unterwerfung beherrschte. Dann Marianne, die ganz und gar verwandt sein wollte und es durch eine ungeheure Seelenenergie auch schaffte, sich bis zur Selbstauflösung anzuverwandeln. Aber das nur als Kostümball. Als kulturelle Sensation. Als literaturgeschichtliche Prachtsanekdote. Und Ulrike. Zwei Jahre Mädchenzauber aus lauter stimmungsvollen So-nicht-Gemeintheiten. Noch im vergangenen Jahr eine feine Unerwecktheit, ein lebhaftes Dabeiseinwollen, immer bemüht, nichts falsch zu machen, eine Landschaft, über der die Sonne noch nicht aufgegangen ist, und jetzt, die Sonne ist aufgegangen, die Landschaft lebt. Jetzt ihr Blick. Es gibt keine Gegenwehr. Du wüsstest nicht, wogegen du dich wehren solltest. Du bist gefangen. Gefangener dieses Blicks.
Er musste noch an den Schreibtisch. Diese Ulrike, die Contresse Ulrike gehört in den Roman, in die höchst fällige zweite Fassung seines Wanderjahre-Romans. Hersilie ist die Figur, die er durch die Contresse bereichern kann. Aber darüber nie ein Wort zu Ulrike. Auch wenn du ihr zu gern hinplaudern würdest, dass sie in deinen Roman kommt, beherrsch dich! Man darf einer Quelle nicht sagen, dass sie eine ist. Sie wäre dann nicht mehr rein.
Er konnte nicht ins Bett. Nur jetzt nicht hinein in jene Selbstverlorenheit, die Schlaf heißt. Wenn er hoffen könnte, von ihr zu träumen, dann ja. Aber so! Eine Wachheit, in der er ununterbrochen an sie denken, sie sich vorstellen konnte, eintauschen gegen einen Schlafzustand, in dem sie höchstwahrscheinlich gar nicht vorkommen kann. Noch nicht.
Auf und ab gehen. An jedem Fenster stehen bleiben. Hinüberschauen. Hinter welchen Fenstern schläft sie? Letztes Jahr hatte auch er im Klebelsberg’schen Haus, das sowohl ein Palais wie ein Hotel genannt wurde, gewohnt. Abgesehen davon, dass die junge Witwe Levetzow die Lebensgefährtin des Grafen Klebelsberg war, hatte Ulrikes Großvater Broesigke im Palais ein ewiges Hausherrenrecht. In diesem Jahr wollte auch der Großherzog Carl August in Marienbad kuren, und da er mit den Familien Broesigke, Klebelsberg und Levetzow seit langem befreundet war, musste er in deren Haus wohnen. Und zwar im ersten Stock, in der Fürsten-Suite, die Goethe im Jahr davor bewohnt hatte. Carl August war bald seit fünfzig Jahren Goethes Landesherr, Goethes Chef und Goethes Freund. Goethe hätte wieder im Klebelsberg-Palais wohnen können, aber er hatte die Goldene Traube gegenüber vorgezogen. Und nach dem, was jetzt passiert war, musste er sich wundern über den weisen Instinkt, der ihn ins Haus gegenüber gelenkt hatte. Jetzt mit ihr unter einem Dach, aber getrennt durch Stockwerk und Wände. Er hätte irgend ein Geräusch erfinden müssen, das bis zu ihr gereicht hätte, um ihr zu melden, dass er da sei und nicht atmen könne, wenn sie nicht erfahre, spüre, höre, dass er da sei. Und nur für sie da sei. Sie hat ein kleines Gesicht. Trotzdem eine Nase, die man nicht Näschen nennen darf. Und zwetschgensteinförmige Augen, die eben die Farbe wechseln. Aber glänzen tun sie immer. Das hatte er schon aus den vergangenen Jahren mitgenommen: diese nie müden, nie matten, diese immerzu blau und grün leuchtenden Augen. Meistens sind sie doch nicht blau oder grün, sondern blaugrün. Er musste sich ihrem Mund zuwenden. Kein Lippengebirge, eine volle und ganz harmonisch verlaufende Oberlippe, die sich auf die bescheiden dienende Unterlippe verlassen kann. Fast ein bisschen einsam, dieser Mund in der unteren Gesichtshälfte. Die Nase bleibt auch für sich. Sie hat eine eher ahnbare als wahrnehmbare Brechung. Sie will einfach nicht spannungslos und langweilig gerade verlaufen. Wer nicht richtig hinschaut, glaubt, sie ende spitz. In Wirklichkeit endet sie in einer zuletzt noch gerundeten Spitze. Sie endet eben, wie eine Nase über diesem einsam schönen Mund enden muss: zu ihm hinführend, ohne ihm zu nahe zu kommen. Eine grandiose Unaufdringlichkeit hat dieses Gesicht. Hat die ganze Ulrike. Jetzt bereute er, dass er immer nur Landschaften und nie Menschen gezeichnet hatte. Dieses Ulrike-Gesicht ist allerdings auch das erste Gesicht in der Lebensgalerie seiner Gesichter, das er gern gezeichnet hätte. Es ist eine Landschaft im Licht. Wenn er kein Zeichner, sondern ein Maler wäre, hätte er gesagt: in einem überirdisch strahlenden Licht. Das könnte man malen, zeichnen nicht.
Er musste vor den großen Spiegel im Ankleidezimmer. Lampen auf beiden Seiten des Spiegels.
Der Wirt der Goldenen Traube war ortsbekannt als Lichtfanatiker. Er ließ keine Messe aus, auf der eine neue Lampenart zu erhoffen war. Das war eine Nachricht, die dem Geheimrat die Wahl dieses Hotels angenehm gemacht haben konnte. Er brachte die Hände auf dem Rücken zusammen, das ergab seine eingeübte, stattliche Erscheinung. Er musste hinüber ins Arbeitszimmer und aus einer Schublade die Wiener Zeitschrift holen, die ihm ein Herr Braun von Braunthal zugeschickt hatte, weil er, der einundzwanzigjährige Dichter, seinen Besuch bei Goethe in Weimar beschrieben hatte. Goethe lachte jedes Mal, wenn er in diesem Report den Teil las, und er las immer nur den, der sich mit seiner Erscheinung beschäftigte:
In jenem Augenblicke aber war mir das nicht die banale Hülle eines Zivilisationsmenschen; Goethe erschien mir da, indem er eine Sekunde lang bei der Türe anhielt und mich ins Auge fasste, wirklich wie ein Standbild des Zeus aus parischem Marmor. Dieses Haupt! Diese Gestalt! Diese Haltung! Schönheit, Adel, Hoheit! Bereits ein Greis von dreiundsiebzig Jahren, das wellenförmig um den starken Nacken fallende Haar weiß wie frischgefallener Schnee, die edlen Züge noch fest, die Muskeln noch stramm, die hochgewölbte Stirne glatt und rein wie von Alabaster, die Lippen mit dem unverkümmerten Ausdruck von Selbstgefühl, Würde und Milde zugleich, das kraftkündende Kinn noch ungesenkt, und endlich diese Augen, diese herrlichen himmelspiegelnden reinen blauen Miniatur-Bergseen! Von allen seinen Abbildungen, die mir bis dahin zu Gesicht gekommen, entsprach auch nicht eine dieser bewundernswerten Gesamtheit von Größe, Schönheit und Kraft; man konnte, im höchsten Aufwande der Kunst, solchen Verein wohl, wie es auch geschehen, plastisch gestalten, aber nie in einem Farbenbilde wiedergeben; dies ebenso wenig, als man den Monte Rosa oder Mont Blanc, verklärt von den Strahlen der untergehenden Sonne, zu malen vermag. So erschien Goethe, und mein Geist huldigte ihm. Wie pries ich mich glücklich, ein noch nicht bedeutender, ein angehender Mensch zu sein; wusste ich ja doch, dass er vielsagenden Männern, ganz fertigen Menschen bisweilen den Zutritt verweigerte, und sah ich ja an seinem Negligé, dass er bei mir entweder eine Ausnahme oder mit mir wenig Umstände machte. Er fasste mich ins Auge wie die königliche Boa Constrictor ein Reh. Nur zermalmte er mich nicht, sondern schritt langsam dem Diwan zu, dem «westöstlichen», mich mit sanfter Handbewegung einladend, ihm zu folgen und dann – o Wonne – an seiner Seite mich niederzulassen. Er begann mildernst das Gespräch, und dabei empfand ich durch alle Glieder einen wohltätig erschütternden elektrischen Schlag, der davon herrührte, dass der herrliche Dichtergreis meine Hand, meine vor Entzücken und Verehrung zitternde Hand, sanft erfasste und mit seinen beiden Händen weich umrahmte, wobei er, den Blick auf mir ruhen lassend, also sprach …
Er legte die Zeitschrift mit einander widerstreitenden Empfindungen in die Schublade zurück, ging wieder hinüber vor den Spiegel, lächelte ein wenig und sah die Lücke, in der einer seiner Vorderzähne fehlte. Seit dreizehn Jahren. Er hatte sich noch nicht daran gewöhnt. Allerdings hatte er seine Mundpartie so diszipliniert, dass die Lücke in Gegenwart von Leuten nie erschien. Hoffte er. Die Schwiegertochter Ottilie hatte er beauftragt, darauf immer zu achten und ihm, wenn die Lücke durch irgendwelchen Stimmungsübermut zu sehen gewesen war, Meldung zu erstatten. Er fand, Ottilie habe diese Meldungen immer mit etwas zu greller Lust exekutiert. Sich selber verbarg er die Lücke nicht. Wenn er allein war. Also jetzt. Es war Ulrike, die sie erscheinen ließ. Als hätte er, was jetzt passierte, vorausgewusst oder befürchtet, hatte er in seinem gerade herausgekommenen Mann von fünfzig Jahren geschrieben, mit so einer Lücke um eine junge Geliebte zu werben sei ganz erniedrigend.
Er ging ins Schlafzimmer, legte sich, wie er war, aufs Bett und suchte bei den Figuren seiner Bücher nach einem Satz, der ausdrückte, was ihn jetzt beherrschte. Es gab diesen Satz. Er hatte ihn aus dem Gedächtnis ziemlich schnell heraufgeholt. Sein Wilhelm hatte, schon als er noch jung war, gedacht: So ist denn alles nichts.
2.
Wenn er, 74, sie, 19, heiraten würde, wäre sie, 19, die Stiefmutter seines Sohns August, 34, und seiner Schwiegertochter Ottilie, 27. Mit solchen Rechnungen fand er sich beschäftigt, als er vor dem Frühstückstisch saß, für den Stadelmann jeden Morgen alles, was man sich wünschen darf, aus dem Traiteur-Haus holte.
Stadelmann, den er schon im vergangenen und vorvergangenen Jahr zu einem Stein-Kenner ausgebildet hatte, schickte er heute auf den Wolfsberg, um Augite herauszuklopfen. Auch ein Feldspat-Zwillingskristall wäre hochwillkommen, gab er ihm noch mit. Dem Schreiber John sagte er, dass heute erst um elf diktiert werde. Es hatte sich nämlich Dr. Rehbein angesagt, sein Dr. Rehbein, Hof-Medikus in Weimar, aber auch Arzt Goethes. Und hatte viele Stunden an Christianes Sterbebett verbracht! Noch nicht ein Jahr her, dass Dr. Rehbein die dritte Frau gestorben war. Dr. Rehbein war vielleicht der beliebteste Mann in Weimar.
Als Goethe in dem Zimmer, in dem er Gäste empfing, erschien, kam ihm Dr. Rehbein, der dort gewartet hatte, stürmisch entgegen. Gerade dass er Goethe noch Gelegenheit gab zu rühmen, wie gesund er sich hier fühle, von den Atemwegsmiseren des vergangenen Winters ganz und gar befreit, da sprudelte er los. Er will sich verloben. Er muss. Wenn er sich nicht sofort verlobe, verliere er Catharina, ja, die dreißig Jahre jüngere Catty von Gravenegg. Da er ohnehin dem Herzog habe vorausreisen müssen, bleibe nichts anderes übrig, als die Verlobung hier in Marienbad zu feiern. Das aber ohne Teilnahme des Herrn Geheimrat zu denken sei ihm nicht möglich. Für die unschöne Eile entschuldige er sich. Aber Catty. Sie verstehen. Er kann doch nicht hier der Durchlaucht den Badearzt spielen, was übrigens nicht erlaubt ist, die hiesigen Badeärzte haben das Monopol, gut, ist er eben ein Badegast im Gefolge Seiner Durchlaucht und so weiter, aber hier wochenlang spazierenschauen, und Catty braust durch München, das ist ungesund, also kommt sie, also gibt’s eine Verlobung. Gestehen müsse er aber doch noch, wie es ihn geschmerzt habe, jetzt im Mann von fünfzig Jahren zu lesen, der Chirurg sei der verehrungswürdigste Mann auf dem ganzen Erdboden.
Goethe ergänzte: Er befreit dich von einem wirklichen Übel. Dann umarmte er Dr. Rehbein sanft und sagte ihm fast ins Ohr, die Chirurgen-Rühmung sei doch nötig für die Handlung des Wanderjahre-Romans, zu dessen Bestand Der Mann von fünfzig Jahren gehöre. Und dieser Roman sei, obwohl vor zwei Jahren erschienen, alles andere als fertig. Täglich werde er von Sätzen und Figuren bedrängt, die dazugehören wollen. Und Wilhelm, der Held der Wanderjahre, soll doch, wenn er alle Angebote der Welt studiert und erprobt habe, Wundarzt werden, also Chirurg. Und warum? Weil der Autor seinem ein Leben lang beschriebenen Wilhelm den Beruf auf den Leib und in die Seele schreiben wolle, durch den er den Menschen am meisten helfen könne. Nützen, Herr Doktor. Vom Nützlichen durchs Wahre zum Schönen. Da wollen wir doch alle hin, Herr Doktor. Und hatte ihm gleich noch glaubhaft sagen können, dafür sei er, Dr. Rehbein, selber ein Beispiel. Wer, wie er, ein Arzt, mit fünfzig so wohl, so wirklich schön dastehe, der habe nichts versäumt, nichts falsch gemacht. Es folgte ein langer Händedruck.
Der Doktor war gegangen mit des Geheimrats herzlicher Zusage, dass er an der Verlobung gern teilnehme. Goethe saß und dachte: Dreißig Jahre jünger. Das war nicht Neid, was er empfand. Er fühlte sich durch diesen Besuch bestätigt. Ach ja, Neid auch. Was ist denn Neid anderes als eine zum Unglück verurteilte Form der Bewunderung. Es können sich jetzt gar nicht genug Fünfzigjährige mit Zwanzigjährigen verloben! Es soll eine Verlobungsepidemie ausbrechen. Einfach, dass er mit seiner ungeheuerlichen Zahl – 74 minus 19 ist gleich 55 – nicht ganz so absurd dasteht.
Wie belebend Dr. Rehbeins Besuch wirkte, sah er daran, dass er den Doktor, der ja jetzt über die Straße hinüber ins Palais Klebelsberg gehen würde, unter der Tür noch so beiläufig wie möglich gebeten hatte, drüben alle Levetzows zu grüßen, speziell Ulrike, und ihr auszurichten, ihr gestern geäußerter Wunsch sei noch heute Vormittag erfüllbar. Jederzeit. Er bemerkte, dass Dr. Rehbein als Bote nicht wusste, wie er das verstehen, also drüben sagen sollte, darum fügte er im Ton äußerster Unwichtigkeit hinzu: Man muss Kinder bilden, wenn sie danach verlangen. Dann beobachtete er, sich am Vorhang haltend, wie Dr. Rehbein über die Straße ging und drüben im Palais Klebelsberg verschwand.
Schreiber John wurde informiert, dass er nachher die Post erst ins Arbeitszimmer zu bringen habe, wenn das Fräulein von Levetzow da sei und Platz genommen habe. Vielleicht hatte Ulrike vergessen, dass sie gestern gesagt hatte: Aber wer ist er! Wenn sie das vergessen hatte, war es eine Floskel gewesen, dann war alles, ist alles eine Floskel, und er ist nichts als ein Illusionist. Kein Vulkanist, kein Neptunist, sondern ein Illusionist. Vielleicht gibt es ihren Blick gar nicht, vielleicht ist sie mit ihren neunzehn Jahren die Ruhigste, Bestimmteste, Unbewegbarste in dieser Familie.
Er musste kurz einen Schrei ausstoßen. Eine Verneinung dessen, was ihm gerade als Selbstgespräch passiert war. Gleich noch einmal diesen kurzen Schrei. Und weil es seine Gewohnheit war, alles, was ihm passierte, nicht nur passieren zu lassen, sondern sich bewusst zu machen, dass es ihm passierte, ließ er sein Selbstgespräch sich fortsetzen: Wenn ich Schreie ausstoße, kurze, nicht zu laute Schreie, dann immer so, dass nur ich meine Schreie höre. Ich will wirklich nicht, dass jemand außer mir hört, dass ich schreie. Überhaupt: Noch musste er nicht schreien. Nur sitzen und warten. Wenn sie nicht kommt, wird er hier sitzen und sich nie mehr rühren. Ein Mensch, beim Warten erstarrt. Er wunderte sich, dass der Schmerz, den das Warten ihm bereitete, ihn nicht zu irgendeiner Bewegung, einem auflösenden Hin- und Hergehen fähig machte. Das wollte er sich demonstrieren. Das war sein Zustand: Ulrike oder nichts. Er, bitte, er hier jetzt, der nicht mehr weiß, wie er ohne Ulrikes Zuspruch Atem holen soll, er hat im vergangenen Jahr im Kreis dieser Familie getönt, wie sehr er sich wünsche, noch einen Sohn zu haben, der müsste dann Ulrikes Mann werden, er selber möchte Ulrike so ausbilden, dass sie ganz zu seinem Sohn passe. Den, der so getönt hatte, so väterlich verlogen, kannte er nicht. Denn das war schon damals verlogen gewesen. Aber nicht moralisch verlogen, sondern ein Schwächeausbruch, eine Lebensfeigheit. Nie mehr könnte er so etwas sagen. Aber Ulrike war damals auch noch nicht Ulrike gewesen. Eine mädchenhafte Eingeschlafenheit war sie, aber jetzt … aber immer noch schmucklos. Nackt der Hals, die Ohrläppchen. Hatte sie im letzten und im vorletzten Sommer auch keinen Schmuck getragen? Vielleicht weil das Wetter zu schlecht gewesen war. Aber jetzt, in diesem gewaltigen Sommer! Wollte sie sich unterscheiden von all den mit Schmuck behangenen Frauen?
Da kam sie. Ein fast farblos grünes Kleid, das ihre Figur mit vielen kleinen Knöpfen genau nachzeichnet. Den runden Ausschnitt mit Spitzen besetzt. Ihre Haare immer ein bisschen loser als alle anderen Frauen. Er konnte mühelos aufstehen. Sie grüßte. Fast munter. Das war nicht seine Stimmung. Auf jeden Fall konnte er diesen Ton nicht mithalten. Aber als sie auf dem Sofa saß, in einer Sofa-Ecke, einen Arm auf dem großen gelben Kissen, da konnte er hin und her gehen und reden wie zu mehreren. Gleich kam auch der Schreiber John, reichte das Tablett, auf dem die Post sich häufte.
Ach die Post, sagte er. Ach nein, lieber John, wenn man solchen Besuch hat, liest man keine langweiligen Briefe. Ach, bleiben Sie, ich will meinem Besuch doch noch zeigen, wie es hier zugeht. Oh, Moment, da ist sogar etwas Eiliges. Sehen Sie, sagte er zu Ulrike, so genau sind wir eingestellt auf einander, dass mein guter John die einzige Post, die keinen Aufschub duldet, oben drauf legt. Dringend ist das, weil die Königliche Hoheit in sieben Tagen Weimar verlässt, also muss heute noch dieses Schreiben hinaus. Bitte, John. Darf ich, fragte er noch zu Ulrike hin.
Sie müssen, sagte sie.
Diktierend ging er vor Ulrike auf und ab: Unsers gnädigsten Herrn Königliche Hoheit haben Unterzeichnetem zu eröffnen geruht, dass Höchst Dieselben den guten Bergrat Lenz bei seinem bevorstehenden Jubiläum mit einigen fürstlichen Geschenken zu erfreuen die Absicht hätten, wozu nachstehende Gaben vorläufig bestimmt seien. Die Festlichkeit werde in einem Gastmahl bestehen. Nun wären meine unvorgreiflichen Vorschläge: Als Hauptstück stellt man den Vesuv dar, eine starke Lava ausgießend; unter diesem könnte die Medaille Platz finden, die der Gefeierte erhalten soll. Er unterbrach und fragte Ulrike: Verstehen Sie?
Ulrike wollte wissen, was unvorgreifliche Vorschläge seien.
Das sei eine höfliche Umschreibung für ein nicht eigenmächtiges Vorwegnehmenwollen.
Und was heißt das, fragte Ulrike.
Mein Vorschlag soll nur ein Vorschlag sein, entscheiden soll der Großherzog. Verstehen Sie, Bergrat Lenz ist leidenschaftlicher Neptunist, und zu seinem Jubiläum wird ihm zum Dessert eine Vulkantorte serviert, auf deren Grund er die Medaille findet, die ihm verliehen wird. Allerdings soll der Großherzog bei seiner Entscheidung meinen Vorschlag schon mitwirken lassen.
Ulrike: Aber eben unvorgreiflich.
Goethe: Genau.
Ulrike: Ein wunderbares Wort. Ich werde die Mutter heute bitten, nicht schon wieder das grelle Blaue anzuziehen, mein unvorgreiflicher Vorschlag wäre: das Hellbeige.
Goethe: Und sie wird gehorchen.
Ulrike: Also ist unvorgreiflich eine Art Befehl.
Goethe: Die höflichste Art, etwas dringend zu wünschen.
Ulrike: Und noch wichtiger, es ist ein Kompliment, der andere fühlt sich inbegriffen. Ich traue ihm zu, dass er mich ganz und gar versteht. Das schmeichelt ihm. Der Herr Geheimrat ist raffiniert.
John, wir hören für heute auf.
John ging. Goethe setzte sich neben Ulrike aufs Sofa und sagte, er möchte alles, was er je zu ihr sage, unvorgreiflich nennen. Das werde ihm den Mut geben, mehr zu sagen, als er dürfe. Darf ich Sie unvorgreiflich einen Augenblick zur Königlichen Hoheit machen?
Ich bin in einem nachrevolutionären Internat erzogen worden, sagte Ulrike, Königliche Hoheit sind gespannt.
Goethe sprang auf, ging vortragend hin und her: Eine geziemend treue Bitte wäre noch übrig. Möchten Höchst Dieselben mich mit fortdauernder Huld beglücken, meiner wohlwollendst gedenken und mir bei nächster Zukunft Gelegenheit zu mannigfaltigster Mitteilung gnädigst gewähren.
Er stand vor ihr, wäre gern auf die Knie gesunken, wusste aber, dass das Aufstehen misslingen konnte. Sie reichte ihm ihre Hand zum Handkuss. Er hielt ihre Hand ungebührlich lange, berührte aber den Handrücken mit seinen Lippen nur ganz wenig. Fast nicht.
Ulrike sprang auf. Ach, Exzellenz, sagte sie, was so eine Revolution alles kaputt macht.
Und er zurück im Umgangston: Ganz unvorgreiflich möchte ich jetzt sagen, dass ich meine Zeit nur noch mit Ihnen verbringen möchte.
Noch wüsste ich nicht, sagte sie, was ich dagegen haben sollte.
Ihre Art, mit mir zu reden, sagte er, weckt in mir etwas. Ich kann es, will es, kaum dass es sich rührt und regt, nicht gleich benennen. Aber es fühlt sich belebend an.
Sie müsse hinüber, sagte sie, um der Mutter den unvorgreiflichen Vorschlag zu machen.
Gehen Sie. Jede Sekunde Ihrer Gegenwart ist … eine … Revolution. Ich habe Angst.
Sie sah ihn an, sagte nichts.
Jetzt sind Ihre Augen grün, sagte er. Rein grün.
Ich finde Angst nicht schlimm, sagte sie in einem lauten, harmlosen, nichtsnutzigen Umgangston.
Und er: Es wäre schön, einen Menschen zu haben, der genau die Angst empfindet, die man selber hat. Das wäre Nähe. Das wäre die Nähe selbst.
Oh, sagte sie, das ist wieder so ein Satz von Ihnen. Einen Menschen haben, der genau die Angst empfindet, die man selbst hat. Exzellenz, darf ich sagen, was ich denke?
Wer mir nicht sagt, was er denkt, beleidigt mich, sagte er.
Schon wieder so ein Satz. Von Ihnen. Ihre Sätze wirken auf mich immer so endgültig. Kein Nachdenken mehr möglich oder nötig. Es ist, wie es ist beziehungsweise wie Sie es gesagt haben. Ich finde den Physik- und Chemieunterricht immer am spannendsten, weil da etwas passiert. Es kommt etwas heraus. Durch eine Versuchsanordnung. Wenn wir, natürlich nur Sie und ich, mit Ihren Sätzen oder überhaupt mit Sätzen, die diesen Geltungston haben, experimentieren würden, wäre das unerlaubt oder interessant?
Und er: Je unerlaubter, um so interessanter.
Schon wieder so eine Satzhoheit, sagte Ulrike, lachte aber ganz fröhlich. Also, sagte sie dann, bevor Sie weitere Erlasse erlassen, vielleicht waren Sie zu lange Staatsminister, komme ich jetzt und sage: Alle diese Sätze sind, wenn man sie umdreht, genau so wahr.
Goethe konnte nicht weniger fröhlich sagen, dass Ulrikes Satz an Gesetzhaftigkeitsdrang seine Sätze bei weitem übertreffe.
Aber, sagte Ulrike, ich trete sofort den Beweis an, dass das Gegenteil genau so wahr klingt. Ich sage nicht, ist, sondern klingt.
Ich bitte darum, sagte er.
Sie: Es wäre schön, einen Menschen zu haben, der genau die Angst nicht hat, unter der man selber leidet.
Er: Weiter!
Sie: Wer mir sagt, was er denkt, beleidigt mich. Bitte, Exzellenz, nicht jetzt prüfen, ob das mit Ihrer Erfahrung sich decke, nur, ob es genau so wahr klinge wie das Gegenteil.
Ulrike, sagte er, Sie werden mir auf die erwünschteste Weise gefährlich. Bitte, drehen Sie diesen Satz nicht um. Für heute reicht es.
Grollen Sie jetzt, Exzellenz?
Ulrike, sagte er, im Augenblick wäre ich imstand, mein Leben für verpfuscht zu halten, weil ich Sie nicht hatte.
Ulrike sagte, das klinge, ohne dass es wahr sein müsse, herzerwärmend.