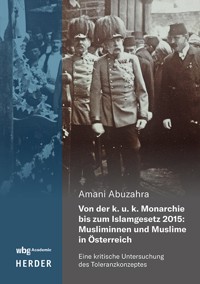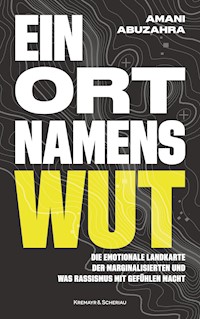
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wut ist nicht gleich Wut. Sie hat viele Gründe: Ungerechtigkeit, Rassismus, Sexismus. Das Ausleben dieser Emotion ist allerdings nicht allen gleichermaßen möglich. Während "besorgte Bürger:innen" ihren Ärger auf Demos kundtun, wirken wütende Marginalisierte in der Öffentlichkeit oft zu laut, zu fordernd, zu bedrohlich. Was aber tun mit Wut, die nicht sein darf? Welchen Raum bekommen wütende Marginalisierte? Und was liegt unter und hinter dieser Wut, die von Ausgrenzung erzeugt wird? Amani Abuzahra stößt in ihrer bestechenden Gesellschaftsanalyse auf Gefühle wie Angst, Scham, Trauer und Erschöpfung, zeichnet eine emotionale Landkarte der Marginalisierten und zeigt, dass Wut nicht nur ein Gefühl mit riesigem Potenzial, sondern auch ein Ort ist, der für alle ein Kraftzentrum sein kann – wenn wir den Mut haben, es zuzulassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AMANIABUZAHRA
DIE EMOTIONALE LANDKARTEDER MARGINALISIERTEN UNDWAS RASSISMUS MIT GEFÜHLEN MACHT
Für Baba & Mama. Für meine Eltern.
Ich bin euch dankbar für die Wegweisungen.
Für den inneren Kompass,
der mir Halt für das Außen gibt.
Für die Entwirrungen dieser verwirrenden Welt.
INHALT
VORSPANN: RASSISMUS & GEFÜHLE
GESCHICHTEN DER WÜTENDEN
MÜCKENSTICHE
EMOTIONEN & LANDKARTEN
EMOTION WUT
WUT – HASS – SCHMERZ
EMOTION ANGST
WUT DER MARGINALISIERTEN
LANDKARTE DER MARGINALISIERTEN
EMOTION TRAUER
ERSCHÖPFUNG DER UNTERPRIVILEGIERTEN
ÜBER PAUSEN: EIN WEG AUS DER ERSCHÖPFUNG
ABSPANN: ÜBER WUT
ANMERKUNGEN
„Please don’t disturb my peace if you’re at war with yourself.“1
VORSPANN:RASSISMUS & GEFÜHLE
Gefühle sind legitim. Wut ist legitim, vor allem in einem System, zu dessen Grundpfeilern Rassismus und Sexismus gehören. Aber nicht allen wird Wut und das Ausdrücken dieser Emotion zugestanden. Dabei dienen Emotionen als Wegweiser und navigieren uns durch das individuelle wie kollektive Leben. Was bedeutet es also, eingeschränkt und reduziert zu werden?
Dieses Buch ist ein Plädoyer dafür, Gefühle2 und Rassismus ernst zu nehmen, die Wut ernst zu nehmen und auch das, was Rassismus mit den Gefühlen Marginalisierter macht. Uns selbst ernst zu nehmen. Erst die Erkenntnis, das Zur-Sprache-Bringen ermöglicht es, etwas zu verändern und uns auf das Bekämpfen von Missständen einzulassen.
Ich analysiere nicht Emotionen als solche, sondern im Kontext von Rassismus: Was also Rassismus mit uns als fühlenden Wesen macht. Wie sich unser Menschsein zeigt beziehungsweise zeigen darf. Ich nehme zum Beispiel nicht Freude oder etwa Höhenangst in meinen Fokus, sondern Gefühle, die in gesellschaftliche patriarchale Verhältnisse eingebettet sind, die von Sexismus und Rassismus geprägt sind. Emotionen also, die im Kontext der Interaktion primär marginalisierte Menschen betreffen.
Marginalisierte und Privilegierte erleben und fühlen die Welt höchst unterschiedlich. Gibt es in unserer Gesellschaft eine „emotionale Norm“? Gefühle, die für die einen legitim und normal sind? Emotionen lassen sich nicht von Kontext, Handlungen und Lebenswelten trennen. Sie sind stets in Machtdynamiken zu verstehen. Dem gehe ich auf den Grund.
Nicht alle Gefühle werden allen zugestanden – vor allem die Wut nicht. Megan Boler beschreibt die Dominanzgesellschaft3 als eine „feeling power“. Die Art und Weise, wie Weiße4 fühlen, wird als „normal“, als die Norm angesehen und akzeptiert. Weinen weiße Menschen, rücken sie mit ihren Sorgen und Ängsten in den Fokus und erhalten Empathie. Bringen Marginalisierte ihre Sorgen und Ängste zum Ausdruck, heißt es: „Sei nicht so empfindlich!“
Scheinbar kommt es darauf an, wer seine Gefühle zum Ausdruck bringt. So wird Wut bei Marginalisierten diszipliniert, kriminalisiert und sanktioniert, denn ihre Wut wirkt als Bedrohung der vermeintlichen Norm. Wütende Marginalisierte werden klein gehalten, lächerlich gemacht, um ihnen die Bedrohlichkeit zu nehmen. Oder aber die Marginalisierten unterdrücken selbst ihre Wut, denn wer will schon als Gefahr gebrandmarkt werden? Wenn man als vermeintliche Bedrohung aufgefasst wird, geht es um die Existenz.
Wir Menschen sind mit einem lernfähigen Gehirn ausgestattet. Früher ging man davon aus, dass diese Lernfähigkeit ab einem bestimmten Alter, spätestens der Adoleszenz, abnimmt. Inzwischen wissen wir dank der fortgeschrittenen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Neuroplastizität um die Umbaufähigkeit (strukturelle Plastizität) des Gehirns.5 Neue Bahnen können entstehen dank verschiedener Erfahrungen: Der Fachausdruck dazu lautet „experience-dependent plasticity of neuronal networks“6. Das bedeutet aber auch, dass Nervenzellen je nach „Benutzung“ wachsen oder verkümmern. Je nachdem, wie wir unser Gehirn „nutzen“, welcher Beschäftigung wir nachgehen, können neue „neuronal pathways“ entstehen. Und damit Wege des Fühlens und Denkens. Das Netzwerk der Neuronen im Gehirn verändert sich im Laufe unseres Lebens. Um zu verstehen, warum manche emotionale Pfade häufig, andere wiederum selten genutzt werden, gilt es, auch die Gesellschaft zu betrachten.
Was braucht es für eine Neuausrichtung unserer neuronalen Wege und damit Emotionen? Ändern wir unsere Lebensweise, ändert sich das Netzwerk der Neuronen in unserem Gehirn. Und damit unsere Gefühle.
Was also tun, wenn wir wiederholt die Erfahrung machen, gekränkt zu werden, wenn wir Wut und andere Emotionen nicht so zeigen können, wie wir fühlen? Unsere Bedürfnisse zurückstecken? Marginalisierte finden sich in einer Gesellschaft wieder, die komplex Fühlenden kaum Raum gewährt. Die rassistisch-belehrenden Debatten seien zu erdulden. Wo haben dann unsere Gefühle Platz? Welchen Weg bahnen sie sich?
GESCHICHTEN DER WÜTENDEN
DER „ORIENTALE“
Es ist der 19. Februar 2020 in Hanau (Deutschland), ein Abend, der für Armin Kurtović und seine Familie alles verändert. Sein Sohn Hamza und acht weitere Menschen werden von einem rechtsextremistischen Attentäter ermordet. Der Vater sucht währenddessen seinen Sohn in der ganzen Stadt: am Kiosk, in der Shisha-Bar, im Krankenhaus, bei der Polizei. Bis er schließlich vom Tod seines Sohns erfährt. Es vergeht über eine Woche, bis er sich von seinem Sohn verabschieden kann. Im Bericht der Obduktion, die übrigens nicht mit der Familie abgesprochen war, wird Hamza als „südländisch-orientalisch“ beschrieben. Dabei ist Hamza blond, hat blaue Augen. Fremdgemacht, bis in den Tod. Zu Lebzeiten hat er Diskriminierung erlebt, wie sein Vater erzählt:
Er ist viel kontrolliert worden von der Polizei in den vergangenen Monaten. Einmal kam er nach Hause und war richtig wütend über eine Kontrolle. Ich habe ihm damals gesagt: „Reg’ dich nicht auf, die Polizisten machen auch nur ihren Job.“ Aber er war wirklich sauer. „Warum machen die ihren Job immer nur bei mir? Weil ich eine Jogginghose trage? Was wollen die?“, hat er gefragt. Wir hatten eine kleine Diskussion, er ist rausgestürmt. Und dann kam er noch mal zurück ins Zimmer und sagte: „Du verstehst das nicht, Papa. Aber irgendwann, irgendwann wirst du es verstehen.“ Ich habe verstanden. Das würde ich ihm gern sagen.7
Hamza Kurtović wurde nicht nur Opfer eines rassistischen Anschlags, sondern auch von Behördenversagen. Tage nach der Ermordung seines Sohns schickten die Behörden dem Vater den Ausländerbeirat, einen Dolmetscher sowie einen Migrationsbeauftragten vorbei. Ihm, Hamzas Vater, der Deutsch spricht, laut Gesetz Deutscher ist, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt.
DIE „AGGRESSIVE“
„Wissen Sie, was Ihr Problem ist, Frau Abuzahra?“, keift sie ins Telefon. Die Veranstalterin eines feministischen Events ist sehr ungehalten, aufgebracht und laut. Ihre Frage ist keine Frage – die Antwort schiebt sie nämlich gleich hinterher: „Ich sage es Ihnen. Sie sind aggressiv!“ Selten, dass ich sprachlos bin, aber in diesem Moment muss ich schlucken. Sie schiebt mir eine Emotion zu, die ich bis jetzt nicht fühle, die sich aber mit ihrer Aussage langsam aufbaut. Sie spricht aggressiv mit mir und greift mich mit verschiedenen Unterstellungen an. Ich hätte keine Inhalte zu liefern, lediglich gute Medienarbeit, PR ohne Expertise quasi. Warum wurde ich dann überhaupt angefragt, auf ihrem Mega-Event zu sprechen? Ich fühle Wut in mir aufsteigen. Wut, weil ich ungerecht behandelt werde. Mein Vergehen?
Ich hatte es „gewagt“, die Assistentin nach einem Honorar zu fragen, an sich nicht unüblich für eine Public Speakerin. Ihre Assistentin, die mich für das große Event gewinnen wollte, meinte allerdings auf meine Nachfrage zu Vergütung, es sei sehr knapp mit dem Budget und kaum mehr etwas davon über, weil bereits andere Speaker:innen gebucht seien. Sie würden allerdings viel Wert darauf legen, ihre Speaker:innen medial zu pushen. Eben das wirft mir die Dame am Telefon gerade vor. Paradox.
Ich recherchiere zum Event im Internet und finde die Homepage, die bereits das Programm ankündigt: ausschließlich weiße Frauen, die auf einer großen Bühne über Feminismus und die Zukunft sprechen sollen. An Dreistigkeit kaum zu überbieten, aber mit dem Telefonat, das auf mein Mail folgt, kommt schließlich das Totschlagargument: Ich sei aggressiv, daher wolle man mich nicht mehr einladen.
DIE „WUT-MUSLIMA“
Asma Aiad, eine Künstlerin und Aktivistin, war in den Sommerferien mit einer Reisegruppe junger österreichischer Musliminnen in die Türkei gereist. Sie nutzten die Urlaubszeit, um ein Land zu erkunden, kulinarisch und kulturell aufzutanken. Gemeinsam reisten sie von Istanbul zurück nach Wien. Sie landeten am Flughafen in Schwechat und bewegten sich wie alle anderen Reisenden in die Ankunftshalle. Dort wurden die Pässe kontrolliert. Eine junge Frau der Reisegruppe von Asma Aiad wurde vom Beamten hämisch befragt, ob sie „eh nicht zwangsverheiratet wurden“.
Kopfschütteln auf Seiten der reisenden Frauen. Sie hatten gerade einen erholsamen Urlaub hinter sich, waren noch nicht mal eine Stunde in ihrem Land zurück und wurden schon mit Klischees, Vorurteilen und Fremdbestimmung konfrontiert. Die Betroffene beschwerte sich, woraufhin der Grenzbeamte erwiderte, er hätte sich nur einen Spaß erlaubt. Als ein anderer Reisender sich einmischte und den Polizisten fragte, wo da der Spaß sei, erwiderte der: „Was mischen Sie sich ein? Ich bestimme hier, was Spaß ist und was nicht. Sind sie ein Verwandter?“
Diese Entgleisung und Grenzüberschreitung eines Beamten ließen die Frauen nicht auf sich sitzen. Sie wehrten sich über den Amtsweg und brachten eine Beschwerde ein. Asma Aiad machte den Vorfall unter dem Titel „Willkommen zurück in Österreich! Willkommen zurück zum Rassismus“ publik. Viele solidarisierten sich mit den Betroffenen. Medien nahmen den Vorfall auf und berichteten darüber unter dem Titel „Wut-Muslima“.
Asma Aiad, die sich beschwerte, um ein Fehlverhalten aufzuzeigen, wurde als wütend dargestellt, als „Wut-Muslima“8 bezeichnet. Zum rassistischen Übergriff am Flughafen kam also die zutiefst misogyne Berichterstattung darüber hinzu.
WUT-STORIES
1„Samstags waren wir immer bei einem ägyptischen Familientreff im ersten Bezirk. Meistens blieben wir bis spät in die Nacht. Ich schlief dann oft am Sofa dort ein. Mein Vater weckte mich, ehe wir losfuhren. Es muss so 1 oder 2 Uhr früh gewesen sein. In der Landgutgasse wurden wir von Polizisten zur Seite gewunken. Es waren insgesamt drei.
Mein Vater kurbelte das Fenster runter.
‚Haben Sie etwas getrunken?‘, fragte ihn der Polizist. Er erwiderte, dass er Muslim sei und deshalb nichts trinke. Daraufhin der Polizist: ‚Jo eh, des sogn’s olle – aussteigen!‘
Der Satz hat sich in mein Hirn gebrannt, wie auch alles, was folgte. Ich weiß noch, dass ich Angst hatte, weil ich nicht wusste, was jetzt mit meinem Vater passieren würde. ‚Enta rayeh feen?‘ (Wo gehst du hin?), fragte ich meinen Vater.
‚Nur Kontrolle‘, antwortete er, um mich zu beruhigen. Der Polizist ging mit meinem Vater zum Kofferraum. Wenige Meter hinter ihnen standen die beiden anderen Polizisten, die miteinander flüsterten. Ich beobachtete alles vom Rücksitz aus. Papa sollte das Warndreieck herzeigen. Meine Unordentlichkeit habe ich von ihm geerbt, dementsprechend heftig wühlte er. Er war beinahe mit dem ganzen Oberkörper im Kofferraum verschwunden. Neben ihm der Polizist, der grinste und zu seinen Kollegen zurückschaute. Ich weiß noch, dass ich mich umschaute. Drüben bei der Tankstelle standen drei Männer, die rauchten. Ich drehte mich wieder um und schaute nach hinten. Mein Vater kramte noch immer. Plötzlich bewegte sich der Kofferraumdeckel nach unten. Der Federmechanismus war kaputt. Das ganze Auto war sowieso schon etwas älter. Der Kofferraumdeckel war also auf dem Weg, mit voller Wucht auf den Rücken meines Vaters zu knallen. Dieser bekam das natürlich nicht mit. Der Polizist neben ihm aber sah, wie sich der Kofferraumdeckel langsam senkte. Ich sah ihn an, während ich an das Heckfenster klopfte, um meinen Vater aufmerksam zu machen. Der Polizist reagierte nicht auf mein Klopfen. Ich wollte ihm doch nur sagen, dass er seine Hand ausstrecken und den Deckel auffangen solle. Das tat er aber nicht. Stattdessen verzog er das Gesicht zu einer Grimasse der Schadenfreude, die sich ebenso in mein Hirn eingebrannt hat und machte zwei Schritte zurück, während er zusah, wie der Deckel auf den Rücken meines Vaters knallte. Ich hörte nur einen kurzen, stumpfen, erstickten Laut von meinem Vater, einem großen und festen Mann der alten Schule, der nie gelernt hatte, Schmerz zu zeigen. ‚Männer weinen nicht‘, sagte er immer zu mir. Aber jetzt wollte ich weinen, aus dem Auto stürmen und dem Polizisten wehtun … so, wie er meinem Vater wehgetan hatte. Die Polizisten hinten lachten. Der vordere lachte ebenso und drehte sich zu ihnen um, als mein Vater dann endlich das Warndreieck fand und es herzeigte.“9
2Saime ist mit ihrer Freundin abends unterwegs, sie freuen sich, den Arbeitstag gemeinsam ausklingen zu lassen. Sie wollen Pizza essen gehen. Da kracht es plötzlich neben ihnen, sie ducken sich reflexartig und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Das war doch ein Schuss?! Sie sind verwirrt. Wer würde auf sie schießen? War es tatsächlich eine Waffe? So klang es zumindest. Sie erhalten kurz darauf die Bestätigung: Sie finden am Boden neben ihnen ein Projektil. Jemand hat tatsächlich auf sie geschossen. Im Wohngebäude war ein Fenster geöffnet, ein Mann war flüchtig zu sehen.
Sie haben Angst, zittern, knien neben einem Auto, wo sie Schutz suchen. Die Angst macht ihnen das Atmen schwer, ihr Brustbereich zieht sich zusammen. Angst schmerzt nachweislich. Sie fühlen den Schmerz. Sie leben die Angst. Wo ist ihre Angst auf der emotionalen Landkarte der Gesellschaft zu finden? Wie viel Beachtung wird ihr geschenkt? Wie ernst werden sie genommen? Werden sie in ihren emotionalen Bedürfnissen aufgefangen?
Sie wenden sich noch in derselben Nacht an die Exekutive. Die Polizei allerdings belächelt das Ganze – dabei sollte sie alarmiert sein. Beide Frauen tragen ein Kopftuch und sind damit eine Projektionsfläche für das Ausmaß an grassierender Islamfeindlichkeit. Saime bleibt mit ihrer Freundin beharrlich, lässt sich nicht abwimmeln und erstattet Anzeige.
3Es laufen die Anmeldungen für das neue Schuljahr. Im Herbst ist es so weit, dann kommt auch Leyla endlich in die Schule. Sie freut sich auf die erste Klasse, aufs Lernen und auf die Lehrer:innen. Ihre Mama hat ihr erklärt, dass man sich dafür in einer Schule anmelden muss und die Direktorin sie kennenlernen will. Leyla ist dreisprachig aufgewachsen: mit Türkisch, Deutsch und Bosnisch. Sie hat auch sehr bald begonnen, sich fürs Lesen, Schreiben, Malen zu interessieren. So kommt es, dass sie schon vor Schulbeginn sowohl Türkisch als auch Deutsch und Bosnisch lesen kann. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist zurzeit die Weltkarte… Länder und deren Hauptstädte mit dem Zeigefinger zu entdecken.
Dann, am besagten Tag, als Mutter und Tochter in der Schule zur Anmeldung erscheinen, kommt alles anders als erwartet. Statt einer Anmeldung zum Schulunterricht bekommt Leyla als zukünftige Schülerin den Status „außerordentlich“ verpasst. Die Muttersprache sei Türkisch und Leylas Name klinge fremd. Das sei Grund genug, so die Direktorin, sie im Laufe des Schuljahrs noch nicht zu benoten, sondern zuerst „adäquat“ zu fördern, damit sie schließlich den Status „ordentliche Schülerin“ erreiche. Die Mutter erhebt Einspruch, macht darauf aufmerksam, dass ihre Tochter drei Sprachen sprechen, schreiben und lesen kann – und das alles bereits ein halbes Jahr, bevor überhaupt die Schule beginnt. Und dass Leylas Mutter selbst Germanistik studiert. Doch all das tut wenig zur Sache.
4„Ich heiße Hamza, aber alle im Kindergarten nennen mich Hamster“, erzählt mir der Junge. „Weißt du, mein Name ist nämlich zu schwer für sie.“
„Und mich nennen alle Afrika“, sagt sein Freund. „Weil ich Schwarz10 bin.“
Ich traue meinen Ohren nicht.
„IF YOU ARE NOT ANGRY, YOU ARE NOT PAYING ATTENTION.“
Wie wütend sind Sie, wenn Sie diese Geschichten lesen? Wie nah sind sie an Ihrer Lebensrealität? Wie sehr entsprechen sie Ihrer eigenen Lebenswelt? Wie viel Wut mussten Sie hinunterschlucken? Wie viel Wut war gesellschaftlich in Ordnung zu zeigen?
Wut wird zum Gradmesser für Ungerechtigkeit, Grenzüberschreitungen, Ausgrenzung, Behördenversagen und Ausschluss. Menschen, die marginalisiert werden – und jene, die zwar nicht selbst betroffen sind, aber dieses Unrecht spüren –, empfinden angesichts dieser Umstände Wut und finden sich an diesem Ort wieder, der auf der emotionalen Landkarte anzeigt: so nicht! Die rassistischen Erlebnisse sind Marker auf der emotionalen Landkarte und wenn man hineinzoomt, wird sichtbar, dass individuell viel Schaden entstanden ist. Zoomt man aus der Landkarte der Emotionen heraus, wird wiederum deutlich, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches, strukturelles Problem handelt. Wut als Reaktion auf diese vielen Marker ist dann nicht mehr länger eine persönliche Angelegenheit, kein individuelles Gefühl, sondern ein kollektives.
Ein anderes Leben ist möglich, sowohl individuell als auch kollektiv. Wut hat das Potenzial, uns dorthin zu navigieren.
MÜCKENSTICHE
Vor einigen Jahren übernachtete ich in Salzburg in einem Hotel. Den Abend davor war ich zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Es war spät geworden. Daher bediente ich auch mich als eine der Letzten beim Frühstücksbuffet. Am Nebentisch hörte ich ungewollt ein Gespräch mit, als die Chefin mit einer jungen Frau sprach, die scheinbar gerade neu in den Betrieb gekommen war:
Chefin: „Dein Name klingt so anders. Türkisch?“
Die Auszubildende bejaht.
Chefin: „Was arbeitet denn dein Papa? Deine Mama ist ja sicher Hausfrau.“
Auszubildende: „Nein, meine Mutter arbeitet. Mein Vater ist zu Hause.“
Die Chefin reagiert erstaunt, doch dann scheint ihr ein einleuchtender Gedanke zu kommen: „Also ganz der Pascha?“
Auszubildende: „Nein, er darf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten.“
Der US-amerikanische Psychiater Chester Middlebrook Pierce, Mitglied der Gruppe „Black Psychiatrists of America“, beschrieb diese sozialpsychologischen Phänomene bereits 1970 als Mikroaggressionen. Es handelt sich hierbei um subtile, nicht immer offensichtliche, passiv-aggressive, rassistische, sexistische, klassistische Aussagen. Sie haben stets dieselben Konsequenzen: Menschen werden in ihrer Identität herabgewürdigt, in Frage gestellt und es wird eine Trennlinie zwischen „hier“ und „dort“, zwischen „uns“ und „den anderen“ gezogen. Sie ist zwar imaginär und konstruiert, aber trotzdem sehr wirkmächtig. Was ist mit „dort“ gemeint? Wie viele Marginalisierte dachten sich nicht schon, was für ein toller Ort „dort“ sein müsse, wenn man „hier“ dieses und jenes nicht machen dürfe, es sich nicht gehöre, nicht üblich sei?
Wie viele Menschen wurden in ihrer Herkunft nicht schon zu Unrecht jenseits der Landesgrenzen verortet? In einem Seminar während meines Masterstudiums zu Intercultural Studies hatten wir uns vorzustellen, woher wir kämen. Mit der Frage kann man mich üblicherweise jagen, wenn sie deplatziert ist. Aber in dem Kontext freute ich mich. Toll, wir würden in dem Studium in die Tiefe gehen und kritisch das Konzept der Herkunft hinterfragen. Dachte ich.
Ich saß in der ersten Reihe. War also die erste, die der Professor aufrief. Ich erzählte, ich sei aus Wien angereist, das Studium fand in Salzburg statt. Der Professor fragte nach, naja, woher ich eigentlich käme? Amstetten, antwortete ich. Das genügte ihm offensichtlich nicht. Nein, ursprünglich, wollte er wissen. Gmunden, zählte ich weiter auf. Dort hatte ich eine Zeitlang im Internat gelebt. Auch diese Antwort stellte ihn nicht zufrieden. Da erst erkannte ich, worauf er hinauswollte. Es musste wohl ein Ort jenseits der österreichischen Landesgrenzen sein. Einen Striptease meiner Familiengeschichte hatte er sich erwartet. Der Gipfel der Frechheit war für mich erreicht, als ich bemerkte, dass er niemand anderen aus der Studiengruppe nach deren Herkunft fragte. Diese Frage war also keine Frage, sie zielte ausschließlich auf Bestätigung ab. Auf die Bestätigung der eigenen Vorurteile, Stereotype und Rassismen.
Und das ließ ich nicht auf mir sitzen. Also fragte ich ihn, woher er denn käme. Er war verwundert. Naja, eh von hier, meinte er. Dieses berüchtigte „Hier“. Ich hakte nach, was denn „hier“ genau zu bedeuten habe? Er nannte ein kleines Dorf in Oberösterreich. An der Umkehrung der Fragerichtung wurde ihm erst bewusst, wie intim, wie persönlich seine Fragestellung war. Diese Spiegelung empfehle ich seitdem immer wieder, wenn ich Erfahrungen mit Grenzüberschreitungen berichtet bekomme. Wenn jemandem unangenehme Fragen gestellt werden, sollte die Person diese einfach dem Gegenüber ebenfalls stellen und den Lernraum eröffnen, was solche Fragerei auslöst – und damit zugleich den Machtmissbrauch des Fragenden unterbrechen. Wer fragt, gibt vor.
Mit solchen Fragen wird Menschen vermittelt, dass sie nicht hierhergehören. In diesem kurzen Dialog kommt es zu einer Fremdverortung auf zwei Ebenen. Zum einen ist es eine fremde Person, welche die Zuschreibung durchs stete Nachfragen vornimmt, zum anderen wird man in der Definition und durch das Infragestellen als fremd markiert.
Fremde werden erkennbar gemacht, indem bestimmte Differenzmerkmale (wie etwa Türkisch, weil Französisch sprechen ist en vogue) zu etwas Fremdem erklärt werden. Die Reduzierung des Menschen auf ein bestimmtes Merkmal birgt eine unermessliche Gefahr für das gesellschaftliche Klima. Es entsteht der Impuls, der in Europa als bereits überwunden galt: Menschen aufgrund ihrer (religiösen) Gesinnung unter Beobachtung zu stellen und dies an ihrer Kleidung und Sprache festzumachen. Das öffnet Tür und Tor für Missbrauch, Generalverdacht und Verleumdung.
Diese kleinen und unscheinbaren Aussagen und Erlebnisse sind wie Mückenstiche. Man wird gestochen, es ist erträglich, das bisschen Jucken. Aber es bleibt nicht dabei, bald folgt schon der nächste Mückenstich. Und wieder einer. Und wieder einer. Bis es zu viel wird. Das Jucken. Das Kratzen. Und dann entstehen Wunden. Die schlecht heilen durch das viele Kratzen. Und dann folgt schon der nächste Stich. Das sind Mikroaggressionen.
Derald Wing Sue ist ein Psychologieprofessor chinesischer Abstammung, wuchs in einem reichen, weißen US-amerikanischen Wohnviertel auf. Er erlebte von klein auf Ungerechtigkeit und Vorurteile, wie zum Beispiel Lehrer:innen, die ihm seine Berufswünsche im Sozialbereich ausredeten, weil „Chinesen sozial nicht so stark sind“. Diese Erfahrungen prägten ihn nachhaltig. Seine Vorbilder waren Malcom X und Martin Luther King Jr., die ihn zu seiner Forschung an der Columbia-Universität inspirierten. In den 1970er Jahren verwendete der US-amerikanische Professor Chester M. Pierce den Begriff Mikroaggressionen, der von Sue Jahrzehnte später aufgenommen und weiter ausgeführt wurde. Sue unterscheidet drei verschiedene Formen der Mikroaggression11:
Da wären erstens Mikroangriffe, ein Herabwürdigen von nichtweißen Menschen, sowohl verbal als auch nonverbal. Hierbei handelt es sich um blanken Rassismus. Menschen werden als fremd markiert und aufgrund ihrer ethnischen, religiösen, kulturellen, sprachlichen Identität sowie ihrer Hautfarbe diskriminiert. Es sind offensichtliche Übergriffe und rassistische Beschimpfungen.
Die zweite Form sind Mikrobeleidigungen, die subtiler und versteckter sind als die offene und direkte Herabsetzung. Ignoriert und nicht ernst genommen zu werden fällt auch in diese Kategorie.
Als wir einmal in einer Gruppe in der Wachau wandern waren, kehrten wir ein und jausneten beim Heurigen. Viele andere Gäste saßen um uns herum auf den andren Bänken und genossen wie wir die Zeit im Grünen. Alle Sitzbänke waren belegt. Als wir fertig waren, ging die Gruppe schon mal vor. Ich saß also allein – mit viel Platz und wartete auf den Kellner, um zu zahlen.
In der Zwischenzeit kamen weitere Gäste. Doch es war kein Tisch mehr frei. Sie schauten sich um und fragten schließlich eine kleine Gruppe, ob sie sich dazu setzen dürften.
Danach kam eine weitere Familie, dann eine dritte und schließlich eine vierte, die sich jeweils zu anderen dazu setzten. Als ich endlich zahlte, machte sich eine der Familien auf den Weg, um den frei gewordenen Platz von mir einzunehmen. Sie hätten sich von Anfang an hersetzen können, ließ ich sie wissen. Sie waren verlegen. Irritiert. Sie meinten lediglich, es sei ihnen nicht bewusst gewesen. Für mich allerdings eine weitere schmerzliche Erfahrung, gemieden zu werden.
Die dritte Form sind Mikroentwertungen, sie bezeichnen ein Entwerten beziehungsweise Negieren der Perspektive Marginalisierter. Erfahrungen von Betroffenen werden dabei nicht ernst genommen, Übergriffe werden kleingeredet oder die Wahrnehmung den Marginalisierten sogar abgesprochen. Wie oft bekommt man nicht in Diskussionen erzählt, man werde auch diskriminiert, wenn man als weiße Person verreise und in anderen Ländern urlaube. Man wisse, wie sich das anfühlt, und so schlimm sei es dann auch wieder nicht.
Diese verschiedenen Formen der Mikroaggressionen, Fragen wie: „Wieso kannst du so gut Deutsch?“, „Bist du zwangsverheiratet worden?“, „Darf ich deine Haare anfassen?“, „Durftest du dir deinen Mann selbst aussuchen?“, „Ist dir nicht heiß mit Kopftuch?“, „Deine Mama muss arbeiten und dein Papa sitzt wie ein Pascha zuhause rum?“ sowie das Nicht-Gesehen-Werden, das Nicht-Gehört-Werden, das Ignoriert-Werden; all das macht wütend.
EMOTIONEN & LANDKARTEN
Diese Wut ist aber keine, die aus dem Nichts kommt. Keine, die nicht berechenbar ist. Im Gegenteil, zu viele rassistische Erfahrungen prägen Marginalisierte, zu viel negative mediale Berichterstattung über Geflüchtete in diese Richtung ebnet eine Bahn, die es leicht macht, in Wut zu verfallen. Beim Aufwachsen in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft höhlt der stete Tropfen den Stein. Erinnerungen kommen hoch, Emotionen werden wach. Der Körper reagiert.
Emotionen hinterlassen in bestimmten Körperregionen ihre Spuren. Gefühle aktivieren unseren Körper sehr unterschiedlich, so das finnische Forscher:innenteam unter der Leitung von Lauri Nummenmaa an der Universität Aalto12. Emotionen zeichnen den Körper. Sie finden also nicht nur im Kopf statt. Während Freude den ganzen Körper einnimmt, aktiviert Scham den Kopfbereich. Trauer hingegen ist wie ein Kälteschock, der Körper wird kalt und zeigt kaum Reaktion. Bei der Liebe wird wiederum ein größerer Teil des Körpers aktiviert. Das Ergebnis der Studie war: Jedes Gefühl hat ein spezifisches Aktivitätsmuster. Wie eine topografische Landkarte lässt sich also auch eine emotionale Landkarte des Körpers zeichnen. Dabei liefern Emotionen wertvolle Informationen über unseren mentalen, körperlichen, geistigen, sozialen, intellektuellen Zustand.
Der Emotionsforscher Thomas Hülshoff beschreibt Emotionen als ein mehrdimensionales Geschehen: „Emotion kann als körperlicher Zustand, als seelische Empfindung oder als ein unser Denken und Handeln bestimmendes Phänomen wahrgenommen werden.“13 Sie bereiten uns auf kommende Ereignisse vor. So kann es durchaus sein, dass sich auf dem Weg zu einem wichtigen Termin Panik ausbreitet: Hände werden schwitzig, Schweißperlen tropfen von der Stirn, Herzklopfen, wir sind nervös. Unsere Gefühle aktivieren das Nervensystem. Hierfür ist die Amygdala in unserem Gehirn verantwortlich. In brenzligen Situationen wird sie aktiv. Widerfährt uns eine Kränkung, eine Ungerechtigkeit, werden wir unfair behandelt, dann ruft das die Reaktion der Wut hervor. Hierfür hat sich zunächst die Amygdala eingeschalten, die den Hypothalamus aktiviert und dieser versetzt den Körper in Alarmbereitschaft.
Jede Emotion hinterlässt Spuren in unserem Gehirn: in Form eines neuronalen Netzwerks. Je öfter wir uns bei einem Gefühl aufhalten, umso stärker wird diese neuronale Bahn. Je öfter wir bestimmte Erfahrungen machen, die spezifische Emotionen auslösen, umso nachhaltiger sind die strukturellen Änderungen im Gehirn. Was wir dann wahrnehmen, sehen, ist nur bedingt eine Spiegelung unserer Welt, sondern primär eine Reaktivierung unserer emotionalen Erfahrungen. Emotionen und Wahrnehmung beeinflussen einander wechselseitig.
Emotionen formen also unsere Wahrnehmung. Jede negative Erfahrung – und das sind Rassismuserlebnisse nun mal – gräbt sich in unser Gehirn ein. Dies wiederum ebnet eine Wahrnehmungsstrecke im Gehirn, die uns hellhörig, vorsichtig und misstrauisch werden lässt. Um uns zu schützen. Denn Ausgrenzung gräbt sich nicht nur in unser Gehirn, sondern vor allem auch in unser Leben.
Daraus können wir schließen: Rassismus ist anstrengend, schränkt enorm ein und raubt wertvolle Zeit!