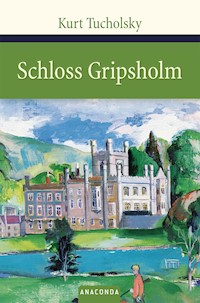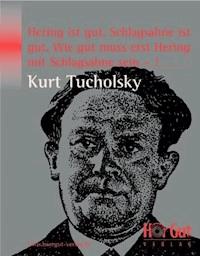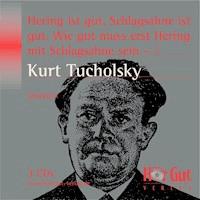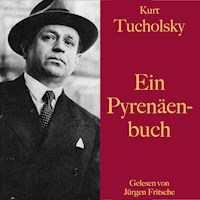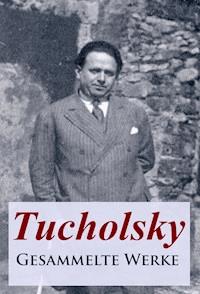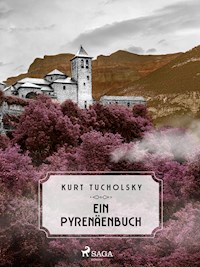
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf eine sehr humorvolle und lebendige Weise nimmt uns der Autor mit auf eine Reise durch die Pyrenäen, auf der wir die Kultur, Bauernvölker, Stierkämpfe und die wundervolle Landschaft kennenlernen. Er beschreibt detailgenau seine Begegnungen und Erlebnisse und schließlich auch die Reise zu sich selbst. Durch immer wieder auftretende geistreiche Reflexionen und amüsante Anekdoten bekommt der Leser einen vollkommenen Einblick in die Reise durch die Gebirgskette.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Tucholsky
Ein Pyrenäenbuch
Saga
Ein Pyrenäenbuch
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1927, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728015452
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Dem Andenken
Siegfried Jacobsohns
DER BEICHTZETTEL
Geographie hatten wir beim roten Gierke. Der Mann war ein Lehrbeamter mit vielen kleinen Äderchen im Gesicht, die ihm ein kupferrotes Aussehen gaben; wegen seines Spitznamens hatte er sich anstandshalber einen roten Bart umgebunden. Er mochte uns nicht, und wir mochten ihn nicht. Er galt für falsch und rachsüchtig, Klassenurteile sind immer richtig – es wird schon gestimmt haben.
„Hast du Geographie gemacht?“ – „Ich habe keine Ahnung!“ – Wovon sollte ich auch eine Ahnung haben? Das kümmerliche Geographiebuch verzeichnete ein paar Namen und stotterte in holprigem Deutsch etwas von „Bodenbeschaffenheit“ und „Sardinenhandel“, der Rote hatte dazu mit einem Rohrstock an der Karte entlanggestrichen, und die Klasse hatte korrekt geschlafen.
„Wir kommen nunmehr zu den Pyrenäen“, sagte der Rote. Ich weiß nicht, ob er heute noch dazu kommt – aber bis auf das schöne Wort „Maladetta“, was kein Fluch, sondern ein Berg ist, habe ich nichts behalten. Es ist alles wie ausgelöscht. Das gute Schulgeld –! Die schöne verlorne Zeit –!
„Pyrenäen“ – das war so eine rostbraune Sache auf der sonst grünen und schwarzen Karte, darin standen ein paar Bergkleckse, rechts und links gefiel sich die Karte in Blau, das war das Meer . . . Ja, und sie trennten Spanien und Frankreich. Auch mußte man jedesmal ein kleines bißchen nachdenken, bevor man den Namen schrieb.
Dies waren die wissenschaftlichen Kenntnisse, die mir die deutsche Schule in bezug auf die Pyrenäen mitgegeben hatte.
*
Aber der Rote lehrte nicht nur Geographie, sondern auch Geschichte, und da ging es wesentlich muntrer her. Eswar eine Mordsgeschichte, in der es nichts wie Schlachten, Fürsten und Staaten gab. Was ein Staat war, hatte er uns nie erklärt, aber das Leben holte das rasch ein. Wenn man zum Beispiel in die Pyrenäen fahren will, braucht man einen Paß.
Die europäischen Staaten fordern zur Zeit noch Eintrittsgeld, und das kann ihnen niemand verdenken. Autorität übt man am besten dem Schwachen gegenüber aus – Dem, der keinen Fußtritt zurückgibt, wenn der armselige verschuldete Popanz die Fahne hebt . . . Bauern, die für ihren ganzen Besitz soviel Steuern bezahlen wie ein Schreibmaschinenfräulein, Aktiengesellschaften, die, wenn es ans Zahlen geht, nur mit ihrer französischen Bezeichnung „Sociétés Anonymes“ auftreten . . . das arme Luder muß sich doch ein Mal, ein einziges Mal fühlen! Der Ausländer ist eine schöne Gelegenheit.
Über die Kuppen und Grate der Pyrenäen hinweg läuft jene kleine gekreuzelte Linie: die Grenze. Der Fall lag wunderschön kompliziert: ich wohne in Paris, und es waren drei Mächte zu bemühen: Deutschland, Frankreich und Spanien. Ich bemühte sie.
Es kostete: vier Arbeitstage sowie zweihundertachtunddreißig Francs. Die Sache spielte sich in Liebe und Freundschaft ab: niemand benahm sich irrsinniger, als ihm seine Vorschrift das vorschrieb, es wurden nicht Kniebeugen noch Freiübungen verlangt, auch vom Einzelvorbeimarsch wurde allgemein abgesehen. Regiert wurde ich bei den Deutschen von einem sehr wohlschmeckenden großen Mädchen, bei den Franzosen von einem höflichen, staubigen Mann, bei den Spaniern von einem Botschaftssekretär und zwei dunkelgetönten Konsularbeamten. Jeder stempelte, trug in Bücher ein, schrieb und fertigte aus, ließ von unbekannten Mächten, die hinter geschlossenen Türen thronten, unterschreiben – –
Das Ministerium des Innern ordnet an, das Ministerium des Äußern mischt sich ein, die Grenzüberwachimg weiß von allen beiden nichts und macht ihre Dummheiten selbständig.
So, genau so, war einst die Herrschaft der Kirche.
Ein Mann ohne Beichtzettel war ein verlorner Mann, ein ausgestoßner Mann, eine unmögliche Erscheinung, ein Auswurf. Der Geist war von Jugend an in das Eisenkorsett des Glaubens eingezwängt worden, so daß er gar nicht anders denken konnte. „Hat er den richtigen Glauben?“ Allenfalls verstand man noch, daß er den falschen hatte – aber gar keinen? Davor bekreuzigte der Gläubige erst sich und verbrannte dann den andern.
Und die Hexenrichter waren keine schwarzen schleichenden Schufte, wie der aufgeklärte Liberalismus sie so oft abgebildet hat – es waren anständige reputierliche Leute, mit einem ordentlichen Studium hinter sich, einem festen Pflichtenkreis um sich, einer geachteten Laufbahn vor sich . . . Trommelten die Trommeln, brodelte das Volk auf den großen Plätzen, surrten die Gebete der Mönche um die Verurteilten – sie sahen das mit ruhigen Augen an. Die Feuer brannten, die Schreie stiegen zum Himmel auf, wie hätte das anders sein können? Das mußte so sein.
Es mußte so sein, weildas mittelalterliche Europa an einer Sache hing, die es von Natur aus nicht gab, sondern die sich der Mensch erst gemacht hatte: an der Kirche. Wer hing am Kreuz? Der Gläubige selbst: röchelnd, mit herausgequollenen Augen, in seiner Bewegung gehemmt, an die Hölzer gebunden, glücklich, gestützt, nicht allein – so hing er da.
Und steht heute auf, sieht das Kreuz mit langem Blick an, schüttelt sich und geht –?
Er ist von einem Kreuz zu einem andern gelaufen.
Er stiert auf die Fahnen wie ein Huhn, das man mit der Nase vor den Kreidestrich gehalten hat, unbeweglichen Auges, er sieht nur das. Hat er die richtige Staatsangehörigkeit? Allenfalls versteht man noch, daß er die falsche hat, aber gar keine –? Davor schrickt der Polizeimann zurück und jagt den andern davon.
Und sie sind so stolz auf ihre Beichtzettel!
Von den Reichen beachtet und benutzt, von den Angestellten als Krippe geliebt, tausendmal verkauft an die wahren Gewalten der Erde, deren Grenzen ganz, ganz anders laufen als es die Geographiebücher angeben, machtlos, wo wahre Macht ihm gegenübersteht: so bläst sich der Staat auf und hat das scheußlichste getan, das es gibt, dem praktischen Zweck eine sittliche Idee anzukleistern.
Offen zugeben, daß die Bergpredigt für ihn nicht gelte, daß die vom Individuum geforderte Moral für ihn nicht gelte, daß die einfachsten, altruistischen Gebote für ihn nicht gelten, will er Gott verdrängen und sich an seine Stelle setzen. Und glückt das nicht, so stellt er sich hinter das noch aufrechte Kruzifix, und der Betende weiß nicht, vor wem er kniet. Drücke die Schwachen – aber schwenke die Fahnen! Bestrafe die Kranken – aber liebe den Präsidentensitz! Schände die Heimat – aber achte den Staat! Und keiner, keiner ist ohne Beichtzettel.
Gibt es keinen? Gibt es denn nicht wenigstens ein paar Tausend in Europa, die unberührt davon bleiben, wenn sich die Unteroffiziere ihrer Länder in die fettigen Haare geraten? Muß uns das berühren, daß die Stahlindustrie des einen Landes die Kohlen des andern braucht? Daß man dafür Kriegslieder geheult, Menschen geblendet, Tiere zerrissen, Häuser zerknallt, Gebete gebetet, bekannte Soldaten geprügelt und unbekannte Soldaten beerdigt, Generale sauber rasiert und Arbeiter mit Artillerie beschossen hat – muß uns der Fibelvorwand berühren? Geht uns der fingierte Grund etwas an? „Über die Köpfe hinweg, Bruder, reich mir die Hand –!“ Ich will keinen Beichtzettel haben, ich will nicht zur Beichte gehen, ich will nicht.
François, Gaston, René – ich liebe euch, nicht obgleich ihr Franzosen seid; ich liebe euch, nicht weil ihr Franzosen seid – ich liebe euch, weil ihr François, Gaston, René seid. Mich interessiert es nicht zu wissen, an wen ihr eure Steuern zahlt, wer bei euch an den Denkmälern die Reden im Gehrock hält, wer an euren Straßenecken den Verkehr behindert . . .
Die Feuerwehr ist ein nützliches Instrument im Leben der Gesellschaft. Ich bete nicht zur Feuerwehr.
Und da habe ich nun meinen Beichtzettel.
Ich sehe die blauen und roten Stempel an, blättre voller Bewunderung in unlesbareh Unterschriften und vielsprachigen Tintenklecksen, falte fromm die Hände . . . Dann stecke ich den Paß in die hintere Gesäßtasche und begebe mich auf die Reise in die Pyrenäen.
STIERKAMPF IN BAYONNE
Auf den weiten Feldern der Ganaderia, der Zucht, schweift Er, der König der Herde. Er weiß nicht, daß er sechstausend Francs kostet – aber daß er der unumschränkte Kaiser ist, der Alleinherrscher über die Jüngern und über alle Kühe – das weiß er. Er sieht keinen Menschen. Er läuft, wenn ihn die Lust ankommt, durch das saftige Gras, über kurzgebranntes Gras, er wälzt sich in duftigem Heu, grast, äugt . . . So vergehen die Jugendjahre – fern in einer Stadt lebt schon Der, der ihn einst töten wird. Er zieht die herbe Luft ein, die von den Bergen herunterweht, und brüllt.
Eines Tages kommen sie auf Pferden und mit dressierten Ochsen, den verschnittnen, dumpfen Ex-Stieren. Die wilde Herde wird getrieben, Er wird abgesondert, Er läuft mit den anderen mit . . . Und findet sich in einem Waggon wieder, in einem dunkeln, rollenden Stall. Von der Bahnrampe aus trottet die Herde, sorgfältig vor Neckereien beschützt, zu einem runden, hohen Haus. Vierundzwanzig Stunden steht er allein im Verschlag, gereizt, unruhig . . . Nachmittags um vier Uhr vierzig öffnet sich die Tür, die grelle Sonne scheint herein, er stürzt heraus . . . Und steht in der Arena.
*
Während sie ihn geholt hatten, war ich über Bordeaux gerollt, wo ich zum ersten und letzten Mal auf dieser Reise, im „Chapeau Rouge“, ein ernsthaftes Abendessen zelebrierte, mit einem Rotwein, weich wie Samt; fort von Bordeaux, über die große Garonnebrücke hinweg, mit einem letzten Blick auf den Hafen, wo das spanische Kriegsschiff mit den fixen Matrosen lag – nach Bayonne. Sonntag? Sonntag ist Stierkampf.
In Paris hatten sie sich im vergangenen Jahr sehr groß getan: es bestände ein Gesetz, wonach in Frankreich der Stierkampf mit Pferden und Tötung des Stiers verboten wäre – und wenn die Leute aus der Provence oder sonstwoher, im „Buffalo“ Stierkämpfe vorführen wollten, so dürften sie das keineswegs in der blutigen Version tun. Das taten sie auch nicht. Sie begnügten sich mit den provençalischen Stier-Spielen – da bleibt der Stier am Leben. Bayonne aber liegt so nahe an der spanischen Grenze, daß die bunte Farbe, womit auf den Atlanten Spanien angemalt ist, abgefärbt zu haben scheint; es sind auch so viel Fremde da, vorzüglich Spanier . . . In Lille, wo niemand den Wunsch danach verspürt, darf man nicht stierkämpfen, in Paris auch nicht. In Bayonne darf man.
Die hohe runde Arena liegt im Nordosten, etwas außerhalb der Stadt – ich war noch gar nicht recht zur Besinnung gekommen, wo ich denn eigentlich wäre, Fluß und Brücke (die Adour) lagen schon hinter mir, da war die ganze Stadt auf den Beinen und rollte, lief, spazierte, hupte und kutschierte zur Arena. Die Sonne schien nicht, der Himmel war gefleckt blau und grau, die gesteckt volle Straße roch nach Staub und Blut.
Haben die Römer auf Steinstufen in ihren Arenen gesessen? Auch sie werden sich weiche Unterlagen mitgebracht haben – man kann Kissen mieten. Alle Welt klettert mit den kleinen Kissen über die Stufen, nimmt Platz, winkt, ruft, lacht . . . Eine schauerliche „banda“, die vorher rotbemützt die Stadt durchblasen hat, trompetet sich die Seele aus dem Hals. Stille. Tusch! Der „Präsident“ hat seine Loge betreten.
Jeder Stierkampf geht unter dem „Präsidium“ irgend eines Mächtigen vor sich – in Madrid ist es der König mit der Unterlippe, in den großen spanischen Provinzstädten der Präfekt, in den kleinen der Bürgermeister oder irgend ein uniformiertes Stückchen General – ihm und seiner Familie weihen die Kämpfer den Stier und das Spiel, ihre Geschicklichkeit und den Tod. Der Präsident ist da.
Der Herr Marquis ist mit seinen Damen aus Biarritz im Auto herübergekommen, nun tritt er an die Brüstung seiner Loge, die im Rang liegt, nimmt mit einer steifen Armbewegung den grauen Zylinder ab und begrüßt das Volk. Aber es ist ganz ausgeschlossen, daß der Filmregisseur Joe May diesen Mann auch nur dreißig Meter lang einen Grafen spielen ließe – er würde ihm vielleicht das Stativ zu tragen geben, aber als Komparse . . . nichts zu machen. Es ist so viel kleine Provinzeitelkeit auf diesem zerlederten Gesicht, der Ritter ist von seinem Schloß heruntergestiegen und begrüßt die lieben Leibeignen . . . Die Leibeignen vollführen einen großen Lärm und schwenken mäßig begeistert die Hüte. Der Graf aus SpanischBautzen setzt sich. Es darf anfangen.
Die Truppe hält ihren Einzug. Es ist etwas kümmerlich damit, gar so viel sinds nicht, und sehr blitzend sieht das alles nicht aus. Die ersten Kämpfer, deren einer vorhin in einem großen Landauer angerollt kam, in der vollen Pracht seiner Ausrüstung, mit dem runden aufgerollten Zöpfchen am Hinterkopf, sie alle knien vor der Präsidentenloge nieder, der Zylinder erhebt sich mit dem Marquis, Die unten murmeln die herkömmliche Formel – – Die Besetzung in der Arena und oben auf den Bänken – es ist nicht Madrid, das uns hier umfäng; die Kämpfe gehen zwar streng formell wie in Spanien vor sich – aber das Ganze ist doch Provinz.
Los.
Der erste Stier von den sechsen kommt aus dem Stall herausgebraust. Da steht er. Musik, das ungewohnte Brausen und so viel Menschen – was soll das? Das wird sich gleich erweisen.
„Juego do Capa.“ Die flinken Männer mit den roten Mänteln laufen vor der pathetischen Kuh auf und ab, sie schwenken die Tücher, hüpfen beiseite . . . Alles, was mit Vollkommenheit gemacht wird, sieht leicht aus. Das istgar nichts, denkt man und denkt falsch. Man vergißt, daß auf Alpenwegen und auch sonstwo diese schweren, kräftigen, großen Tiere dem Spaziergänger das volle Bewußtsein Dessen beibringen, was eigentlich ein Stier ist . . . Und Die da necken ihn wie ein Hundchen. Da kommen die ersten Pferde.
Es sind alte Kracken, gut für den Abdecker, abgearbeitete Kreaturen, die ihr ganzes Leben lang geackert, gezogen und getragen haben. Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert: ihre offenbar dieses Lohnes. Ein Auge hat man ihnen mit einem Tuch zugebunden, was ihnen ein sonderbar verkommnes, verludertes Aussehen gibt. Sie lassen an Pferde eines Strauchdiebes denken, an Landschenken im dreißigjährigen Kriege, nach einer erheblichen Schlägerei . . . Mitdem zugebundenen Auge der Innenseite des Kreises zugewendet, werden sie in die Arena geritten. Auf ihnen sitzt der Picador.
Aber ich habe immer geglaubt, der Picador sei ein Mann, der, beritten, mit dem Stier kämpft, ein Kampf, der dann manchmal für das Pferd ein böses Ende nähme . . . Der Picador ist ein Schlächter.
Niemand kann mit einem ausgewachsenen Stier kämpfen, der nicht vorher zwei, drei Pferde erledigt hat, und nimmt er sie nicht an, so ist das für den Toreador eine böse Belastungsprobe. Das, was der Stier mit den Pferden macht, ist eine große körperliche Anstrengung für ihn, er arbeitet sich mit dem besten Teil seiner Kraft erst einmal an diesen Opfern ab . . . Ein Mann in roter Bluse führt das erste Pferd am Zügel. Es schnaubt.
Der Stier sieht das Pferd an. Der Picador riskiert eine mutige Geste mit seiner Lanze. Der Stier nähert sich; der Rotblusige hält das Pferd noch immer fest, wendet die Breitseite dem Stier zu, damit Der es recht bequem hat. Er nimmt dankend an. Er geht – mit leichtem Anlauf – an das Pferd heran, kracht mit ihm zusammen und bohrt das rechte Horn in den magern Leib. Er senkt den Kopf tiefer, er wühlt darin herum, das Ganze sieht aus, als erfülle er ohne alle Leidenschaft eine unumgängliche Formalität. Das Pferd trappelt, so gut es kann, auf den freien Hufen, zwei schweben in der Luft. Dann zieht der Stier das Horn heraus.
Das Pferd ist unten offen. Einige Därme und etwas Schleim hängen aus ihm heraus, es möchte sich hinlegen. Nichts. Der Picador ist abgestiegen, macht die Steigbügel zurecht und steigt auf den Fetzen Pferd zum zweiten Mal. Der Stier soll noch einmal stoßen. Der Stier stößt noch einmal.
Nun baumelt dem Pferd ein graurosa Beutel zwischen den Beinen, einmal verfängt es sich in dem Geschlinge und tritt hinein. Der Picador ist abgestiegen . . . Und nun läuft doch wahrhaftig dieses gute alte Tier – immer ohne einen Laut – durch die ganze Arena, es möchte heraus, dahin, woher es gekommen ist, in den Stall, fort von hier . . . Man läßt es heraus. Und alles wendet sich wieder dem Stier zu.
Ich sehe mich um.
Ich kenne das, was in den Augen mancher Beschauer – und noch mehr: Beschauerinnen – liegt, wenn Breitensträter dumpf auf Samson-Körner boxt. Kein Sport ist vor Mißbrauch sicher. Hier ist nichts davon. Ich versäume die schönsten Kunststücke der Mantelleute, die mit dem Stier einen großen Fandango tanzen: in keinem Gesicht, in keinem Auge, in keiner Miene ist auch nur der geringste Blutrausch zu sehen. Sind diese Leute grausam?
So spricht der Weise:
„Ein anderer Grundfehler des Christentums ist, daß es widernatürlicherweise den Menschen losgerissen hat von der Thierwelt, welcher er doch wesentlich angehört, und ihn nun ganz allein gelten lassen will, die Thiere geradezu als Sachen betrachtend . . . Die bedeutende Rolle, welche im Brahmanismus und Buddhaismus durchweg die Thiere spielen, verglichen mit der totalen Nullität derselben im Juden-Christentum, bricht, in Hinsicht auf Vollkommenheit, diesem letzteren den Stab; so sehr man auch an solche Absurdität in Europa gewöhnt sein mag.“ Und:
„Man sehe die himmelschreiende Ruchlosigkeit, mit welcher unser christlicher Pöbel gegen die Thiere verfährt, sie völlig zwecklos und lachend tötet, oder verstümmelt, oder martert, und selbst die von ihnen, welche unmittelbar seine Ernährer sind, seine Pferde, im Alter, auf das Äußerste anstrengt, bis sie unter seinen Streichen erliegen.“ Denn:
„Man muß an allen Sinnen blind oder durch den foetor judaicus völlig chloroformiert sein, um nicht einzusehen, daß das Thier im Wesentlichen und in der Hauptsache durchaus das Selbe ist, was wir sind, und daß der Unterschied bloß im Accidenz, dem Intellekt liegt, nicht in der Substanz, welche der Wille ist. Die Welt ist kein Machwerk und die Thiere kein Fabrikat zu unserm Gebrauch.“
Daher:
„Nicht Erbarmen, sondern Gerechtigkeit ist man dem Thiere schuldig.“
Also keine Grausamkeit. Fühllosigkeit.
Neben mir sitzt ein hervorragend unangenehmer junger Herr, er ist mit zwei Brautens erschienen und hat einen gar großen Mund. „Ho!“ und „Ohé!“ schreit er, er erteilt Noten an Stier, Pferde und Matadore, er leitet die Sache gewissermaßen. Als der Stier einmal dringend in einem Pferd beschäftigt ist, ruft er dem Pferd hinüber: „Das hast du nicht gern, was? Das kann ich dir nachfühlen!“ – Mit dem setze ich mich ins Gespräch. Und er sagt, ganz und gar bezeichnend, in einem besonders scheußlichen Moment: „Mais regardez donc le toréador – le reste n’existe pas!“ – Nicht für ihn. Für keinen.
Immer noch Pferde. Der erste Stier ritzt eins auf und erledigt die zwei nächsten. Jetzt ist er böse und ermüdet. Und nun bekommt er es mit den Menschen zu tun.
Alles, was hier geschieht, hat seine jahrhundertalten Riten. Jede Bezeichnung, jede Bewegung, jede Möglichkeit ist traditionell. Zu dieser Tradition gehört die „suerte“ der Banderillas. Diese Piken, die dem wütenden Stier in den Nacken gesetzt werden, um ihn noch wütender zu machen, werden ihm vorher gezeigt; es ist ritterlich, ihn darauf aufmerksam zu machen, was nun kommt, und vielleicht interessiert es ihn auch. Der Banderillenmann stellt sich also zehn Meter vor dem Tier auf, dessen Flanken wie ein Blasebalg gehen, hebt die Piken hoch, senkt sie langsam, es ist, als wolle er den Stier mit zwei Zauberstöckchen beschwören: dann läuft er den Stier an. Es ist die graziöseste und eleganteste Bewegung, die ichin diesem Stierkampf gesehen habe: das Leben des Mannes hängt an zwei Zentimetern. Der Stier sieht ihn kommen, er schnaubt ihm entgegen, er stößt nach ihm – in die Luft, da hängen die Banderillas an seinem dicken Nacken, schwanken auf und ab, etwas Blut rieselt an ihnen herunter . . . Und der Läufer hat nur eine ganz kleine Bewegung gemacht, um dem Stoß auszuweichen, der eben erst die Pferde aufgeschlitzt hat.
Jetzt ist der Stier ernsthaft wütend. Er brüllt, klagend und drohend, er wirft mit dem Vorderfuß den Sand auf, versucht die langen Stäbe mit den Widerhaken abzuschütteln – und bohrt sie sich tiefer ins Fleisch. Wieder umspielen ihn die Mäntel der Capeadore, ein zweites Paar Banderillas wird ihm gesetzt, diesmal war der Läufer so dicht dran, daß er fast zwischen den Hörnern stand – das Publikum rast. Und nun noch ein drittes Widerhakenpaar. Inzwischen ist ein ruhiger Mann in der Arena vor die Präsidentenloge getreten.
Der Stier sieht nichts, denn er ist mit seinen Tüchern befaßt. Aber was da zwischen dem Präsidenten und dem Mann unten mit Kniefall und Zylindergruß ausgemacht wird: das ist der Tod. Der Mann läßt sich einen Degen und ein rotes Tuch geben.
Der Stier stürzt sich auf das rote Tuch wie ein Stier auf das rote Tuch. Der Mann hat kaum einen Schritt beiseite getan. Und nun zeigt er ihm den scharfgeschliffnen Degen. Der Stier sieht dumm herüber – er steht jetzt ganz nah vor mir, es ist ein schwarzes großes Tier, an der nassen Haut läuft das rote Blut in kleinen Bächen herunter. Alle paar Sekunden blitzt etwas Weißes in seinem Auge auf, wie ein Funke, ein Lichtschaum. Der Toreador geht auf ihn zu, zielt –
Da steht der Stier mit dem Degen oben im Rücken und seinen drei Paar Widerhaken und tobt. Ist das das Ende? Das Publikum ist begeistert – aber es ist nicht das Ende. Einen zweiten Degen, bitte.
Das ist das Ende. Die rötesten Mäntel bringen ihn nicht mehr zum Aufstehen, er brüllt dumpf, fällt zur Seite, zuckt . . . Aus. Gruß an die Loge, grauer Zylinder, Hüteschwenken, Bravo, Hoch und Dank, „L’Arrastre“: ein sechsfaches Eselsgespann schleift den Stier und die beiden Pferde hinaus. Der nächste.
Der nächste ist ein junger, aufgeregter Herr, der wie ein Bajazzo aus seinem Stall herausgepurzelt kommt. Er macht den Leuten viel zu schaffen, und das soll er ja wohl auch. Er zerstößt das Pferd, das ihm sein Vorgänger leicht angestoßen zurückgelassen hat, zu einem bösen Klumpen, der Picador fällt herunter, es geschieht ihm aber nichts.
Der Stier zerquält ein Pferd, so daß es sich schon nach dem ersten Stoß nicht mehr erheben kann – und da liegt es. Ich kann genau das Auge sehen, dieses große, sanfte Auge. Das Auge versteht nicht. Es sagt: „Warum? Warum?“ – Es dauert lange, bis der Mann mit dem kleinen handfesten Messer kommt, das schnell wie ein Keil in den Schädel geschlagen wird . . . es dauert so lange. Die Kapelle spielt, ein sanfter Walzer wogt über das sterbende graue Pferd hin, weich und schaukelnd – ich weiß, wie der im Sande ruhende Körper unten aussieht . . . Da kommt der Abdecker. Le reste n’existe pas.
Dieser Stier hat einen schweren Tod. Der Toreador verbraucht 6 (in Buchstaben: sechs) Degen, bis er ihn soweit hat – und das Publikum wird ungeduldig. „Schlächterei!“ schreien die fein empfindenden Leute. Weiße Taschentücher wehen zum Präsidenten hierauf – aber Der rührt sich nicht, sondern sieht, den Kopf auf die Brüstung gelehnt, gelangweilt zu. Seine Damen gucken gar nicht hin. Nun fällt der Stier. Erlöster, nicht einstimmiger Beifall.
Aber während alles um den sterbenden Stier beschäftigt ist, liegt an der Ostwand des Zirkus im Sand das graue Pferd. Sie haben es mit einer Decke zugedeckt, man sieht das Hinterteil und den Schwanz. Es ruht. Und mir ist, als glänze dieser Kadaver, mit einem sanften Schein um sich.
Der nächste.
Nummer vier will gar nicht aus dem Stall. Hohngebrüll in der Arena: „Feigling!“ Das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Er kommt, passiert die beiden Torwächter, die ihm zwei ganz kleine Haken applizieren . . . Dann machte er seine siebenundsiebzig Stationen durch.
So sechs. Schnaubende Mäuler, sich bäumende Pferde. Pferde, die nicht wollen, aber herangezerrt werden. Einmal ein Kunststück des Matadors: er sitzt, er neckt den böse gemachten Stier im Nacken, er rückt auf dem kleinen Holzstreifen, der die Arena innen wie eine runde Bank umgibt, immer näher an ihn heran, gibt ihm also die Zehntelsekunde vor, die er zum Aufstehen braucht – in diesem Spiel, wo es um die Zehntelsekunde geht . . . Und auch dieser Stier ist in einer Viertelstunde draußen, gezogen von Mauleseln mit den roten Pompons. Ein Torero, Emilio Mendez, steht wie eine Bildsäule, bevor er zusticht, in einer vornübergebeugten Haltung, leicht, wie auf dem Theater . . . Es ist ein dunkler, schwarzer Mensch, in diesem Augenblick sieht er genau aus wie Walter Hasenclever. Ein Stier wandelt mit einem Widerhaken im Nacken umher, als gehe ihn das Weitere nun nichts mehr an. Die Tücherleute machen die muleta: Kein Allotria! Hier! Sterben gehn! – Und da bequemt er sich denn.
Bei alledem ist kein Stierkämpfer ohne Schrammen und Wunden; bekommt ihn der Stier auch nur selten ganz zu fassen, so ritzt ihn doch oft das Horn. Was viel gefährlicher auslaufen kann als es den Anschein hat: ist das Horn vorher in den Eingeweiden der Pferde gewesen oder hat es auch nur Erde aufgewühlt, so riskiert der so leicht Verwundete den Tetanus.
Kurz vor Schluß gehe ich hinaus. . . Draußen umlagern die Kutscher, die Chauffeure, Knechte und Volk die Arena. Sie steht hoch gegen den Himmel und sieht auf einmal böse aus. Ein Stierkampf von draußen. . . Ich weiß jetzt, was da drin geschieht – ich höre es an den Schreien. Zunächst bleibt alles still. Jetzt, jetzt muß er an sein Pferd geraten sein, ich fühle den dumpfen Zusammenstoß bis hier her. Die Arena schreit. „Hjai!“ wie aus einer Kehle. „Hjai–!“ Und dann ein langes Brausen und wirres Rufen. . . Langsam schlendere ich durch die Wagen.
Sind das Lieblinge, die Toreadore! Die Spanier verehren ihre Stierhelden wie die Halbgötter. Der große Tenor der Arena, Nacional II, hat vor ein paar Tagen, nachdem sie ihm bei einer Meinungsverschiedenheit den Kopf mit einer Weinflasche eingeschlagen haben, ein Begräbnis gehabt wie ein General. Kein Pantheon wäre ihnen für die großen Männer zu schade. Nun, das ist wohl überall dasselbe – nur gibt es sich anderswo wissenschaftlicher, gebildeter, immer mit dem Kulturfortschritt im Prospekt. . . Herrgott aus Spanien! Wenn du Sonntag vormittags auf dein Land heruntersiehst, so steigen dir wohlgefällige Düfte in die Nase, süßer Weihrauch und die Lobreden deiner fetten Pfaffen. Wenn du aber nachmittags herunterhörst, so hörst du aus dreißig, vierzig Arenen: „Hjai –!“, hörst das Blasen der bandas, das wirre Rufen und das Brüllen der sterbenden Tiere. Jeden Sonntag. Im Jahre 1924, lieber Gott, waren es 248 Male, daß du das in Spanien hören konntest – und dabei sind nicht die simpeln Spiele mitgerechnet, die sich halbwüchsige Bauernknechte in kleinen Flecken mit den ganz jungen Tieren erlaubten. Nur die formellen: zweihundertachtundvierzig. In Frankreich für dasselbe Jahr: 16. Nicht viel – aber immer noch mehr als damals, als man im Jahre 1857 die Stierkämpfer zum Lande herausjagte. Das Verbot ist praktisch längst außer Kraft gesetzt. Sie sind alle wieder da. Und sie heiligen deinen Feiertag.
Da kommen die Leute zu Hauf aus dem Mordturm – wenn ich noch einen Wagen haben will, muß ich mich beeilen.
Eine Barbarei.
Aber wenn sie morgen wieder ist: ich gehe wieder hin.
AUSFLUG ZU DEN REICHEN LEUTEN
„Er ließ das Tier von oben rauschen
Und unter sich den Drachen lauschen
Und neben sich die Mäuse nagen,
Griff nach dem Beerlein mit Behagen –“
Wer weniger Geld hat, dem fehlen die materiellen Voraussetzungen, das Leben vollzu genießen. Sicherlich schlummern auch im Arbeiter unerlöste kulturelle Bestrebungen, aber Sie müssen nicht vergessen, Herr Ministerialrat, die Tiefergestellten wollen vielleicht, aber sie können nicht. Ich bitte Sie, was haben denn diese Leute für Interessen! Wer mehr Geld hat, ist ein Trottel. Er hat wohl materiell alles, was er braucht, aber ihm fehlt doch unsre Kultur. Die neuen Reichen, Herr Ministerialrat, können alle, aber sie wollen ja gar nicht. Ich bitte Sie, was haben denn diese Leute für Interessen!
Die armen Reichen. Sie haben wirklich keine gute Presse.
„. . . jene feierliche Ironie, die ich bei allen Leuten mit bescheidnem Einkommen bemerkt habe, mit denen ich in Beziehung stehe“ heißt es in dem reizvollen Tagebuch A. O. Barnabooths von Valéry Larbaud. Barnabooth ist ein Milliardär von gigantischen Ausmaßen. „Ich rede sie so ohne Hintergedanken an, von Mensch zu Mensch, ganz familiär, wie das zum Beispiel die Amerikaner lieben. Aber sie verbeugen sich, und wenn der Kopf ganz unten ist, stecken sie mir die Zunge heraus. Sie drücken mir die Hand wie auf einem Begräbnis, und ich fühle die ganze Verachtung, die sie für mich haben. Sie verstecken ihre Gefühle nicht einmal; denn wenn sie ihr hochachtungsvoll ergebenes Gesicht aufziehen, halten sie einen Milliardär für viel zu dämlich, als daß er etwa merken könnte, wie man ihm schmeichelt. Es sind sehr subtile Herrschaften. Ich habe erst geglaubt“, sagt der Milliardär, „daß diese stillschweigende Ironie das Grinsen des Neides ist. . . Aber nein, das ist kein Neid: es ist die Unfähigkeit, die Augen aufzumachen und über gewisse Vorstellungen hinauszusehen. Es ist einfach Beschränktheit.“
Denn weil sich jeder eine Welt macht, in deren Mittelpunkt er selber steht, so verneint er die der andern, deren Weltbild ihn etwa an die Wand klemmen könnte. So lieben denn silbergepunzte Demokratenfrauen die armen Arbeiter, die es nicht besser wissen, und verachten die reichen Milliardäre, die es nicht besser wissen. Reiche Leute haben eine gefügige Presse. Reiche Leute haben keine gute Presse.
In Biarritz kommen sie wild vor. Der nach Fischen riechende Winkel, als den Taine den Ort noch in den fünfziger Jahren angetroffen hat, ist durch den spanischen Adel und vorzüglich durch die Queen, der die englische Aristokratie todesmüde nachfolgte, erst zu Dem geworden, was es heute ist. Es liegt entzückend: die silbrig-blaue Küste mit Felsen, die kunstvoll durchbrochen sind, so daß man darin spazieren gehen kann, Blumenanlagen: es wächst da ein niedriger Baum mit hellgrünem, zartgefiedertem Laub, der sieht aus wie ein Mohrrübenbaum, und an bestimmten Stellen zu bestimmten Stunden geht es auch recht elegant her. (Das allgemeine Straßenbild ist es nicht.) Allerdings spielt sich das, was man unter „Biarritz“ zu verstehen hat, auf den Besitzungen der reichen Leute ab, in den Klubs, den Parks, den kleinen und großen Villen am Meer und in den Schlössern, die von der Küste entfernt liegen. Will man französische Eleganz beschreiben so muß man nie vergessen, daß die Begriffe „Kempinski“ und „Esplanade“ deutsche Begriffe sind, und daß Frankreich nicht das besitzt, was einmal ein sehr witziger Architekt mit dem Wort „Berlin hat eine Mittel-Volée“ bezeichnet hat. Die französische Mitte liegt in der äußeren Lebensführung und in den Ansprüchen wesentlich unter der deutschen, aber dafür gehts dann auch oben ganz hoch hinauf. Der große Reichtum. . . Davon kann ich nun wenig berichten. Nicht etwa aus Verachtung, sondern weil ich diesen Kreis des Lebens nicht abgeschritten habe, weil er mir fremd ist, weil meine finanziellen Mittel nicht ausreichen, ich mir also meine Nase an der Glasscheibe plattdrücken müßte. Mir ist es nicht selbstverständlich, im Hotel du Palais abzusteigen, der Apparat würde auf mir lasten, und ich käme über jene gequälte Ironie nicht hinweg, die der Reporter anwendet, um zu zeigen, daß ihm das alles in keiner Weise imponiert und daß er doch der bessere Mensch ist.
Nach Biarritz bin ich aus Pflichtbewußtsein gegangen. Die Photographien in den Zeitschriften hätten mich nicht gelockt: auf allen saßen die weißbehosten Tennisspieler mit ihren Damen, das Meer und das Auto im Hintergrund, sie saßen – wie ländlich! – am Wegesrand oder an kleinen Tischen mit Teekännchen und roten Sonnendächern.
Die Kurliste sagt, wer alles in Biarritz ist. Sie finden das in ihrer eleganten Zeitschrift, wenn die es nicht vorzieht, Heringsdorf zu photographieren. Die Mistinguett soll da sein. Aber Missia habe ich selbst gesehen, Missia, das dicke Stück aus dem Theaterchen „Perchoir“ zu Paris, eine himmlische, nicht mehr junge Person, mit einem Gesicht wie ein, sagen wir, Mond, einer Himmelfahrtsneese – und frech! Frech wie Anton. Sie geht mit einem jungen Mann über die Straße, tut recht vertraut mit ihm, und ich bin maßlos eifersüchtig. Ich auch. . .!
In dem kleinen Restaurant, wo ich das Frühstück nehme und beileibe nicht esse, da sitzt mit Papa und Mama und Brüderchen eine ganz junge Engländerin, einfach ein Kind, vielleicht fünfzehn, sechzehn Jahre. Sie hat ein bißchen Sommersprossen, einen langen Kopf, lange Finger – sie ist gar nicht hübsch. Aber sie ist unanständig, sie hat Das, was ältre Herren zu erheblichen Unvorsichtigkeiten verleitet, etwas Verdorben-Frauliches, sie lockt, einmal rasch hinter der Hoteltür, wenn Mama nicht hinseht. . . Vielleicht machts ihr gar keinen Spaß, aber sie hat in ihren verbotenen Büchern gelesen, daß es Spaß macht. Nun, man wird sie gut verheiraten, und dann wird es wohl vorbei sein.
Übrigens, das ist nun so in einem fernen Badeort ganz besonders hübsch, daß nicht alle zehn Schritt jemand auf der Straße wie angewurzelt stehen bleibt, einen mit idiotisch erfreutem Gesichtsausdruck ansieht und brüllt: „Nein –!“ Dergleichen ist Stenographie und heißt: „Traue ich meinen Augen? Sie sind es natürlich nicht, denn Sie können ja gar nicht in demselben Ort sein wie ich!“ Und dann gehts los, und der ganze Vormittag ist flöten.
Ciboure. Ich muß in die Réserve de Ciboure, das habe ich in Paris aufbekommen. Nicht in die Hotels, nicht zum Père Tolstoi, der mit schütterm Bart und schöner Tochter ein Nachtlokal leitet – ich soll in die Réserve de Ciboure. Wenn ich muß. . .