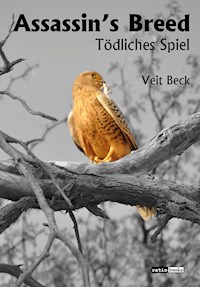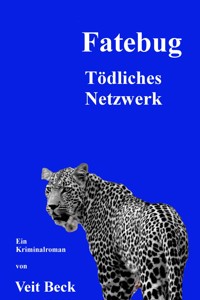Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag ratio-books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mindestens zwei Morde. Mehr als zwei Jahre. So lange sucht Hauptkommissar Weber schon nach dem Täter. Nun ist er überzeugt, ihn gefunden zu haben. Aber die Beweise werden nicht reichen, noch nicht. Daher will der Ermittler den Verdächtigen im Rahmen einer Vernehmung in die Enge treiben. Eine letzte Chance und ein riskantes Vorhaben. Denn der Verdächtige hat seine eigene Agenda, er hütet ein Geheimnis, dass er um keinen Preis enthüllen darf. Daher muss er den Kommissar nicht nur von seiner Unschuld überzeugen, sondern ihn gezielt in die Irre führen. Was als gewöhnliche Vernehmung beginnt, wird zu einem wilden Ritt durch die Abgründe unserer Gesellschaft. Und ausgerechnet einer der berühmtesten Philosophen der Geschichte, dessen Anliegen doch eigentlich die Aufklärung war, wird zum unfreiwilligen Komplizen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mindestens zwei Morde. Mehr als zwei Jahre. So lange sucht Hauptkommissar Weber schon nach dem Täter. Nun ist er überzeugt, ihn gefunden zu haben. Aber die Beweise werden nicht reichen, noch nicht. Daher will der Ermittler den Verdächtigen im Rahmen einer Vernehmung in die Enge treiben. Eine letzte Chance und ein riskantes Vorhaben. Denn der Verdächtige hat seine eigene Agenda, er hütet ein Geheimnis, dass er um keinen Preis enthüllen darf. Daher muss er den Kommissar nicht nur von seiner Unschuld überzeugen, sondern ihn gezielt in die Irre führen.
Was als gewöhnliche Vernehmung beginnt, wird zu einem wilden Ritt durch die Abgründe unserer Gesellschaft. Und ausgerechnet einer der berühmtesten Philosophen der Geschichte, dessen Anliegen doch eigentlich die Aufklärung war, wird zum unfreiwilligen Komplizen.
Veit Beck
Ein riskantes Vorhaben
Vollständige Taschenbuchausgabe
2024
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie
Erschienen im ratio-books Verlag als Imprint von
© Gedankenkunst Verlag UG, Düsseldorf
Grevenbroicher Weg 23, 40547 Düsseldorf
Text: © Veit Beck
Lektorat: Anja Koda
Cover Design: © Veit Beck
eISBN 978-3-96136-990-4
www.veitbeck.de
»Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren begriffen sey?«
Inhalt
Prolog
Dialog 1
Dialog 2
Dialog 3
Dialog 4
Dialog 5
Dialog 6
Dialog 7
Dialog 8
Dialog 9
Dialog 10
Epilog
Letzte Worte
Literaturhinweise
Prolog
»Ist das nicht zu riskant? Glauben Sie wirklich, das könnte funktionieren?«
»Wenn Sie eine bessere Idee haben, dann bitte …«
»Aber wenn wir ihn festnehmen, dann ist er gewarnt. Wenn er uns nichts sagt, wenn er sich nicht verrät, werden wir ihn nie mehr kriegen. Denn eins ist sicher. Dann wird er noch vorsichtiger sein. Oder aufhören. Glauben Sie denn, dass Sie ihn überführen können?«
»Ja, das glaube ich! Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es war. Aber ob die Beweise, die wir haben, vor Gericht ausreichen …? Da bin ich mir nicht so sicher. Klar, es mag Schöffen und Richter geben, denen das ausreicht. Wenn der Staatsanwalt geschickt und überzeugend ist, mag es vielleicht reichen. Aber wenn nicht, dann geht er uns durch die Lappen. Dann waren die ganzen Anstrengungen vergebens. Tausende von Stunden, über zwei Jahre. Für was? Für nichts.«
»Und wenn er die Aussage verweigert? Wenn er nur »Anwalt« sagt. Sobald ein Anwalt im Spiel ist, wird er ihm empfehlen zu schweigen. Er wird sich die Akten kommen lassen. Sich ansehen, was wir haben. Und sehen, dass es viel zu wenig ist. Dass es wahrscheinlich nicht für eine Verurteilung reichen wird. Dass Schweigen die beste Strategie für seinen Mandanten ist. Und das wars dann. Was macht Sie so sicher, dass es nicht so laufen wird?«
»Ich ermittle jetzt zwei Jahre in dem Fall. Die Aufklärung war ein mühsamer und langwieriger Prozess. Dabei gehörte der Mann die ganze Zeit zum Kreis der Verdächtigen. Wir haben oft mit ihm geredet, ich habe ihn dabei gut kennengelernt. Und ja, ich mag ihn nicht. Er war von Anfang an zu sicher, selbstgerecht, arrogant. Zeitweise schien es, als wenn er es genossen hatte, mit uns zu tun zu haben. Als wollte er uns spüren lassen, dass er mehr weiß als wir. Und dass wir das, was er weiß, nie erfahren werden. Und genau da werde ich ihn packen. Er ist ein Fanatiker. Seine Überheblichkeit wird ihn zu Fall bringen. Wenn ich ihn dazu bringe, eher auf sein Ego, denn auf seinen Verstand zu hören, dann kriege ich ihn.«
Dialog
1.
»Sie wissen, weshalb Sie hier sind?«
»Ich hatte so eine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich Sie auch erwartet.«
»Hatte?«
»Nun ja. In Anbetracht des Aufwandes, den Sie für angemessen hielten, um mich hierhin einzuladen, bin ich mir da nicht mehr so sicher.«
»Wären Sie denn gekommen, wenn ich Ihnen eine Karte mit einer Einladung geschickt hätte?«
»Vielleicht hätte es ja noch einen Mittelweg gegeben. Irgendetwas zwischen einer Karte und dem SEK? Aber nun ist es, wie es ist. Ich bin hier. Sie haben, was Sie wollen. Und ich bekomme bald ein neues Türschloss. Gott sei Dank, denn das alte hat seit geraumer Zeit ein wenig geklemmt. Das hätte ich sicher bald ersetzen müssen.«
»Ich glaube, ein Türschloss ist in absehbarer Zukunft Ihr geringstes Problem. Zumindest werden Sie sich darüber keine Gedanken machen müssen. Ich bin mir sicher, Sie werden für das Schloss in der Tür zu Ihrem Zimmer keinen Schlüssel haben.«
»Dann sind wir wohl beim Thema. Genug des Vorspiels. Kommen wir zur Sache.«
2.
»Einverstanden! Ich werde nun das Mikrofon anschalten. Ich nehme das Gespräch auf, damit es später keine Missverständnisse gibt oder wir uns nicht mehr so genau an die Dinge erinnern können, über die wir gesprochen haben.«
»Bitte, von mir aus gern.«
»Okay. Dann erledigen wir zuerst ein paar Formalitäten. Ich bin Hauptkommissar Weber. Sie befinden sich im Polizeirevier Köln. Ich verhöre Sie als Beschuldigten.«
»Das habe ich mir schon gedacht. Einen Zeugen würden Sie sicher nicht in Handschellen auf das Revier schleifen lassen, nachdem das Sondereinsatzkommando meine Wohnung gestürmt und mich aus dem Bett gerissen hat.«
»Jetzt übertreiben Sie aber. Sie haben mitnichten im Bett gelegen. Sondern am Schreibtisch gesessen. Zwar noch im Morgenmantel, aber wach. Was machen Sie denn schon so früh am Schreibtisch?«
»Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich früh morgens am kreativsten arbeiten kann. Das war schon so während der Zeit, als ich noch berufstätig war. Ich habe immer zugesehen, dass ich früh morgens, spätestens um 6:30 Uhr im Büro war. Selbst, wenn ich unterwegs war. Ich habe mir sogar die Hotels danach ausgesucht, ob sie bereits ab 05:30 Uhr Frühstück angeboten haben. Damit ich meinen Tagesrhythmus einhalten konnte. Ich …«
»Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Wir sollten zuerst die nötigen Formalitäten erledigen. Sie werden gleich noch genug Zeit zum Reden haben. Okay?«
»Na gut. Dann fasse ich mich in Geduld. Machen Sie weiter.«
»Ich gehe zwar davon aus, dass man Sie schon bei der Festnahme über Ihre Rechte informiert hat, aber zur Sicherheit spreche ich den Text noch einmal.«
»Dann haben wir es auch auf Band. Schon gut. Bitte!«
»Sie haben das Recht zu Schweigen, Sie müssen nichts sagen, was Sie belasten könnte. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen ein Anwalt gestellt. Haben Sie Ihre Rechte verstanden?«
»Ja, das habe ich.«
»Wollen Sie einen Anwalt?«
»Ich denke, im Moment kann ich darauf verzichten. Ich bin ja schließlich unschuldig. Hören wir uns doch einfach einmal an, was Sie mir genau vorwerfen. Ich kann mich doch später noch anders entscheiden?«
»Jederzeit. Sie müssen es mir nur sagen.«
»Gut!«
»Dann noch ein paar Formalien. Sie sind Peter Schönig. Geboren 1962 in Dortmund und derzeit wohnhaft in Siegburg, Kesselstraße 3.«
»Das sollten Sie doch mit Sicherheit schon wissen. Ansonsten wäre es doch ziemlich peinlich. In Anbetracht des Aufwandes, den Sie betrieben haben, um mich hierher zu verfrachten. Und in Anbetracht der Schäden, die Sie angerichtet haben. Okay, wenn es denn sein muss. Ja, der bin ich. Und jetzt würde ich endlich gerne erfahren, warum ich hier bin. Man hat mir zwar mitgeteilt, dass ich vorläufig festgenommen bin. Ich wüsste aber gerne auch warum.«
»Weil Sie zwei Menschen ermordet haben. Mindestens zwei.«
»Ufff!«
»Möchten Sie vielleicht doch einen Anwalt?«
»Nein, ich möchte erst hören, was genau Sie mir zur Last legen und wie Sie darauf kommen.«
»Ich bin mir sicher, dass Sie am 27. Oktober des vorletzten Jahres Iwan Smolek und am 14. April des letzten Jahres Werner Freisenberg ermordet haben.«
»Und ich bin mir sicher, dass ich das nicht getan habe.«
»Sie kennen die beiden Männer doch?«
»Ja, ich kenne sie. Oder, um es präzise zu sagen, ich weiß, wer sie sind. Aber ermordet, ermordet habe ich sie nicht.«
»Da sagen die mir vorliegenden Informationen etwas anderes.«
»Dann stimmen die Ihnen vorliegenden Informationen nicht. Was auch immer sie sagen, die Wahrheit sagen sie nicht. Warum zum Teufel hätte ich das tun sollen?«
»Aus dem gleichen Grund, aus dem Sie sie vorher schon belästigt, oder sollte ich besser sagen, angegriffen haben. Ich vermute aus Hass.«
»Hass trifft es nicht. Nein, bevor Sie jetzt etwas in den falschen Hals bekommen. Ich habe sie nicht gemocht, aber ich habe sie nicht ermordet. Ich bin kein Unschuldslamm, aber ein Mörder bin ich nicht.«
»Was war es dann? Wenn nicht Hass. Woher kannten Sie die Männer?«
»Das ist eine lange Geschichte …«
»Wir haben Zeit!«
»Ich bin mir nicht sicher …«
»Ohhh doch. Ich habe genug gegen Sie in der Hand, um Sie in Untersuchungshaft zu nehmen. Wenn Sie also behaupten, unschuldig zu sein und nicht bis zum Prozess damit warten wollen, das Gegenteil zu beweisen, müssen Sie mich jetzt davon überzeugen.«
»Müsste das denn nicht andersherum sein? Müssten nicht Sie beweisen, dass ich schuldig bin?«
»Schuldig sind Sie zwar noch nicht. Aber immerhin so verdächtig, dass ein Untersuchungsrichter es für sinnvoll gehalten hat, Sie festnehmen zu lassen. Und er wird auch bereit sein, Sie anzuklagen und Sie bis zum Prozessbeginn wegsperren zu lassen.«
»Gut. Aber Sie werden mir noch einmal helfen müssen.«
»Was erwarten Sie von mir?«
»Sie müssen mir noch sagen, wo dieser Freisenberg und dieser, wie hieß er noch gleich, Smolarek, nein Smolek gewohnt haben.«
»Ohhhh! Sind es so viele gewesen, dass Sie sich nicht mehr an die Namen erinnern können?«
»Autsch. Das war nun wirklich etwas missverständlich. Nein, ich tue mich generell etwas schwer mit Namen. Ich kann sie mir einfach schlecht merken. Schon während der Zeit meiner Berufstätigkeit, da gab es ja ständig Meetings, mit vielen Teilnehmern, häufig mit Leuten, die man vorher nie getroffen hatte. Zu Anfang gab es meistens Vorstellungsrunden, damit man wusste, wer wer und wer was ist. Da musste ich immer aufpassen, dass ich mir die Namen notiert habe, mir gemerkt habe, wer wo saß, weil, behalten, mir die Namen einfach merken, das funktionierte nicht. So sehr ich mich auch bemühte, es klappte nicht. Also bitte, helfen Sie mir, sagen Sie mir, wo dieser Smolek herkam. Sie haben mich ja auch nach meinem Namen gefragt. Obwohl Sie sich eigentlich hätten sicher sein sollen. Nicht, dass ich Ihnen eine falsche Geschichte erzähle. Oder, um es präzise zu formulieren, eine richtige Geschichte, aber zur falschen Person.«
»Wenn es hilft. Also Smolek war Malermeister und …«
»Der Maler! Na klar! Sie brauchen nicht weiter zu reden. Ich erinnere mich. Sehr gut sogar.«
»Na, dann lassen Sie mich mal hören.«
»Wo soll ich anfangen? Sie wissen, warum ich ihm die Reifen aufgeschlitzt habe?«
»Erzählen Sie mir einfach Ihre Geschichte. Dann erzähle ich Ihnen meine Version und wir finden heraus, was die Wahrheit ist.«
»Na gut. Auf Smolek bin ich vor ungefähr drei Jahren gestoßen. Also, nicht direkt, anfangs wusste ich ja nicht, dass er es war und dass er Smolek hieß. Im Gegenteil, es war ganz schön anstrengend das herauszufinden.«
»Ich höre Ihnen zu.«
»Das war das erste Jahr, nachdem ich aufgehört hatte zu arbeiten. Ich wusste noch nicht, was ich tun wollte, nur, dass ich von dem genug hatte, was ich bis dahin getan hatte. Klar, das ist nichts Besonderes, das geht fast jedem so. Aber nur wenige tun es, hören auf, ohne schon einen Plan zu haben, was sie danach tun wollen. Zumindest, wenn sie aus freien Stücken aufhören. Das muss man sich ja auch leisten können. Bis zur ersten Rentenzahlung dauert es dann ja noch etwas. Ich habe es getan und hatte viel Zeit. Neben dem Fehlen von finanziellen Sorgen ein Luxus, den ich über Jahre nicht genießen konnte. Und was macht man, wenn man zu viel Zeit hat und eigentlich nicht so recht weiß, was man mit ihr anfangen soll? Spazierengehen! Das vertreibt zwar nicht unbedingt die Langeweile, beruhigt aber wenigstens das Gewissen. Ja. Lesen. Bingen. Schlafen. Schön und gut, aber als Rechtfertigung mit dem Arbeiten aufzuhören? Eher uncool. Und nach einer gewissen Zeit auch nicht wirklich erfüllend. Aber zurück zum Thema. Also, ich bin in der Zeit viel spazieren gegangen, und eines Tages entdecke ich auf einer meiner Lieblingstrecken etwas Neues. Ich hatte gar nicht darauf geachtet, wusste gar nicht, ob das nun wirklich neu war oder vielleicht schon am Tag vorher dagewesen war. Wenn man häufig die gleiche Strecke läuft, achtet man nach einer gewissen Zeit ja gar nicht mehr auf den Weg. Oder auf das, was man dort alles sehen könnte. Wenn man denn hinsehen würde. Doch dieses Mal habe ich etwas gesehen. Etwas, das mir aufgefallen ist, nicht, weil es noch nie dagewesen ist, sondern, weil es dort nicht hingehörte. Der Weg, den ich ging, führte ungefähr einen halben Kilometer von meinem damaligen Wohnort entfernt, links hoch von der Hauptstraße auf eine Nebenstraße zu einem kleinen Dorf. Mittelscheid oder so ähnlich. Ich sollte mich eigentlich daran erinnern, denn dort wäre ich fast einmal hingezogen. Vor zwanzig Jahren, als ich mit meiner Frau nach einem neuen Heim gesucht hatte, wir wollten raus aus der Stadt, wie so viele damals, mehr aufs Land. Dort gab es ein wirklich schönes Haus, meine Frau wollte es eigentlich gerne haben, mir hat es zwar auch gefallen, aber es war mir zu teuer. Damals war unsere wirtschaftliche Lage ja noch nicht so rosig. Es ist dann ein anderes Haus geworden. Zentraler gelegen, unten im Tal, billiger. Vermeintlich, denn wenn man bedenkt, was wir dort noch hineingesteckt haben, hätten wir uns auch das Häuschen in Mittelscheid leisten können. Aber zurück zum Weg. Nachdem man von der Hauptstraße links abbiegt, geht es steil den Berg hoch, so ungefähr 500 bis 600 Meter. Zwei Anstiege mit einer kleinen Senke dazwischen, für den ungeübten Wanderer schon ein wenig anstrengend, aber ich war an dem besagten Tag ja schon gut im Training. Der Weg ist wirklich schön, links stehen zumeist einige Pferde, rechts eine Reihe von alten Obstbäumen, ganz unterschiedliche Sorten, hier können sich die Bürger der Gemeinde im Herbst kostenlos Obst pflücken. Was kaum einer tut. Vielleicht, weil es zu wenige wissen. Aber wohl eher, weil es die meisten nicht interessiert. Das Obst im Supermarkt zu kaufen, ist doch viel bequemer. Und es geht ja auch schneller. Dann hat man mehr Zeit, zum Bingen, Daddeln oder Abhängen. Meine Frau und ich, also zumeist meine Frau, denn wenn ich ehrlich bin, war sie es, die mich diesbezüglich angetrieben hat, waren des Öfteren dort und haben Obst, vornehmlich Äpfel, gepflückt. Nicht, dass wir sie gebraucht hätten, wir haben auf unserem Grundstück mehrere Apfelbäume, die mehr Obst produzieren, als wir essen, verarbeiten oder verschenken können. Aber dort, neben dem Weg, gibt es einige Sorten, die wir nicht im Garten haben und die auch nicht in jedem x-beliebigen Supermarkt zu kaufen sind.«
»Bitte!«
»Moment, Sie haben doch gesagt, wir hätten alle Zeit der Welt. Wollen Sie ein schnelles Geständnis? Oder wollen Sie die Sache wirklich verstehen?«
»Okay! Dann machen Sie weiter!«
»Wenn man dann oben ist, dann geht es rechts ab nach Mittelscheid. Ich gehe aber immer geradeaus, da geht es ein kleines Stück runter, vielleicht so 100 Meter, dann macht die Straße eine scharfe Linkskehre. Und exakt am Scheitelpunkt der Kehre geht es links neben der Straße steil bergab, 50 Meter vielleicht. Unten fließt ein Bach, der in einem Rohr unter der Straße durchgeleitet wird. Nichts Spektakuläres. Normalerweise. Doch eines Tages sah ich dort unten etwas Weißes. Etwas, was dort unten nicht hingehört. Trotzdem ich angestrengt heruntergeschaut hatte, konnte ich nichts Genaues erkennen. Deshalb, runterklettern wollte ich nicht, es ist da wirklich verdammt steil, habe ich einige Fotos mit dem Handy gemacht. Zu Hause, ich hatte nämlich auch meine Brille nicht mit, habe ich mir dann die Bilder angesehen, und in der Vergrößerung konnte man deutlich erkennen, woher das Weiß kam. Es waren drei, vier weiße Eimer, so 10-Liter-Farbeimer. Zwei davon waren offen, man konnte eine Spur aus weißer Farbe sehen, von den Eimern in den Bach.«
»Und das hat Sie wütend gemacht?«
»Allerdings. Ich habe sofort das Ordnungsamt der Gemeinde angerufen, denen das Problem geschildert, ihnen den Ort durchgegeben und gefragt, ob sie das mit der Anzeige erledigen oder ich noch persönlich zur Polizei muss. Musste ich. Ich habe dem Ordnungsamt dann noch die Bilder gemailt, dann bin ich auf die Wache. Das hat ziemlich lange gedauert. Erst musste ich fast eine Stunde warten, dann hat ein missmutiger Polizist die Anzeige aufgenommen, was nochmals ungefähr 30 Minuten brauchte. Dann hat der Beamte mir einen Ausdruck zum Unterschreiben gegeben und das wars dann. Nach meinem Eindruck allerdings nicht nur für den Tag, sondern generell. Ich habe nichts mehr von dem Vorfall gehört. Immerhin waren, als ich nach drei Tagen an der Stelle vorbeikam, die Farbeimer weg. Das Ordnungsamt hatte wohl die Kollegen vom Bauhof in Gang gesetzt und die haben den Müll wohl beseitigt. Dann, ich hatte die Sache schon fast vergessen, so ungefähr drei Monate später, die gleiche Stelle, dasselbe Problem. Na ja, nicht ganz. Dieses Mal waren es sogar noch einige Eimer mehr. Fast ein Dutzend. Nicht nur mit weißer, sondern auch in anderen Farben. Schwarz, rot, soweit ich mich erinnere. Ich habe dann wieder das Ordnungsamt informiert und bin auch wieder zur Polizei auf die Wache. Allerdings erst am nächsten Tag. Ich hatte befürchtet, dass es wieder so lange dauert, hatte aber an dem Tag noch einen Termin. Was eigentlich unnötig war, denn dieses Mal ging es relativ zügig. Keine zwanzig Minuten, und ich war fertig. Bei der Gelegenheit hatte ich auch nachgefragt, was nach meiner vorherigen Anzeige passiert war. Der Beamte, es war ein anderer Polizist als beim letzten Mal, wusste von nichts, hatte aber dann im Computer nachgesehen. Die Anzeige hatte er schnell gefunden. Mehr dazu sagen, konnte er mir nicht. Daraufhin hatte ich ihn gefragt, was sie denn nun aufgrund meiner neuen Anzeige machen werden. Sich die Sache ansehen, in dem Gebiet mehr Streife fahren, das wars dann auch schon. Nichts von Spurensicherung, Beobachtung, Befragungen.«
»Was hatten Sie denn erwartet. Bei diesem Vergehen?«
»Etwas mehr. Auch wenn es Mühe oder Geld gekostet hätte. Ich hatte erwartet, dass sie das Vergehen ernster genommen hätten. Genauso, wie ich mir wünschen würde, dass Sie es etwas ernster nehmen würden. Ob sie das gemacht haben, mit den intensivierten Streifen, ob sie überhaupt etwas gemacht haben, kann ich nicht beurteilen. Ich habe dort nie einen Streifenwagen gesehen. Aber ich war ja auch nicht ständig vor Ort. Die Polizei allerdings auch nicht, denn nach gut zwei Wochen lagen dort unten schon wieder etliche Farbeimer.«
»Und das hat Sie wütend gemacht?«
»Ja, aber überraschenderweise nicht auf den Verursacher. Sondern mehr auf die Behörden. Die nichts getan hatten. Außer den Müll wegzuräumen. Den der Maler dort entsorgt hatte. Auf Kosten der Allgemeinheit. Zulasten der Umwelt. Denn dort gab es auch viele Amphibien. Vor allem Feuersalamander. Die es ohnehin dort schon schwer genug hatten. Im Sommer fand man bei fast jedem Spaziergang Überreste von überfahrenen Tieren auf der Fahrbahn. Eine Freundin von uns hatte sich dafür stark gemacht, dass dort Warnschilder aufgestellt wurden. Was dann auch gemacht wurde und sich zu einer Art Posse entwickelt hatte. Denn die Warnschilder waren so klein, dass man schon an ihnen anhalten und aussteigen musste, um sie erkennen zu können. Wenn das so geplant war, um die Fahrzeuge zu entschleunigen, war das ein cleverer Plan. Nur funktioniert hat er nicht. Niemand hat vor den Schildern angehalten. Wie viele die Warnschilder überhaupt gesehen haben, kann ich natürlich nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass nicht viele die Salamander gesehen haben. Zumindest nicht frühzeitig genug, um die Feuersalamander nicht zu überfahren.«
»Tja, das ist sicher schade, hat aber …«
»Schon gut. Ich langweile Sie. Wahrscheinlich haben wir doch nicht so viel Zeit, wie Sie gesagt haben. Sie zumindest. Ich schon. Aber war ja klar. Deshalb sitzen wir hier ja auch nur zu zweit. Im Film sind die Polizisten immer zu zweit. Und mehrere stehen noch hinter einem Spiegel und hören zu. Aber hier haben wir ja noch nicht mal einen Spiegel. Brauchen Sie ja auch nicht. Sie haben da oben im Eck, rechts von der Tür ja die kleine Videokamera. Ist das überhaupt erlaubt?«