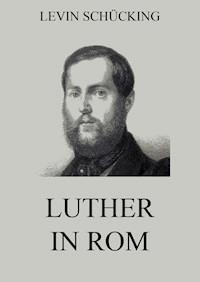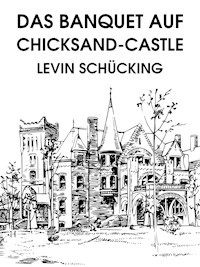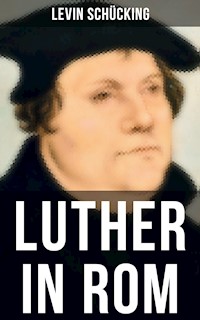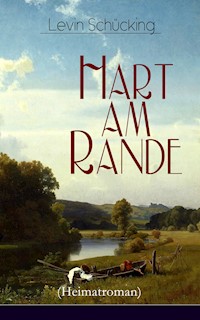Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 'Ein Sohn des Volkes' von Levin Schücking wird die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der im 19. Jahrhundert in Deutschland lebt und sich dem revolutionären Geist seiner Zeit anschließt. Der Roman zeichnet sich durch seinen fesselnden historischen Kontext aus, der die politischen und sozialen Spannungen dieser Ära einfängt. Schücking präsentiert die Handlung mit einem lebendigen und mitreißenden Schreibstil, der die Leser in die Welt des Protagonisten eintauchen lässt. Durch die detaillierten Beschreibungen und die klugen Dialoge entsteht ein Bild von Mut, Verantwortung und Leidenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Sohn des Volkes
(Historischer Roman)
Books
Inhaltsverzeichnis
Erster Theil.
Eine Familie von 1789.
Erstes Kapitel.
Die Zeit der Begebenheiten, welche wir dem geneigten Leser auf diesen Blättern zu erzählen uns anschicken, ist von den gewaltsamsten Leidenschaften durchtobt und von Handlungen bezeichnet worden, die eine schlummernde Welt zu Schrecken und Entsetzen wach gerufen haben. Aber nichts kann an Ruhe und Frieden dem stillen ländlichen Bilde gleich kommen, das sich dem Auge darstellt, indem wir den Vorhang vor der ersten Scene unsers Dramas in die Höhe wallen lassen.
Auf einer grünen Rasenfläche sehen wir im Vordergrunde rechts eine Linde sich erheben, einen jener ungeheuern und prachtvollen Bäume, die in sich allein ein ganzes Waldleben zu hegen scheinen und von der üppigen, ewig treibenden Kraft der Natur strotzen, welche immer aufs Neue grüne Zweige im Lenzwinde schaukelt, während das Beste, was in uns erblüht, mit den Jahren ergilbt, absinkt und schwindet, ohne neu aufzugrünen oder zu erstehen.
In den Blättern der Linde spielen die Sonnenstrahlen mit dem Flüstern der Abendluft, und ein dichter Schwarm von Mücken steigt wie ein elastischer Ball auf und nieder, rastlos, immer gedrängt, immer so laut und lustig summend, als ob die bösen Schwalben, die oben durch die Zweige schießen, gar nicht in der Welt wären.
Hinter dem großen Baume befindet sich ein mit Sandsteinquadern eingefaßter breiter Graben voll Schilf und Wasserlinsen, zur Linken von einem schweren und massiven Bogen überbrückt, der steinerne Pfeiler und ein offenes eisernes Gitterthor trägt. Den Hintergrund aber bildet ein hohes Gebäude, mit zwei vorschießenden niedern Flügeln. Es ist aus Ziegelsteinen aufgeführt, mit Mansardendach, breiten Essen, Vortreppen und Wappen versehen; die Mauerflächen tragen grobgehauene Sandsteinarbeiten, welche Jagdtrophäen und Ackerbauwerkzeuge darstellen; und so bildet es einen jener Adelssitze, wie man sie im Zeitalter des französischen Geschmacks aufführte und in allen Theilen Deutschlands, hauptsächlich in Westfalen und am Niederrheine in großer Menge findet. Die Balconthür über dem Haupteingange steht offen; jenseits an der Rückseite des Gebäudes müssen sich ebenfalls große Fensteröffnungen befinden, denn man sieht das Licht der niedergehenden Sonne hell und voll hindurchleuchten. Hof und Vorderseite des Gebäudes dagegen hüllen die Abendschatten ein, und nur die blaue Schieferkuppel eines achteckigen umfangreichen Thurms, der sich auf der Rückseite über das Schloßdach emporhebt, ist fast ganz bedeckt von dem röthlich-goldenen Glanze des Abendroths und seiner Reflexe am östlichen Himmel. Rechts, am Ende des Daches, fällt ein mächtiges Storchennest in die Augen: ein Zögling dieser luftigen Erziehungsanstalt zeichnet sich mit seinem langen dünnen Jünglingsleibe scharf am blauen Himmel ab, wie er den Hals reckt und augenscheinlich mit großer Spannung die eifrigen Turnübungen seines einzigen Brüderleins betrachtet. Dieses hat sich auf die Mitte des Daches begeben, wo es sich vom Forst auf eine große Windfahne zu schwingen sucht; so oft aber die Füße des rastlosen Jünglings die Fahne berühren, schnellt diese, von dem Stoße getrieben, im Kreise umher, und der Turner taumelt flatternd auf den Forst zurück; trotz dem wird er nicht müde, seine fruchtlosen Anstrengungen fortzusetzen und also ein belehrendes Beispiel zu bieten, daß die Kinder der Störche in ihren Anschlägen oft nicht klüger sind, als die Kinder der Menschen auch.
Nachdem wir jetzt noch einige Gruppen von italienischen Pappeln und prächtigen alten Obstbäumen dem stattlichen Herrenhause rechts und links als grüne, vollbuschige Einfassung zugegeben, ist unser Landschaftsbild fertig, und nur die Staffage fehlt noch. Diese überwölbt der Baum im Vordergrunde mit seinen fabelhaft mächtigen Aesten. Ein runder Steintisch steht neben dem Stamme, mit blendend weißem Linnen bedeckt und mit einem sehr reichlichen Abendmahle besetzt, zu welchem sich eine Versammlung der vergnügtesten Menschen eingefunden hat, die jemals eine Familie bildeten. Obenan in dem Stuhle mit mannshoher rohrgeflochtener Rückenlehne ruht der hoch- und wohlgeborene Hausherr, Seine Gnaden, der Freiherr Karl Borromäus Guntram, Vogt zu Schwalborn auf Schwalborn und Erbherr auf Flittersdorf. Und in der That, um bei ihm anzufangen, so ließe sich auch von den scharfsinnigsten Leuten nicht leicht ein Grund erdenken, weßhalb der Freiherr von Schwalborn nicht sehr vergnügt und heiter sein sollte, besonders an diesem herrlichen Abende, so umgeben von allen den Seinen, den blühenden Sprossen seiner Familie. Er genießt erstens einer ganz vortrefflichen Gesundheit und hat noch kein einziges graues Haar, obwol er nun über fünfzig Mal schon die Generationen seines ererbten Hof-Storchennestes sich hat erneuern gesehen. Dann besitzt er ferner, wenn die Ernten nicht ganz und gar misrathen, ein völlig hinreichendes Auskommen, und endlich erfreut er sich des besten Ansehens im Lande, sämmtlicher Ehrenrechte seines Standes und der Gerichtsbarkeit über Leibeigene und Hintersassen; — mit eingeschlossen das unschätzbare Vorrecht, alle diejenigen, welche ihm misfallen oder Verdruß machen, für eine ausreichende Anzahl von Tagen zur Beförderung der öffentlichen Sittlichkeit und gesetzlicher Ordnung in seinen Thurm einsperren lassen zu dürfen.
Seine Gnaden tragen einen grauen Rock mit breiten Aufschlägen und hohem Kragen, nach englischem Musterschnitte, wie es die Mode jener Zeit verlangt, einen stattlichen Zopf und kurze Beinkleider von blauem Manchester mit gelben Klappstiefeln, was Alles ihre ansehnliche Erscheinung zu erhöhen sich nicht wenig zweckdienlich und fördersam erweist.
Ihm gegenüber sitzt »Gnaden Mama«, eine große, kräftige, gefürchtete Frau. Sie war im Grunde eine gutherzige Dame, von edeln, stark ausgebildeten, aristokratischen Zügen; aber da ihr Gemahl zuweilen, besonders in heißen Sommermonaten, wo die Landwirthschaft gerade die größte Thätigkeit in Anspruch nimmt, an einer gewissen Scheu vor Bewegung litt und still saß, statt dem Gesinde auf die sonnigen Aecker nachzugehen, hatte die Hausfrau so oft die Zügel der Herrschaft ergreifen müssen, bis sie sich endlich vollständig daran gewöhnt das Regiment zu führen. Sie war dadurch streng, etwas laut und heftig geworden, und schon nach einigen Jahren der Ehe hatte der Freiherr es oft bereut, daß er die Sommertage zu warm, die Frühstunden zu feucht und kalt gefunden. Aber jetzt war es zu spät; die gnädige Frau stand einmal unbestritten an der Spitze des Hauswesens. Auch war sie unleugbar die kräftigste Natur in der Familie.
Bei der Einmündung von Flüssen in einen Hauptstrom kann man oft noch lange die Farbe des einen Seitenflusses im Gewässer vorherrschend finden, während ein anderer Seitenfluß sogleich im Hauptstrome verschwindet. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich bei den Familien. Das Blut der einen bleibt herrschend, wenn eine Verbindung es in eine andere Familie überleitet; das der andern verschwindet spurlos. In unserm Falle war die erstere Erscheinung eingetreten; das Blut der Edeldame, in den Familienstrom der Schwalborn übergeleitet, hatte entschieden die Oberhand behalten, und aus den zwei Sprossen der Verbindung blickte deutlich das Naturel der Mutter hervor.
Diese Sprossen waren ein Sohn und eine Tochter; jener hieß Karl, diese Marianne; zwei frische, kernige, fröhliche Naturen, im Aeußern, wie gesagt, der Mutter ähnlich, wie diese große und edle Gestalten. Nur war der Sohn etwas zu rasch in die Höhe geschossen, und da er sich vornüber gebeugt hielt, so hatte er dadurch das Ansehen einer gewissen Schwächlichkeit bekommen, die er doch in der That nicht besaß, und die auch sein blühendes, etwas gebräuntes Gesicht widerlegte. Dieses Gesicht war regelmäßig und schön, einer jener Typen von ovaler Bildung, Adlernase, feinem Munde und hoher Stirn, wie man sie beim norddeutschen und normannischen Adel findet. Von hellbraunen Locken umgeben, war dieser Kopf mithin ganz geeignet, den Stolz einer zärtlichen Mutter zu bilden; aber es fehlte Etwas an demselben, das freilich einen wesentlichen Bestandtheil eines gut organisirten Kopfes bildete und dessen Mangel wol im Stande war, Gnaden Mama einen großen Theil ihrer Freude beim Anblicke ihres Sohnes zu verderben. Dieser entartete Jüngling trug nämlich keinen Zopf und hatte sich darauf gesteift, sein Haar gleich einem uncultivirten Heiden gerade so zu tragen, wie Gott es ihm wachsen ließ. Daher kam es denn auch, daß man in der ganzen Gegend fast mit den Fingern auf den Ohnezopf wies, so wie man jetzt auf Denjenigen weisen würde, der einen Zopf trüge — ein Gegensatz, worin ein belehrender Beitrag zur Philosophie der Geschichte enthalten ist.
Ist hiermit nun der wunde Fleck der Familieneintracht berührt, so freut es uns doppelt, auf einen Gegenstand übergehen zu können, der lauter Licht, Freude und Harmonie ausstrahlt. Dieser Gegenstand hat Wangen wie Milch und Blut, einen kleinen, dunkellockigen Kopf auf stolzgeschwungenem Nacken, sehr viel Muthwillen und Unternehmungsgeist und das weichste Kinderherz von der Welt. Er heißt Marianne Freifräulein von Schwalborn und ist des Hauses Stolz, Zier und Juwel. Marianne war lebhaft, rasch in ihren Bewegungen und besaß von jungfräulicher Herbheit und einer gewissen kecken Bubenhaftigkeit des Betragens gerade genug, um auf der einen Seite das Landfräulein in seiner vollsten Blüte darzustellen, auf der andern nicht in Mangel an Anmuth zu verfallen.
Neben Marianne sitzt noch eine Persönlichkeit, eigentlich die auffallendste Erscheinung des ganzen Kreises. Es ist ein kleiner Mann mit ungewöhnlich großem Kopfe, dessen Züge breit und kräftig angelegt sind, doch ohne darum irgend eine bedeutende Wirkung, weder in Schönheit noch in Ausdruck, hervorbringen zu können. Der Mann ist eigentlich häßlich mit seinem Koboldsgesichte, aber die vorstehende Oberlippe, der Blick der großen braunen Augen deuten auf eine Gutmüthigkeit, welche auch einen noch braungelberen Teint und noch unschönere Züge vollständig aufwiegen würde. Er ist der Bruder des Gutsherrn, der Freiherr Desibodus Ehrembrecht, Domherr zu Trier, aber trotz seines geistlichen Berufs von Morgens früh bis Abends spät in einen höchst weltlichen, kurzen, grünen Jagdrock gekleidet und ein großer Jäger vor dem Herrn.
Dies ist die Familie des Freiherrn Guntram von Schwalborn, die Familie von Anno 1789, blühend in aller unangetasteten Innigkeit und Heiterkeit, in der ganzen Heiligkeit eines ursprünglichen, naturgemäßen Verhältnisses. Sie ist froh ihrer Eintracht und ihres ansehnlichen Besitzes, und voll Vertrauen blickt sie in die Zukunft, sich anheimgebend der weisen Fügung Gottes und der Alles nicht minder unfehlbar lenkenden Fürsicht von »Gnaden Mama«.
Das zu patriarchalisch früher Stunde servirte Abendmahl war beendet. Wo Zerrwitz bleibt! seufzte der Domherr, der sich fortzukommen sehnte, um mit seinem Neffen Karl in die Laubgänge des Gartens zu eilen, wo er ein gestern nicht beendigtes Gespräch über das neueste Schäfer-Singspiel Georg Jacobi’s zum Abschlusse bringen wollte.
Er kommt alle Tage später, sagte unwillig der Freiherr, indem er seinem Sohne den schwerbeschlagenen Meerschaum reichte, um ihn sich füllen und anzünden zu lassen.
Da ist er! rief freudig Marianne aus; Cölestine ist bei ihm!
Sie sprang auf und hüpfte ihrer Seelenfreundin entgegen, der Tochter des Erwarteten, welche mit diesem eben die Allee heraufkam.
Der Herankommende, der Hauptmann Zerrwitz, war eine seltsame Figur und in allen Dingen das Widerspiel des Freiherrn. Aber der Hauptmann und der Freiherr waren sich seit geraumer Zeit deßhalb nicht minder unentbehrlich geworden. Das Bedürfniß der Geselligkeit hatte sie an einander geknüpft, und obwol sie fast jedes Mal in Zank und Groll von einander schieden, so erwarteten sie doch täglich mit Sehnsucht die Abendstunde, welche sie zusammen zuzubringen gewohnt waren. Man konnte übrigens keine größern Gegensätze sehen. Der wohlbeleibte und behagliche Freiherr war ein Mann von feinem Schicklichkeitsgefühl und zeigte in seinem Betragen jene aristokratische Schonung der Eigenheiten Anderer, welche im Umgange so wohlthuend ist. Der lange, hagere Hauptmann, voll Säure und Galle, von unruhiger Beweglichkeit, gefiel sich vor allen Dingen in einer höchst philosophischen Verachtung der Etiquette und guten Formen. Alle Augenblicke sah man den Freiherrn Gelegenheit bekommen, seinem Gaste gegenüber jene Kunst weisen Nichtbeachtens oder geschickten Abwendens zu üben, womit der Mann von guter Erziehung Verletzungen des Auslandes beseitigt. Aber es waren noch größere Gegensätze da: der Freiherr hatte als Officier unter der Fahne der großen, schönen Kaiserin Maria Theresia gedient, der Hauptmann seine Epauletts unter Friedrich dem Großen verdient; jener war erfüllt von den Ideen des rechtgläubigen kaiserlichen feudalen Deutschlands, dieser von den neuen Gedanken, als deren Vertreter die junge lorberdurchflochtene Krone Preußen sich erhoben hatte. Der Hauptmann, der bürgerlicher Geburt war, hatte nur nach unzähligen, fehlgeschlagenen Anstrengungen, nach einer Menge Uebergehungen und Zurücksetzungen, nur durch die Beweise der außerordentlichsten Tapferkeit sich unter so viel adeligen Mitbewerbern Bahn brechen können, um zu seinem jetzigen bescheidenen Grade zu gelangen. Er haßte deßhalb den Adel. Der Freiherr haßte die Preußen mit all dem Hasse, den das katholische Deutschland damals gegen sie hegte. So standen sie sich gegenüber, ein Oesterreicher und ein Preuße, ein Ghibelline und ein Welfe, ein Rechtgläubiger und ein Ketzer, ein Baron und ein Bürgerlicher — und doch ließen sie nicht von einander. Der Hauptmann hatte durch seine verstorbene Frau ein kleines Gut in der Nachbarschaft geerbt, und da ihn dies, nachdem er den Abschied erhalten, an die Gegend fesselte, so war er ganz allein auf den Umgang mit dem Freiherrn angewiesen. Dieser aber fand in dem Hauptmanne den einzigen Menschen in der Nachbarschaft, der ihn verstand, wenn er ihm, trotz eines Kreuzfeuers von lebhaftestem Widerspruche, die ewig denkwürdigen Züge und Großthaten des alten Feldmarschalls Laudon beschrieb und auseinandersetzte, mit wie viel Heldenruhm sich die Truppen Oesterreichs im siebenjährigen Kriege bedeckt.
Was sein Aeußeres angeht, so hatte der Hauptmann eine kurze und stumpfe Nase, ein rundes Gesicht mit etwas vortretenden Backenknochen, schmale graue Augen und einen großen blonden Schnurrbart. Das röthliche Haar war mit Puder bedeckt und in einen mächtigen Zopf geflochten, der just so steif und gerade herabhing, wie sein Besitzer sich aufrecht hielt, in seiner engen Uniform mit silbernen Galons, kurzen hechtgrauen Beinkleidern und hohen schwarzen Gamaschen. Nach der Physiognomie und den Namen zu urtheilen, könnten wir also den oben angeführten Gegensätzen in den beiden alten Herren auch noch den des slawischen und des deutschen Bluts hinzufügen.
Der Hauptmann setzte sich, ohne eine Einladung abzuwarten, neben den Freiherrn und legte seinen dreieckigen Hut auf den Tisch; dann zog er ein Zeitungsblatt hervor, auf welchem er eine Stelle mit Rothstift bezeichnet hatte, und schob es mit einem schadenfrohen Lächeln dem Herrn von Schwalborn hin. Während dieser sich darin vertiefte, schlugen die beiden Mädchen den Weg nach dem Schloßgarten ein; der Domherr aber erhob sich, nahm seinen Neffen unter den Arm und folgte mit ihm den beiden anmuthigen, leicht dahinschwebenden Gestalten.
Zerrwitz hatte sein Kinn in die Hand gestützt und sah mit funkelnden Augen auf den lesenden Freiherrn. Als dieser zu Ende war, fragte er schadenfroh lachend: Nun, was sagen Sie, Herr von Schwalborn?
Der Freiherr zuckte die Achseln.
Wieder einmal ein tüchtiger Hieb an den Stamm verruchter Vorurtheile!
Ja ja, noch einige Hiebe der Art, und der Stamm fällt — aber hoffentlich den sinnverwirrten Menschen, die ihn niederreißen, auf den Schädel.
Ah, pah, hat nichts zu sagen, nur immer zu! rief der Hauptmann lachend, indem er eine kräftige Bewegung mit seiner gebräunten Faust machte.
Der Freiherr, dessen Seele schmerzlich von der Nachricht bewegt war, die er eben gelesen, fand dieses Lachen und diese Bewegung im höchsten Grade roh und plebejisch; aber er antwortete mit seiner frühern Milde: Sie freuen sich über die Schläge, mit welchen die Jacobiner den Adel ausrotten wollen; geben Sie Acht, nächstens werden wir sie dieselben Schläge gegen die Kirche und die Religion führen sehen!
Nun, meinethalb — wenn sie ihren alten katholischen Götzendienst abschaffen— das wird auch nichts schaden! Dann werden sie alle lutherisch in Frankreich, und ich wüßte nicht, was sie Besseres thun könnten! Wenn sie gescheit sind, berufen sie sich den Wöllner ins Land, der bringt ihnen das mit Edicten in die schönste Ordnung! Seine königliche Majestät — der Hauptmann lüftete den Hut — leiht ihn gern her, wenn es ein solches gutes Werk gilt!
Der Freiherr zuckte wieder die Achseln; der Hauptmann strich sich vergnügt den fuchsigen Schnurrbart.
Es wird wahrscheinlich ganz anders kommen, sagte Herr von Schwalborn resignirt. Nach dem Adel und der Kirche wird man den Thron umstürzen!
Den Thron! schrie lachend Zerrwitz. Gott behüte uns — wie können Sie von den Leuten solchen Unsinn denken! Möchte doch sehen, wie solch ein Volk von Schwerenöthern ohne einen König auskommen könnte!
Mein lieber Herr von Zerrwitz, die Sachen sind weit ernster, als Sie denken. Es werden Tage kommen, wo Sie sich nicht mehr so schadenfroh die Hände reiben werden! Diese Bewegung in Frankreich wird nicht enden, sobald einige, wenn Sie wollen, Verbesserungen der alten Verfassung hergestellt sind: nein, nein, die ganze Mauer stürzt zusammen, aus welcher man einige schadhaft gewordene Steine ohne Gefahr herausziehen zu können glaubt! Und dann stürzt mehr, dann stürzt eine halbe Welt Frankreich, dem alten ritterlichen Frankreich Ludwig’s XIV. und Heinrich’s IV. nach!
Nämlich das liebe heilige römische Reich — Gott steh’ ihm in seinem Sterbestündlein bei! versetzte Zerrwitz, ungerührt von den düstern Voraussagungen des Freiherrn.
Ja, so denkt Ihr Leute von den öden Ufern der Havel und Spree — Ihr habt Euer Erbtheil in harten Thalern eingesackt, und nun kümmert Ihr Euch nicht, wie der edle Hausrath Eurer Aeltern zu Grunde geht, wie der Ehrenbecher, aus dem Euer Vater an Feiertagen trank, zum Juden wandert, der Trödler des Gebetbuchs Eurer Mutter sich bemächtigt und den Schild Eurer Ahnen ein Plebejer als altes Eisen ersteigert.
Der Hauptmann Zerrwitz sah bei diesem sentimentalen Ausfall den Freiherrn mit Augen an, die von innerlichem Vergnügen leuchteten.
Das ist wahr! um Gebetbücher und alte Schilde mit dem jammervollen Thiere, dem zweiköpfigen Adler darauf, hat sich der alte Fritz verdammt wenig gekümmert: aber dafür hat er ein neues blankes Haus gebaut, ein Haus wie Stahl so fest.
Wir wollen darüber nicht streiten. Wir betrachten die Welt mit zu verschiedenen Augen. Ich glaube an die Festigkeit eines solchen Baues nicht, wenn der Bauherr dabei nicht an Gott gedacht und irgend einen Gottesgedanken in den Grund eingemauert hat. Das hat weder Euer Albrecht von Brandenburg, der dem deutschen Orden Preußen stahl, noch der »große Kurfürst«, der allerdings ein respectabler Mann war, aber am Ende auch das Reich verrieth, noch der sogenannte alte Fritz, diese widerwärtige Persönlichkeit, dessen atheistischer Materialismus die Kleinheit seiner Seele, dessen Despotismus die Schlechtigkeit seines Herzens beweist und der dem Hause Oesterreich unter jammervollem Vorwand das schöne Schlesien wie ein Räuber fortnahm —
Herr! rief Zerrwitz aus und schlug zornig mit der Faust auf den Tisch —
Nehmen Sie sich in Acht, Herr Hauptmann, unterbrach mit kaltblütiger Freundlichkeit Frau von Schwalborn — es ist eine Steinplatte!
Beschimpfen Sie mir den alten Fritz nicht! fuhr der Hauptmann mit rothglühendem Gesicht fort: hat Ihr Oesterreich —
Ich rede nicht von Oesterreich: obwol ich Ihnen gern gestehe, daß mir das blühend reiche Land mit seinen Alpen, seinen Strömen, mit seinen malerischen Völkerschaften, mit seinem Wien, wo der Türke und der Spanier, der Böhme und der Sicilianer sich begegnen, daß mir dies Oesterreich lieber ist als Ihre Havelsteppen. Aber wir reden von etwas Anderm. Sie spotten Deutschlands, des Reichs, und ich wollte Ihnen sagen, daß eine Stunde kommen wird —
Wo das liebe römische Reich sich in seiner Noth auf die Strümpfe macht und um Hülfe in die Havelsteppen wallfahrten geht, um nicht ganz aufgezehrt zu werden, sagte Zerrwitz.
Der Freiherr schüttelte den Kopf.
Es wird anders kommen, als Sie, anders, als wir Beide denken. Das Reich ist in traurigen Verhältnissen, das ist wahr. Aber auch Preußen ist eine Bildsäule mit thönernen Füßen. Es fehlt ihm die innere Notwendigkeit. Deutschland — das ist das Schiedsrichterthum der Nationen: das ist der Geistesbronnen, zu dem die europäischen Völker trinken kommen; das ist das Herz Europas, das ist der Muth und das Gemüth zu gleicher Zeit. Nun frag’ ich Sie, wenn Ihr Preußen zu stolz seid, an einer solchen Völkerexistenz Theil zu nehmen, was bleibt für Euch als Idee, was bleibt als ideale Basis für eine preußische Weltmacht übrig? Antworten Sie mir, Böotier, der Sie zu stolz sind, ein Grieche sein zu wollen.
Der Hauptmann Zerrwitz, auf den dieser politische Transscendentalismus einen sehr komischen Eindruck machte, begnügte sich damit, den Freiherrn lächelnd anzusehen und dabei spöttisch mit den Augen zu zwinkern.
Ich will Ihnen eine Antwort sagen, fuhr der Freiherr fort: Seit uns die Franzosen und Schweden den westfälischen Frieden gemacht haben, ist Deutschland jämmerlich verkommen. Niemand weiß, wer Koch und wer Kellner im Reiche, Niemand weiß zu gehorchen, Niemand weiß im rechten Augenblick zu gebieten. In dieser Auflösung hat der Herrgott eingesehen, daß wir neu geschult werden müssen, daß uns ein Schulmeister noth thue, und da hat er uns dies Preußen geschickt: Ordnung, genaue Rechnung, exacte und ehrliche Buchführung in Verwaltung und Steuerwesen, vor Allem aber Gehorsam, Ordre pariren, militairische Subordination, das lehrt uns dieser Schulmeister, und dafür müssen wir ihm dankbar sein. Weßhalb sollen wir uns wundern, daß ein Schulmeister ein Schulmeister ist — daß er sich im süßen Gefühl schaukelt, Alles besser zu wissen als wir? Auch daß er eine dürftige und poesielose Natur hat, dürfen wir ihm nicht vorwerfen. Hätte er Verständniß für den Aufschwung genialer Naturen, streifte sein Auge hinüber über die Schranken seines Horizonts, über die Klugheit und die Kritik hinaus, in die Regionen, wo das Recht der schaffenden Göttlichkeit im Menschen beginnt — dann würde sein Sinn beirrt, seine Entschlossenheit wankend gemacht und seine Energie erlahmte bei der eisern consequenten Durchführung seines Lebensberufes, die sein Verdienst und seinen Ruhm bildet. Aber einst wird der Tag kommen, wo Deutschland Ordnung und Gehorsam gelernt hat, wo es der Schule entwachsen ist. Dann ist die Aufgabe Preußens erfüllt, und von diesem Augenblick an wird sein Traum aufhören müssen, eine außerhalb des Reichs bedeutungsvolle Weltstellung einnehmen zu können.
Ha, ha, ha! lachte Zerrwitz. Also Sie räumen doch ein, daß alle Andern gegen Preußen nur Kinder sind und daß sie von Preußen in die Schule genommen werden müssen!
Der Frau von Schwalborn, die bis jetzt dieser Debatte schweigend zugehört hatte, waren die Expektorationen ihres Gemahls in hohem Grade unangenehm. Nicht daß sie anderer Meinung gewesen wäre; aber sie hatte das peinliche Gefühl, welches man empfindet, wenn man tiefer aus dem Gemüth geschöpfte Auffassungen oder die Ueberzeugungen, welche überlegene Bildung und Geisteshöhe geben, wider die trivialen Meinungen der Alltäglichkeit vertheidigen hört und, wie immer, im Kampf mit der unzertrennlichen Suffisance der letztern unterliegen sieht. Frau von Schwalborn unterbrach deßhalb das Gespräch und sagte mit scharfer, gebieterischer Betonung: Wollt Ihr nicht zu spielen anfangen, lieber Mann?
Man griff zu den Karten und begann Tarok zu spielen.
Während der Hauptmann mischte, sagte Frau von Schwalborn zu ihrem Manne: Bestelle doch die Zeitung ab, man muß sich den Aerger aus dem Hause halten! — —
Sehen wir uns unterdeß, während die alten Herren in die Wechselfälle ihres Spiels vertieft sind, nach Karl und seinem Oheim um.
Du findest es unrecht, lieber Karl, sagte der Domherr, als sie über die kiesbestreuten Pfade des Gartens dahinwandelten — du findest es unrecht, daß der Königssohn in unserm Stücke nicht den angenommenen Gewohnheiten treu bleibt, sondern den Schäferstab fortwirft, um das ihm heimgefallene Scepter seines gestorbenen Vaters zu ergreifen.
In der That, lieber Oheim, halte ich es für unrecht, daß er in eine Sphäre zurückkehrt, wohin ihm Chloe nicht folgen kann, da er ihr doch ewige Treue geschworen hat.
O, lieber Karl, wie verkehrt urtheilst du da! Wenn wir die Schranken, welche sich unserm Glück widersetzen, durchbrechen, die Verhältnisse, welche den Wünschen unsers Herzens entgegentreten, verhöhnen wollten, woher sollten wir dann noch die süßen Gefühle der Wehmuth oder das Bewußtsein der Entsagung nehmen, welche uns so nöthig sind, um uns selbst als edle, bessere Menschen zu fühlen?
Sollte es in Alexis das Bedürfniß der Entsagung sein, was ihn Chloe verlassen und einen Thron suchen heißt?
Gewiß — ganz gewiß; es ist die holde Schwärmerei seiner Seele, die ihn drängt, unter dem Purpurmantel ein Leben voll Wehmuth und Entsagung zu suchen. Gewiß, inmitten seines Glanzes und übersättigt von der Herrlichkeit, die ihn umgibt, wird er träumerisch die Verse Matthisson’s sprechen:
Mich lockt zum Wiesenplane Der Mädchen Abendreih’n, Mich reizt im leichten Kahne Des Vollmonds milder Schein; Mich labt der Weste Fächeln Am Hainquell; mich entzückt Ein Veilchen, das mit Lächeln Mir die Erwählte pflückt! —
und er wird weinen, daß er das Paradies des Dichters verloren hat.
Der Domherr war stehen geblieben, und der kräftige, jagd- und wettergebräunte Mann hatte sich in die anmuthigste Stellung geworfen, seinem muskulösen Arme eine graziöse Biegung gegeben und die behaarte Rechte leichte, graziöse Bewegungen machen lassen, während er die Verse flötete. Es war ein lächerlicher Anblick. Aber Karl lachte nicht. Er war ein guter Junge, und der liebe Gott hatte ihm die größte aller Gnaden beschert: er hatte alle kritische Anlage von ihm fern gehalten. Die Gebildeten jener Zeit hielten nun einmal die Unnatur und die Heuchelei der Empfindung, wenn sie in recht anmuthiger Wendung und möglichst zierlich verblümelt auftrat, für Poesie. Karl hatte das von dem Onkel als Tradition überkommen und war in dem Alter, wo der Schein blendet. Jene anmuthigen Poeten im Bänderschuh und Strohhut schienen ihm Götter. Er wußte nicht, wie viel Roheit oft hinter ihren süßen Tändeleien sich barg. So nahm er denn des Onkels Kunstansicht für den Canon wahrer Aesthetik, und nur in Einem Punkte lehnte sich sein Naturell wider diesen auf. Der Domherr war nämlich auch darin von den künstlerischen Begriffen seiner Zeit durchtränkt, daß er ältere Baukunst befehdete; die gothische vorzüglich war ein Greuel in seinen Augen, und er hatte längst einen detaillirten Plan entworfen, den Kölner Dom auf den Abbruch zu verkaufen, um aus dem Erlös einen neuen geschmackvollen Tempel aufzuführen. Dieser sollte in demselben reinen und idealen Kunststyle erstehen wie die Tempel der Liebe und Freundschaft, die man zwischen Rosen und Vergißmeinnicht mit Wasserfarben in Stammbücher junger Mädchen gemalt findet. Hier widersetzte sich Karl; er konnte zwar gegen die Gründe des Onkels nicht aufkommen, aber sein Herz, das für die hohen Schöpfungen seiner Väter schlug, wollte sich nicht beschwichtigen lassen.
So lassen Sie mir wenigstens meine geschmacklosen Steinhaufen, wie Sie sie nennen, lieber Onkel, da sie doch nun einmal da sind; lassen Sie sie mir, wenn auch nur zur Vergleichung, wie schön sich Ihre Tempel dagegen ausnehmen; machen Sie daraus die Prügelknaben Ihrer ästhetischen Unterrichtsstunden!
Karl sprach dies mit erhobener Stimme, denn er sah durch dunkelgrüne Zweige das helle Kleid der Tochter des Hauptmanns schimmern, welche jenseits der Taxuswand neben seiner Schwester vorbeischritt. Er hätte ums Leben gern gehabt, daß Cölestine ihn gehört. Aber die beiden jungen Mädchen schienen ganz in ihr Gespräch versunken. Sie hatten eine vergötternde Freundschaft, eines jener über Grab und Tod hinaus berechneten Seelenbündnisse geschlossen, wie es die schwärmerisch angeregten Gemüther jener Tage liebten, umflochten von Immergrün, überschattet von düster rauschenden Cypressenzweigen. In diesem Verhältniß war Cölestine die Gebende, Marianne, die zu ihrer Freundin wie zu einem Wesen höherer Art hinaufblickte, die Empfangende. Die Letztere war ein einfaches Naturkind, sich der Freundin hingebend im Liebesbedürfniß ihrer achtzehn Jahre, von dieser fortgerissen in Schwärmereien, welche ihrem Innern eigentlich fremd waren und denen sie doch, soweit nur die kleinen Kräfte ihres Gefühls reichten, nachhing. Es war das jene Heuchelei der Liebe, welche aus Gutmüthigkeit Empfindungen zu theilen sich bestrebt und unterdeß vorläufig auch zu theilen vorgibt, weil es dem Andern darin heimisch ist. Cölestine dagegen hatte seit je einen großen Schwung des Geistes besessen; es schlummerten kühne Gedanken in ihr, welche nur die strenge Zucht des Vaters und die Landeinsamkeit, die alle geistige Anregung ausschloß, nicht aufkommen ließen. Cölestine war auch die Schönere von Beiden; ihre feingezeichnete gerade Nase, das Oval ihres etwas zu blassen Gesichts waren von auffallender Schönheit und ihre runde schmale Stirn von wahrhaft classischer Vollendung. Und doch war es nicht unmöglich, daß Marianne bei der ersten Begegnung einen vortheilhaftern Eindruck gemacht hätte als Cölestine. Eine gewisse Sicherheit des Auftretens, welche das Bewußtsein des Ranges gibt, eine kecke Frische der Anschauung und des Ausdrucks hatte das adelige Fräulein vor ihrer Freundin voraus, und Cölestine war nur zu oft im Stande, das Herzgewinnende ihrer Erscheinung mit einem Anzuge zu verderben, der durch ungeschickte Wahl der Farben allen Regeln des Geschmacks Hohn sprach; und da ihr inneres geistiges Leben nur in Büchern Nahrung gefunden, hatte sie sich angewöhnt, so regelmäßig und wählerisch zu sprechen wie diese Bücher selbst, was ihr den Schein eines anspruchsvollen Wesens gab, das sie in der That nicht besaß. Die selbsterworbene Bildung tritt freilich immer anspruchsvoller auf als jene, die durch unsere Herkunft und Erziehung natürlich in uns aufwächst; mag jene gründlicher und verdienstlicher sein, so wird diese doch immer den Vorzug voraus haben, daß sie als etwas sich von selbst Verstehendes und Unbewußtes sich darbietet.
Die beiden Mädchen unterhielten sich sehr eifrig.
Nein, das kann ich dir nicht einräumen, Cölestine, sagte Marianne, indem sie mit äußerst wichtiger Miene ihr Lockenköpfchen schüttelte; wir Frauen werden immer von den Männern als die kleine Schaluppe betrachtet werden, die von ihrem stolzen Kriegsschiffe nachgezogen wird und nur im Falle der Noth die Ehre hat, von ihnen als Rettungsboot benutzt zu werden, wenn ihre Gefühle, ihre ehrgeizigen Bestrebungen im Kampfe mit der Welt Schiffbruch leiden.
Glaubst du? Ich weiß nicht, ob die Zukunft uns nicht ein anderes Loos anweist. Es hat sich eine seltsame Bewegung, eine geistige Währung unsers Planeten bemächtigt …
Ja freilich, fiel Marianne ein, wenn ich meinen Vater und den deinen zusammen disputiren und kannegießern höre, dann kommt es mir vor, als ob die Menschen ihre alten Möbel verschlissen hätten und sich durchaus eine ganz neue Einrichtung in ihren Stuben machen wollten!
Ja, das ist in der That wahr, und ich glaube, es ist an uns, mitzurathen und uns zu regen, damit …
Damit unsere kleinen zierlichen Nähtischchen neben ihren langweiligen Actentafeln in Eine und dieselbe Linie gerückt werden?
Damit unser Geschlecht nicht wieder in das alte dienende Verhältniß gesetzt werde, wo ihm die Entwickelung seiner geistigen Anlagen verkümmert wird und ein enger Kreis alltäglicher Gefühle vorgeschrieben ist, über den es bei Strafe der Ketzerei nicht hinausreichen soll!
Ist die Welt des Gefühls nicht die unsere? Sind wir zu Thaten berufen?
Wenn nicht zu Thaten, doch zu Gedanken. Und würdest du nicht innere Entwickelungen, Siege, Selbstbefreiungen des Gemüths nach innern Kämpfen, nicht auch Thaten nennen?
Ich weiß nicht mehr, was ich dir antworten soll, Cölestine; du wirst wol, wie immer, Recht haben! —
Mit solchen Gesprächen plauderten die Gruppen von Personen, die wir dem Leser vorgeführt haben, den lauen Lenzesabend fort. So friedlich das Bild, welches wir vor seinen Augen entrollten, so unbewegt und mild die weiche Luft, die über demselben liegt, so zittern doch gewisse Schwingungen darin nach, die von einem wild bewegten Mittelpunkte entfesselter Gedanken und empörter Kräfte bis in diese entlegene Landeinsamkeit gedrungen sind. Während der Hauptmann sich der Axthiebe freut, welche jacobinische Hände gegen den alten Stammbaum feudaler Herrlichkeit führen, will Karl die Rechte einer schönen, von Leidenschaft ergriffenen Innerlichkeit im Conflict mit dem äußern Beruf triumphirend wissen; Cölestine aber fodert von der Bewegung, in welche die Geister der Zeitgenossen gerathen sind, eine andere Stellung des Weibes in der Gesellschaft. Bescheidene, milde Wünsche! Wie alt mußte die Welt werden, um den Muth zu fassen, sie auszusprechen! Und wie rasch ward dann der Sprung gemacht zu der Zeit, die mit mächtigem Verlangen kriegerisch an alle Thore der verschlossenen Burgen schlägt, von denen herab die lachenden Erben der Geschichte ihre Unterthanen beherrschen!
Zweites Kapitel.
Am folgenden Morgen finden wir unsere Familie um den Frühstückstisch versammelt, der in einem großen Zimmer des Erdgeschosses von Haus Schwalborn stand. Die Fenster, welche nach dem Garten hinausgingen, waren von den Wipfeln der nächsten Obstbäume vor den Strahlen der Sonne geschützt, und der Raum hatte dadurch etwas Schattiges und Düsteres bekommen. Dunkles Holzgetäfel erhöhte diesen Eindruck. An den Wänden umher hingen die Bilder der Vorfahren, Physiognomien ohne große Bedeutung, anständige Gesichter ehrenwerther Leute, in deren Zügen weder große Leidenschaften noch große Schicksale sich aussprachen. Nur Ein Bild machte eine Ausnahme dies stellte eine Klosterfrau dar, deren blasses, sanftes Gesicht mit einem Ausdruck von Melancholie aus der Stirnbinde und den Linonfalten hervorsah, daß es Einem das innerste Herz rührte. Neben ihrem Bilde hing sonderbarer Weise ein anderes, augenscheinlich von gleicher Hand gemalt und in gleichen Rahmen gefaßt, das einen stattlichen, derben, keckblickenden Bauer darstellte. Wie dieses Plebejergesicht in der Ahnengalerie des freiherrlichen Hauses Schwalborn Aufnahme gefunden, ist ein Räthsel, dessen Lösung wir erst von der Zukunft erwarten können.
Die Gesellschaft war auffallend still heute, beinahe gedrückt. Gnaden Mama hatte sich am Abend zuvor mit dem Verwalter gezankt, und demzufolge war ihre gefältelte Nachthaube noch diesen Morgen weit tiefer über das linke Ohr gezogen als über das rechte, — in Umstand, der allen Hausbewohnern einen unerfreulichen Eindruck machte, denn er deutete auf stürmische Witterung. Der Freiherr von Schwalborn grübelte über die roth angestrichene Stelle des Reichspostreiters nach, welche der Hauptmann am Abend zuvor ihm mitgetheilt hatte; und diese Stelle enthielt genug, um einen ruhigen Mann von gesunden Grundsätzen ärgerlich zu machen. Ja, ja, es gingen Dinge in der Welt vor, welche Guntram von Schwalborn durchaus nicht gefielen; der Hexentanz der »Vernunft« in Frankreich wirbelte in immer weitern Kreisen umher und kam somit näher und näher. Am stillsten war der Domherr; dem war immer, als hätte er ein schlechtes Gewissen, wenn die gestrenge Dame verdrießlich war, und er vermied es, seine Schwägerin anzusehen. Aber desto aufmerksamer war er für ihre Bedürfnisse; er schob ihr bald die Butterdose aus Meißner Porzellan zu, bald hielt er ihr mit graziösem Lächeln die silberne Zuckerschale hin, — kleine Dienste, an welche Karl heute seltsamer Weise gar nicht dachte; mit Karl mußte überhaupt etwas vorgegangen sein; er hatte am Abend zuvor Cölestinen nach Hause begleitet — war zwischen Beiden etwas vorgefallen? Marianne, die allein um seinen Ritterdienst wußte, sah ihn forschend an. Er war blaß, war zerstreut und ließ endlich gar den Deckel der Milchkanne auf seine Tasse fallen, daß der Henkel derselben abbrach und die dicken Kaffeetropfen auf Mariannens lilaseidenes Fichu spritzten.
Du bist heute sehr ungeschickt, Karl! sagte seine Mutter unwillig.
Es ist nur der Henkel, Gnaden Mama.
Eine Tasse ohne Henkel ist, was ein Mensch ohne Zopf, lieber Karl. Marianne, wirf die Tasse in den Schloßgraben.
Marianne ging, um zu gehorchen, und Karl entfernte sich, ohne sein Frühstück zu beenden.
Trotzkopf! sagte Frau von Schwalborn entrüstet. Da geht er. Was hat der Junge? Guntram, du solltest solch ein Betragen nicht dulden.
Was meinst du, liebe Agnes?
Ich meine, daß die Jugend von heute immer mehr ausartet. Hast du den Lambert Kersting neulich im Sonntagsstaat in der Pfarrkirche gesehen? Geputzt wie ein Zierbengel aus der Stadt. Weiße Weste, silbergrauen Frack, zwei Uhren, ganz wie der ärgste Muscadin.
Das ist ein toller Bursch! sagte der Domherr; er hat sich den schwarzen Hengst, den der alte Kersting großgezogen, zum Reitpferde dressirt, daß es eine Lust ist, die beiden Wildfänge zu sehen; man weiß nicht, wer toller, der Schwarze oder der Blondkopf.
Ich glaube in der That, Sie haben noch Ihre Freude daran, mon frère!
O keineswegs, keineswegs, Frau Schwester!
Du solltest dem Ding ein Ende machen, Guntram.
Ach, laß doch den Bauerburschen sich seines Lebens freuen, antwortete der Freiherr.
Das nennst du, sich seines Lebens freuen?! Den Herrn machen, über seinen Stand hinaus wollen, das Volk mit seinem Beispiel verderben, nach der neuen Weise tanzen, welche die tolle hirnwüthige Canaille in Frankreich aufspielt — Gnaden Mama wurde immer heftiger —, nein, das soll ein Ende haben, das dulde ich auf unsern Gütern nicht! Bitte, Herr Bruder, ziehen Sie die Klingel.
Was willst du thun, Agnes?
Den Verwalter kommen lassen. Der hochmütige Bauerbursche soll unterducken. Du wirst ihn auffodern lassen, sein Dienstjahr anzutreten.
Liebe Masoeur! sagte der Domherr erschrocken. — Agnes, warf der Freiherr ein, ich würde dir rathen, dies erst näher zu überlegen. Wir haben seit zwei Generationen nicht mehr unser Recht auf die Kinder des Schulzen geltend gemacht!
So wird es desto eher Zeit, daß wir es thun, damit dieses Recht nicht durch Verjährung verloren gehe!
Wir haben Verpflichtungen gegen die Familie, sagte der Freiherr Guntram von Schwalborn seufzend, und indem er auf das Bild des Bauers deutete, fügte er hinzu: Der Alte dort war ein Ehrenmann!
Ehrenmann hin, Ehrenmann her! eiferte Gnaden Mama — sollen wir deßhalb seinen Enkel einen Lump werden lassen?
Es ist mir nicht Alles klar in unsern Verhältnissen zu dieser Bauerfamilie; für alle Fälle meine ich, wir sollten die Leute nicht reizen!
Die gestrenge Hausfrau hatte auf solche Warnungen keine andere Antwort als den Ausruf: Einfältiges Geschwätz! und dann wandte sie sich zu dem unterdeß erschienenen Verwalter mit dem Auftrage:
Gehe Er noch diesen Morgen zum Schulzen Kersting; suche Er den Lambert auf und sage Er ihm, am Ersten folgenden Monats soll er sein Knechtjahr auf unserm Hofe antreten, und wenn er nicht komme, werde man ihn holen lassen.
Der Verwalter machte ein verwundertes Gesicht und blickte auf den gnädigen Herrn und den Domherrn hinüber. Dieser zog die Achseln und jener blies eine Wolke blauen Rauchs aus seinem Meerschaum auf. So nahm er schweigend seinen Rückzug, draußen aber murmelte er: Lambertule, Lambertule, was wirst du sagen — quid dices! Das heiße ich eine saure Botschaft tragen!
Der Verwalter war ein Mann, der seine Schule durchgemacht und in dem ein gewisser kaustischer Witz, ein trockner Humor sich entwickelt hatte. In jenen Tagen der guten alten Zeit gab es der Verhältnisse, Dinge und Vorgänge wahrlich genug, an denen ein Mann von gesundem Sinn, den der Zufall außerhalb dieser Verhältnisse und Vorgänge gesetzt, zum lachenden Philosophen werden konnte. Das war denn unser Verwalter, Herr Benedict Tafelmacher hieß er, auch geworden. Er lächelte fast immer, und heute lächelte er ganz besonders, als er sich den alten hochbeinigen Fuchs satteln ließ und unterdeß die großen verzinnten Sporen anschnallte, um den Befehl der gnädigen Frau auszurichten; einen mächtigen Regenschirm unter dem Arm, ein dreieckiges Hütlein auf den wohlfrisirten Locken, saß er dann auf und trabte zum Hofthore hinaus.
Der Bauer wird die Köpfe zusammenstecken, der Bauer wird in einige Gährung gerathen, sagte er für sich hin, während der alte Fuchs in seinen gewohnten kurzen Trab fiel, den keine Göttermacht beschleunigt hätte. Nun, schadet gar nichts, schadet durchaus nicht. Der Bauer muß gezwickt werden, sonst sticht er. Rusticus ungentem pungit, pungetem ungit, das ist ein altes Sprüchwort. Aber den Botenlohn, den ich mir verdiene, gebe ich für minder als eines Hellers Werth dahin!
Der Domherr hatte sich unterdeß auf sein Zimmer zurückgezogen; Karl suchte ihn hier auf und warf sich in einen Lehnstuhl am Fenster, während er seine Füße auf den Rücken eines großen braunen Wolfshundes von vorzüglicher Schönheit legte. Der Domherr nahm eine Filetarbeit, in welcher er eine leichte Jagdtasche strickte. Was hast du, lieber Karl? Du bist so düster, sagte er, als sein Neffe fortwährend stumm blieb.
Ich bin unglücklich.
Unglücklich? Wie leicht die Jugend dieses Wort ausspricht! Weißt du denn, was Unglück ist? O nein. Deine frischen Augen haben noch nicht in den Abgrund geblickt, den die Erfahrung uns Aelteren unter dem Boden unserer Existenz ausgehöhlt zeigt. Du ahnst das Leid nicht, das auf beiden Seiten unsern Lebensweg umgibt. Du weißt nicht, wie viel Wehe und Elend der Mensch zu dulden hat — oft nur um verjährter, eingewurzelter Vorurtheile willen, die den Fittich des aufstrebenden Genius lähmen, die Begeisterung eines thatkräftigen, edeln Willens in Fesseln schlagen und das Herz vom Herzen reißen!
Karl sprang bei diesen Worten auf und ergriff die Rechte seines Oheims. Mein Gott, Onkel, das sagen Sie? O, wie wahr, wie wahr ist, was Sie sagen!
Was hast du, Karl? Ich erschrecke dich, indem ich dir Dinge schildere, von denen dein junges, harmloses Herz keine Ahnung hatte — ja, es ist so, leider ist es so — die süßesten, erhebendsten, die herrlichsten Gefühle des menschlichen Herzens müssen brechen an Schranken, welche doch eigentlich nur die Willkür aufgerichtet hat. Der Schlendrian einer harten, blinden, dummen oder eigensüchtigen Scheinmoral hat sich zum Richter aufgeworfen und verdammt sie als dem Katechismus eines längst nicht mehr gültigen Gesellschaftsdogmas zuwider.
Der Domherr war warm geworden. Wer weiß, welche Erinnerungen aus jüngern Tagen sein Herz schwellen machten, als er so sprach! Wie sollte er, der Verehrer einer süßlich tändelnden Poesie, auch stets unempfindlich gewesen sein gegen die romantischen Empfindungen des Herzens, welche diese Poesie in jeder Zeile hauchte und auf welche er beim frühen Eintritt in seinen Stand hatte für ewig Verzicht leisten müssen!
Aber seine Aufregung kam bei weitem nicht der Karl’s gleich. Mit hochgeröthetem Gesicht hatte er des Oheims Hand gedrückt, während dieser sprach, und jetzt warf er sich schluchzend an seine Brust und sagte: Oheim — mein theurer Oheim — verzeihen Sie mir, daß ich auch Ihnen mistraute, auch gegen Sie mein Herz verschloß!
Karl — Junge — um Gottes willen, was ist dir?
Ich will es Ihnen sagen, versetzte Karl, sich fassend, ich will Ihnen Alles sagen, denn ich sehe ja, Sie werden mich verstehen, mich mit meiner Leidenschaft unter Ihren Schutz nehmen!
Leidenschaft? Schutz nehmen? Was soll das heißen?
Hören Sie, Onkel. Ich liebe. Ich hege eine Leidenschaft, die zugleich zu heftig und zu hoffnungslos ist, um mir nicht in die Tiefen meiner Seele den brennendsten Schmerz zu senken.
Ha — und wen, Unglücklicher?
Ich liebe Cölestinen!
Der Domherr fuhr aus seinem Sessel auf, und indem er beide Hände auf die Schultern Karl’s legte, sagte er heftig: Karl, Karl! was muß ich von dir hören! Du? Cölestine? Eine Bürgerliche ohne Herkunft — eine Protestantin? Gott im Himmel! Unglücklicher Mensch! Wie kannst du einer solchen ruchlosen Thorheit dich hingeben?
Oheim — das sagen Sie mir? und eben noch sagten Sie …
Ei, was ich eben sagte, darauf kommt es nicht an — das war im Allgemeinen gesagt — ich dachte an ganz andere Fälle — du wirst doch nicht glauben, ich würde damit eine Verbindung gutheißen zwischen dem Reichsfreiherrn von Schwalborn und einer Zerrwitz?
Der Domherr legte eine besondere verächtliche Betonung auf den plebejischen Namen.
Karl warf sich in die Sophaecke und verhüllte sein Gesicht mit den Händen.
Herr des Himmels — wenn das deine Mutter erführe! stammelte der Domherr und begann im Zimmer auf und ab zu schreiten, indem er in höchster Beklommenheit an den Nägeln kaute. Was ihn beängstigte, war nicht allein eine scenenreiche, allen Frieden des Hauses scheuchende Zukunft, in welche Karl’s Geständniß ihn blicken ließ; es waren auch schmerzliche Gedanken an die eigne Verantwortlichkeit. Wie — so würden diese Gedanken, in Worte gefaßt, etwa gelautet haben — wie würde es dir ergehen, armer Desibodus Ehrembrecht, wenn Gnaden Mama wüßte, auf welche Pfade du ihren Sohn und Stammhalter gebracht! Wie würde sie dir die unschuldige Schäferpoesie vorwerfen, mit welcher du ihn genährt — die milden, süßflötenden Götter und Göttinnen deiner Idyllen würden unter ihren Händen eine Schar Dämonen werden, die dich umbrächten! Armer, armer Desibodus Ehrembrecht!
Er fühlte sich völlig rathlos.
Wie lange nährst du diese unselige Leidenschaft? fragte er nach einer langen Pause.
Karl antwortete nicht.
Ich hoffe nicht, daß du dich ihr erklärt hast.
Ja, lieber Onkel, das habe ich, gestern, als ich Cölestinen heimführte. Der Hauptmann war noch in sein Spiel bei meinem Vater vertieft; ich brachte sie bis an ihre Hausthür. Als sie mir gute Nacht sagte — da ward mir so weich ums Herz, daß mir die Stimme versagte und Thränen meine Augen füllten. Sie sah es. Sie schied nicht, sondern hielt lange meine Hand in der ihren. Ich küßte endlich ihre Hand, und meine Thränen fielen darauf. Sie drückte meine Hand, sah mich mit einem unaussprechlichen Blick an — und — schlüpfte über ihre Schwelle!
Schlüpfte über ihre Schwelle! rief der Domherr, der voll Angst zugehört hatte, tief Athem holend — das ist also Alles?
Es ist genug, uns fürs Leben Eins und unzertrennlich zu fühlen!
Ja, ja, lächelte der Domherr, wir kennen das! — Er griff heftig nach seinem Hut und spanischen Rohre.
Wohin wollen Sie? fragte Karl, ängstlich auffahrend — was mein überschwellendes Herz Ihnen anvertraute, werden Sie nicht misbrauchen, lieber Onkel!
Misbrauchen? nein — darüber sei ruhig.
Er eilte ohne weitere Erklärungen aus dem Zimmer. — —
Der Domherr hatte beschlossen, augenblicklich mit Cölestinens Vater zu sprechen. Er machte sich ungesäumt nach dessen Wohnung auf den Weg. Als er vor dem freundlichen kleinen Landhause stand, welches Hauptmann Zerrwitz bewohnte, war er bereits zur Hälfte beruhigt. Seine peinigendsten Beängstigungen waren untergegangen in der Ueberzeugung, daß der Hauptmann mit seiner Entschlossenheit und Thatkraft gewiß rasch das richtige Mittel auffinden würde, um der verdrießlichen Verirrung der beiden jungen Leute aufs nachdrücklichste ein Ende zu machen. Und dann waren ja auch Cölestine wie Karl so wohlgerathene und einsichtsvolle junge Leute, daß es nicht schwer sein konnte, sie zur Vernunft zu bringen.
Cölestine öffnete dem Domherrn die Hausthür. Sonst hatte er die Gewohnheit, sie freundlich lächelnd zu begrüßen, auch wol, wenn Niemand zugegen war, der einer solchen Compromittirung seiner Würde Zeuge, ihre schmale und sammtne Hand zu küssen. Heute erwiderte er ihre Frage nach seinem Wohlergehen mit einem sehr strengen, väterlich strafenden Blick und eilte dann schweigend über den Hausflur an die Thür vor des Hauptmanns Wohnzimmer.
Der Hauptmann war damit beschäftigt, das Schloß einer langen Entenflinte vom Roste frei zu scheuern, und bewillkommnete mit einem nachlässigen Kopfnicken den Domherrn, der, indem er seinen brüsken Freund begrüßte, keine von den Formeln der Höflichkeit vergaß, welche die gute Sitte jener Tage vorschrieb.
Nehmen Sie Platz, Herr von Schwalborn.
Der Domherr setzte sich, stülpte den Hut auf sein spanisches Rohr und legte die Hände gefaltet darüber, um den Augenblick abzuwarten, wo der alte Soldat es für passend halten würde, seinem Besuche mehr Aufmerksamkeit als seinem Flintenschlosse zu schenken.
Dieser Augenblick schien aber nicht eintreten zu wollen.
Er ist doch ein ungehobelter Roturier, dachte der Domherr und fühlte, daß jeder verfließende Moment es ihm schwerer mache, zu beginnen.
Ein schöner Tag heute! hob der Hauptmann nach einer Weile an, während er die Nuß festschraubte.
Zu warm! sagte der Domherr seufzend und die Stirn wischend.
Machen Sie sich’s bequem, wie ich! Rock aus! — Der Domherr lächelte mit vieler Würde. Er wußte, was er sich schuldig war.
Ich habe eine seltsame Unterredung mit meinem Neffen gehabt, begann er, um einmal das Eis zu brechen.
Nun? sagte der Hauptmann, anscheinend mit großer Gleichgültigkeit und doch gespannt aufhorchend.
Und nun komme ich zu Ihnen. Ich wollte Ihnen einen Wink geben — eine bloße Andeutung wird Ihnen genügen, und Sie werden ein Ende machen!
Ich verstehe Sie nicht.
Zwischen Karl und Cölestinen hat sich ein Liebeshandel entsponnen.
Ei was! sagte der Hauptmann, indem er seine Arbeit unterbrach und den Domherrn anschaute.
Ja, ich habe mich ebenso gewundert wie Sie! erwiderte der Domherr, obwol er auf den Lippen des Hauptmanns ein so maliciöses Lächeln schweben sah, als ob dieser sich durchaus nicht verwundere. Der Domherr wurde ganz irr an ihm.
Es ist sehr, sehr zu verwundern, sagte jener; sie ist ein gutes, hübsches Mädchen, und er ein gescheiter, schmucker Bursche.
Es ist sehr zu verwundern, sagte der Hauptmann mit dem ernsthaftesten Gesichte von der Welt.
Der junge Freiherr von Schwalborn, versetzte der Domherr etwas piquirt, hat sonst freilich noch keine Anlage zu thörichten Streichen bewiesen. So wird denn hoffentlich auch dieser ohne schlimme Folge bleiben. Ich denke, Sie säumen nicht, mit Ihrer Cölestine ein ernstes Wort zu reden, ihr allen Umgang mit Karl zu verbieten und nöthigenfalls sie für eine Zeitlang fortzuschicken. So ist die Verdrießlichkeit still beseitigt, ohne daß die Familie meines Bruders beunruhigt und durch ärgerliche Scenen belästigt wird.
Der Hauptmann sah den Domherrn eine Weile schweigend an.
Herr Domcapitular, sagte er dann mit seinem maliciösesten Lächeln, ich sehe ganz die Verpflichtung ein, die mir als tieferstehendem bürgerlichen Menschen obliegt, Alles zu opfern, um jeder Beunruhigung der hochfreiherrlichen Familie vorzubeugen, ja nöthigenfalls das Einzige, was ich auf Erden besitze, mein Kind, von mir zu geben, um Ihrem Hause ärgerliche Scenen zu ersparen. Ich sehe das sehr wohl ein, sehr wohl! Doch wird Ihre eigene erleuchtete Einsicht es Ihnen sagen, welch ein unerhörtes Glück für mich und meine Tochter dann liegen würde, in eine Verbindung mit einem so vornehmen, so grenzenlos und unaussprechlich adeligen Hause zu treten. Wie aber wollen Sie, daß wir selbst ein Glück leichtsinnig von uns stoßen sollen? Denken Sie, die unermeßliche Ehre! Glauben Sie denn, ich sei nicht ehrgeizig wie ein anderer Mensch auch?
Sie scherzen, sagte der Domherr sehr erschrocken.
Bewahre mich der Himmel, in so ernster Angelegenheit zu scherzen!
Aber …
Ich weiß, was Sie sagen wollen. Der Abstand zwischen unserer Niedrigkeit und der Schwalborn’schen Höhe ist so groß, daß selbst ein so wohlerzogener Mann, wie Sie, nicht Anstand nimmt, mich darauf aufmerksam zu machen, ohne befürchten zu müssen, daß er mich verletze. Aber machen Sie sich die Mühe nicht, lieber Domherr! König Cophetua liebte eines Bettlers Tochter und — doch Sie sind in solchen Geschichten bewanderter denn ich … stellen Sie sich die rührendsten Situationen aus ihnen allen vor und … nehmen Sie unsere Partei.
Herr Hauptmann, wie kommen Sie mir vor — erlauben Sie mir doch, meine Gedanken auszusprechen — ich bin weit entfernt, etwas für Sie Verletzendes in Beziehung auf Geburt zu äußern — aber bedenken Sie doch — Sie sind Protestant.
Ja, das bin ich! und beim Teufel … hohnlachte der Hauptmann laut auf … das freut mich am meisten! Sagen Sie, Domherr, wollen Sie uns beistehen?
Ich sollte …
Karl’s Werbung um meine Tochter seinen Aeltern erklären, befürworten — der Bursche hat selbst nicht den Muth, zu sprechen.
Ums Himmels willen, welche Idee!
Ich bitte Sie darum!
Fodern Sie nichts, was meinem Gewissen, meiner … ja, meiner Ehre zuwider ist.
Wir sprechen uns noch darüber, sagte der Hauptmann mit unerschütterlicher Zuversicht.
Lächerlich, wahrhaft lächerlich! rief der Domherr desto entrüsteter aus, sprang auf und eilte nach sehr kaltem Abschiede davon. Der Hauptmann ließ ihn ruhig gehen, ohne ihn zu begleiten.
Als der Domherr fort war, ließ Zerrwitz seine angenommene Ruhe fahren und schritt mit untergeschlagenen Armen heftig in seiner Stube auf und ab.
Zerrwitz war von einem brennenden Ehrgeize besessen, und die vielen Demüthigungen, welche der bürgerliche Officier, selbst im Heere eines Friedrich des Großen, hatte über sich ergehen lassen müssen, konnten diesen Ehrgeiz nur bis zu einer ins Krankhafte gehenden Reizbarkeit ausbilden. Durch seine Verhältnisse jetzt an einen Erdfleck gebannt, wo er weit und breit nur Eine Familie fand, die sich an Rang und Ansehen über ihm dünkte, war es natürlich, daß sich alle seine Gedanken auf diese Familie richteten. Er war zornig, daß es ihm nicht einmal in einem Dorfe vergönnt, der Erste zu sein. Die adelstolze Familie kränkte ihn fortwährend — am meisten dadurch, daß sie augenscheinlich ihn gar nicht kränken wollte, sondern im Bewußtsein ihrer größern Vornehmheit nur das Gegentheil beabsichtigte und ihn augenscheinlich durch ihren Umgang zu ehren glaubte. Man schlug seine Einladungen mit einer würdevollen Gemessenheit aus, aber man bestürmte ihn mit Vorwürfen, wenn er eine Einladung ablehnte. Man sprach in seiner Gegenwart von Mesallianzen, von bürgerlichen Emporkömmlingen, als ob es gar nicht anders möglich sein könne, als daß er oder irgend ein anderer verständiger Mann darüber gerade so denke, wie man in Schwalborn darüber dachte! Man trug bei jeder Berührung die vollständigste Sicherheit zur Schau, daß dem bürgerlichen preußischen Hauptmanne nicht einfallen könne, sich für gleichen Stoffes zu halten, wie den ehemaligen österreichischen Dragoner-Lieutenant von Adel. Diese Sicherheit, dieses Bewußtsein war es, was den Hauptmann am meisten kränkte. Denn er fand trotz seines Ingrimms dawider gar kein Mittel, keine Waffe. Ausdrückliche Ueberhebung und Ausbrüche des Hochmuths hätte er mit Aussicht auf Erfolg befehden, demüthigen können. Aber gegen dieses stille innere Hoheitsbewußtsein war sein Ehrgeiz wehrlos. Die Formenroheit, die trotzigen Manieren, die er ihm gegenüber geflissentlich annahm, brachten ihn nicht weiter, und indem er fühlte, daß sie etwas von einem kindischen Ungezogensein hatten und ihn eher erniedrigten als hoben, wurde seine Seele noch erbitterter. Und doch vermochte er den Umgang mit den Schwalborns nicht aufzugeben. Dazu überwog der Ehrgeiz in ihm zu sehr den Stolz!
So beschränkte er sich darauf, bis die Stunde einer Demüthigung gekommen, das Verhältniß so hinzunehmen, wie es war, und nur zu seiner vorläufigen Herzensbefriedigung dem Freiherrn und seiner Gemahlin stets gerade so viel unangenehme Dinge beizubringen, wie ihm irgend einfallen wollten.
Eines schönen Tages aber machte der Hauptmann, dessen Auge, wie das eines alten Fuchses, nichts außer Acht ließ, was im Kreise seiner Beobachtung lag, die Entdeckung, daß sich der junge Erbe von Schwalborn in seine Tochter Cölestine verliebt habe.
Diese Entdeckung versetzte ihn in eine heftige Gemüthsbewegung. Eine Verbindung der jungen Leute war nicht nur ein Glück für seine Tochter, wie es die Welt nennt und es der Hauptmann, der in dieser Beziehung um keine Staffel höher stand als die Welt, ebenfalls ansah; noch näher trat ihm dabei die Hoffnung auf die glänzende Befriedigung seines innern Grolls, wenn die hochmüthige Familie da drüben den einzigen Sohn und Erben mit der Tochter des armen bürgerlichen Mannes zum Altare schreiten sehen müsse.
Vielleicht hätte ein anderer Mann in des Hauptmanns Lage mit gerechtem Stolze den Gedanken von sich abgewiesen, seine Tochter einer Familie aufzudrängen, die auf sie als ihrer unwürdig herabsah. Aber der alte Preuße hatte leider diesen Stolz nicht. Doch beschränkte er sich anfangs darauf, die beiden jungen Leute zu beobachten. Er fand sie zu seinem großen Verdrusse zu schüchtern und zu sentimental. Aber zu schlau, sichtliche Begünstigungen ihres Verhältnisses durchblicken zu lassen, suchte er vorläufig der Freundschaft zwischen Cölestinen und Mariannen jeden möglichen Vorschub zu leisten. Er wußte wohl, daß sich von Cölestinens Seite in dies Verhältniß viel von dem Egoismus der Liebe mische, daß sie oft nicht der Freundin allein, sondern der Schwester des Geliebten Ergießungen ihres Herzens machen werde, welche dem Letztern nicht unenthüllt bleiben konnten. Nebenbei suchte er Cölestinens Gedanken von zu vager Schwärmerei zurückzuhalten und auf die »praktischen« Bedingungen des Lebens zurückzuführen.
Du bist meine gute, verständige Tochter, sagte er einst zu ihr, als sie ihm die Wange küßte, um ihm gute Nacht zu wünschen. Ich habe nichts mehr, was mir Freude verspricht auf der Welt, als dich. Du wirst mir auch keinen Kummer machen, nicht wahr? Du liest mir zu viel — werde nur nicht überspannt, mein Kind. Sei immer offen gegen mich!
Cölestine blickte wie schuldbewußt zu Boden.
Du weißt ja, ich werde deinen Neigungen nie Gewalt anthun. Folge den Eingebungen deines Herzens — mir ist es Eins, wohin sie dich ziehen, wenn sie dich nur nach einem bestimmten Ziele ziehen. Du magst einen Bauerburschen oder einen Prinzen lieben — mir ist es gleich; aber du mußt ihn dann auch heirathen wollen. Nur nichts ohne Ziel und klar ausgesprochenen Zweck!
Cölestine hielt ihre Neigung tief im geheimsten Winkel ihres Herzens verschlossen, so daß sie keine Ahnung davon hatte, der Vater könne diese Worte mit bestimmter Beziehung gesprochen haben. Aber desto ermuthigender wirkten sie in ihrer schüchternen Seele; und als sie gestern Karl’s weiches, inniges: Gute Nacht! hörte, seine Hand in der ihren zittern fühlte, da überließ sie sich dem Gefühle, dessen Wogen über ihr zusammenschlugen; mit einem warmen Händedruck sagte sie Alles. Sie war sein!
Drittes Kapitel.
Wir müssen dem Leser jetzt eine Person vorführen, die in dem Baue unserer Erzählung eine Hauptstütze bildet. Es ist der Erbe eines Schulzenhofes, und er heißt Lambert Kersting. Sein Vater ist der reichste Bauer weit und breit, weil er nicht allein seinen väterlichen Hof, sondern auch die Verwaltung eines andern Guts besitzt, das Schwarzhorst heißt, der reichste Hof im Lande ist und dem heiligen Petrus zu Brennweiler, d. h. der dortigen Cisterzienserabtei, gehört; wenigstens werden dahin die Einkünfte abgeliefert; aber verwaltet wird der Hof nicht von dem Kloster aus, sondern seltsamer Weise ist der jedesmalige Schulze zu Kersting, der zu den Leibeigenen der Familie von Schwalborn gehörte, der unabhängige Verwalter des Hofes mit allem seinen ausgedehnten Zubehör an Feldern, Wiesen, Wald, Gefällen, Mühle und Gerechtsamen. Diese auffallende Stellung und Befugniß des Bauers hatte eine Urkunde seiner Gutsherrschaft für alle Zeiten anerkannt.
Man konnte nichts Schattigeres, Behaglicheres, Idyllischeres sehen, als dieses Gut Schwarzhorst. Der große Bauerhof lag am Abhange eines waldigen Hügels, das rothe Ziegeldach war bestreut von Blütenschauern der nahen Obstbäume, und unten am Fuße des Hügels rauschte, zwischen zwei lebendigen Hecken der nächsten Gärten eingefaßt, ein heller, lustiger Bach, der wie voll Kinderfröhlichkeit springend, gurgelnd, spritzend über Kiesel und Wurzelgeflecht fortschoß, um einige Schritte weiter eine kleine, vom Alter geschwärzte Mühle zu treiben und dann in einen breiten, schilfreichen Teich zu schießen. Ein Kranz dichten Eichenlaubs umrahmte das Bild.
Im Innern des Haupthauses, das durch seine Größe und Stattlichkeit die Mitte hielt zwischen Bauerhof und Herrenhaus, war Alles still; das Vieh war ausgetrieben, die Pferde vor den Pflügen und die Menschen mit ihnen gezogen zu gemeinsamer Thätigkeit. Das Landleben bringt die Thiere und die Menschen so nahe zusammen; die Menschen müssen da arbeiten wie die Thiere, und diese werken so still, so resignirt, so stets im selben Geleise, wie ihre Freunde, die Menschen. Die Waldgötter hätten aus dem nahen Busche hervortreten und sich an den Herd setzen können, so still war es auf dem Gehöfte. Nur die Tauben und Sperlinge, die im Strohdache der Scheunen nisteten, schienen es zu hüten. Sie waren so keck, daß sie sich kaum herabließen, den Hufen eines alten fuchsigen Kleppers auszuweichen, der auf dem Baumhof weidete.
In der weiten Küche ist Niemand; aber aus einem Hinterzimmer tönt eine laute Stimme. Wir betreten es. Es ist ein großes, mit einer gewissen Eleganz eingerichtetes Zimmer, welch man in dieser ländlichen Umgebung nicht erwarten sollte. Die Wände sind freilich nur geweißt, aber mit soliden neuen Möbeln besetzt; in der Mitte ein runder, spiegelblank gebohnter Klapptisch von Eichenholz, auf dem Bücher und Schriften liegen, und ein bequemes Canapee steht quer in das Zimmer gerückt, eine Genialität der Aufstellung, welche Bewunderung verdient in einer Zeit, in welcher man noch keinen Begriff davon hatte, daß sich ein Canapee anders als dicht an die Wand und ein Fauteuil anders als in die Zimmerecke stellen lasse. Die beiden Fenster waren geöffnet und eine Fülle dichter Weinranken hereingeschlagen; davor aber stand ein hoher Apfelbaum, in dessen Zweige die Buchfinken ihr künstlich verflochtenes Nest gebaut hatten. Das Gemach war so wohnlich, so sommerlich, so still, als hätte ein Dichter sich mit allen seinen Liebhabereien und Phantasien darin eingerichtet. Nur die Jagdapparate, die an den Wänden umherhingen, die Doppelpistolen, die über den Büchern auf dem kleinen Spiegeltische lagen, störten etwas diesen Eindruck. Neben den Pistolen lagen noch ein voller Kranz aus Eichenlaub und ein Dolch auf diesem Spiegeltische.
Es waren zwei Männer in dem Zimmer; der eine ein junger Mensch mit gewöhnlichen Zügen und auffallend blondem Haar: eine jener deutschen Physiognomien, mit runden frischen Wangen, breitem Kinn und starkem Einbug zwischen der geraden Stirn und der eben so geraden Nasenlinie. Was ihn auszeichnet, ist ein lebhaftes Glühen in den schmal geschlitzten Augen, ein Zug von Verschlagenheit und Keckheit um die Winkel des lächelnden Mundes. Er trug einen glänzenden, fein ausgenähten blauen Kittel und ein rothes seidenes Tuch, das nachlässig um den starken gebräunten Hals geschlungen war.
Der junge Mann stand mitten im Zimmer und schien sehr lebhaft seinem Gesellschafter etwas zu beweisen. Dieser Letztere war ein ältlicher Mann in militairischer Tracht, der auf dem Canapee ruhte und mit dem Lederquast seines spanischen Rohres spielte. Es ist ein alter Bekannter des Lesers, nämlich Niemand anders als der Hauptmann Zerrwitz, der unmittelbar nachdem ihn der Domherr verlassen, sich gedrungen gefühlt hatte, eine Unterhaltung mit dem jungen Manne zu suchen.
Was ihr jungen Leute doch heutzutage aus den Büchern herausstudirt! sagte der Hauptmann kopfschüttelnd, nachdem Lambert ihm eine Stelle aus Schiller’s Räubern declamirt.
Aus den Büchern? Nun ja, aus den Büchern; aber was sind die Bücher anders, als die Spiegel, in welchen das Leben sich abbildet? Es grins’t Euch mit einer scheußlichen Grimasse an, das Spiegelbild — nicht wahr? Und deßhalb sagt Ihr hochmüthig: es ist nicht so, das sind haarsträubende Phantasien verrückter Dichter. Meinethalb! träumt fort in Euerm Wahne — träumt, bis eine blutige Hand Euern Arm umkrallt und Euch wach schüttelt.
Und wessen ist die blutige Hand?
Die der Revolution! Gott segne sie!
Ihr seid ein verruchter Mensch, Lambert!
Meint Ihr? Nun, Jeder hat seine Ansichten. Ihr wißt nicht, wie ich die Euern nenne, alter Preuße! Auch haben wir beide unsere Autoritäten hinter uns — ich einige zwanzig Millionen begeisterter Franzosen, die das Feuer der Freiheit vom Himmel geholt haben und einen Weltbrand daraus machen, aus dem wie ein Phönix, leuchtenden Glanzes, die Himmel überstrahlend, der gerettete Genius der Menschheit aufsteigt.