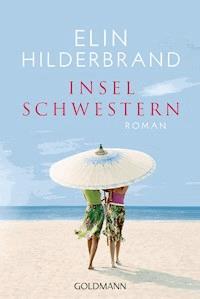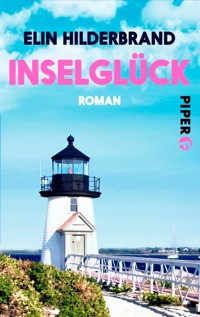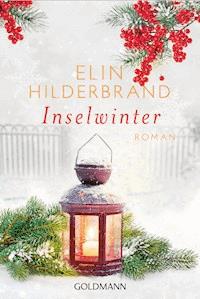8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Deacon Thorpe, berühmter Sternekoch und charismatischer Lebemann, erliegt im Sommerhaus der Familie auf Nantucket völlig überraschend einem Herzinfarkt. Die drei wichtigsten Frauen in Deacons Leben, seine Kinder und seine engsten Vertrauten kommen auf der Insel zusammen, um Abschied zu nehmen. Die ungleichen Frauen waren stets Konkurrentinnen, mit dem Ehrgeiz, den ersten Platz in Deacons Leben und in seinem Herzen zu erobern. Und so dauert es nicht lange, bis Geheimnisse offenbart werden und alte Feindschaften zutage treten. Doch dieser schicksalhafte Sommer hält für alle eine Überraschung parat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Deacon Thorpe, berühmter Sternekoch und charismatischer Lebemann, erliegt im Sommerhaus der Familie auf Nantucket völlig überraschend einem Herzinfarkt. Buck, sein Agent und bester Freund, sieht sich vor die Aufgabe gestellt, die gesamte Familie im Haus auf der Insel zusammenzuführen. Deacons drei Exfrauen sind einander spinnefeind, weil sie sich gegenseitig den Mann ausgespannt haben. Dann erfahren sie auch noch, dass Deacon hochverschuldet war und das Sommerhaus, das für alle einen hohen emotionalen Wert besitzt, binnen zwei Wochen der Bank gehört, sofern die Familie nicht genug Geld auftreibt. Es dauert nicht lange, bis erste Konflikte aufbrechen und einige gut gehütete Geheimnisse zu Tage treten, die Deacons Erbe überschatten. Doch dieser schicksalhafte Sommer hält für alle eine Überraschung bereit …
Weitere Informationen zu Elin Hilderbrand
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
ELIN HILDERBRAND
Ein Stern am
Sommerhimmel
Übersetzt
von Almuth Carstens
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel
»Here’s to Us« bei Little, Brown and Company
in der Hachette Book Group, New York.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2017
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Elin Hilderbrand
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: plainpicture/Elektrons 08; FinePic®, München
Redaktion: Ann-Catherine Geuder
em · Herstellung: eS
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-20635-2V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Anne und Whitney Gifford:
Danke für »mein eigenes Zimmer«.
PROLOG: EIN PERFEKTER TAG
Deacon Thorpe ist dreizehn Jahre alt und noch mehr Junge als Mann, als sein Vater Jack ihm verkündet, sie würden einen Tagesausflug machen, nur sie beide.
Deacon ist fasziniert von der Vorstellung, einen Tag außerhalb der Stadt zu verbringen. Sie haben kaum Geld für mehr als das reine Überleben. Jack arbeitet als Chef de Partie im Sardi’s am Times Square und hat nur drei Tage im Monat frei.
Noch mehr freut sich Deacon über das »nur wir beide«. Jack ist der König von Deacons Welt, hauptsächlich deswegen, weil er so selten anwesend ist. Deacon sieht dem Zusammensein mit ihm mit derselben freudigen Erregung entgegen wie Astronomen einem Kometen oder einer Sonnenfinsternis.
Jack weckt Deacon um vier Uhr morgens. Sie lassen Deacons Mutter und seine Schwester Stephanie schlafend in ihrem Apartment zurück. Auf Jacks Anweisung hin zieht Deacon seine Badehose an, und Jack trägt ein leuchtend gelbes Hemd mit Kragen, das Deacon noch nie gesehen hat.
Jack zupft mit stolzem Lächeln daran. »Extra für heute gekauft«, sagt er.
Für den Ausflug hat Jack einen Oldsmobile Cutlass gemietet. Deacon wusste gar nicht, dass sein Vater Auto fahren kann. Sie wohnen in Stuyvesant Town, und wenn sie irgendwohin wollen – zur Arbeit, in die Schule, in den Park –, nehmen sie die U-Bahn oder den Bus.
»Das ist mal ein klasse Schlitten«, sagt Jack.
Er steckt plötzlich voller Überraschungen.
Deacon verschläft einen Großteil der Fahrt und wacht erst auf, als sie eine Brücke überqueren, die aussieht wie aus einem Stabilbaukasten zusammengesetzt. Im Radio läuft Elton John mit »Don’t Go Breaking My Heart«. Jack singt mit: »Oh, honey, if I get restless …«
»Wo sind wir?«, fragt Deacon.
»Cape Cod«, entgegnet Jack, dann schmettert er: »Whoa-ho, I gave you my heart!«
Cape Cod. Das klingt irgendwie mythisch, wie Shangri-La.
Jack stellt das Radio leise und sagt: »Ich wünsche mir einen perfekten Tag mit meinem Sohn. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder?«
Um neun Uhr sitzen sie auf dem Oberdeck einer Fähre und trinken Kaffee. Deacon durfte noch nie Kaffee trinken; seine Mutter glaubt, das würde sein Wachstum hemmen. Jack scheint keine Bedenken zu haben, eine Tasse für Deacon zu bestellen. »Vielleicht willst du ein bisschen Sahne und Zucker reintun«, sagt er. »Damit er nicht so stark ist.« Aber Deacon entscheidet sich, ihn schwarz zu trinken wie sein Vater. Einige seiner jüdischen Schulfreunde hatten schon ihre Bar-Mizwa, und so betrachtet Deacon auch diesen Tagesausflug – als einen Initiationsritus, bei dem er etwas über das Erwachsenwerden lernt.
Die Fähre bringt Deacon und Jack an einen Ort namens Nantucket Island. Jack will unbedingt, dass sie sich an die Reling stellen, sobald Land in Sicht kommt. Sie passieren eine Steinmole, auf der sich Seehunde in der Sonne aalen. Echte Seehunde! Es sind die ersten wilden Tiere, die Deacon außerhalb eines Zoos sieht. Die Fähre gelangt in einen Hafen voller eleganter Motorjachten und Segelboote mit hohen Masten und komplizierter Takelage. Über ihren Köpfen kreisen Möwen. Deacon erblickt zwei Kirchtürme, einen mit weißer Spitze und einen mit goldener Kuppel, und Grüppchen grauer Schindelgebäude.
»Heute leben wir das Leben, wie es auf Nantucket üblich ist«, sagt Jack.
Auf dem Anleger mietet er wieder einen Wagen – einen sandbraunen Willys-Jeep, der keinem Fahrzeug gleicht, das Deacon je in New York gesehen hat. Er hat kein Dach, keine Fenster, noch nicht einmal Türen, sondern besteht im Wesentlichen aus zwei Sitzen und einer Gangschaltung, vier Rädern und einem Motor. Ein klasse Schlitten ist er nicht – dem Cutlass so unähnlich wie nur möglich –, doch Jack wirkt glücklicher, als Deacon ihn jemals erlebt hat.
»Spring rein!«, sagt Jack. »Auf geht’s zur großen Rundfahrt.«
Sie holpern über kopfsteingepflasterte Straßen vorbei an einer Eisenwarenhandlung namens Hardy’s, in deren Schaufenster zwischen Holzkohlegrill und Rasenmäher eine männliche Puppe steht, die dasselbe Hemd mit Kragen trägt wie Jack. Erst mäht er den Rasen, denkt Deacon, dann grillt er ein paar Burger. Es ist wie eine Szene aus Drei Mädchen und drei Jungen.
Sie kommen an einer Pizzeria vorbei, dann an einem Restaurant, das Opera House heißt.
Jack zeigt darauf. »Mein altes Jagdrevier«, sagt er. »Im Speiseraum steht eine echte britische Telefonzelle, in der ich früher immer meine französische Freundin Claire geküsst hab.«
Deacon spürt, wie er rot wird. Er kann sich nicht vorstellen, dass Jack Thorpe jemanden küsst, nicht einmal Deacons Mutter.
Sie fahren eine lange, kurvenreiche Straße entlang und passieren dabei mit grauen Schindeln verkleidete, von Rosen umrankte Cottages und Wiesen, auf denen hinter Lattenzäunen Pferde grasen. Links erhascht Deacon immer wieder flüchtige Blicke auf den blauen Hafen. Die Sonne ist sehr heiß geworden, und sein Magen fängt an zu knurren. Er hat heute bisher nur Kaffee getrunken und noch gar nichts gegessen.
Ein Leuchtturm kommt in Sicht. Er ist weiß mit einem breiten roten Streifen um die Mitte. Sie fahren an einem großen Gewässer vorbei; jenseits davon kann Deacon das Meer sehen. An einem Schild, auf dem HOICKSHOLLOW steht, biegt Jack links ab.
»Die gute alte Hoicks Hollow Road«, sagt er. »War früher mein zweites Zuhause.«
»Wirklich?«, entgegnet Deacon.
»Lustiger Name für eine Straße, oder?«
Deacon weiß nicht, was er antworten soll.
»Jedenfalls lustiger als East 28th Street«, meint Jack.
Die Straße schlängelt sich dahin, bis sie zum Sankaty Head Beach Club gelangen. NURFÜRMITGLIEDER steht auf dem Schild. Es riecht köstlich nach Pommes frites, und Deacon würde gern glauben, dass sie hier essen werden, doch das »nur für Mitglieder« flößt ihm Unbehagen ein. Die Thorpes sind keine Familie, die irgendwo Mitglied ist. Ganz und gar nicht. Deacon vermutet, dass man ihnen gleich erklären wird, sie seien widerrechtlich hier und sollten verschwinden.
Überraschenderweise wird Jack Thorpe an der Tür jedoch nicht nur begrüßt, sondern herzlich willkommen geheißen – von einem stämmigen, rotgesichtigen Mann mit einem Namensschild, das ihn als Ray Jay Jr., Manager ausweist.
»Jack Thorpe!«, sagt Ray Jay Jr. »Gott, was für ein Augenschmaus! Wie lange ist es her?«
»Viel zu lange«, erwidert Jack und stellt Ray Jay Jr. Deacon vor. »Ich habe gerade zu Deacon gesagt, dass ich mir einen perfekten Tag mit meinem Sohn wünsche. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Wie wär’s mit was zu essen, um der alten Zeiten willen?«
»Sollt ihr haben, Jack«, sagt Ray Jay Jr. und geleitet Jack und Deacon in den Club. Sie kommen an Schildern vorbei, auf denen DAMENGARDEROBE und HERRENGARDEROBE steht. Durch eine weiß lackierte Schwingtür gelangen sie nach draußen. Ray Jay Jr. bittet sie, an einem Tisch mit Blick auf den Swimmingpool Platz zu nehmen, der rautenförmig und mit tiefem, verlockend türkisblauem Wasser gefüllt ist. Zu beiden Seiten des Pools stehen Umkleidezelte mit gepolsterten Liegestühlen davor, auf denen wunderschöne Frauen in Bikinis an ihrer Sonnenbräune arbeiten und flachsblonde Kinder sich auf marineblau-weiß gestreiften Handtüchern rekeln. Kellner servieren Eistee mit Zitronenschnitzen, Bier und Fruchtcocktails. Hinter dem Pool ist über einen Holzzaun rot-weiß-blaues Flaggentuch drapiert, wahrscheinlich ein Überrest der Zweihundertjahrfeier.
Aus dem Lautsprecher ertönt wieder der Song »Don’t Go Breaking My Heart«.
Jack hält sich ein imaginäres Mikrofon unters Kinn, während er im Falsett mitsingt. Dann sagt er zu Deacon: »Spring doch einfach rein. Ich bestell für dich.«
Jetzt begreift Deacon, dass dies der Grund für die Badehose war, und zieht sein T-Shirt aus. Er tritt an den Rand des Pools. Ein paar Kinder planschen am flachen Ende, während ein älterer Herr im Freistil seine Bahnen zieht. Das einzige Schwimmbecken, in dem Deacon bisher war, befindet sich im Stadtteilzentrum in der Avenue A, wo das Wasser nach Chlor stinkt und zu warm und immer voller kreischender Kinder und Rabauken ist, die Deacon untertauchen und ihm den Kopf so lange unter Wasser halten, bis er in Panik gerät. Im Vergleich dazu ist dieser Pool kühl und friedlich wie ein See im Paradies.
Ich wünsche mir einen perfekten Tag mit meinem Sohn. Dieser Satz lässt Deacon das Herz aufgehen. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er das Gefühl, von Bedeutung zu sein.
Er springt hinein.
Zum Lunch gibt es einen doppelten Bacon-Cheeseburger mit Pommes, eine eiskalte Cola und Softeis. Ray Jay Jr. kommt, um sich zu erkundigen, wie das Essen ist, und Jack ein Bier anzubieten, aber Jack lehnt ab.
»Ich bin mit meinem Sohn hier«, sagt er.
Deacon hat noch nie erlebt, dass sein Vater ein Bier ausschlägt, schon gar nicht, wenn es umsonst ist. Jack hat ein Alkoholproblem, sagt Deacons Mutter. Sie nennt es ein Berufsrisiko, weil er ein einem Restaurant arbeitet, wo Alkohol eine allgegenwärtige Versuchung ist. Wenn Jack trinkt, passiert Schlimmes. Er gerät grundlos in Wut, wirft mit Sachen um sich, macht Sachen kaputt, beschimpft Deacon, Stephanie und ihre Mutter lautstark – und dann weint er immer, bis er zusammenklappt. Heute aber scheint Jack ein anderer Mensch zu sein. In seinem gelben Hemd mit Kragen sieht er aus wie ein Mitglied dieses Privatclubs. Im Radio läuft »Afternoon Delight«.
»Du weißt, worum es in diesem Song geht, oder?«, fragt Jack augenzwinkernd.
Deacon senkt den Blick auf seinen Teller. »Ja«, sagt er.
Jack klopft ihm verschwörerisch auf den Rücken. »Dann ist ja gut. Wollte nur wissen, ob du informiert bist.«
Deacon denkt, sie würden vielleicht den ganzen Nachmittag am Pool bei den Frauen in ihren Bikinis verbringen, doch Jack sagt: »Jetzt aber los an den Strand. Unmöglich, nach Nantucket zu kommen und nicht an den Strand zu fahren.«
Und so steigen sie wieder in den offenen Jeep, nicht ohne zwei der marineblau-weiß gestreiften Handtücher, die Ray Jay Jr. ihnen beim Hinausgehen zugesteckt hat.
»Hier habe ich vor fünfzehn Jahren gearbeitet«, sagt Jack. »Ich war der Neuling und Ray der Meister am Grill. Ich hätte dasselbe tun sollen wie er. Hätte bleiben und das Leben leben sollen, wie es auf Nantucket üblich ist.«
Deacon nickt zustimmend, obwohl er befürchtet, dass er selbst vielleicht gar nicht existieren würde, wenn Jack das wirklich getan hätte. Dieser beunruhigende Gedanke verflüchtigt sich, sobald Deacon den Strand sieht. Er ist ein langer Streifen goldenen Sandes. Der Ozean ist flaschengrün mit von weißer Gischt gekrönten Wellen. Jack und Deacon breiten ihre Handtücher aus. Jack stürzt sich ins Wasser, und Deacon folgt ihm.
Sie bodysurfen eine gute Stunde lang in den Wellen, dann lassen sie sich auf ihre Tücher fallen und dösen in der Sonne. Als sie aufwachen, ist das Licht sanfter geworden, und das Wasser funkelt.
»Hier ist sie«, sagt Jack. »Die goldene Stunde.«
Ein paar Minuten lang sitzen sie schweigend da. Deacon hat noch nie zuvor eine goldene Stunde erlebt, ist jedoch einmal mit der Familie seines Freundes Emilio in der Kirche gewesen, und so ähnlich fühlt er sich jetzt, friedvoll und andächtig. In seinem Leben in New York sieht er zu viel fern, und er und Emilio und Hector schießen in den Gassen hinter Stuy Town oft Flaschenraketen ab. Jack entfernt sich ein Stück den Strand entlang, und Deacon spürt, dass sein Vater allein sein möchte, deshalb tritt er wieder ans Wasser, wo er eine vollkommen geformte Muschelschale mit einem blau marmorierten Wirbel auf der Innenseite findet. Die nimmt er mit nach Hause, beschließt er. Er wird sie für immer behalten.
Er schleudert Steine ins Meer, bis Jack mit verträumtem, entrücktem Gesichtsausdruck zurückkommt. Deacon fragt sich, ob er wohl an seine französische Freundin Claire denkt.
»Was meinst du, sollen wir allmählich umkehren?«, fragt Jack. »Bis um sechs muss ich den Jeep zurückgegeben haben.«
Deacon nickt, aber das Herz wird ihm schwer. Er hat keine Lust, nach Hause zu fahren. Der Rest des Nachmittags ist von Melancholie überschattet. Sie holpern mit dem Jeep übers Kopfsteinpflaster und geben ihn bei der Autovermietung ab. Er hat Jack vierzig Dollar gekostet, was Deacon wie ein Vermögen erscheint.
Auf dem Anleger holt Jack eine Portion frittierte Muscheln, zwei Hummerbrötchen und zwei Schokoladen-Milchshakes. Deacon und sein Vater verspeisen ihr Festmahl auf dem Oberdeck der Fähre, während die Sonne untergeht und das Wasser rosa und golden sprenkelt. Jack summt eine Mischung aus »Don’t Go Breaking My Heart« und »Afternoon Delight« vor sich hin.
»So, das war ein perfekter Tag mit meinem Sohn«, sagt Jack. »Sollen wir runtergehen, damit du dich hinlegen kannst?«
Deacon würde am liebsten protestieren. Er möchte draußen bleiben und zuschauen, wie die Lichter von Nantucket verblassen und schließlich verschwinden, aber der Wind wird stärker, und Deacon bibbert. Er folgt seinem Vater nach unten, wo sie eine Bank für sich ergattern. Jack rollt die beiden gestreiften Handtücher zusammen – Deacon hat nie daran gezweifelt, dass sein Vater sie behalten würde; in dieser Hinsicht denkt er praktisch – und legt sie als Kopfkissen für Deacon auf das eine Ende der Bank.
»Danke«, flüstert Deacon.
Er versucht mit aller Macht, wach zu bleiben, doch das Schiff schaukelt sacht wie eine Wiege und bewirkt, dass seine Augenlider schwer werden und irgendwann zufallen. Irgendwie weiß Deacon, dass mehr als ein perfekter Tag mit seinem Vater zu Ende geht. Es ist, als könnte er in die Zukunft sehen: Eine Woche später wird Jack seine Familie endgültig verlassen und die letzten Überreste von Deacons Kindheit mitnehmen. Es gibt nichts, was einer von ihnen tun könnte, um das zu verhindern.
BUCK
In seinen dreißig Jahren als Agent hatte John Buckley einige erstaunliche Taten vollbracht, die aber nichts waren im Vergleich zu dem Wunder, Deacon Thorpes ganze Familie in dem Haus auf Nantucket zusammenzubringen, damit sie alle Deacons Asche verstreuen und den beunruhigenden Zustand seiner Finanzen erörtern konnten.
Buck wusste, dass er eigentlich zurückhaltend mit dieser Selbstbeweihräucherung sein musste, denn die ganze Familie würde nicht zusammenkommen. Scarlett hatte sich standhaft geweigert und würde so lange in Savannah bleiben, vermutete Buck, bis ihr klar wurde, dass kein Geld mehr da war. Irgendwann in naher Zukunft würde sie wie Wile E. Coyote in den alten Cartoons, der glaubte, auf festem Boden zu stehen, unter sich schauen und bemerken, dass da nichts war als Luft. Dann würden sie mit Sicherheit von ihr hören.
Sechs Wochen waren verstrichen, aber John Buckley konnte immer noch nicht fassen, dass sein allererster Klient und bester Freund Deacon Thorpe – der berühmteste Koch Amerikas – tot war.
Am 6. Mai war ein Anruf von einer unbekannten Nummer auf Bucks Handy eingegangen, und da Deacon sich seit fast achtundvierzig Stunden nicht gemeldet hatte, nahm John Buckley ihn entgegen, weil er dachte, er sei vielleicht von seinem Freund. Er saß in einem Stuhl im Colonel’s, dem letzten Friseurgeschäft alter Art in New York City, wo Handys ausdrücklich verboten waren.
Buck wusste, dass er nie wieder einen Termin bei Sal Sciosia (dem Colonel, Schlacht um Khe Sanh, Vietnam) bekommen würde, wenn er den Anruf annahm, aber er hatte keine Wahl.
Eine unbekannte Nummer konnte alles Mögliche bedeuten. Am wahrscheinlichsten: Deacon war mal wieder auf einer Sauftour, obwohl er versprochen, geschworen, praktisch einen heiligen Eid unter Blutsbrüdern geleistet hatte, dass es nie mehr einen Vorfall geben würde wie den vor zwei Wochen, der Deacon höchstwahrscheinlich seine Ehe gekostet hatte. Scarlett hatte Ellery von der Petite Ecole, einer der renommiertesten Privatschulen in New York City, genommen und war mit ihr nach Savannah gereist, Deacon reumütig und zerknirscht als Neuabstinenzler zurückgeblieben.
Aber Menschen blieben ihren Schwächen treu. Wenn Buck in seinen dreißig Jahren als Agent eins gelernt hatte, dann das. Dieser Anruf würde entweder vom NYPD sein oder vom Barkeeper im McCoy’s, wo Deacon sturzbetrunken mit dem Kopf auf dem Tresen lag.
Buck musste rangehen.
»Hallo?«
»Mr Buckley?«, sagte eine amtlich klingende Stimme. »Hier ist Ed Kapenash. Ich bin Polizeichef von Nantucket, Massachusetts.«
»Nantucket?«, fragte Buck. Deacon besaß ein großes, baufälliges Sommerhaus auf Nantucket, das den Namen Amerikanisches Paradies trug, den Buck insgeheim grotesk fand. »Ist Deacon da?« Sein Tonfall vermittelte mehr Ungeduld, als er beabsichtigt hatte, und vermutlich nicht den vollen Respekt, der einem Polizeichef gebührte.
»Wir haben Ihre Nummer in seinem Handy als seinen Notfallkontakt gefunden«, sagte der Chief. »Ich nehme an, Sie sind ein Freund …? Von Deacon Thorpe …?«
»Sein Agent«, sagte Buck, dann fügte er seufzend hinzu: »Und ja, sein bester Freund. Ist er im Gefängnis?« Auf Nantucket war Deacon bisher nie in Schwierigkeiten geraten – aber was ihn betraf, gab es für alles ein erstes Mal.
»Nein«, sagte der Chief. »Er ist nicht im Gefängnis.«
Buck verließ das Colonel’s halb rasiert.
Sein seit dreißig Jahren bester Freund war tot.
»Massiver Herzinfarkt«, hatte der Chief gesagt. »Ein Inselbewohner namens JP Clarke hat ihn heute Morgen gefunden und telefonisch gemeldet. Aber der Gerichtsmediziner hat den Todeszeitpunkt auf ungefähr zwölf Stunden früher festgesetzt – also auf etwa sieben, acht Uhr gestern Abend.«
»Hatte er getrunken?«, fragte Buck. »Drogen genommen?«
»Er war hinten auf der Terrasse über dem Tisch zusammengesackt«, sagte der Chief. »Mit einer Cola light. Und im Aschenbecher lagen vier Zigarettenstummel. Drogen wurden nicht gefunden, aber der Gerichtsmediziner veröffentlicht noch einen Bericht. Mein herzliches Beileid. Meine Frau war ein großer Fan seiner Sendung. Sie hat zu jedem Patriots-Spiel den Muscheldip gemacht.«
Beileid, dachte Buck. Das gehörte auf Deacons Blöde-Wörter-Liste. Was sollte es überhaupt heißen?
»Dann überlasse ich es Ihnen, die Familie zu informieren?«, fragte der Chief.
Buck schloss die Augen und dachte: Laurel, Hayes, Belinda, Angie, Scarlett, Ellery.
»Ja«, bestätigte er.
»Und Sie kümmern sich um die sterblichen Überreste?«
»Ich kümmere mich … ja, ich kümmere mich um alles.«
Massiver Herzinfarkt, dachte Buck. Cola light und vier Zigaretten. Es waren die Zigaretten, die den Ausschlag gegeben hatten, schätzte er. Er hatte Deacon gesagt … Aber jetzt war keine Zeit, seinem inneren Oberstabsarzt freien Lauf zu lassen. Deacon war nicht mehr da. Das war nicht fair. Es war nicht richtig.
»Danke, Chief«, sagte Buck, »dafür, dass Sie mich benachrichtigt haben.«
»Na ja«, sagte der Polizeichef, »das ist leider mein Job. Richten Sie auch den Angehörigen mein Beileid aus.«
Buck legte auf und ließ seinen Arm in die Höhe schnellen. Ein Taxi setzte den Blinker und hielt am Straßenrand. Alles auf der Welt war wie zuvor, und doch war alles anders. Deacon Thorpe war tot.
Dieser Tod war niederschmetternd genug, doch als Deacons Testamentsvollstrecker musste Buck sich anschließend auch mit dem Papierkram befassen, der unweigerlich folgte. Er fing mit dem Offensichtlichen an: Deacons Testament. Das Restaurant hatte er seiner Tochter Angie hinterlassen, was naheliegend war, obwohl Harv es erst einmal weiterführen würde. Seinen zweiten größeren Vermögenswert – das Haus auf Nantucket – hatte er den drei Frauen vermacht, mit denen er verheiratet gewesen war, Laurel Thorpe, Belinda Rowe und Scarlett Oliver, die es zu je einem Drittel besitzen und die Zeit, die sie dort verbrachten, gerecht und nach den Bestimmungen des Testamentsvollstreckers unter sich aufteilen sollten.
Na prima, dachte Buck.
Während er die Heiratsurkunden sichtete, die Deacons Eheschließungen mit Laurel, Belinda und Scarlett bescheinigten, die Scheidungsvereinbarungen mit Laurel und Belinda, den Kaufvertrag für das Haus auf Nantucket, das sich als mit drei Hypotheken und zwei Pfandverschreibungen belastet erwies, die GmbH-Unterlagen für Deacons Vier-Sterne-Restaurant, den Board Room im Zentrum von Manhattan, seine Verträge mit ABC (uralt, nicht mehr in Kraft) und dem Food Network, seine Kontoauszüge und Courtageabrechnungen, geriet Buck immer mehr in Panik. Das darf doch nicht wahr sein, dachte er und durchstöberte jede Schublade im Schreibtisch des Restaurants, durchsuchte akribisch das Apartment in der Hudson Street, was in Abwesenheit von Scarlett viel leichter zu bewerkstelligen war. Jedes Blatt Papier, das Buck fand, machte die Situation schlimmer. Es war wie ein Wechselspiel aus guten Nachrichten und schlechten Nachrichten, nur dass diese Version schlechte Nachrichten und noch schlechtere Nachrichten hieß.
Deacon hatte seit einem halben Jahr keine Hypothekenzahlungen mehr für das Haus auf Nantucket geleistet und war mit der Miete für die Wohnung in New York drei Monate im Rückstand. Wo war sein ganzes Geld nur geblieben? Buck stieß auf einen entwerteten Scheck über hunderttausend Dollar, ausgestellt auf Skinny4Life. Skinny4Life?, dachte Buck. Hundert Riesen? Das klang nach einem von Scarletts »Projekten«; da hatte es die von einer Frauenkooperative in Gambia gefertigten Taschen gegeben und danach eine Firma für bio-vegane Kosmetik, die vor ihrer Pleite fünfzigtausend von Deacons Dollars verschlungen hatte. Bevor Scarlett beschloss, »Geschäftsfrau« zu werden, hatte sie Fotografie studiert. Deacon hatte ein kleines Vermögen dafür ausgegeben, dass sie das University College im Südteil der Stadt besuchte – das, darauf hatte Buck ihn mehrmals hingewiesen, weder eine Universität noch ein College war. Deacon hatte für Scarlett eine hochmoderne Dunkelkammer in das Apartment einbauen lassen und ihr Kameras und Computer und Scanner und Drucker gekauft, die insgesamt den Wert eines Rolls-Royce mit Vollzeitchauffeur hatten. Die ganze Ausrüstung schlummerte jetzt hinter verschlossener Tür vor sich hin.
Buck entdeckte noch zwei entwertete Schecks, einer über vierzigtausend Dollar, ausgestellt auf Ellerys Schule, der andere für den Genossenschaftsvorstand des Gebäudes in SoHo, in dem Hayes wohnte. Buck hatte sich immer gefragt, wie Hayes sich das Apartment leisten konnte, und jetzt wusste er es: Deacon hatte dafür bezahlt. Wie es aussah, hatte er auch Angie hin und wieder einen Scheck zukommen lassen – dreitausend Dollar hier, zwölfhundert Dollar da –, und zwar mit dem Vermerk Spielgeld für Buddy. Und dann war da noch ein Scheck über dreißigtausend Dollar für einen gewissen Lyle Phelan, der auf den Fragezeichen-Stapel kam.
Trotz der hohen Summe all dieser Ausgaben wunderte Buck sich. Deacon bezog nur einen Dollar Gehalt vom Board Room, um die Betriebskosten zu senken, die bekanntermaßen die haarsträubendsten aller Restaurants des Landes waren. Aber die Einkünfte aus seinen beiden Fernsehsendungen – Vom Tag in die Nacht in den Tag mit Deacon und Aufgespießt – hätten eigentlich dafür sorgen müssen, dass er zahlungsfähig blieb.
Dann stieß Buck auf die telegrafische Überweisung vom 3. Januar. Eine Million Dollar von Deacons Konto bei Merrill Lynch an … die GmbH Board Room, der das Restaurant gehörte. Buck erinnerte sich, dass Deacon ihm um Weihnachten herum erzählt hatte, einer der Investoren sei ausgestiegen, und zwar Scarletts Onkel, der Richter aus Savannah. Der Mann – Buck hatte ihn vor zehn Jahren bei der Hochzeit kennen gelernt – war im Board Room essen gewesen, und anscheinend war dabei etwas schiefgelaufen. Deacon hatte Buck nie erklärt, was genau, aber der Richter hatte am Tag darauf angerufen und gesagt, er wolle sein Geld zurück, sofort. Und Deacon hatte nicht protestiert.
Er hatte entsetzt gewirkt über den Vorfall, Buck aber schon in der nächsten Woche telefonisch mitgeteilt, er habe einen neuen Investor aufgetrieben, der seine Visionen teile. Der Typ ist mit im Boot, hatte er gesagt. Garantiert.
Der Typ, das wusste Buck jetzt, war Deacon selbst gewesen.
Buck entdeckte die Police einer Lebensversicherung über eine Viertelmillion Dollar, deren Begünstigte Scarlett und Ellery waren. Die würden wahrscheinlich die Miete für das Apartment in der Hudson Street sowie die Kosten für Ellerys Unterricht für ein paar weitere Jahre decken. Deacons geliebtes Haus auf Nantucket würde dagegen zwangsversteigert werden; die Bank würde es Ende des Monats wieder in Besitz nehmen, wenn die Erben nicht die 436292,19 Dollar aufbrachten, die für die drei Hypotheken und die Pfandverschreibungen überfällig waren. Und selbst wenn jemand die ausstehenden Schulden zahlte, waren da immer noch die allmonatlich anfallenden 14335 Dollar zu bewältigen.
So einen Schlamassel hatte Buck noch nie gesehen!
Er hatte Laurel und Hayes und Belinda und Angie kontaktiert – und Scarletts Mutter Prue eine ausführliche Nachricht hinterlassen, die sie an Scarlett weitergeben sollte, die sich weigerte, Bucks Anrufe entgegenzunehmen. Sie würden sich auf Nantucket treffen, um Deacons Asche im Nantucket Sound zu verstreuen, und dann würde Buck allen mitteilen müssen, dass es, falls sich niemand fand, der das Haus rettete, mit ihren glücklichen Inselsommern vorbei sein würde.
PIRATEN-TAXI
508-555-3965
»Pirate« Oakley
AHOI, MÄNNER!
Deacons Blöde-Wörter-Liste
1. Protegé
2. buchstäblich
3. Halbschwester/-bruder
4. Oxymoron
5. Schlagabtausch
6. schick
7. Syllabus
8. ausgedörrt
9. Tumult
10. Doggybag
11. flatterhaft
12. Unikum
13.
14.
New York Post, Samstag, 7. Mai 2016
Populärer Fernsehkoch Deacon Thorpe mit 53 tot aufgefunden
Nantucket, Massachusetts – Deacon Thorpe, 53, Chefkoch und Eigentümer des Board Room in Manhattan und Moderator der beliebten Sendung Aufgespießt bei Food Network, starb nach Angaben von Edward Kapenash, Polizeichef der Insel, am Donnerstagabend in seinem Ferienhaus an einem Herzinfarkt.
Wie Angestellte der Steamship Authority bestätigten, traf Thorpe mit einer Donnerstagmorgen-Fähre auf Nantucket ein. Am Freitagmorgen wurde er von Inselbewohner JP Clarke entdeckt.
»Ich wollte ihn abholen«, sagte Mr Clarke. »Wir hatten vor, angeln zu gehen.«
Mr Clarke erklärte, die Vordertür des Hauses, dessen Name Amerikanisches Paradies laute, sei offen gewesen, und nachdem er mehrmals nach Mr Thorpe gerufen habe, sei er eingetreten. Er habe Mr Thorpe über dem Picknicktisch auf der hinteren Terrasse zusammengesackt aufgefunden und den Notruf gewählt. Der Gerichtsmediziner kam zu dem Schluss, dass Thorpe irgendwann am Abend zuvor an einem Herzinfarkt verstorben war.
Deacon Thorpe machte 1985 seinen Abschluss am Culinary Institute of America in Hyde Park, New York. Nach Praktika im Odeon und im Union Square Café in New York City ergatterte Thorpe den Posten des Chef de Cuisine im Solo, dem Restaurant, das maßgeblich an der Entwicklung des Flatiron District zum Magneten für Gourmets beteiligt war. Thorpe arbeitete dort von 1986 bis 1989. In dieser Zeit bot ihm ABC eine halbstündige Late-Night-Show mit dem Titel Vom Tag in die Nacht in den Tag mit Deacon an, die allgemein als Urahnin des Reality-TV gilt. Von 1986 bis 1989 liefen davon sechsunddreißig Folgen. 1989 ging Thorpe nach Los Angeles. 1990 wurde er Küchendirektor der Restaurantkette Raindance und hatte die Aufsicht über Filialen in Los Angeles, Chicago und New York. Während seiner Tätigkeit für Raindance entwickelte Thorpe das Rezept, für das er berühmt wurde, den Venusmuschel-Dip Casino. 2004 wurde es von der Zeitschrift Gourmet zum Rezept des Jahres ernannt. Bei einem Auftritt in The Late Show with David Letterman präsentierte Thorpe den Dip, und Letterman sagte: »Ich kann einfach nicht aufhören zu essen. Was ist da drin?«, worauf Thorpe bekanntermaßen antwortete: »Ein Teelöffel Crack.« Das löste einen wütenden Kommentar der Gesellschaft für ein drogenfreies Amerika aus, die Thorpe der »Verharmlosungung des Drogenkonsums« bezichtigte. Thorpe entschuldigte sich später. 2005 wählte das Food Network ihn dazu aus, eine Sendung namens Aufgespießt zu moderieren, die 2007 für einen Emmy als herausragende Kochsendung nominiert wurde. Im selben Jahr eröffnete Thorpe in der Upper West Side von Manhattan den Board Room, sein eigenes Restaurant, das Bon Appétit als teuerstes Restaurant in Amerika bezeichnete. Das Neun-Gänge-Menü wechselt wöchentlich gemäß den frischen Zutaten, die die siebenundzwanzig von Thorpe handverlesenen Lieferanten aus der Region anbieten. Über die Hälfte der Speisen wird über einem Hartholzfeuer zubereitet – Thorpe bevorzugte dafür Hickoryholz aus Nova Scotia, das ihn über fünftausend Dollar pro Woche kostete. Zu weiteren typischen Merkmalen des Board Room gehören leichte Sechshundert-Dollar-Kaschmirdecken für die Gäste und eine Karte mit achtzehn Spezial-Cocktails, kreiert von seinem Barkeeper David Disibio, der in Botanik promoviert hat. Der Festpreis für das Neun-Gänge-Menü liegt bei fünfhundertfünfundzwanzig Dollar pro Person beziehungsweise sechshundertfünfzig Dollar mit passenden Cocktails und Weinen. George Clooney, Derek Jeter und Bill Clinton essen regelmäßig hier.
Deacon Thorpe war für sein Leben abseits des Herdes fast so berühmt wie für das hinter ihm. Mit Laurel Thorpe, seiner Highschool-Liebe, war er von 1982 bis 1988 verheiratet. Das Paar hat einen Sohn, Hayes Thorpe, 34, der für die Zeitschrift Fine Travel Hotels bewertet. 1990 heiratete Thorpe die Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin Belinda Rowe; Angela Thorpe, die Tochter der beiden, wurde von ihrem Vater im Board Room für den in der Gastronomie einzigartigen Posten des Chef de Feu ausgewählt. Nach der Scheidung von Rowe im Jahr 2005 heiratete Thorpe Scarlett Oliver, eine Sensation für die Boulevardpresse, da Ms Oliver jahrelang für Mr Thorpe und Ms Rowe als Kindermädchen gearbeitet hatte. Das Paar hat eine neunjährige Tochter namens Ellery Thorpe.
Mr Thorpes Agent und langjähriger Freund John Buckley sagte am Freitagnachmittag: »Jeder, der Chef Thorpe kannte, ist schockiert und traurig über seinen Tod. Das Land hat nicht nur ein kulinarisches Genie verloren, sondern auch eine kulturelle Ikone. Die Freunde und Angehörigen von Mr Thorpe bitten die Öffentlichkeit um Diskretion und Respekt.«
Venusmuschel-Dip Casino mit Kräuterbutterbaguette
(mit freundlicher Genehmigung von Deacon Thorpe)
8 Scheiben dick geschnittener Speck, gehackt
1 grüne Paprika, gewürfelt
1 rote Paprika, gewürfelt
1 süße Zwiebel, gewürfelt
1⁄2 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver
1⁄4 Teelöffel frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
4 Knoblauchzehen, gehackt
1 Tasse Venusmuscheln (frisch oder abgetropft aus der Dose), gehackt
450 g Frischkäse, gewürfelt
225 g Fontina, frisch gerieben
110 g Parmigiano-Reggiano, frisch gerieben
Ofen auf 200 Grad vorheizen. Eine runde Backform mit 23 cm Durchmesser mindestens 7 cm hoch mit Antihaftspray aussprühen.
Speck bei mittlerer Hitze in einer großen Pfanne ausbraten, bis er ganz knusprig und das Fett ausgelassen ist. Mit einem Schaumlöffel herausheben und auf einen mit Küchenkrepp belegten Teller geben.
Paprika und Zwiebel sowie das geräucherte Paprikapulver und den Pfeffer zum Fett hinzufügen. Das Gemüse unter ständigem Rühren etwa 6 bis 8 Minuten garen lassen, bis es weich ist. Knoblauch und gehackte Muscheln hinzugeben und weitere 2 Minuten kochen. Alles mit einem Schaumlöffel herausnehmen, in eine große Schüssel füllen und Frischkäse, geriebenen Käse und Speck hinzufügen und die Mischung mit einem großen Pfannenwender verrühren. In die Backform geben, in den Ofen stellen und 25 bis 30 Minuten backen, bis sie golden ist und Blasen wirft. Zusammen mit dem Kräuterbutterbaguette sofort servieren.
Kräuterbutterbaguette
1 großes Ciabatta-Baguette in gut 1 cm dicken Scheiben
4 Esslöffel weiche Butter
1⁄3 Tasse frisch gehackte Kräuter (ich nehme Koriander, Basilikum, Thymian und Oregano)
1⁄2 Teelöffel Meersalzflocken
Ofen auf 200 Grad vorheizen. Baguettescheiben mit der weichen Butter bestreichen und mit der Kräutermischung (Zusammensetzung beliebig!) bestreuen. Die Brotscheiben etwa 10 Minuten backen, bis sie warm und golden sind, aus dem Ofen nehmen und mit Salz bestreuen. Sofort servieren.
ERGIBT 4 BIS 6 PORTIONEN
FREITAG, 17. JUNI
ANGIE
Es war der elfte Tag, an dem sie wieder als Chef de Feu arbeitete, obwohl sie versuchte, nicht in solchen Kategorien zu denken – seit elf Tagen wieder bei der Arbeit, dreiundvierzig Tage, seit Deacon gestorben war. Stattdessen bemühte sie sich, darin nur einen weiteren Freitagabend im Board Room zu sehen, den hektischsten Abend der Woche. Die Welt war zutiefst geschockt vom Tod ihres Vaters gewesen, daher hatte Harv, der Geschäftsführer – und der Einzige mit genügend Mumm für schwierige Entscheidungen –, das Restaurant für einen Monat geschlossen. Die vorderen Fenster waren mit schwarzen Gardinen verhängt gewesen, die Harv angemessen fand. Die Leute – Gäste, Fans der Kochsendungen und andere Trauernde – stellten Blumensträuße, Bilder, Gedichte, Stofftiere, Kerzen und Kreuze neben die Tür. Wenn Angie diese Liebesbeweise sah, schmerzte es sie in der Kehle. Sie hätte gern geweint, doch es wollten keine Tränen fließen. Sie war knochentrocken.
Angie hatte gedacht, die Popularität des Restaurants könnte vielleicht schwinden, oder es würde vom Kurs abkommen wie ein Schiff ohne Kapitän. Der Board Room war Deacons Kreation und Vision – vom Caprese-Salat mit von einer kleinen Farm aus dem Umland stammenden Walderdbeeren, den er zwei Tage vor seinem Tod auf die Karte gesetzt hatte, bis hin zu den glänzenden Kupfertischen und den vom Abkömmling eines russischen Zaren speziell für das Restaurant gefertigten Kaviarsets und den exklusiven Robert-Graham-Hemden, die er Dr. Disibio hinter der Bar tragen ließ. Bizarrerweise aber – oder vielleicht auch nicht; Angie war keine große Kennerin der menschlichen Psyche – hatte sich die Nachfrage nach Reservierungen mehr als verdoppelt, was kaum vorstellbar schien. Schon jetzt betrug die Wartezeit sechs Wochen.
Angie war dankbar für den Trubel. Her mit den Bestellungen! Sie stapelten sich nur so: Ananas-Habanero-Garnelen, mit Ahornsirup glasierter Räucherlachs, »sexy« gegrillter Tintenfisch. Das Freitagabendtempo hatte sich gerade von Wahnsinn zu rasender Achterbahn gesteigert, als Joel hinter Angie trat und ihr ins Ohr flüsterte: »Ich sage es ihr heute noch. Ich verlasse sie, Baby.«
Angie griff nach der heißen statt nach der kalten Zange und verbrannte sich die Hand. Sie saugte an der Haut zwischen Daumen und Zeigefinger. »Können wir später darüber reden?«, fragte sie.
Tiny, dessen Aufgabe es war, das Feuer zu schüren und darauf zu achten, dass es immer die richtige Hitze hatte, sagte: »Hau ab, Joel. Wir sind hier dabei, die Leute zu füttern.«
Er würde es ihr heute noch sagen. Er würde sie verlassen.
Angie konnte sich nicht auf ihre Arbeit konzentrieren; die Bestellungen türmten sich so hoch auf, dass sie praktisch darunter vergraben war und Julio, der Disponent, laut fluchte.
»Alles in Ordnung, Angie?«, fragte Tiny leise. »Hat Joel was gesagt, das dich geärgert hat?« Tiny war ein sanfter Riese, fast zwei Meter zehn groß. Er war seit der Wiedereröffnung des Restaurants dafür zuständig, Angies emotionale Temperatur zu messen.
»Alles gut«, flüsterte Angie.
Joel hatte die Worte gesagt, die Angie von ihm hören wollte, seit sie nach der Weihnachtsfeier des Personals vor sechs Monaten das erste Mal miteinander geschlafen hatten. Er würde seine Frau verlassen und seine Beziehung zu Angie offiziell machen. Angies Gefühle schlugen Purzelbäume.
Der Tag von Deacons Tod war ein für die Jahreszeit unüblich warmer Donnerstag im Mai gewesen, einer jener Frühlingstage, die alle Menschen an die Freuden des Sommers denken lassen – an Spaziergänge im Park, an Picknicks im Grünen. Deacon hatte sich freigenommen und Harv erklärt, er wolle für ein paar Tage nach Nantucket, um zu angeln und einen klaren Kopf zu bekommen, was Angie für eine gute Idee gehalten hatte. Scarlett hatte Deacons ständige Trinkerei und seinen gelegentlichen Drogenkonsum satt und war nach Savannah geflogen – diesmal für immer, sagte sie. Sie hatte Ellery sogar von der Schule abgemeldet. Angie hatte Deacon versichert, dass sie zurückkehren würde. Scarlett neigte zu Ausrastern – Angie glaubte insgeheim, das liege daran, dass die Kalorien, die sie zu sich nahm, nicht genügten, um ihren Verstand anzuregen –, und außerdem hatte sie nur zwei Koffer mitgenommen. Deren Inhalt würde ihr nicht länger als zwei Wochen reichen, und sie war bereits zehn Tage weg. Ich habe es schon wieder vermasselt, Buddy, hatte Deacon gesagt. Ehe Nummer drei, und ich hab sie in den Sand gesetzt. Es ist alles meine Schuld. Wenn mit einer Frau Schluss ist, ist es immer meine Schuld.
Angie hätte fast erwidert, die Institution Ehe schiene dafür erfunden worden zu sein, Deacon ein Bein zu stellen, aber sie hielt sich zurück. Er war total aufgelöst, was Angie, ehrlich gesagt, seltsam fand. Seine Ehe mit Scarlett war doch eh nicht viel mehr als schöner Schein. Jeden Dienstagabend, wenn das Restaurant geschlossen war, ging Deacon mit Angie essen, weil Scarlett bereits um acht Uhr ins Bett ging und sowieso nichts aß. Aber dass man seinen einzigen freien Abend nicht mit seiner Frau verbringen wollte, sprach ja wohl für sich.
An jenem Donnerstagabend hatte Joel Angie nach Hause gefahren, wie sie es sich zur Gewohnheit gemacht hatten. Sie hatten sich mit dem Rest des Personals nach dem Dienst einen Drink genehmigt, wie üblich, dann hatte sich Joel wie üblich als Erster verabschiedet, Angie war ihm fünf, sechs Minuten später bis zur Ecke 60th und Madison gefolgt, wo sie in seinen Lexus stieg und sie zusammen zu Angies Apartment fuhren. Sie liebten sich schnell und dann, nachdem Angie ihnen beiden einen Cognac eingeschenkt hatte, noch einmal langsamer.
Als Joel an jenem Donnerstag aufstand, um zu gehen, klammerte Angie sich an ihn und bat ihn zu bleiben.
»Komm schon«, sagte Joel. »Du weißt, dass ich das nicht kann.«
Joel wohnte in New Canaan, einem Städtchen, das Angie nicht kannte, doch sie malte es sich als hügelig aus, als einen Ort, wo vor weißen Schindelhäusern mit schwarzen Fensterläden Kaninchen an smaragdgrünem Gras knabberten. Sie argwöhnte, dass in New Canaan nur Weiße lebten. Wenn Angie jemals bei Joel in der Rosebrook Road auftauchen würde – das stellte sie sich oft vor –, würden die Nachbarn glauben, sie sei gekommen, um zu putzen oder um sie auszurauben.
»Bitte!«, sagte Angie. Sie war sich nicht sicher, woher diese Verzweiflung kam. Sechsundzwanzig Jahre lang hatte sie ein emotional unbeschwertes, herrlich unabhängiges Leben geführt. Sie hatte mit Männern zusammengearbeitet, seit sie achtzehn war, und mit einigen geschlafen, aber keiner von ihnen war ihr nach zehn Uhr am nächsten Morgen noch wichtig gewesen. In Joel Tersigni hatte Angie sich jedoch sofort verliebt, als Deacon ihn vor zwei Jahren angeheuert hatte. Joel war attraktiv auf eine Weise, die Angies Geschmack genau zu entsprechen schien: die dunklen Haare, der Kinnbart, das durchtriebene Lächeln, der rauchige, verführerische Unterton in der Stimme. Und er hatte ein gebieterisches, charismatisches Auftreten. Er wusste jeden Gast, der zur Tür hereinkam, persönlich anzusprechen, ob es sich nun um Kim und Kanye handelte oder den Hausmeister einer Schule in Wichita, Kansas, der vorhatte, für ein Abendessen im Board Room die Ersparnisse seines Lebens auszugeben.
Und nach sieben oder acht Gläsern von Dr. Disibios gefährlichem Drachenpunsch bei ihrem Weihnachtsabendessen mit dem Motto »China« hatte Joel Angie in die Vorratskammer gezogen und sie dort verführt.
Seitdem waren über vier Monate vergangen. Inzwischen hatten sie ihre »Gemeinsamkeiten«: bestimmte Witze, Schlagwörter, Gesten. Angie ließ sich jeden Samstag von einer Jamaikanerin aus der Vorbereitungsküche für fünfzig Dollar Cornrows flechten, und jeden Donnerstag entflocht Angie sie wieder und fasste sie zu einem krausen Pferdeschwanz zusammen. Diesen Pferdeschwanz liebte Joel. Als Halb-Schwarze war sie eine Exotin für ihn, das wusste sie. Joel war in Pigeon Forge, Tennessee, aufgewachsen; seine Eltern hatten dort das so genannte Biblical Dinner Theater betrieben. Joel war nach Manhattan entflohen, das für sie eine Stadt der Sünder war.
»Ich muss los, Ange«, sagte Joel. Sie liebte es, wie er ihren Namen aussprach; sie liebte es, dass er sie Ange nannte. Der einzige Mensch, der das außer ihm noch tat, war ihr Bruder Hayes. Angie gab Joel einen langen, saftigen Kuss, der ihn aufstöhnen ließ, jedoch nicht, das wusste sie, zum Bleiben bewegen würde.
Nachdem sie die Tür hinter ihm geschlossen hatte, dachte sie: Ich würde alles dafür tun, dass er mir gehört.
Am nächsten Morgen rief Buck an.
Dein Vater …, sagte er. Deacon … dein Dad …
Ja, was gibt’s?, fragte Angie.
Er ist nach Nantucket gefahren …, sagte Buck.
Ich weiß. Das hat Harv mir erzählt. Zum Angeln. Angie dachte kurz an frische Filets vom gestreiften Zackenbarsch, mariniert in etwas Olivenöl und Chilipulver, auf das Hickoryholzfeuer gelegt, bis sie nicht mehr glasig waren, und dann mit Zitronensaft beträufelt. Ein absoluter Genuss.
Angie, sagte Buck. Er hatte einen Herzinfarkt. Er ist tot.
Angie legte wortlos auf, als wäre der Anruf von Buck ein Telefonstreich.
Ihr elfter Abend endete ohne Trara. Vielleicht hatte es aber auch Trara gegeben, und Angie hatte es nicht bemerkt. Das Tuch, das sie sich um den Kopf gebunden hatte, fühlte sich an wie eine Flammenkrone, ihr Magen wie ein Knäuel Gummibänder, und ihre Füße hatten sich in ihren Clogs in Ziegelsteine verwandelt. Sie legte ein Lachsfilet aufs Feuer, war jedoch zu abgelenkt, um das Zischen zu genießen oder die Wolke aus süßem Ahornsiruprauch.
Joel würde seine Frau verlassen. Oder hatte sie ihn missverstanden oder das Wort »verlassen« falsch interpretiert?
»Alles in Ordnung?«, fragte Tiny.
»Alles gut«, flüsterte Angie.
Joel wirkte nervös, als sie im Auto saßen, zappelig – wahrscheinlich hatte er gekokst. Manchmal genehmigte er sich mit Julio in der Vorratskammer eine Line, das wusste sie, obwohl Harv bei der Wiedereröffnung eine neue Null-Toleranz-Regel eingeführt hatte. Ab jetzt bleiben wir sauber, hatte er gesagt. Aber wie Angie nur allzu gut wusste, taten die Menschen, was sie tun wollten.
»Ich sage es ihr, sobald ich zur Tür rein bin«, sagte Joel. »Ich hab keine Lust mehr, mit uns ist Schluss. Ich will die Scheidung.«
»Ja«, erwiderte Angie. »Okay.« Sie versuchte, nicht daran zu denken, dass sie eine Familie zerstörte. Joel war unglücklich mit seiner Frau Dory, die ein paar Blocks südlich des Restaurants als Anwältin für Fusionen und Übernahmen arbeitete und mit ihrem Gehalt ihrer beider Leben finanzierte, wie sie Joel tagtäglich ins Gedächtnis rief. Joel war zehn Jahre jünger als Dory, und er hatte ihre Zwillingssöhne Bodie und Dylan adoptiert, inzwischen Teenager, die auf den manikürten Rasenflächen der New Canaan High School Lacrosse spielten.
»Wir hatten seit drei Monaten keinen Sex mehr«, sagte Joel. »Sie ist nie zu Hause. Wir haben null Lebensqualität.«
Drei Monate?, dachte Angie. Joel und Dory hatten also noch miteinander geschlafen, nachdem die Sache zwischen ihm und Angie angefangen hatte? Angie berührte die empfindliche Blase, die sich auf ihrer Hand gebildet hatte. Joel fand es vermutlich angemessen, ihr das jetzt zu erzählen, weil es von der Nachricht über seine bevorstehende Trennung begleitet wurde.
»Warum heute?«, fragte sie. »Ist was Besonderes passiert?«
»Sie verhält sich neuerdings merkwürdig. Als ob sie womöglich schon Bescheid wüsste. Ich will sie verlassen, bevor ich erwischt werde. Das ist ein Unterschied, weißt du?«
»Ich weiß«, sagte Angie. In den letzten vier Monaten hatte sie höllische Angst gehabt, erwischt zu werden, nicht nur von Dory, sondern auch von Deacon. Deacon hätte es nicht gebilligt, dass Angie und Joel eine Affäre hatten, und das war die Untertreibung des Jahres. Er hätte getobt wie ein Wilder, wenn er herausgefunden hätte, dass Joel und seine Tochter miteinander schliefen. Sein erster Einwand wäre der gewesen, dass Joel verheiratet war, sein zweiter, dass Joel im Restaurant arbeitete und es, falls es zwischen ihnen schiefging, für alle peinlich werden würde. Wahrscheinlich hätte es auch noch den dritten Einwand gegeben, dass Joel irgendwie nicht gut genug für Angie war. Er sei zu alt (mit vierzig vierzehn Jahre älter als sie) und, so hätte Deacon vielleicht behauptet, ein moralisch heruntergekommener Casanova, der sich nicht nur Angies Jugend zunutze gemacht hatte, sondern auch ihre Naivität in Sachen Liebe. Deacon kannte Joel nur allzu gut; sie hatten sich oft genug miteinander betrunken und sich genügend Geschichten erzählt. Wenn Deacon es wirklich herausgefunden hätte, hätte er womöglich versucht, Angie irgendwie zu bestrafen – indem er aufhörte, ihr heimlich Schecks auszustellen, oder sie, schlimmer noch, von ihrem Posten entließ. Mit diesen Befürchtungen war es jetzt natürlich vorbei; an ihre Stelle war die brennende Trauer über seine Abwesenheit getreten.
»Außerdem«, sagte Joel, »möchte ich für dich sorgen.«
Joel wollte »für sie sorgen« – diese Worte waren ein regelrechtes Narkotikum. Und gleichzeitig ertönte im Radio ihr Song, »Colder Weather« von der Zac Brown Band. Angie hatte sich bemüht, realistisch zu bleiben, was Joel betraf. Männer verließen ihre Frauen nie; alles andere war eine urbane Legende. Aber mit diesem einen simplen Satz – Ich möchte für dich sorgen – hatte Joel Tersigni ihr den Boden unter den Füßen weggerissen. Sie stürzte. Ein Zurück, so fürchtete sie, war unmöglich.
Es gab keine Parkplätze in der 73rd Street.
»Soll ich weiterfahren und suchen?«, fragte Joel. »Und raufkommen?«
Instinktiv schüttelte Angie den Kopf. Sie fuhr morgen nach Nantucket. Dort würde sich die ganze Familie versammeln und Deacons Asche verstreuen. Angie würde zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit drei Tage mit ihrer Mutter unter einem Dach verbringen. Plötzlich war ihr alles zu viel.
»Soll ich sie doch nicht verlassen?«, fragte Joel. »Liebst du mich nicht?«
»Natürlich liebe ich dich«, sagte Angie rasch. Das versicherte sie Joel ständig, eigentlich viel zu oft. Belinda hätte ihr geraten, ein paar Zweifel zu säen, sich geheimnisvoll zu geben. Doch Angie handelte ohne Hintergedanken. Sie hatte so lange darauf gewartet, einen Herzensfreund zu finden, jemanden, dem sie alles erzählen konnte. »Aber es ist spät, und ich bin fix und fertig.«
»Schlaf doch morgen aus«, meinte Joel.
Er hörte nie richtig zu, wenn sie nicht genau das sagte, was er hören wollte.
»Ich muss packen«, sagte sie.
Er warf ihr einen verständnislosen Blick zu.
»Ich fahre nach Nantucket«, sagte sie. »Weißt du nicht mehr? Am Dienstag bin ich zurück.«
»Ein Grund mehr dafür, dass ich heute mit raufkomme«, sagte er. »Wie soll ich es vier Tage ohne deinen Körper aushalten?«
Sie wünschte, er hätte »dich« statt »deinen Körper« gesagt. Aber dann erinnerte sie sich an die Zeit vor sechs Wochen: Sobald Joel von Deacons Tod erfahren hatte, war er in die Stadt gekommen, um bei Angie zu sein. Er hatte sie in die Arme genommen und ihr Zittern absorbiert; er hatte ihr einen Cognac geholt, ihr ein Bad eingelassen, sich auf den Badezimmerfußboden gesetzt und ihre Hand gehalten. Er hatte alle Anrufe für sie entgegengenommen und an der Tür ihre besorgten (neugierigen) Nachbarn abgewimmelt, indem er ihnen sagte, Angie sei noch nicht so weit, jemanden zu sehen. Er hatte dabeigestanden, als sie ihre kostbare Sammlung von Holzkochlöffeln zerbrochen hatte – manche davon über hundert Jahre alt –, bis sie auf dem Küchenboden lagen wie ein Haufen Holzspäne, und sie dann mit Besen und Schaufel zusammengefegt. Er war in den Eckladen gegangen, um ihr Zigaretten zu holen, und hatte es irgendwie geschafft, das riesige Fenster zu öffnen, das seit Angies Einzug klemmte, damit sie rauchen konnte, ohne das Apartment zu verlassen. Er hatte zugeschaut, wie sie ihren Schneebesen auseinandernahm, bis er aussah wie eine hässliche postmoderne Blume. Er sagte ihr nicht, sie führe sich auf wie eine Verrückte, er sagte ihr nicht, sie solle mit dem Rauchen aufhören, er fragte sie nicht, warum sie nicht weinte. Joel Tersigni hatte absolut alles richtig gemacht bis auf seine Heimkehr zu Dory jeden Abend. Aber auch damit würde es jetzt vorbei sein. Er würde seine Frau verlassen.
»Such einen Parkplatz«, sagte Angie. »Ich warte oben auf dich.«
LAUREL
Sie hatte eine lange Liste mit Dingen, die zu erledigen waren, bevor sie morgen früh nach Nantucket flog, und doch ließ sie sich von dem leuchtend rosa Umschlag auf ihrem Schreibtisch ablenken. Es war eine Geburtstagskarte von Deacon, die pünktlich am 2. Mai eingetroffen war. Auch wenn er sie in vielerlei Hinsicht enttäuscht hatte – ihren Geburtstag hatte er nie vergessen. Am 2. Mai und an den Tagen darauf war Laurel zu beschäftigt gewesen, um den Umschlag zu öffnen, und am 6. Mai war Deacon gestorben, und jetzt hatte sie Angst, es zu tun, denn damit würde sie zum letzten Mal von ihm hören, und zu dieser Konfrontation war Laurel noch nicht bereit.
Sie riss ihren Blick von dem Umschlag; sie würde ihn heute aufmachen, aber erst später, beschloss sie. Morgen würde sie eine Reise in die Vergangenheit antreten. Sie war nicht mehr auf Nantucket gewesen, seit sie und Deacon sich vor so vielen Jahren getrennt hatten.
Ihr gegenüber saß eine Frau namens Ursula, die drei schulpflichtige Enkel hatte. Ursula und die Kinder waren obdachlos und warteten darauf, dass Laurel ihnen eine Unterkunft beschaffte. Ursulas Tochter Suzanne, die Mutter der Kinder, war drogenabhängig, hatte Ursula all ihre weltliche Habe gestohlen und dann ihre Mietschecks gefälscht, was ihr eine Zwangsräumung aus der Sozialbausiedlung Silverhead eingetragen hatte, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Ursula griff nach dem gerahmten Foto auf Laurels Schreibtisch.
»Ist das Ihr Freund?«, wollte sie wissen.
Als ein Klient Laurel diese Frage zum ersten Mal gestellt hatte, war sie erbleicht, doch inzwischen war das so oft passiert, dass sie sich daran gewöhnt hatte.
»Mein Sohn«, sagte sie. Das Foto, auf dem auch ein Stück von Carmelo Anthonys Trikot und seinem massigen Arm zu sehen war, zeigte sie und Hayes als Zuschauer bei einem Knicks-Spiel.
»Ihr Sohn? Sieht alt genug aus, um Ihr Lover zu sein. Ich dachte, Sie sind vielleicht eine von diesen Raubkatzen.«
»Nein«, sagte Laurel. Gegen diesen Ausdruck war sie allergisch.
»Haben Sie ’n Ehemann?«, fragte Ursula.
Laurel starrte auf ihren Computer. In der 162nd Street gab es ein Hotel, in dem sie Ursula und die Kinder für drei Nächte einquartieren konnte. Das würde genügen müssen und wäre besser als ein Obdachlosenheim.
»Zurzeit nicht«, sagte sie.
»Aber Sie waren mal verheiratet?«
»Vor langer Zeit«, bestätigte Laurel und lächelte Ursula auf eine Weise an, die dem Thema hoffentlich ein Ende setzen würde.
»Aber jetzt sind Sie geschieden?«, fragte Ursula.
»Ja. Geschieden.« Laurel wagte nicht zu erwähnen, dass ihr Exmann kein anderer war als Sternekoch Deacon Thorpe. Eins hatten ihre Klienten gemeinsam: Sie sahen sehr viel fern. Womöglich war Ursula ein treuer Fan von Deacon, einer von Millionen, die bei der schockierenden Nachricht von seinem Tod geschluchzt hatten.
»Hat Ihr Mann Sie betrogen?«, wollte Ursula wissen.
»Ich kann Ihnen bis zum Samstag ein Zimmer im Bronx Arms Hotel anbieten, ein Doppelbett und ein Kinderbett«, sagte Laurel. »Wie klingt das?«
»Das braucht Ihnen nicht peinlich sein«, sagte Ursula. »Alle Männer gehen fremd. So sind sie eben.«
Laurel musste am selben Tag noch fünf weitere Familien unterbringen, doch das leidige Gespräch mit Ursula beschäftigte sie weiter.
Alle Männer gehen fremd. So sind sie eben.
Laurel befahl sich, nicht mehr an Deacon zu denken. So war es in den letzten sechs Wochen fast jeden Tag gewesen: Er nistete sich in ihrem Kopf ein und weigerte sich auszuziehen, wie ein Hausbesetzer.
Sie öffnete den Umschlag. Die Geburtstagskarte zeigte einen tanzenden Snoopy mit hoch in die Luft gerecktem Kopf und einen vorgedruckten Text: Jemand Besonderes hat heute Geburtstag! Als sie die Karte aufklappte, stand da in Deacons nahezu unleserlicher Kritzelschrift: In ewiger Liebe, D.
In ewiger Liebe: Highschool, Hayes, Kochschule, die erste Fernsehsendung, Scheidung. Bei den meisten Menschen wäre dies das Ende gewesen, das war Laurel klar, aber ihre Beziehung zu Deacon, wie schlecht sie auch werden mochte – und in den ersten Jahren mit Belinda war sie richtig schlecht gewesen –, hatte immer auf einem Fundament aus bedingungsloser Liebe beruht, das früh gelegt worden war. Ihre Liebe war eine Grundzutat seines Lebens gewesen wie das Mehl oder Salz in seiner Vorratskammer. Wenn Belinda nach seiner Rückkehr nach New York zum Drehen unterwegs war, trafen Laurel und Deacon sich gelegentlich im Raindance auf einen Drink. Diese Abende hatten immer keusch geendet, doch es gefiel Laurel, dass Deacon sie Belinda verschwieg. Und dann, Jahre später, als Deacon und Belinda ihren großen Krach gehabt hatten und Belinda wütend nach Los Angeles abgerauscht war, wen hatte Deacon da angerufen?
Laurel.
Sie und Deacon hatten fünf Tage zusammen auf den Virgin Islands verbracht. Das war ein Geheimnis, das Laurel sorgfältig hütete. Keiner kannte es – weder Buck noch Hayes, niemand. Laurel stellte es sich als eine Murmel aus Obsidian vor, kompakt und schwarz, die sich in einen entlegenen Winkel ihres Gehirns schmiegte. Ab und zu kam sie herausgerollt, und Laurel erinnerte sich an die Sonne auf St. John, die Segeltouren, den Sex.
Noch später, als Deacon mit Scarlett verheiratet und wieder Vater eines Babys war, waren er und Laurel dort angelangt, wo alle geschiedenen Paare irgendwann gern landen würden – an einem Ort des Friedens und, ja, der Liebe und Wertschätzung füreinander, der Dankbarkeit für ihre gemeinsame Vergangenheit und der Anerkennung dessen, was sie gelernt hatten und woran sie Seite an Seite gewachsen waren. Laurel war immer ein lebensfroher Mensch gewesen, was es ihr erleichterte, Deacon zu vergeben. In den letzten zehn Jahren hatten sie und Deacon einmal wöchentlich telefoniert, sich an Feiertagen zusammen mit Hayes getroffen, sich gegenseitig als emotionale Unterstützung gedient. Als Laurel ihre letzte Beziehung beendet hatte – mit Michael Beale, einem Pflichtverteidiger, den sie bei der Arbeit kennen gelernt hatte –, hatte sie Deacon angerufen, um Dampf abzulassen. Und nur zwei Wochen vor seinem Tod hatte Deacon ihr telefonisch die ganze schmutzige Geschichte mit der Stripperin und dem Saab erzählt, und dass er Ellery nicht von der Schule abgeholt hatte, bis es so spät war, dass die Direktorin gezwungenermaßen Buck kontaktieren musste.
Deacon hatte Laurel auch erklärt, er werde aufhören zu trinken, und Laurel hatte ihm entgegnet, dann wäre es das Beste, sich einer Gruppe anzuschließen – das wusste sie von unzähligen Klienten –, und es fänden im Umkreis von vier Blocks um sein Apartment in der Hudson Street herum täglich fünfzehn AA-Meetings statt. Da spazierst du einfach rein, sagte Laurel. Ich komme mit.
Nee, hatte Deacon gesagt, das schaff ich allein.
Das wird nicht klappen, hatte Laurel gedacht, aber nicht laut ausgesprochen. Sie hatte die Erfahrung gemacht, dass Druck bei Süchtigen nicht funktionierte. Deacon würde hingehen, wenn er dazu bereit war; er würde gehen, wenn er den absoluten Tiefpunkt erreicht hatte.
Als Buck anrief und ihr mitteilte, dass Deacon an einem Herzinfarkt gestorben war, hatte sie sofort gedacht: Kokain. Doch der toxikologische Bericht zeigte, dass er clean gewesen war. Deacon hatte anscheinend auf der hinteren Terrasse des Amerikanischen Paradieses eine Zigarette geraucht, eine Cola light getrunken und in den Sonnenuntergang geblickt, als sein Herz aufhörte zu schlagen.
Sie las die Karte noch einmal: In ewiger Liebe, D. Und dann ließ Laurel, obwohl sie eigentlich keine Zeit dazu hatte, das Gesicht in ihre Hände sinken und weinte.
HAYES
Sulas Brüder wollten ihn zum Speerfischen mitnehmen; die Australier wollten mit ihm den linken Surfspot hinter dem Riff ausprobieren, und Hayes wollte mit Sula im gelben Sand liegen und sich einen Schuss setzen. Stoff gab es auf Nusa Lembogan reichlich; auf der anderen Seite der Insel residierte ein Drogenbaron, der Schiffsladungen von Lombok nach Java abfing und einen Teil davon für sich abschöpfte. Der Drogenbaron wollte amerikanische Dollar; Hayes wollte für den Rest seines irdischen Lebens high sein.
Sein Vater war seit anderthalb Monaten tot. Er hatte einen massiven Herzinfarkt gehabt, eine Bezeichnung, die Hayes gruselig fand. Der Tod war plötzlich, unerwartet, gewaltsam erfolgt.
Hayes’ Mutter war am Boden zerstört, seine Schwester Angie blutleer, kraftlos, blind, taub und stumm zurückgeblieben, und Buck hatte angerufen und darauf bestanden, dass er mit der »ganzen Familie« über »Deacons Angelegenheiten« reden müsse. Hayes hatte zuerst gedacht, Buck meinte irgendwelche privaten Beziehungen von Deacon, was ihm indiskret erschienen wäre, doch dann kam er zu dem Schluss, dass es wohl um das Testament, Geld und Ähnliches gehen werde, was ein Zeichen der Hoffnung hätte sein können, wäre da nicht der unheilschwangere Unterton in Bucks Stimme gewesen. Scarlett war anscheinend noch in Savannah – zumindest glaubte Hayes, dass Buck das gesagt hatte. Der Empfang war schlecht gewesen.
Jedenfalls würde Hayes morgen fliegen, nach vierundzwanzig Stunden in New York landen und dann mit Angie nach Nantucket fahren.
Er hatte keine Lust dazu.
Deshalb würde er fürs Erste nicht mehr daran denken.
Hayes und Sula rekelten sich in Sulas Zimmer in einem der sechs Teakholzgebäude auf dem Grundstück der Familie. Auf dem Boden lag eine Matratze, bezogen mit einem weißen Seidenlaken, das von ihrem Schweiß immer schmuddeliger wurde, und in der Ecke stand ein buddhistischer Schrein. Der Raum roch nach welken Blumen und faulem Obst.
Sulas Familie – ihr Vater und ihre drei älteren Brüder – war nach der des Drogenbarons die zweitreichste Familie auf Nusa Lembogan. Sula war in Australien zur Universität gegangen und sprach perfekt Englisch, mit einem Aussie-Akzent, den Hayes bezaubernd fand. Sie hatte hellbraune Haut und feucht glänzende braune Augen und schoss Hayes den besten Stoff zwischen die Zehen, der ihm je untergekommen war, abgesehen von dem reinen Opium, das er in der chinesischen Provinz Jiangxi geraucht hatte. Der alte Chinese, der Hayes die Opiumpfeife gereicht hatte, hatte dazu ein paar warnende Worte geäußert (Hayes hatte den Dialekt zwar nicht verstanden, aus dem Tonfall des Mannes jedoch geschlossen, dass es eine Warnung war). Vermutlich: Wenn du dieses Zeug einmal probiert hast, bist du sein Sklave.
Sklave.
Süchtig.
Drogenabhängig.
Deacons Tod hätte ein Weckruf für Hayes sein müssen. Werde clean! Achte gut auf dich! Wir bekommen pro Leben nur einen Körper, und Hayes vergiftete seinen systematisch. Er sollte mehr grünes Gemüse essen und Vinyasa-Yoga praktizieren; er sollte alle verbotenen Substanzen meiden und seinen Alkoholkonsum auf ein Glas Rotwein am Samstagabend beschränken. Schließlich führte Hayes ein Leben, für das die meisten Menschen morden würden. Er bereiste die ganze Welt, um über die besten Hotels zu berichten. Im Six Senses im Oman war er per Drachenflieger eingetroffen; im Mount Nelson in Kapstadt hatte er an einem Tisch neben Nelson Mandela seinen Tee zu sich genommen, im Mandarin Oriental in Bangkok am Ufer des Chao Phraya gebratenen Reis und Wassermelonensaft gefrühstückt. Er hatte Beiträge über den Palácio Belmonte in Lissabon geschrieben, über den Gritti Palace in Venedig, das La Mamounia in Marrakesch und das Hotel D’Angleterre in Kopenhagen. Hayes war fast überall allen anderen um eine Nasenlänge voraus. Das allein hätte ein High für ihn sein müssen.
Er musste sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn er vorsichtig war, würde ihm nichts passieren. Das war die Rationalisierung eines Süchtigen, das wusste Hayes schon, als er sich mit diesen Worten selbst beruhigte.
Er funktionierte, zumindest irgendwie. Er schaffte es sechs oder sieben Stunden ohne Stoff, bis das Jucken anfing. Er hatte sich das ganze linke Schulterblatt blutig gekratzt. Jetzt waren all die maßgeschneiderten Hemden, die Hayes sich in London hatte machen lassen, mit Blut gesprenkelt.
Sula erhob sich vom Bett. Sie ging in die Küche, um den Fisch zuzubereiten, den ihre Brüder gefangen hatten; sie würde ihn mit Satay-Sauce zum Abendessen servieren. Hayes schlang sich einen Batik-Sarong um die Taille und trat ins Freie, um eine selbstgedrehte Zigarette zu rauchen. (Er musste unbedingt aufhören zu rauchen. Da waren er und Angie sich einig.) Hayes sah, wie die australischen Surfer den Strand entlang auf ihn zugelaufen kamen. Ihre Neoprenanzüge hingen ihnen vom Körper wie große Fetzen Haut. Freudestrahlend checkten sie ihre Action-Camcorder.
»Hey, Kumpel«, rief einer von ihnen, ein Jugendlicher namens Macka, Hayes zu. »Fantastischer Tag, Mann. Du hättest mitkommen sollen.«
Hayes verspürte Gewissensbisse. Er hätte heute mit ihnen surfen oder mit Wayan und Ketut fischen gehen und einen Beitrag zum Essen leisten sollen; der Duft von Ingwer und Sesamöl aus der Küche, wo Sula kochte, war Wahnsinn.
Aber Hayes hatte lieber auf einer Wolke geschwebt und die Welt von oben betrachtet – das grüne Wasser, die sich wiegenden Palmen, die Geisterkrabben, die durch den Sand huschten.
High.
Higher.
Sula bediente Hayes, ihre Brüder, ihren Vater und die Aussies an einem Gemeinschaftstisch im Hof, wo sie einen Blick auf den spiegelglatten Teich und die Springbrunnen hatten. Sulas Vater war so reich, dass er zum Essen jeden Abend eine dreiköpfige Gamelan-Kapelle anheuerte. Die drei saßen auf Seidenkissen auf einer Plattform in einer Ecke des Hofes; Flöten- und Xylofonklänge erfüllten die Luft.
Der Fisch wurde in Bananenblätttern gedämpft, dann mit Erdnusssoße bedeckt und auf Jasminreis serviert. Heroin vertrieb jeden Hunger bis auf den nach mehr Heroin, doch sogar Hayes schlang das Essen hinunter. Der Fisch war saftig, die Soße scharf und pikant.
Richard, ein Freund von Macka, fragte Hayes: »Dann verlässt du uns also morgen, Kumpel?« Dabei warf er einen schiefen, gierigen Blick auf Sula, die gerade das Dessert auf den Tisch stellte – eine Platte mit frischen Papayas, Mangos, Rambutans, Wassermelonenschnitzen und Babybananen.