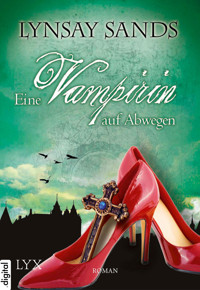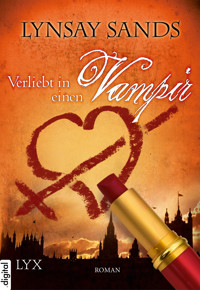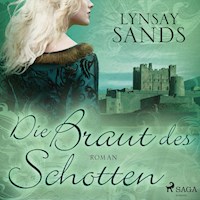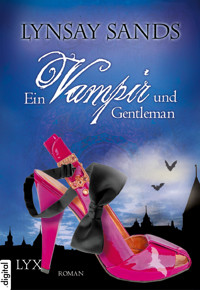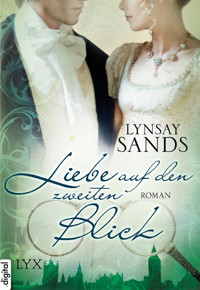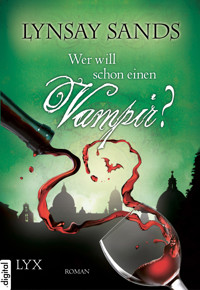9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Argeneau
- Sprache: Deutsch
Der Vampir Dante Notte hat bereits davon gehört, dass Liebe wehtun kann - er hat jedoch nicht damit gerechnet, dass sie ihn frontal mit einem Wohnmobil trifft! Und was sind schon gebrochene Rippen und eine verletzte Lunge verglichen mit der Erkenntnis, dass Mary Winslow, die Fahrerin, seine Seelengefährtin ist. Doch was eigentlich ein Glücksfall sein sollte, bedeutet für Mary Gefahr: Denn die Männer, die bereits Dantes Zwillingsbruder gefangen nahmen, sind nun auch hinter ihr her. Nur Dante kann sie jetzt noch beschützen und damit Mary überzeugen, dass sie für immer zusammengehören ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem Buch1234567891011121314151617Die AutorinDie Romane von Lynsay Sands bei LYXImpressumLYNSAY SANDS
Ein Vampir im Handgepäck
Roman
Ins Deutsche übertragen von Ralph Sander
Zu diesem Buch
Mary Winslows Leben steht kopf: Nach dem Tod ihres Mannes will sie eine letzte Tour mit dem gemeinsamen Wohnmobil unternehmen. Doch wenn sie geglaubt hat, ihr Trip würde ereignislos verlaufen, so hat sie sich gewaltig getäuscht: Bei einem Zwischenstopp kommt es zu einem tragischen Unglücksfall, bei dem Mary einen Mann anfährt. Doch anstatt seine Verletzungen zu beklagen, wie es normale Unfallopfer tun, klettert der Mann, der sich Mary als Dante Notte vorstellt, in ihr Wohnmobil – und behauptet zu allem Überfluss, er sei ihr Seelengefährte (und ein Vampir). Wäre da nicht diese unglaubliche starke Verbindung, die Mary spürt, hätte sie Dante schon längst am Straßenrand stehen gelassen. Und so beschließt sie, ihrem Herzen zu folgen … auch wenn das bedeutet, dass sie ihr Leben für einen absolut Fremden riskieren muss. Denn nun sind die Kidnapper, die bereits Dantes Zwillingsbruder entführten, auch hinter Mary her …
1
Mary verkniff sich ein Gähnen und schüttelte den Kopf, um die Müdigkeit zurückzudrängen, die sich von allen Seiten auf sie legte. Am Morgen hatte sie verschlafen und den Tag mit solcher Verspätung begonnen, dass sie eigentlich noch gar nicht müde sein sollte. Aber die stundenlange Fahrt ohne Unterbrechung war doch zu erschöpfend. Als sie gemeinsam mit Joe diese Strecke von ihrer kanadischen Heimat bis nach Texas zurückgelegt hatte, war ihr das gar nicht so weit vorgekommen. Allerdings hatten sie auch die ganze Zeit über alles Mögliche geredet, dadurch war die Fahrt wie im Fluge vergangen. Und sie hatten sich gegenseitig mit einem Becher Kaffee nach dem anderen versorgt, um sich wachzuhalten. Jetzt hingegen fuhr sie Stunde um Stunde über endlos lange Straßen, ohne dass jemand mit ihr redete oder ihr einen Kaffee reichte.
Bailey setzte sich auf dem Beifahrersitz halb auf und stieß sie mit der Schnauze an, wobei sie besorgt winselte. Mary lächelte flüchtig. Ohne den Blick von der Straße zu nehmen, tastete sie nach ihrer Schäferhündin, um sie zu streicheln. Es war so, als würde die Hündin einen sechsten Sinn besitzen und immer dann ihren Trost anbieten, wenn Marys Gedanken um ihren verstorbenen Ehemann kreisten.
»Ist schon okay«, versicherte sie dem Tier. »Es geht mir gut. Außerdem sind wir fast da. Noch gut eine Stunde, dann legen wir die nächste Pause ein.« Sie rang sich zu einem Lächeln durch und setzte sich etwas gerader hin, während sie die Hand wieder ans Lenkrad legte.
Im nächsten Moment wich das Lächeln einem entsetzten Ausdruck, da der Wagen mit der rechten Seite über irgendein Hindernis auf der Fahrbahn holperte. Mary machte eine Vollbremsung, und obwohl sie das Pedal bis zum Anschlag durchtrat, brauchte ihr Wohnmobil eine Weile, ehe es endlich zum Stehen kam. Durch das Bremsmanöver hatten sich im hinteren Teil des Wagens Schranktüren und Schubladen geöffnet, deren Inhalt sich nun auf dem Boden wiederfand.
Die Lippen fest zusammengepresst sah Mary in die Außenspiegel und warf auch einen Blick auf den Monitor, der das Bild der Rückfahrkamera zeigte, weil sie hoffte, dort irgendwo erkennen zu können, wen oder was sie überfahren hatte. Aber da es auf dieser einsamen Strecke keine Straßenlampen gab, war überall nur finstere Nacht zu sehen. Nicht mal die Nachtsichtfunktion der Kamera konnte ihr weiterhelfen. Voller Unbehagen kam sie zu dem Schluss, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als auszusteigen und nachzuschauen.
»Bestimmt hat da jemand während der Fahrt einen Müllsack aus dem Wagen geworfen«, sagte sie zu Bailey. Vor dem Knall hatte sie im Scheinwerferlicht kein Hindernis gesehen, da war nur die asphaltierte Straße gewesen.
Vielleicht musste sie ja gar nicht aussteigen.
Der Gedanke war ihr gerade erst durch den Kopf gegangen, als sie ihn auch schon wieder verwarf. Ihre Augen waren nicht mehr so gut wie früher, außerdem war sie vielleicht viel müder, als sie es sich selbst eingestehen wollte. Hatte sie ein Reh angefahren, das aus dem Wald gekommen war? Möglicherweise war da ja auch ein Fußgänger in dunkler Kleidung unterwegs gewesen. Es war diese Überlegung, dass sie jemanden erfasst haben könnte, der am Straßenrand entlanggegangen war, die sie schließlich dazu zwang, auszusteigen und nach dem Rechten zu sehen.
Sie drückte auf die Taste, die den Fahrersitz ein Stück nach hinten gleiten ließ, und stand auf. Weit kam sie allerdings nicht, da Bailey inzwischen aufgestanden war und ihr den Weg versperrte.
»Beweg dich, Mädchen«, forderte sie die Schäferhündin auf, die sogleich gehorchte und vor ihr zur Tür hinter dem Beifahrersitz trottete. Mary ging ein Stück zur Seite und öffnete eines der Ablagefächer über den Vordersitzen, um die dort verstaute große Taschenlampe herauszuholen. Die Klappen dieser Fächer waren so ziemlich die einzigen, die bei der Vollbremsung nicht aufgegangen waren. Das war schon gut so, denn sonst wären ihr und Bailey all diese Dinge auf den Kopf gefallen.
Mit der Taschenlampe in der Hand ging Mary um Bailey herum, damit sie nach dem Türgriff fassen konnte. Ohne die Hündin, die mit der Nase überall dabei sein wollte, wäre das Ganze deutlich einfacher gewesen. Aber mitten in der Nacht auf einer stockfinsteren Landstraße war es ihr natürlich lieber, Bailey vorgehen zu lassen. Natürlich kannte sie die Geschichten von Überfällen auf Wohnmobile, die nachts auf einsamen Highways gekapert wurden. Nur waren die eben alle auf den Highways unterwegs und nicht auf einer solchen Nebenstrecke. Niemand sollte ihr hier auflauern, weil normalerweise niemand darauf hoffen konnte, in dieser Gegend auf ein Wohnmobil zu stoßen. Kein vernünftiger Verbrecher würde auf die Idee kommen, tage- oder wochenlang auf der Lauer zu liegen, dass ausgerechnet an dieser einen Stelle ein Wohnmobil vorbeikam, weil ein einziger Reisender so dumm war, auf der landschaftlich schöneren Strecke unterwegs zu sein.
Andererseits … wo stand geschrieben, dass Verbrecher vernünftig waren, fragte sich Mary und stieß die Tür auf. Bailey verschwand sofort in die Dunkelheit.
»Bailey, warte auf mich!«, rief sie hastig, eilte zwei Stufen nach unten und blieb auf der letzten inneren Stufe stehen, weil sie die Taschenlampe anmachen wollte. Sie ließ den Lichtkegel über den Kies und das Gras am Straßenrand wandern und stellte sich schließlich auf das Gitter, das beim Öffnen der Tür nach draußen geklappt war und als weitere Stufe diente.
Kühle Luft schlug ihr entgegen, als sie ihren Wagen verließ, doch davon bekam Mary kaum etwas mit, da sie damit beschäftigt war, ihre Hündin zu suchen. Sie sah gerade noch die Schwanzspitze hinter dem Wohnmobil verschwinden. Leise fluchend lief sie hinterher, auch wenn von Laufen nicht gerade die Rede sein konnte. Der Straßenrand war mit Steinen und Unkraut übersät, und wenn sie eines nicht gebrauchen konnte, dann war das ein Sturz hier mitten in der nächtlichen Wildnis. Wenn sie sich dabei etwas brach, würde sie lange auf Hilfe warten können – sofern sich überhaupt jemals ein Mensch hierherverirrte.
»Bailey?«, rief Mary, als sie das Heck erreicht hatte. Sie stutzte, als sie ein Zittern in ihrer Stimme bemerkte. Himmel, sie hörte sich ja an wie eine verängstigte alte Frau, musste sie empört über sich selbst feststellen. Gereizt rief sie: »Bailey, komm sofort her, sonst hole ich die Leine.«
Von rechts war ein Bellen zu hören, das aus Richtung der Fahrerseite kam. Sie wollte eben losgehen, da tauchte Bailey vor ihr auf und wedelte aufgeregt mit dem Schwanz. Als die Hündin sah, dass sie die Aufmerksamkeit ihres Frauchens auf sich gelenkt hatte, bellte sie erneut.
»Was ist denn?«, fragte Mary und hörte im Geiste, wie Joe die Frage zu Ende führte: »Was hast du, Lassie? Ist Timmy in den Brunnen gefallen?« Es war einer seiner kleinen Scherze gewesen, von denen er immer jede Menge auf Lager gehabt hatte. Ganz gleich, wie oft er sie von sich gegeben hatte, er hatte Mary jedes Mal damit erheitert.
Leise seufzend verdrängte sie diese Gedanken und ließ den Lichtkegel der Taschenlampe über den Bereich hinter dem Wohnmobil wandern. Nach ihrer Schätzung musste sie noch bestimmt zehn bis fünfzehn Meter weitergefahren sein, ehe der Wagen zum Stillstand gekommen war. Es konnten aber genauso gut auch vierzig oder fünfzig Meter gewesen sein. Immerhin war dieses Gefährt mit seinen zehn Tonnen Gewicht nicht dafür konstruiert, auf der Stelle zum Stillstand zu kommen. Mary war schon immer der Ansicht gewesen, dass so schwere Fahrzeuge vorn und hinten mit Warnaufklebern versehen sein müssten: »Abstand halten, Wohnmobile haben einen langen Bremsweg!« Das würde auf jeden Fall andere Autofahrer vom Drängeln und auch davon abhalten, sie auf dem Highway nach dem Überholen zu schneiden. Genau deshalb war sie auch auf dieser Nebenstrecke unterwegs, weil sie ihre Ruhe vor all den aggressiven Fahrern haben wollte, die auf den Highways ihr Unwesen trieben. Und vermutlich hing es auch damit zusammen, dass sie nicht an der Stelle vorbeikommen wollte, an der Joe letztes Jahr seinen Herzanfall erlitten hatte.
Sie schob auch diesen Gedanken beiseite und schwenkte die Taschenlampe langsam hin und her, um die Straße Stück für Stück auszuleuchten. Außer nassem Asphalt war nichts zu sehen. Dem glänzenden Straßenbelag nach zu urteilen, musste es erst vor Kurzem geregnet haben.
Erst jetzt fiel ihr auf, wie feucht die Luft war. Sie ging weiter zurück in die Richtung, aus der sie gekommen war, aber nach ein paar Metern überkam sie eine unerklärliche Nervosität, da sie die Sicherheit ihres Wohnmobils hinter sich zurückließ. Es war bestimmt lächerlich, doch die Nacht war hier draußen pechschwarz, und die Stille um sie herum hatte etwas Seltsames an sich, so als würde ihr jemand auflauern, der gebannt den Atem anhielt. Ansonsten war nur zu hören, wie eine sanfte Brise die Blätter leise rascheln ließ. Hätte sie nicht auch Grillen, Frösche und Eulen hören müssen? Aus einem unerfindlichen Grund störte es sie, dass dieser Teil der Geräuschkulisse fehlte.
»Überhaupt nichts«, murmelte Mary beunruhigt und ging Schritt für Schritt rückwärts, bis sie mit den Beinen gegen die Stoßstange ihres Wohnmobils stieß. Fast hätte sie das Ganze auf der Stelle abgeblasen, um sich fluchtartig ins Wageninnere zurückzuziehen. Aber das wollte ihr Gewissen nicht zulassen. Sie hatte irgendetwas überfahren. Das Beste wäre, sie hätte einen Müllsack erwischt, aber das war nicht sehr wahrscheinlich, weil dann nämlich die ganze Straße mit Abfall übersät gewesen sein müsste – und das war nicht der Fall. Die andere Möglichkeit war die, dass sie ein Reh oder irgendein anderes Tier erwischt hatte. Aber es war ihr kein Tier gegen den fahrenden Wagen gelaufen, sondern sie war über etwas hinweggeholpert, das sich bereits auf der Fahrbahn befunden hatte – und dabei hatte sie deutlich gespürt, dass sie erst mit dem Vorderrad und anschließend auch noch mit dem Hinterrad darübergefahren war.
Aber vielleicht hatte sich das Hindernis ja an der Hinterachse verfangen und war mitgeschleift worden, überlegte sie und bückte sich, um unter das Heck des Wohnmobils zu leuchten. In dem Moment begann Bailey zu bellen, und Mary richtete sich auf und ging um den Wagen herum. Die Hündin stand auf der Beifahrerseite, starrte in die Dunkelheit zwischen den Bäumen und knurrte irgendetwas an.
Sofort richtete Mary die Taschenlampe auf die Stelle, die Bailey fixierte, und glaubte für einen Sekundenbruchteil, dort einen Schatten zu sehen. Aber der war so schnell wieder verschwunden, dass es ebenso gut auch ein Schatten gewesen sein konnte, der von ihrer Taschenlampe verursacht worden war. Aber irgendetwas machte Bailey nervös.
Auf einmal wurde Mary von Angst heimgesucht. Sie musste schlucken und näherte sich ihrer Hündin, indem sie langsam seitwärts ging, damit ihr Rücken dem Wohnmobil zugewandt war und sie die Taschenlampe weiter auf den Wald richten konnte. Es schien zwar eine Ewigkeit zu dauern, bis sie auf diese Weise die Tür erreichte, doch ihr Instinkt sagte ihr, dass sie dem Wald besser nicht den Rücken zudrehen sollte.
Schnell machte sie die Tür auf, und sofort huschte Bailey nach drinnen, als wäre ein Rudel Höllenhunde hinter ihr her. Bailey war prinzipiell nicht feige, vielmehr stürmte sie in eine Auseinandersetzung hinein, um sich schützend vor ihre Leute zu stellen. Als sie jetzt aber im Wohnmobil Schutz zu suchen schien, da sträubten sich Marys Nackenhaare, und sie sah zu, dass sie sich auch in Sicherheit brachte.
In einer fließenden Bewegung zog sie die Tür hinter sich zu und verriegelte sie. Aber selbst jetzt fühlte sie sich noch nicht sicher. Sie musste weg von hier, und das so schnell wie möglich.
Ohne sich um das Durcheinander zu kümmern, das durch die Vollbremsung entstanden war, warf sie die Taschenlampe auf den Beifahrersitz und nahm auf ihrer Seite Platz. Zum Glück hatte sie den Motor laufen lassen, sodass sie jetzt nur noch den Gang einlegen und Gas geben musste. Als der Wagen einen Satz nach vorn machte, fielen noch mehr Gegenstände aus den Schränken und landeten polternd auf dem Boden. Ein dumpfer Knall war zu hören, als wäre Bailey beim Anfahren gegen irgendetwas geworfen worden.
Besorgt warf Mary einen Blick über die Schulter. Im hinteren Teil des Wagens war alles dunkel, aber sie glaubte eine Bewegung vor der geschlossenen Schlafzimmertür auszumachen. Diese Tür hätte geöffnet sein sollen, aber sehr wahrscheinlich war sie zugefallen, als Mary beim Anfahren zu viel Gas gegeben hatte.
»Alles in Ordnung, Mädchen?«, fragte Mary und drehte sich wieder nach vorn, um auf die Straße zu sehen. Ein Blick in die Außenspiegel und auf den Monitor der Rückfahrkamera zeigte nichts als Schwärze. Sie wurde ein bisschen ruhiger, als Bailey mit einem normalen Bellen antwortete.
Wenigstens hatte sie durch ihren Kavalierstart nicht auch noch ihren Hund umgebracht, dachte sie, um im nächsten Moment wieder auf den kleinen Bildschirm zu blicken.
Mary war sich mehr als sicher, dass sie da hinten irgendetwas überfahren hatte. Einfach jetzt davonzufahren kam ihr nicht richtig vor, denn auch wenn sie zurückgegangen war, um nachzusehen, hatte sie nicht gründlich gesucht. Sie befürchtete, sie könnte eine verletzte Person übersehen haben, die jetzt hilflos im Straßengraben lag. Was aber keinen Sinn ergab. Was immer es war, das sie überfahren hatte, es hätte gut erkennbar mitten auf der Straße liegen müssen, und nicht irgendwo im Gebüsch. Immerhin war ihr niemand vor den Wagen gelaufen und durch den Zusammenprall weggeschleudert worden.
Ihr Gewissen verlangte von ihr umzukehren und gründlicher zu suchen, doch die Vorstellung, noch einmal dort anzuhalten und auszusteigen, ließ ihr einen eisigen Schauer über den Rücken laufen. Etwas hatte Bailey Angst gemacht – und ihr selbst auch, das wollte sie gar nicht abstreiten. Vielleicht sollte sie einfach die Polizei anrufen, damit jemand herkam und sich genauer umsah. Aber womöglich würde man sie dann auffordern umzukehren und an dem vermeintlichen Unfallort auf einen Streifenwagen zu warten. Dabei fühlte sie sich allein schon bei dem Gedanken unbehaglich, sicher aufgehoben in ihrem Wohnmobil da warten zu müssen.
Lieber Gott, sie führte sich auf wie ein kleines Mädchen, das zum ersten Mal ganz allein zu Hause war, überlegte Mary empört, hielt das Lenkrad fester umfasst und stieß ein leises, ungehaltenes Fauchen aus. Dann griff sie nach ihrem Handy … und fasste ins Leere. Es steckte nicht mehr in seiner Halterung. Ein kurzer, suchender Blick ergab rein gar nichts. Es war so dunkel, dass sie nicht mal ihre Füße sehen konnte, von einem Handy ganz zu schweigen. Sie biss sich auf die Lippe und spielte mit dem Gedanken anzuhalten und danach zu suchen, aber nach einem Blick auf den kleinen Monitor verwarf sie diesen Gedanken ganz schnell wieder. Sie würde bis zum nächsten Stoppschild weiterfahren, entschied sie. Im Augenblick wusste sie nicht mal, wo genau sie eigentlich war. Sie kannte nur den Namen dieser Straße, aber wenn sie bis zur nächsten Kreuzung weiterfuhr, würde sie anhand der dortigen Straßenschilder und Wegweiser präzisere Angaben machen können.
Der Gedanke ließ sie einen Blick auf den Tacho werfen. Wenn sie einfach nachsah, wie viele Meilen sie bis zum nächsten Stopp zurücklegte, konnte sie der Polizei sogar ziemlich genau sagen, wo sie suchen sollten. Das war doch sicher hilfreicher als alles andere, was ihr bislang in den Sinn gekommen war.
Dante stöhnte und machte die Augen auf. Sein Blick blieb an der Kante des eingebauten Betts hängen, und er wünschte, er hätte die Kraft, sich vom Boden zu erheben und wieder auf das weiche, bequeme Bett zu legen. Aber er war sich sicher, dass er nicht mal zu einer so lapidaren Anstrengung fähig sein würde. Wie es schien, hatte es ihn bereits seine letzten Kraftreserven gekostet, um in das Wohnmobil einzusteigen und sich bis zu dem Bett zu schleppen, neben dem er jetzt lag.
Es war wirklich eine Schmach. Als das Wohnmobil abrupt diesen Satz nach vorn gemacht hatte, war er unglücklich vom Bett gerollt und in einer misslichen Lage auf dem Boden gelandet. Sein Körper war völlig verdreht, mit Kopf und Schultern steckte er zwischen dem Bettgestell und einem Türpfosten fest, während seine Füße zwischen das Bett und den anderen Türpfosten geraten waren. Dabei war er mit seinem Hintern gegen die Badezimmertür gestoßen, die dadurch aufgegangen war, sodass er jetzt mit besagter Körperpartie auf den kalten Kacheln lag.
Diese unbequeme Position war eine zusätzliche Erschwernis, die dem Schmerz, den seine Verletzungen verursachten, die Krone aufsetzte. Dass er Schmerzen hatte, war kein Wunder, immerhin war er von einem Wohnmobil überfahren worden, auch wenn das womöglich die falsche Beschreibung für das war, was ihm widerfahren war. Dante war durch den Wald gerannt, bis auf einmal keine Bäume mehr da gewesen waren. Er hatte einen Moment benötigt, um zu begreifen, dass er eine Stelle erreicht hatte, an der der Wald durch eine Straße durchbrochen wurde. Und einen Sekundenbruchteil später hatte er dann auch begriffen, dass da ein Wohnmobil auf ihn zugerast kam. Instinktiv hatte er noch versucht, einen Zusammenstoß zu vermeiden, aber er war mit zu viel Schwung unterwegs, weshalb er von seiner eigenen Vorwärtsbewegung vorangetrieben genau bis vor die Räder des Fahrzeugs rutschte. Die Fahrerin konnte ihn unmöglich gesehen haben, und selbst wenn, wäre sie nicht in der Lage gewesen, noch rechtzeitig zu bremsen.
Unwillkürlich presste er die Lippen zusammen, als er daran zurückdachte, wie etliche Tonnen Metall und Holz über seinen Bauch gerollt waren. Er hatte mitanhören können, wie mehrere Rippen brachen und wie ein Lungenflügel zerplatzte. Aber er war nicht bewusstlos geworden, und nachdem ihn das Vorderrad erfasst hatte, hatte er instinktiv versucht, sich zur Seite zu rollen, um sich vor dem Hinterrad in Sicherheit zu bringen. Doch er war so benommen und schockiert gewesen und hatte krampfhaft nach Luft geschnappt, dass er sich nur auf den Bauch drehen konnte. Im nächsten Moment rollten die Zwillingsreifen auf der Beifahrerseite über ein Fußgelenk. Dabei konnte er noch von Glück reden, dass er nicht noch weiter nach vorne geraten war, sonst hätten ihm die linken Zwillingsreifen den Kopf zermalmt.
Lieber ein zertrümmertes Fußgelenk als einen zu Brei gematschten Kopf, sagte er zynisch, dann atmete er heftig aus und schaute sich an, wo sein Fuß an der Wand eingeklemmt worden war. Genauso schnell schaute er auch wieder weg, da er sein zermalmtes Fußgelenk nicht allzu genau betrachten wollte.
Verdammt, es hatte ihn ziemlich schwer erwischt. So schwer, dass er sich fragen musste, wie er es geschafft hatte, sich in das Wohnmobil zu schleppen. Die ersten Momente gleich nach dem Unfall waren etwas schwammig. Er erinnerte sich an die Panik, die ihn befallen hatte, als ihm bewusst geworden war, dass seine Verfolger ihn womöglich einholen könnten. Diese Panik hatte gereicht, dass er sich aufrappelte und im Wohnmobil Zuflucht suchte.
Die pure Verzweiflung war Ansporn genug, die Fahrertür zu erreichen und um Hilfe zu bitten. Nur war da keine Tür zu entdecken, bloß ein großes Fenster, das den Blick auf einen leeren Fahrersitz bot. Verwirrt hatte er versucht zu verstehen, was das für ein Gefährt war. Dann hörte er auf der anderen Seite eine Tür zuschlagen. Sofort humpelte Dante um den Wagen herum, als plötzlich neben ihm ein Schäferhund auftauchte, der mit dem Schwanz wedelte und ihn neugierig beschnupperte. Das Tier machte einen freundlichen Eindruck, aber dann wurde es von seiner Besitzerin gerufen und entschwand in die Dunkelheit.
Dante versuchte, die Fahrerin zu sich zu rufen, aber er bekam kaum genug Luft in den unversehrten Lungenflügel. Wie es ihm möglich war, sich überhaupt von der Stelle zu bewegen, wusste er selbst nicht so genau. Auf jeden Fall waren irgendwelche Laute für den Moment ausgeschlossen. Also kämpfte er sich weiter auf die andere Seite des Wohnmobils vor. Dort angekommen sah er in einigen Metern Entfernung den Lichtkegel einer Taschenlampe über den Asphalt zucken. Aber was nur ein paar Meter waren, stellte für ihn in seiner momentanen Verfassung eine unüberwindbare Entfernung dar. Dann entdeckte er die Tür an der Seite des Wohnmobils und hatte das Gefühl, eine Himmelspforte gefunden zu haben. Er öffnete diese Tür und zwang sich, die wenigen Stufen zu überwinden. Dann blieb er stehen und sah wieder zum Lichtkegel der Taschenlampe, der vom Heck des Wohnmobils reflektiert wurde. Die Fahrerin war für Sekunden deutlich zu sehen, und er stellte überrascht fest, dass diese Frau bemerkenswert gut aussah.
Er versuchte, in ihre Gedanken einzudringen und sie zu kontrollieren, weil er sie zum Wohnmobil zurückbeordern wollte, damit sie endlich weiterfuhr, aber weder konnte er sie kontrollieren noch lesen. Er musste einsehen, dass er durch seine Verletzungen und diese unsäglichen Schmerzen so geschwächt war, dass ihm nicht einmal etwas so Simples gelingen wollte. Er würde sich wohl oder übel hier im Wagen verstecken müssen, also schleppte er sich weiter in das Wohnzimmer und konnte noch in letzter Sekunde die Tür schließen, obwohl der Schäferhund schon auf ihn zulief.
Es war dunkel in diesem Wohnmobil, aber seine Augen kamen mit der Finsternis gut zurecht. Kaum hatte er im hinteren Teil des Wagens ein Bett entdeckt, gab es für ihn kein Zurück mehr. Erleichtert stellte er fest, dass es eine Schlafzimmertür gab, und irgendwie brachte er noch die Kraft auf, diese Tür hinter sich zuzuziehen. Schließlich sank er aufs Bett. Danach musste er zumindest für kurze Zeit bewusstlos gewesen sein, bis er plötzlich aus dem Bett rollte, als das Wohnmobil seine Fahrt fortsetzte.
Verkrampft lag er da und fürchtete, seine Verfolger könnten ihn noch eingeholt, die Fahrerin überwältigt und somit den Wagen in ihre Gewalt gebracht haben. Doch dann hörte er die Frau, wie sie nach ihrem Hund rief. Ihre Stimme klang ein wenig angespannt, aber nicht so von blankem Entsetzen geprägt, wie es sicherlich der Fall gewesen wäre, wenn sie in der Gewalt der Leute gewesen wäre, denen er so knapp entwischt war. Wie es schien, war er ihnen jetzt endgültig entkommen – auch wenn es keine absolute Gewissheit gab, dass sie ihnen in diesem Moment nicht doch folgten, in der Hoffnung auf eine passende Gelegenheit, ihn erneut einzukassieren. Seine Verletzungen mussten heilen, er musste wieder zu Kräften kommen, damit er sicherstellen konnte, dass er ihnen nicht wieder in die Fänge geriet – jedenfalls nicht, ohne dass er zuvor mit Mortimer und Lucian gesprochen und ihnen gesagt hatte, was hier los war. Nur um das tun zu können, brauchte er Blut.
Sein Blick konzentrierte sich auf die Decke, die halb vom Bett runterhing. Fast hätte er vor Verzweiflung leise geseufzt. Ihm fehlte die Kraft, um sich irgendwie auf das Bett zu ziehen, aber erst recht war er außerstande, die Tür weit genug zu öffnen, damit er die Fahrerin sehen, in ihre Gedanken eindringen und sie auffordern konnte, zu ihm zu kommen. Wie es schien, würde er warten müssen, bis sie einen Grund hatte, sich in den hinteren Teil zu begeben. Hoffentlich wartete sie damit nicht zu lange.
Diese Frau ahnte vermutlich nicht einmal, in welcher Gefahr sie schwebten. Auch wenn sich seine Verfolger nicht gezeigt hatten, mussten sie das Wohnmobil gesehen haben. Ganz bestimmt würden sie sich früher oder später auf die Suche danach begeben. Die gute Nachricht war die, dass sie erst mal zu dem Haus zurückkehren mussten, in dem sie ihn und Tomasso festgehalten hatten, weil dort ihr Wagen stand. Damit würden Dante und die Besitzerin des Wohnmobils zumindest einen kleinen Vorsprung für sich herausholen können, aber viel Zeit würde ihnen dennoch nicht bleiben. Wenn die Frau beim nächsten Stopp nicht unverzüglich herkam und ihn entdeckte, konnte das für sie beide ungeahnte Konsequenzen haben.
»Verdammt«, knurrte Mary, während sie auf das Display ihres Smartphones schaute und den Sprung betrachtete, der sich über den Touchscreen zog. Das Handy musste irgendwo unglücklich aufgeschlagen sein, als es aus der Halterung gefallen war. Oder Mary war draufgetreten, als sie in aller Eile hinter das Lenkrad gestürmt war, um endlich weiterzufahren. So oder so war die dünne Glasscheibe durchgebrochen, und das Telefon war tot. So viel also zu ihrem Vorhaben, die Polizei zu verständigen.
Missmutig steckte sie das Telefon zurück in die Halterung und nahm den Stift von dem kleinen Klemmbrett, das sie am Armaturenbrett festgemacht hatte. Sie notierte den Namen der Querstraße und die seit dem Unfall gefahrenen Meilen, dann steckte sie den Stift weg, sah nach links und rechts und nahm erst dann den Fuß vom Bremspedal, um weiterzufahren. Beim erstbesten Geschäft oder bei einer Tankstelle würde sie anhalten und von dort aus die Polizei verständigen. Das würde ihre Ankunft auf dem Campingplatz zwar noch weiter hinauszögern, doch es ging nicht anders. Ihr Gewissen würde niemals Ruhe finden, wenn sie das nicht tat.
Das Gute war, dass Mary nicht allzu lange würde warten müssen, um in die Nähe eines Telefons zu kommen. Am Morgen hatte sie noch einen Blick auf die Straßenkarte geworfen, daher wusste sie, dass sich dort, wo die 87 auf die 10 traf, auch mindestens ein Rastplatz befand. Auf dieser Straße sollte sie bald die 87 erreicht haben, wenn der Blick auf ihr Navi sie nicht getäuscht hatte. Wenn sie schon einen Rastplatz anfuhr, würde sie bei der Gelegenheit auch volltanken müssen, da die Nadel der Tankanzeige sich allmählich der Reserve näherte.
Als Bailey leise winselte, drehte Mary sich um, konnte aber in der Dunkelheit nach wie vor nicht erkennen, wo sich die Hündin aufhielt. Die Sorge nagte an ihr, dass sich die Schäferhündin doch verletzt haben könnte, weil vielleicht irgendetwas auf sie gefallen war. Mary zog die Stirn in Falten und forderte Bailey auf: »Komm nach vorn, Süße. Ich weiß, du bist müde, aber wir sind ja bald da. Also komm her und setz dich zu Mama, damit ich weiß, dass mit dir alles in Ordnung ist.«
Als die Hündin darauf nicht reagierte, nahm Mary ein wenig vom Gas weg und beugte sich zur Seite, um nach der Taschenlampe zu greifen, die auf dem Beifahrersitz lag. Sie musste sich wirklich weit rüberlehnen, was wahrscheinlich ziemlich idiotisch von ihr war, aber sie schaffte es, die Taschenlampe an sich zu nehmen, ohne mit dem Wohnmobil ins Schleudern zu geraten.
Sie machte die Taschenlampe an, richtete sie nach hinten und wagte einen flüchtigen Blick über die Schulter. Erleichtert stellte sie fest, dass Bailey vor der Schlafzimmertür lag und einen unversehrten Eindruck machte. Die Hündin war bestimmt nur müde und beklagte sich darüber, dass diese Reise so unendlich lange dauerte. Davon überzeugt machte Mary die Taschenlampe aus und legte sie auf das ausladende Armaturenbrett.
Bailey legte sich abends gern zu einer bestimmten Uhrzeit schlafen, und wenn sie müde war, teilte sie es mit, indem sie einem die Pfote auf den Arm legte und den »Trauerblick« aufsetzte, wie Joe es immer genannt hatte. Zum Glück war die Hündin klug genug, so etwas nicht während der Fahrt zu machen, stattdessen schien sie sich aufs Wehklagen zu verlegen. Jedenfalls hoffte Mary, dass es so war. Auf jeden Fall würde sie sich das Tier genauer ansehen, sobald sie den Rastplatz erreicht hatten, nur um Gewissheit zu haben, dass sie wirklich nicht von irgendetwas Umherfliegendem getroffen worden war.
Diese Sorge und die Frage, was genau sie eigentlich der Polizei sagen sollte, ließen sie so sehr in Gedanken versinken, dass sie zusammenzuckte, als ihr Navi auf einmal verkündete, sie müsse in Kürze auf die 87 abbiegen. Die Meldung kam früh genug, um abzubremsen und so langsam in die Kurve zu fahren, dass nicht noch mehr aus den Schränken und Schubladen auf dem Boden landete. Sie blinzelte ein wenig, da sie nach dem Rastplatz Ausschau hielt, doch der lag noch hinter der I-10 und damit vorläufig noch außer Sichtweite.
Da das Navi darauf programmiert war, ihr den Weg zum Campingplatz zu weisen, wollte es sie jetzt auf die Auffahrt zur I-10 schicken, doch Mary reagierte nicht darauf und folgte weiter der 87. Kurz darauf konnte sie vor sich die Lichter sehen, die den Rastplatz und die Tankstelle beleuchteten, und bremste weiter ab, um auf die Ausfahrt zu wechseln, ohne dass Bailey von weiteren schweren Objekten getroffen wurde.
Erleichterung überkam sie, als sie das Wohnmobil auf einem freien Parkplatz abgestellt und den Motor ausgemacht hatte. Diese Erleichterung war allerdings nicht von langer Dauer, denn irgendwann stand Mary von ihrem Platz auf und drehte sich um, damit sie einen Blick auf das Chaos im Durchgang werfen konnte. Der Lichtschein vom Rastplatz, der durch die Fenster ins Wohnmobil drang, genügte völlig, um sie erkennen zu lassen, wie viel Arbeit vor ihr lag, um alles wieder an Ort und Stelle unterzubringen. Ihr war klar, dass sie das in Ordnung bringen musste, bevor sie diesen Rastplatz wieder verlassen konnte. Sie verzog missmutig den Mund und begann damit, sich durch das Chaos hindurch einen Weg in den hinteren Teil des Wohnmobils zu bahnen.
Ihre Handtasche hatte sie vor dem Zugriff Unbefugter gut versteckt im Kleiderschrank eingeschlossen, wo sie sie immer aufbewahrte. Die musste sie jetzt haben, da sie womöglich Kleingeld für das Münztelefon benötigte, falls die Angestellten der Raststätte sich weigerten, sie von deren Apparat aus telefonieren zu lassen. Außerdem war es lange nach Essenszeit, und es würde sogar noch viel später sein, wenn sie erst mal alles aufgeräumt und sicher verstaut hatte. Die Möglichkeit, in der Raststätte zu essen, würde ihr wenigstens die Mühe ersparen, noch eine Mahlzeit kochen zu müssen, wenn sie dann endlich den Campingplatz erreicht hatte.
Auf etwas Glattem auf dem Fußboden geriet sie ins Rutschen, und sie musste sich am Küchentresen festklammern. Verwundert betrachtete sie dann den Fleck auf dem Boden vor dem Kühlschrank – eine kleine dunkle Lache, die ein bisschen nach Ketchup aussah, aber dünnflüssiger war. Und es war nicht die einzige dieser Art, wie Mary beiläufig wahrnahm. Offenbar musste bei der Vollbremsung die Kühlschranktür auf- und wieder zugegangen sein, allerdings wusste sie nicht so recht, was dabei herausgefallen sein sollte, um solche Flecken zu verursachen. Sie konnte kein zerbrochenes Glas oder irgendein Fläschchen entdecken, doch das musste nichts bedeuten, da eine der vielen Schüsseln oder Handtücher darauf gelandet sein konnte.
Bevor sie weiterfuhr, musste sie also nicht nur alles wieder einräumen, sondern auch noch den Boden wischen. Mary ging weiter, und Bailey stand auf, als sie sich ihr näherte. Sie jaulte aufgeregt und drehte sich zur Schlafzimmertür um, als könnte sie es nicht erwarten, in diesen Raum zu gelangen.
»Ja, ja, ja, du kannst dich aufs Bett legen und schlafen«, sagte Mary ein wenig ungehalten, als sie nach der Tür griff, um sie aufzuschieben. Für Bailey war das Erlaubnis genug, denn kaum war der Türspalt breit genug, zwängte sie sich hindurch, um aufs Bett springen zu können.
Kopfschüttelnd folgte Mary der Hündin in den beengten Raum. Sie lehnte sich gegen den Matratzenrand, drehte sich zur Seite und öffnete die Tür des Kleiderschranks. Dieser Schrank mitsamt den Schubladen darunter, die momentan durch das Bett blockiert wurden, war immer ihr persönlicher Bereich gewesen, während die hintere Kombination aus Schrank und Schubladen ihrem Mann gehört hatte. Sie warf einen Blick in das dunkle Schrankinnere und tastete nach der Handtasche, machte dann aber einen Schritt nach hinten, um das Licht anzuschalten.
Sie konzentrierte sich wieder auf die Suche nach ihrer Handtasche, doch dann sah sie, dass Bailey zur anderen Seite vom Bett sprang, um im winzigen Badezimmer an irgendetwas zu lecken. Was war das? Eine Schulter? Mary kniff die Augen ein wenig zusammen und beugte sich über das Bett, um mehr sehen zu können. In der nächsten Sekunde fielen ihr bald die Augen aus dem Kopf, als sie begriff, dass da ein sehr großer und sehr nackter Mann halb im Bad und halb im Schlafzimmer auf dem Boden lag. Es war sein nackter Hintern, der ins Badezimmer hineinragte, und es war der gleiche nackte Hintern, von dem Bailey eifrig Blut ableckte.
2
»Bailey«, keuchte Mary gleichermaßen beunruhigt wie besorgt, während ihr überstrapaziertes Gehirn nach einer Erklärung dafür suchte, wie dieser Mann hier reingekommen sein konnte. Als sie sich am Morgen auf die Reise begeben hatte, war er definitiv noch nicht dort gewesen, und während der Fahrt konnte er nicht zugestiegen sein. Die einzige Gelegenheit, bei der sie die Tür ihres Wohnmobils nicht abgeschlossen hatte, war nach dem Zusammenstoß mit dem nach wie vor unbekannten Hindernis gewe…
Mary verkrampfte sich, als ihr klar wurde, dass dieser Mann das Hindernis gewesen war. Sie hatte ihn überfahren. Es war die einzige Erklärung, die einen Sinn ergab. Dass er blutverschmiert war, legte schließlich auch die Folgerung nahe, dass er in irgendeine Art von Unfall verwickelt gewesen war. Aber wie zum Teufel hatte er es geschafft, in ihren Wagen einzusteigen, ohne von ihr gesehen zu werden?
Sie kroch über das Bett, weil sie wissen wollte, wie sie ihm helfen konnte. Sofort hielt sie inne, als er den Kopf zu ihr drehte und sie mit tiefschwarzen Augen eindringlich ansah. Einen Moment lang hielt sie seinem Blick stand, dann aber wich sie langsam vor ihm zurück. Der Mann war leichenblass und von Kopf bis Fuß mit Blut überzogen, außerdem war Blut in den Teppich eingezogen und hatte eine Lache auf den Fliesen im Badezimmer gebildet. Es war dieses plötzliche silberne Glühen in seinen Augen, das ihr auf einmal Angst machte.
Mary betrachtete den Mann noch einmal kurz und sagte sich, dass sie ihm nicht helfen konnte, da er dringend ärztlich behandelt werden musste. Er brauchte einen Rettungswagen, ein Krankenhaus, eine Operation und viele Liter Blut. Sie drehte sich weg und rief ihm zu: »Ich hole Hilfe!«
Wieder stakste sie durch den Gang, um nichts von dem kaputtzutreten, was auf dem Boden gelandet war, blieb dann erneut stehen und schaute über die Schulter. »Bailey!«, rief sie, aber die Hündin ließ sich nicht blicken. In energischem Tonfall fügte sie hinzu: »Komm zu Mommy! Sofort!«
Diesmal gehorchte Bailey und kam aus dem Schlafzimmer zu ihr gelaufen. Erleichtert stieg Mary aus dem Wohnmobil, wartete, bis die Hündin ihr gefolgt war, und drückte die Tür ins Schloss. Reflexartig griff sie nach dem Schlüsselbund, um die Tür zu verriegeln, als ihr plötzlich einfiel, dass der Schlüssel noch im Zündschloss steckte. Mary überlegte kurz, ob sie wieder einsteigen sollte, entschied sich aber dagegen. Stattdessen drehte sie sich zu Bailey um und sagte: »Sitz. Warte hier auf mich.«
Als Bailey sich neben dem Zugang zum Wohnmobil hinsetzte, nickte Mary zufrieden und murmelte: »Braves Mädchen.« Dann lief sie in Richtung Raststätte los.
Auf der einen Seite gab es eine Tankstelle mit Supermarkt, auf der anderen ein Restaurant. Sie nahm die Tür zum Lokal und stürmte nach drinnen, blieb aber gleich wieder stehen, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Ein wenig überrascht zählte sie rund ein Dutzend Gäste, manche von ihnen in Zweier- und Dreiergruppen, andere saßen allein an ihrem Tisch. Es war mehr los, als sie um diese Uhrzeit erwartet hätte. Ein Blick auf die Wanduhr zeigte, dass es kurz nach acht war. Offenbar war sie nicht als Einzige nachts auf Reisen.
Sie entdeckte auch zwei Kellnerinnen. Die Jüngere stand an einem Tisch und nahm wohl eine Bestellung auf, während sich die Ältere hinter der mit Hockern gesäumten Theke aufhielt. Da die Frau gerade in ihre Richtung sah, lief Mary zu ihr und platzte raus: »Im Schlafzimmer liegt ein nackter Mann in meinem Bett.«
Die Kellnerin grinste sie breit an und gab ironisch zurück: »Sie Glückliche.«
Mary stutzte, dann redete sie weiter: »Nein, Sie verstehen nicht. Er ist verletzt!«
»Da waren Sie wohl ein bisschen zu stürmisch, wie?«, zog die andere Frau sie auf.
»Zu stürmisch?«, wiederholte Mary verwundert und lief prompt rot an, als sie zwei Sekunden später die Anspielung verstand. Die Frau meinte tatsächlich, der Mann hätte sich beim Sex mit ihr verletzt! Himmel! »Wir waren nicht … hören Sie, Lady, ich bin zweiundsechzig, und dieser Mann könnte ohne Probleme mein Sohn sein«, gab sie pikiert zurück.
»Na, da haben Sie gleich in doppelter Hinsicht Glück gehabt«, meinte die Kellnerin. »Aber es ist nicht nett von Ihnen, vor einer anderen Frau, die selbst seit zehn Jahren auf Diät ist, mit einem solchen Steak zu prahlen.«
Mary schnalzte aufgebracht. »Ich prahle mit überhaupt nichts. Dieser Mann ist wirklich schwer verletzt, alles ist voller Blut. Er braucht Hilfe, aber mein Handy ist kaputtgegangen und ich …«
»Ruf den Rettungswagen, Joan.«
Mary drehte sich abrupt um, als die ältere Kellnerin diese Anweisung in einem energischen Tonfall durch das Lokal rief, und erblickte eine Frau und einen Mann, die plötzlich neben ihr standen. Die beiden waren ein junges Paar, sie attraktiv, mit langen braunen Haaren, zum Pferdeschwanz zusammengebunden, er mit kurzen blonden Haaren und ernster Miene. Mary hatte die zwei beim Hereinkommen gesehen, allerdings war ihr da nicht aufgefallen, dass die beiden Ärztekleidung wie im Krankenhaus trugen. Prompt verspürte sie Erleichterung, während die Frau sie besänftigend anlächelte.
»Hallo, ich bin Dr. Jenson, und das ist mein Mann, Dr. Jenson. Wenn Sie uns zu Ihrem Freund bringen, können wir sehen, ob wir ihm irgendwie helfen können, bis der Rettungswagen eintrifft.«
»O ja«, sagte Mary, atmete befreit auf und führte sie in Richtung Ausgang. Als sie die Tür aufdrückte, fand sie aber, dass sie etwas klarstellen sollte: »Der Mann ist nicht mein Freund. Ich kenne ihn gar nicht. Ich habe ihn nur im Schlafzimmer meines Wohnmobils entdeckt, nachdem ich hier angehalten habe. Möglicherweise habe ich ihn überfahren. Er blutet am ganzen Leib.«
»Sie haben ihn überfahren?«, fragte der Mann mit Baritonstimme, als sie den Parkplatz überquerten. »Womit denn?«
»Mit meinem Wohnmobil«, antwortete Mary und stellte erleichtert fest, dass Bailey sich in der Zwischenzeit nicht von der Stelle gerührt hatte. Die Hündin war gut darin, das zu tun, was man ihr sagte, aber so, wie sich die Dinge entwickelt hatten …
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe«, erwiderte der Mann bedächtig. »Sie haben den Mann nackt in Ihrem Wohnmobil gefunden und … was dann? Haben Sie ihn rausgeschmissen und ihn dann überfahren?«
»Was?« Sie sah den Mann verdutzt an. »Nein, natürlich nicht. Ich glaube, dass ich ihn überfahren habe, und als ich nachgesehen habe, was mir da unter den Wagen geraten ist, muss er wohl ins Wohnmobil eingestiegen sein. Ich habe ihn erst entdeckt, als ich hier angekommen bin.« Sie blieb an ihrem Wohnmobil stehen, öffnete die Tür und ging voran, um den beiden den Weg zu zeigen. Das wäre eigentlich nicht nötig gewesen, weil der Wagen sehr kompakt aufgebaut war und man geradewegs bis ins Schlafzimmer durchgehen konnte. Dass Mary ihnen voranging, hatte eigentlich einen anderen Grund: Sie war sich nicht sicher, ob er überhaupt noch da war. Sie hatte ja zuerst selbst kaum glauben können, dass er sich in ihrem Schlafzimmer aufhielt, weshalb sie nicht ausschließen wollte, dass er nur eine Halluzination war, ausgelöst durch den Stress, den diese Reise für sie bedeutete.
Als sie aber die Schlafzimmertür aufschob und über das Bett hinwegspähte, da konnte sie ihn klar und deutlich sehen. Er lag auf der Seite, die breiten Schultern zwischen Bett und Wand eingeklemmt, den Hintern nach wie vor auf den kalten Badezimmerfliesen und so splitternackt wie in dem Moment, als er zur Welt gekommen war.
»O weh.«
Mary drehte sich um und merkte, dass sie im Weg war. Sie zwängte sich in den schmalen Zwischenraum zwischen Bett und Wand, um den beiden Platz zu machen. Sie sah unschlüssig zwischen dem Mann und der Frau hin und her und schlug dann vor: »Vielleicht sollte ich den Auszug öffnen.«
»Damit könnten Sie ihn zusätzlich verletzen«, sagte die Frau, kletterte aufs Bett und rutschte auf Knien zur anderen Seite.
»Lisa hat recht«, stimmte der Arzt seiner Frau zu, fasste Mary am Arm und dirigierte sie raus aus dem zu kleinen Raum. Selbst wenn sie sich ganz an die Seite drückte, war für ihn kein Platz da, um an ihr vorbeizukommen. Solange die Auszüge nicht geöffnet waren, konnte man sich in diesem Teil des Wohnmobils nicht mal auf der Stelle umdrehen.
»Wie wäre es, wenn Sie nach dem Rettungswagen Ausschau halten, während wir hier sehen, was wir für ihn tun können?«, schlug er sanft, aber nachdrücklich vor und zog sie zurück zur Tür.
Bereitwillig verließ Mary das Schlafzimmer. Sie war sogar regelrecht erleichtert darüber, gehen zu können. Der Anblick dieses verdreht daliegenden, blutüberströmten Mannes genügte auch so schon, um ihr Albträume zu bescheren. Da sie nicht davon ausging, dass er das überleben würde, wollte sie lieber nicht danebenstehen, wenn er starb. Es war schlimm genug, dass sie an dem Ganzen womöglich schuld war.
»Wenn die Sanitäter da sind, schicken Sie sie rein«, wies der Mann sie sanft an und beugte sich vor, um ihr die Tür aufzumachen.
Mary nickte nur und ging die Stufen hinunter, bis sie auf dem Asphalt neben dem Wagen stand. Sie hörte, wie die Tür hinter ihr zugezogen wurde, warf einen nervösen Blick hinter sich und schaute dann zu Bailey, als die sie mit der Nase anstieß.
»Es wird alles wieder gut«, murmelte sie und tätschelte den Hund, war sich aber nicht sicher, ob das auch stimmte.
Wenn der Mann in ihrem Schlafzimmer der war, den sie überfahren hatte, und wenn er jetzt wie befürchtet starb, dann … dann war das doch Mord, oder nicht? Oder musste Tötungsabsicht vorliegen, damit es als Mord ausgelegt werden konnte? Vielleicht war es Totschlag oder etwas anderes in dieser Art. Sie hatte keine Ahnung, aber irgendetwas war es auf jeden Fall.
Es war ein Unfall gewesen, hielt sie sich vor Augen. Sie hatte den Mann nicht auf der Straße gesehen, allerdings war sie zu der Zeit bereits ziemlich müde gewesen. Zwar hätte sie nicht gedacht, dass sie so müde gewesen war, trotzdem hätte sie ihn wahrnehmen müssen, oder nicht? Der Mann war völlig nackt! Er hatte keine dunkle Kleidung getragen, die hätte verhindern können, dass man ihn als Hindernis wahrnahm. Sie hätte ihn sehen müssen.
Plötzlich ging die Wagentür auf, und Mary drehte sich um. Sie sah die hübsche Brünette aus dem Wohnmobil steigen. Die nahm von Mary jedoch nicht die geringste Notiz, sondern warf die Tür hinter sich zu und lief zum Restaurant zurück.
Verwundert sah Mary ihr hinterher, dann richtete sie den Blick wieder auf ihr Wohnmobil und überlegte, ob sie hineingehen und nach dem Rechten sehen sollte. War er bereits tot? War er … Geräusche, die vom Lokal an ihr Ohr drangen, ließen Mary abermals in diese Richtung blicken. Voller Erstaunen verfolgte sie mit, wie die Ärztin mehrere Gäste zum Wohnmobil führte. Nach Marys Dafürhalten waren diese Männer allesamt Trucker … oder Holzfäller.
»Holen Sie ihn raus?«, fragte Mary besorgt, als die Ärztin an ihr vorbeiging. Es war die einzige Erklärung, die sie für das Aufgebot an so vielen großen und starken Männern hatte. Allerdings hatte sie keine Ahnung, wie diese Riesen von Männern alle in ihrem Wohnmobil Platz finden und dabei auch noch in der Lage sein sollten, den Verletzten aus dem Schlafzimmer zu schaffen. Und wohin wollten sie ihn bringen? Wollten sie ihn einfach hier auf den Asphalt legen? Oder sollte er ins Lokal gebracht werden? Letzteres war eigentlich am wahrscheinlichsten. Die Beleuchtung im Wohnmobil war im Moment nicht besonders gut. Nachdem sie den Wagen hier abgestellt hatte, hatte sie nicht daran gedacht, den Generator einzuschalten. Daher war die einzige verfügbare Lampe die kleine LED, die sie angemacht hatte, um nach ihrer Handtasche zu suchen.
»Warten Sie hier und passen Sie auf, ob der Rettungswagen eintrifft«, wies die Brünette sie an, dann zog sie die Tür auf und gab den Männern ein Zeichen, dass sie die Stufen hochgehen sollten. Schließlich folgte sie ihnen und schloss hinter sich die Tür, während die beunruhigte Mary nur dastehen und zusehen konnte. Das Wohnmobil schaukelte leicht, da sich die Leute darin hin und her bewegten. Mary biss sich auf die Lippe und fragte sich, wie diese Leute glaubten, den Mann aus dem Schlafzimmer nach draußen zu schaffen, wenn sich doch alle gegenseitig im Weg standen. Sie hätte wirklich die Auszüge ausfahren sollen, überlegte sie missmutig, während sie die Straße mal in die eine, mal in die andere Richtung absuchte und zu grübeln begann, wie lange es wohl dauern würde, bis endlich die Ambulanz eintraf.
Als sich die Wagentür erneut öffnete, drehte sich Mary erwartungsvoll um, doch es kam nur einer der Männer nach draußen. Als er die Stufen herunterkam und die Tür hinter sich zumachte, ging Mary einen Schritt zur Seite. Sie erwartete, dass der Mann irgendetwas zu ihr sagte, aber er ging nur mit lässigen Schritten und einem entspannten Lächeln auf den Lippen zurück zum Restaurant.
Verwundert schaute Mary ihm hinterher. Sie hätte sich noch vorstellen können, dass das Ärztepaar ihn losgeschickt hatte, um dringend benötigtes Verbandszeug oder Ähnliches zu besorgen. Aber in diesem Fall hätte er sich doch bestimmt beeilt und wahrscheinlich finster dreingeblickt, weil die Lage so ernst war.
Sie beobachtete ihn weiter durch die große Fensterfront des Lokals und konnte sehen, wie er sich an seinen Tisch setzte und weiteraß, als sei nichts geschehen. Dann kamen die beiden Kellnerinnen zu ihm. Ihre Neugier war ihnen genauso deutlich anzusehen wie die Sorge, doch was er ihnen erzählte, schien sie nicht nur zu beruhigen, sondern auch zu amüsieren, da sie Augenblicke später entspannt und lächelnd davongingen, als hätte er ihnen einen guten Witz erzählt.
Mary war mehr als verdutzt über das, was sich da vor ihren Augen abspielte. Erneut ging die Tür ihres Wohnmobils auf, und ein weiterer Mann kam zum Vorschein. Auch er wirkte völlig locker und guter Dinge, aber bevor er dem ersten Mann ins Restaurant folgen konnte, stellte sich Mary ihm in den Weg. »Was geschieht da drinnen? Ist er …?«
»Na, der wird schon wieder«, versicherte ihr der hünenhafte Mann mit rauer Stimme. Ihr fielen zwei Stichwunden am Hals des Mannes auf, als der um sie herumging, um ins Restaurant zurückzukehren. Ehe sie jedoch weiter darüber nachdenken konnte, wurde sie von den Worten des Mannes abgelenkt, der ihr noch zurief: »Das mit dem Blut war mehr Schau als alles andere.«
Ungläubig sah Mary dem Mann hinterher. So viel Blut konnte nicht bloß Schau sein, der ganze Boden war blutüberströmt gewesen. Nachdem sie das Ärzteehepaar zu ihm gebracht hatte, wollte sie dem Mann deswegen auch gar nicht noch mal in die Augen sehen, weil sie fürchtete, in ihnen den Tod zu entdecken, der ihn jeden Moment ereilen konnte.
Erleichtert horchte sie auf, als in einiger Entfernung die Sirene eines Rettungswagens ertönte. Mary drehte sich nach links und rechts, dann entdeckte sie die blinkenden Lichter des Wagens und ging ihm entgegen, um ihn zu sich zu winken, sobald er auf den Parkplatz einbog. Der Rettungswagen war bereits in Sichtweite, da machte Mary aus dem Augenwinkel eine Bewegung aus und drehte sich um. Ein weiterer Trucker kam soeben aus dem Wohnmobil. Er wirkte genauso ruhig und gelassen wie sein Vorgänger und ging wie dieser zurück zum Restaurant. Aber jetzt hatte sie keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, denn der Rettungswagen kam soeben vor ihr zum Stehen. Zwei Rettungssanitäter stiegen aus und kamen auf sie zugelaufen.
»Haben Sie angerufen?«, wollte der Fahrer wissen.
Mary schüttelte den Kopf. »Das hat die Kellnerin für mich erledigt.«
Der Mann nickte und ließ seinen Blick über sie wandern. »Welche Beschwerden haben Sie? Stiche in der Brust? Atemprobleme?«
Mary winkte ab und ging zum Wohnmobil, während sie erklärte: »Nein, nein, mit mir ist alles in Ordnung. Aber ich habe mit meinem Wagen jemanden überfahren, und der ist jetzt schwer verletzt. Es sind gerade schon zwei Ärzte bei ihm, aber …«
Sie unterbrach sich und blieb stehen, dann sah sie über die Schulter und musste feststellen, dass die beiden Sanitäter zum Wagen zurückliefen. Mary stutzte, begriff dann aber erleichtert, dass die zwei nur losgelaufen waren, um ihre Ausrüstung zu holen. Jetzt, da sie wussten, was vorgefallen war, konnten sie zügig handeln, und schon wenige Augenblicke später schoben sie eine mit jeder Menge Ausrüstung vollgepackte Trage vor sich her. Auf der Trage lagen ein Fixierbrett und eine Halskrause, falls die Wirbelsäule verletzt sein sollte, dazu eine große orangefarbene Tasche mit dem Rotkreuzsymbol darauf sowie ein Defibrillator. Beim Anblick dieser Dinge ging ihr durch den Kopf, dass der nackte Mann in ihrem Schlafzimmer wohl besser nicht von der Stelle bewegt wurde, solange nicht klar war, ob er sich irgendeinen Wirbel gebrochen hatte. Allerdings war sie sich sicher, dass die Ärztin daran gedacht hatte, bevor sie losgegangen war, um die Männer aus dem Restaurant zu holen, damit die den beiden helfen konnten, den Verletzten aus seiner misslichen Lage zu befreien. Zumindest nahm sie an, dass die Ärztin die Leute zu diesem Zweck mitgebracht hatte. Warum die Männer dann nach Erledigung dieser Aufgabe nicht alle gemeinsam, sondern einer nach dem anderen ihr Wohnmobil verließen, war Mary allerdings schleierhaft.
Die Sanitäter hatten jetzt an Tempo zugelegt, und Mary musste sich beeilen, um nicht von den beiden überholt zu werden.
»Wer sind die Ärzte bei dem Unfallopfer?«, fragte der Fahrer plötzlich.
»Ein Ehepaar namens Jenner oder so ähnlich«, antwortete Mary, die sich nicht genau erinnern konnte, weil in dem Moment zu viel Trubel geherrscht hatte.
»Jenson?«, erkundigte sich der andere Sanitäter, als sie am Wohnmobil angekommen waren und Mary ihnen die Tür aufhielt.
»Ja, das könnte der Name sein«, sagte sie und drehte sich verwundert um, als auch noch der vierte Mann auftauchte und die Stufen hinunterging. Ihr fiel auf, dass er am Hals sowohl eine blutverschmierte Verletzung als auch einen Einstich hatte, aber sie wurde gleich wieder vom Fahrer des Rettungswagens abgelenkt, als der erklärte: »Dann hat Ihr Freund ja Glück gehabt. Die Jensons sind Spitzenklasse.« Dann ging er an dem Mann vorbei nach drinnen.
»Er hat recht«, bestätigte der zweite Sanitäter und folgte seinem Kollegen. Er zog die Tür hinter sich zu, was ihr zu verstehen gab, dass sie sie nicht dabei haben wollten.
Mary seufzte leise, störte sich aber nicht daran, dass man sie wieder außen vor gelassen hatte. Da drinnen war nun mal wenig Platz, und sie wollte nicht den Worten des einen Truckers Glauben schenken, dass das Blut alles gewesen sein sollte. Außerdem fiel ihr jetzt, als sie sich den Anblick in ihrem Schlafzimmer ins Gedächtnis zurückrief, ein, dass irgendwas mit der Brust des Mannes nicht stimmte. Von diesem Reifenabdruck abgesehen hatte sein Oberkörper irgendwie verformt oder platt gedrückt ausgesehen, was auch für eins der Beine galt.
Sie murmelte besorgt vor sich hin und ging zu Bailey, die sich neben dem Wohnmobil auf dem Asphalt zusammengerollt hatte. Als sie den Kopf der Hündin streichelte, stellte diese sich sofort hin und schaute aufmerksam in alle Richtungen.
»Alles wird gut«, sprach sich Mary selbst Mut zu und wünschte nur, sie könnte ihren eigenen Worten Glauben schenken. Als ihr Blick zum Restaurant zurückwanderte, fiel ihr wieder ein, dass sie die Gelegenheit hatte nutzen wollen, dort eine Kleinigkeit zu essen. Aber im Moment stand ihr nicht der Sinn danach. Später vielleicht, sofern man sie nicht sofort festnahm und vor den Henker schleifte, der mit ihr kurzen Prozess machen würde, überlegte sie missmutig. Dieser Gedanke ließ ihr die Frage durch ihren Kopf gehen, wo denn eigentlich die Polizei blieb. Die hätte doch längst hier sein müssen, um Aussagen aufzunehmen und mit den Ermittlungen zu beginnen, oder nicht? Wieder öffnete sich die Tür ihres Wohnmobils, und diesmal war es das Arzt-Ehepaar, das ihren Wagen verließ. An ihrer Kleidung klebte Blut, und mit einem Mal wurde ihr bewusst, dass das, was sie vor dem Kühlschrank für so etwas wie Ketchup gehalten hatte, wahrscheinlich auch Blut gewesen war.
»Wie geht es ihm?«, fragte Mary.
Der Mann drehte sich um und schloss die Tür hinter sich. Mary stutzte, als sie an dessen Hals ebenfalls zwei Einstiche bemerkte, doch dann lenkte die Ärztin die Aufmerksamkeit auf sich, als sie gut gelaunt antwortete: »Es geht ihm bestens. Die Sanitäter sind jetzt bei ihm.«
»Aber …« Mary stutzte und sah zum Wohnmobil, da plötzlich der Generator angesprungen war. Vermutlich brauchten die Sanitäter mehr Licht, oder sie mussten den Defibrillator an den Strom anschließen. In dem Moment wurde ihr bewusst, dass sie alles bis auf die orangefarbene Tasche auf dem Boden vor dem Wagen hatten stehen lassen.
»Was machen die …?«, setzte sie zu einer Frage an, verstummte aber gleich wieder, als sie feststellen musste, dass die Jensons längst auf dem Weg zurück ins Restaurant waren.
Aufgebracht schnaubend sah Mary wieder zum Wohnmobil und machte einen Schritt darauf zu, als die Tür aufging und die beiden Sanitäter nach draußen kamen. Von drinnen war einen Moment lang das Rauschen der Dusche zu hören, dann war die Tür auch schon wieder zugefallen. Verwundert sah sie mit an, wie die Sanitäter zur Trage gingen.
»Wollen Sie mit dem Ding da rein?«, fragte sie, als einer der beiden sich ans Kopfende stellte. »Da drinnen ist es etwas beengt.«
»Nicht nötig«, sagte der Sanitäter unbekümmert und lächelte sie an. »Ihm geht’s gut.«
»Es geht ihm überhaupt nicht gut«, widersprach sie. »Der Mann war fast tot. Er … hey, Sie fahren doch jetzt nicht etwa weg!«, protestierte sie sofort, als sie sah, dass er die Trage in Richtung des Rettungswagens schob.
»Es geht ihm gut. Das Blut war nur Schau«, versicherte ihr der Fahrer, der seinem Kollegen folgte.
»Aber …« Bestürzt drehte sie sich zu ihrem Wohnmobil um und überlegte, was sie mit dem Mann anstellen sollte. Am besten war es dann wohl abzuwarten, bis er nach draußen kam. Sie konnte einfach nicht glauben, dass es ihm tatsächlich so gut gehen sollte, wie jeder hier behauptete. Aber falls dem so war, hielt sich im Moment ein großer nackter Mann in ihrem Wohnmobil auf. Beziehungsweise in ihrer Dusche, den Geräuschen nach zu urteilen. Sie durfte nicht vergessen, den Wassertank aufzufüllen und den grauen Tank zu leeren, sobald sie den Campingplatz erreicht hatte. Außerdem musste sie … was zum Teufel dachte sie da eigentlich? Sie würde sich nicht von der Stelle rühren, solange dieser Mann, der momentan ihre Dusche in Beschlag nahm, nicht seinen Hintern aus ihrem Wagen bewegt hatte. Zu gut war ihr noch ihre erschreckte Reaktion im Gedächtnis, als sich ihre Blicke begegnet waren. Da war etwas an seinem Ausdruck gewesen, an der konzentrierten Art, wie er sie angesehen hatte mit diesen pechschwarzen Augen, in denen silberne Sprenkel zu glühen schienen …
Nein, sie würde nicht reingehen, sondern warten, bis er rauskam. Falls er rauskam. Was, wenn er einfach mit ihrem Wagen davonfuhr? Sie hatte den verdammten Schlüssel stecken lassen. Und ihre Handtasche war auch noch im Wagen. Der Mann konnte mit ihrem Wohnmobil einfach losfahren und irgendwo Urlaub machen.
Sie sollte reingehen und ihren Schlüssel an sich nehmen, solange der Mann noch duschte – obwohl sie sich nicht sicher war, ob das überhaupt der Fall war. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass er in der Verfassung war, sich in die Duschkabine zu schleppen. Andererseits behaupteten ja alle, dass es ihm gut ging. Sie öffnete die Tür einen Spaltbreit und bemerkte, dass das Duschgeräusch verstummt war.
Dann würde sie eben doch warten, bis er nach draußen kam, entschied Mary und drückte die Tür leise zu, gerade als von drinnen Bewegungen zu hören waren. Das Brummen des Generators verstummte ebenfalls, und sie begann nervös von einem Bein aufs andere zu treten, während sie überlegte, was sie zu ihm sagen sollte, wenn er auftauchte. Falls er auftauchte. Er würde doch rauskommen, oder?
Bailey winselte leise und stieß mit der Schnauze gegen die Tür, als wollte sie Mary auffordern, in den Wagen zurückzukehren. Aber Mary schüttelte den Kopf. »Wir werden warten«, entschied sie mit leiser Stimme und drehte dem Wagen den Rücken zu. Sie beobachtete einen schwarzen Van, der mit hoher Geschwindigkeit auf dem Highway unterwegs war, dann aber abrupt abbremste und den Blinker setzte, wohl weil der Fahrer auf den Rastplatz abbiegen wollte. Bis es so weit war, würde noch einige Zeit vergehen, da dichter Verkehr herrschte, der vermutlich von den Wagen verursacht wurde, die von der Abfahrt von der I-10 kamen. In der nächsten Sekunde wirbelte sie entsetzt zur Tür ihres Wohnmobils herum, da jemand den Motor anließ.
»O nein!«, murmelte Mary und zog abermals die Tür auf. Sie hatte eben die Gitterstufe überwunden, da schoss Bailey an ihr vorbei und hätte sie beinahe aus dem Gleichgewicht gebracht, weil die Hündin unbedingt als Erste in den Wagen wollte. Mary klammerte sich links am Tresen fest, rechts musste ihr der Beifahrersitz Halt geben, dann warf sie Bailey einen verärgerten Blick zu, weil die es sich wie gewohnt zwischen den beiden Sitzen bequem gemacht hatte. Der dummen Hündin schien gar nicht klar zu sein, dass der Mann am Lenkrad da gar nichts zu suchen hatte. Schlimmer noch: Sie betrachtete ihn, als würde sie ihn anhimmeln, während sie aufgeregt mit dem Schwanz wedelte und ihr die Zunge aus dem Maul hing.
Mit der Hündin würde sie später noch ein ernstes Wörtchen reden müssen, beschloss Mary, während sie ein paar Schritte nach vorn machte und dem Mann am Steuer einen finsteren Blick zuwarf. Dieser wich jedoch einem erschrockenen Gesichtsausdruck, als ihr die Veränderungen auffielen, die der Mann durchgemacht hatte. Er war nicht länger das bleiche, blutüberströmte Unfallopfer, das kaum noch Luft bekam. Dieser Mann hatte eine rundum gesunde Ausstrahlung, und die vom Duschen noch feuchten Haare trug er glatt nach hinten gekämmt. Er atmete auch ganz normal. Auch klebte an ihm kein Blut mehr. Nicht ein einziger Tropfen. Mary konnte das so genau beurteilen, weil eine Sache gleich geblieben war: Er war noch immer völlig nackt. Und mit seinem nackten Hintern saß er auf ihrem Fahrersitz.
3
»Was zum Teufel soll denn das?«, herrschte Mary den jungen Mann an und ging nach vorn, um sich drohend über ihn zu beugen. Wenn es sein musste, würde sie ihm gehörig wehtun, denn niemand nahm ihr ungeschoren ihr Wohnmobil weg. »Nehmen Sie Ihren verdammten Hintern von meinem Sitz!«
»Keine Sorge, ich habe geduscht. An mir klebt kein Blut. Setzen Sie sich.« Während er in aller Seelenruhe antwortete, machte das Wohnmobil einen so abrupten Satz nach vorn, dass Mary fast zu Boden geschleudert wurde. Sie konnte sich gerade noch am Esstisch festklammern, richtete sich wieder auf und bekam die Rückenlehne des Fahrersitzes zu fassen. Dem Mann auf ihrem Platz warf sie einen vernichtenden Blick zu.