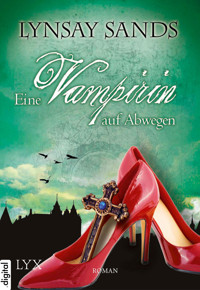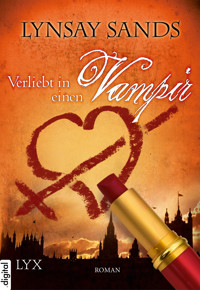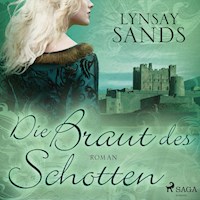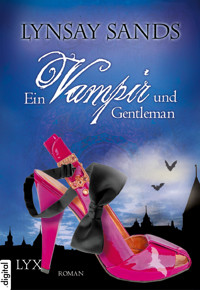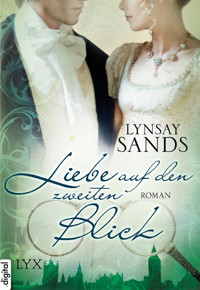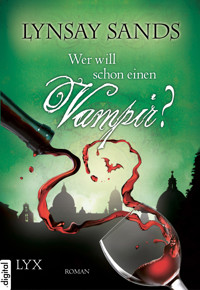9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Argeneau
- Sprache: Deutsch
Ein Vampir für alle Fälle
Als Mac Argeneaus Haus in Flammen aufgeht, tritt C. J. Cummings auf den Plan, die den Fall untersuchen soll. Die Agentin weckt Gefühle in Mac, die er seit Jahrhunderten nicht mehr verspürt hat. C. J. lässt der geheimnisvolle Wissenschaftler mit den silberblauen Augen ebenfalls nicht kalt. Aber auch wenn sie nichts dagegen hätte, ihn mal ohne seinen weißen Kittel - oder ohne alles - zu sehen, so hat sie doch einen Fall zu lösen. Dass Mac sie als Bodyguard engagieren will, hilft ihr auch nicht gerade dabei, sich auf ihren Job zu konzentrieren. Doch als bei einem weiteren Anschlag auch ihr Leben in Gefahr gerät, ist es Mac, der alles in Bewegung setzt, um die Frau zu beschützen, die dazu bestimmt ist, seine Gefährtin zu sein.
"Lynsay Sands erobert mit jedem Buch erneut mein Herz!" HARLEQUIN JUNKIE
Band 32 der erfolgreichen Vampirserie um die liebenswerte Argeneau-Familie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Die Autorin
Die Romane von Lynsay Sands bei LYX
Impressum
LYNSAY SANDS
Ein zauberhafter Vampir
Roman
Ins Deutsche übertragen von Ralph Sander
Zu diesem Buch
Mac Argeneau weiß nur zu gut, dass Unsterbliche nicht unverwundbar sind. Weihwasser oder Silberdolche mögen ihnen nichts anhaben, aber Feuer kann ihnen durchaus gefährlich werden. Als sein Haus in Flammen aufgeht, ist er sich daher sicher, dass dies kein Unfall war. Doch wer sollte Interesse daran haben, einen Wissenschaftler zu töten, der sich auf Blutkrankheiten spezialisiert hat? Zumindest eine gute Sache bringt der Anschlag mit sich: C. J. Cummings, die Agentin, die seinen Fall untersuchen soll, weckt Gefühle in ihm, die er seit Jahrhunderten nicht mehr verspürt hat. Auch C. J. lässt der attraktive Wissenschaftler mit den silber-blauen Augen nicht kalt. Allerdings würde sie doch gern wissen, wie er es geschafft hat, dem Inferno ohne die geringste Verbrennung zu entkommen. Er verbirgt ganz offensichtlich etwas vor ihr. Und auch wenn sie nichts dagegen hätte, ihn mal ohne seinen weißen Kittel – oder ohne alles – zu sehen, so hat sie doch einen Fall zu lösen. Dass Mac da-rauf besteht, sie als Bodyguard zu engagieren, hilft auch nicht gerade dabei, sich auf die Ermittlungen zu konzentrieren. Doch als bei einem weiteren Anschlag auch ihr Leben in Gefahr gerät, ist es Mac, der alles in Bewegung setzt, um die Frau zu beschützen, die dazu bestimmt ist, seine Gefährtin zu sein.
Prolog
Mac hatte eben erst seine Zentrifuge eingerichtet, als ihm der Geruch von Rauch in die Nase stieg. Er hob den Kopf und atmete tief durch die Nase ein. Da war der beißende Reiniger, den er für die Oberflächen benutzt hatte, außerdem diverse Chemikalien und andere Gerüche, die er auf die Schnelle nicht bestimmen konnte, und die aus den Kisten aufstiegen, die er erst noch auspacken musste. Und außerdem – ja, eindeutig – Brandgeruch.
Ein Anflug von Panik ließ Mac einen Schauer über den Rücken laufen. Wo Rauch war, da war auch Feuer, und Feuer war für seine Art nicht gut. Natürlich war Feuer auch für Sterbliche nicht gut, doch für Unsterbliche war es noch viel schlimmer, da sie äußerst leicht entflammbar waren.
Abrupt richtete er sich auf, stieg über den einen, dann über den anderen ungeöffneten Karton, um sich einen Weg durch das Labyrinth aus Kisten zu bahnen, die alle noch darauf warteten, von ihm ausgepackt zu werden. Als er die Treppe erreicht hatte, die aus dem Keller nach oben führte, eilte er die Stufen hinauf und nahm immer zwei von ihnen auf einmal, bis er die Spezialtür erreicht hatte, die er erst vor wenigen Tagen hatte einbauen lassen. Sie sollte Geräusche, Keime und alles andere davon abhalten, in das Labor einzudringen, das er in seinem Keller einrichten wollte. Auch die Wände waren versiegelt und mit einer Spezialschicht überzogen.
Offenbar waren seine Bemühungen erfolgreich gewesen, denn selbst auf der obersten Stufe war nur ein Hauch von Brandgeruch zu bemerken. Als er aber die Tür öffnete, war es so, als würde er in den Höllenschlund blicken. Die Küche gleich hinter der Tür stand in Flammen, die einem lebendigen Wesen gleich laut brüllend auf ihn zugestürzt kamen.
Ein Entsetzensschrei kam ihm über die Lippen, als heiße Luft ihn umhüllte. Hastig schlug Mac die Tür zu. Fast wäre er rücklings die Treppe hinuntergeflogen, da er nichts anderes im Sinn hatte, als dem Feuer so schnell wie möglich zu entkommen. Auf der letzten Stufe strauchelte er dann doch noch und stieß gegen einen Karton. Er hielt inne und drehte sich einmal langsam um die eigene Achse, wobei er sich vorkam wie eine Maus in einem brennenden Labyrinth auf der Suche nach einem Ausweg.
Sein Blick wanderte zu den kleinen Oberlichtern an der rückwärtigen Wand des Kellergeschosses, und er sah die Flammen, von denen die Büsche dort oben verzehrt wurden. Er machte kehrt und lief zu den vorderen Räumen. Er riss die erste Tür auf, hinter der sich ein Badezimmer mit einem noch winzigeren Oberlicht befand. Das Glas war mit einer Art Lasur überzogen, durch die alles nur verschwommen zu sehen war. Dennoch genügte es, um zu erkennen, dass dort draußen ebenfalls ein Feuer wütete.
Er rannte zur nächsten Tür und riss sie auf. Dahinter befand sich ein Raum von drei mal vier Metern Größe mit zwei Oberlichtern, die an der Rückseite des Hauses entlangliefen. Voller Verzweiflung starrte Mac auf die Flammen, die hinter den Scheiben loderten. Er saß in der Falle. Es gab keinen Weg nach draußen … und dann wurde ihm zu allem Elend auch noch bewusst, dass er keine Hilfe holen konnte. Im Keller gab es kein Telefon, das mit dem Festnetz verbunden war, und sein Handy hatte er auf dem Küchentresen liegen lassen, damit er bei seiner Arbeit hier unten nicht gestört wurde.
Ich bin erledigt, ging es Mac voller Entsetzen durch den Kopf. Doch dann sah er hinter den Flammen rote Lichter aufblitzen. Vorsichtig näherte er sich dem Fenster und versuchte zu erkennen, was da draußen vor sich ging. Ein Funke Hoffnung erwachte in ihm, als er den Feuerwehrwagen entdeckte, der ganz oben in der Auffahrt parkte. Feuerwehrleute eilten umher und holten Ausrüstung aus dem Fahrzeug. Wenn es ihm gelang, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und sie wissen zu lassen, wo er war …
Mac machte kehrt und lief zurück in den zentralen Raum, wobei er wieder durch das Meer aus Kisten watete, bis er die eine entdeckte, die er brauchte. Er riss den Deckel auf und durchwühlte den in Luftpolsterfolie verpackten Inhalt, bis er fündig wurde: sein altes und sehr schweres Mikroskop. Erleichtert nahm er es heraus und zog die Folie ab, während er zurück zum Lagerraum lief. Ohne zu zögern, ging er mit großen Schritten bis zur Mitte des Raums und schleuderte das Mikroskop auf das nächstgelegene der beiden Oberlichter. Das Glas zerbrach, und Mac machte einen Satz nach hinten, als die Flammen explosionsartig auf den Raum übergriffen, als könnten sie es nicht erwarten, nach drinnen zu gelangen. Ihnen folgte dichter Rauch, der Mac einhüllte und ihm die Luft nahm, während er um Hilfe rief.
Beim dritten Hilferuf tauchten vor dem Fenster dunkle Schatten auf. Er glaubte zwei Männer in klobiger Schutzausrüstung zu erkennen, wie sie für die Feuerwehr typisch war. Dann rief jemand: »Hallo? Ist da drinnen jemand?«
»Ja!«, antwortete Mac erleichtert. »Ich bin im Keller!«
»Wir holen Sie da raus! Halten Sie durch. Wir holen Sie raus!«
»Gehen Sie da hin, wo weniger Rauch ist«, rief ein anderer Mann.
»Okay!« Mac zog sich aus dem Zimmer zurück, beobachtete dabei aber fasziniert, wie sich das Feuer vom Fenster ausgehend ausbreitete und auf die Trockenmauer übersprang. Jetzt würde es schnell um sich greifen, da er ihm den Weg ins Innere geebnet hatte. Der Rauch war bereits überall und drang in den zentralen Raum. Doch damit konnte er klarkommen. Rauch würde ihn nicht umbringen, Feuer hingegen sehr wohl.
Fluchend wandte er sich um und kehrte in das Badezimmer gleich daneben zurück. Das war bislang von Flammen und Rauch verschont geblieben, doch das war nur eine Frage der Zeit. Er ging zu der gusseisernen Badewanne mit den Klauenfüßen, die er kurz vor seinem Einzug neu lackiert hatte, drückte den Stöpsel in den Abfluss und schickte ein Stoßgebet gen Himmel, als er die Wasserhähne aufdrehte. Erleichterung überkam ihn, als das Wasser zu laufen begann. Noch hatte das Feuer nicht dafür gesorgt, dass die Wasserversorgung unterbrochen war. Zudem waren die Hähne und Armaturen so alt, dass sie keine Mischdüse besaßen, die die Geschwindigkeit regulierte, mit der das Wasser aus dem Rohr schoss. Mit hohem Druck strömte es in die Wanne, die schnell volllief – zumindest deutlich schneller, als es in New York der Fall gewesen wäre. Da wären zehn bis fünfzehn Minuten vergangen, um die Wanne zu füllen, hier dauerte es ungefähr nur halb so lange. Dennoch waren es die längsten Minuten seines Lebens, zumal sich die Flammen durch die Wand zwischen Lagerraum und Badezimmer fraßen, noch bevor die Wanne voll war.
Mac wartete nicht länger, sondern stieg in Schlafanzughose und T-Shirt in die zu drei Viertel mit rasch heißer werdendem Wasser gefüllte Wanne und tauchte unter, bis nur noch seine Nase aus dem Wasser ragte.
Der Rauch breitete sich durch die Lüftungsschlitze nun auch im Badezimmer aus, was ihm das Atmen erschwerte. Außerdem war das Wasser höllisch heiß, da es durch die vom Feuer aufgeheizten Rohre strömte, ehe es in die Wanne laufen konnte. Es war heiß, und es wurde immer noch heißer. Die eine Wand des Badezimmers stand nun völlig in Flammen, und auch die beiden angrenzenden Wände fielen mehr und mehr dem Feuer zum Opfer. Der Linoleumboden fing Feuer und rollte sich in Richtung Wanne auf. Mac schätzte, dass das Wasser bald anfangen würde zu kochen. Mit einem Mal wurde ihm bewusst, wie sich ein Hummer fühlen musste, wenn er in einen Kochtopf geworfen wurde. Es war eine verdammt grausame Art zu sterben … Allerdings würde er nicht sterben. Solange er nicht mit den Flammen in Berührung kam, würde er das hier überleben, doch Mac vermutete, dass er sich noch wünschen würde, tot zu sein, lange bevor das hier vorüber war.
1
Der Empfangsbereich der Polizeiwache war menschenleer, als C. J. eintrat. Es wunderte sie nicht weiter, da Polizeiwachen in Kleinstädten nachts meist nur mit Minimalbesetzung arbeiteten. Auf der Theke, die sich am anderen Ende über die ganze Breite des Raums erstreckte, stand eine Klingel. Doch die musste sie letztlich nicht benutzen, denn noch bevor sie sich auf den Weg dorthin machen konnte, steckte ein älterer Mann seinen Kopf durch die Tür hinter dem Tresen und zog fragend die Augenbrauen hoch.
»C. J. Cummings?«
Sie nickte. »Captain Dupree?«
»Der bin ich«, bestätigte er ihr und fügte unüberhörbar gereizt hinzu: »Ich habe schon auf Sie gewartet.«
C. J. sah ihn verwundert an und erwiderte: »Es ist noch nicht Mitternacht. Wir hatten vereinbart, dass ich um Mitternacht herkomme, wenn Jeffersons Schicht vorbei ist.«
»Ja, das hatten wir«, räumte Dupree mürrisch ein. »Aber als wir das verabredet hatten, wusste ich noch nicht, dass irgendein Feuerteufel auf die Idee kommen würde, das Haus eines Bürgers meiner Stadt abzufackeln, während der sich noch im Haus befand. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir von Ihnen eine Nummer geben lassen, um Sie anzurufen. So habe ich jetzt hier warten müssen, bis Sie eintreffen, ehe ich mich auf den Weg zum Tatort machen kann.«
Je länger er redete, umso verdutzter schaute sie drein. Schließlich sagte sie: »Ich weiß wirklich nicht, warum Sie der Ansicht sind, hier auf mich warten zu müssen, Captain. Jefferson ist derjenige, mit dem ich reden will. Dafür ist Ihre Anwesenheit nicht erforderlich.«
»Mag sein. Aber er ist einer von meinen Leuten, also werde ich dabei sein«, erklärte er entschieden. »Aber das Ganze ist jetzt ohnehin kein Thema mehr, da Jefferson auf dem Rückweg zur Wache die Meldung von diesem Feuer mitbekommen hat. Er ist jetzt am Brandort und wartet darauf, dass wir hinfahren, um ihm Gesellschaft zu leisten.«
»Wir?«, wiederholte C. J. überrascht.
»Ja, wir.« Er nickte nachdrücklich. »Ich brauche Sie da.«
»Warum?«, fragte sie sofort.
»Sie sind Detective, nicht wahr?« Das war nicht als Frage gemeint, weshalb er auch gar nicht erst ihre Antwort abwartete, sondern weiterredete: »Sehen Sie, bevor ich Captain wurde, war ich auch Detective, aber das ist schon zwanzig Jahre her. Die Methode der Beweissicherung kann sich seitdem verändert haben. Das ist der erste Mord, der sich in Sandford ereignet, und ich will nichts verkehrt machen.«
»Bestimmt ist einer Ihrer Männer …«, begann sie, kam aber nicht weit.
»Mein einziger Detective ist letzten Monat tot umgefallen. Herzinfarkt. Ich habe noch keinen Ersatzmann eingestellt, und einer von den jüngeren Kollegen hat einen Kurs belegt, um sich mit der Arbeit eines Detective vertraut zu machen, aber er hat damit gerade erst angefangen. Also …« Er unterbrach sich und warf ihr einen unmissverständlichen Blick zu. »… habe ich mir gedacht, dass Sie mitkommen und uns sagen, was wir sicherstellen müssen und wie es verpackt werden muss. Bei der Gelegenheit können Sie dann auch Jefferson Ihre Fragen stellen.«
C. J. begann den Kopf zu schütteln, noch bevor er ausgeredet hatte. »Captain, ich bin kein Cop. Ich gehöre zur Special Investigations Unit, wir sind eine zivile Organisation. Wir ermitteln gegen Cops, sind aber keine Cops. Ich habe an einem Tatort überhaupt nichts zu suchen«, sagte sie nachdrücklich.
»Jetzt mögen Sie keine Polizistin mehr sein, aber Sie waren mal eine«, erwiderte Captain Dupree völlig unbeeindruckt.
C. J. kniff die Augen leicht zusammen, als er das sagte und gleich darauf den Beweis dafür lieferte, dass er sich ihren Werdegang sehr genau angesehen hatte. »Genau genommen haben Sie wie meine Jungs im Streifendienst angefangen. Dann sind Sie ins Morddezernat aufgestiegen und schließlich zum Canadian Security and Intelligence Service gegangen, auch CSIS genannt. Wie ich gehört habe, waren Sie dort eine der besten Detectives und konnten jede Menge Erfolge verbuchen, ehe Sie zur SIU gewechselt sind.«
Er verkniff sich zwar den Zusatz »und zur Verräterin an unseren Jungs in Uniform wurden«, doch sie konnte es aus seinem Tonfall deutlich heraushören. Wenn man in Polizeikreisen wegen Korruption und anderer krimineller Delikte ermittelte, machte man sich damit nicht viele Freunde. Jedenfalls nicht in ebenjenen Polizeikreisen. Die meisten Cops sahen in C. J. und den Leuten, mit denen sie zusammenarbeitete, Verräter, die gegen ihre Kollegen agierten. Was ihr Ansehen bei der Polizei anging, bewegten sich die Mitarbeiter der SIU höchstens eine Stufe über dem Ruf von Nichtsnutzen. Oder vielleicht sogar eine Stufe darunter.
C. J. kümmerte das nicht sonderlich. Anfangs hatte sie sich daran gestört, mittlerweile war sie daran gewöhnt und sagte sich, dass sie eine wichtige Arbeit leistete. Ihrer Meinung nach war ein guter Cop Gold wert, aber in jedem Beruf gab es schwarze Schafe, und ein mieser Cop konnte mehr Schaden anrichten als jeder durchschnittliche Verbrecher.
Sie bereute nicht, was sie tat, und sie hatte auch kein schlechtes Gewissen.
»Also?«, fuhr Dupree sie an. »Werden Sie uns hier helfen oder nicht? Falls nicht, müssen wir warten, bis ein Detective der Ontario Provincial Police herkommt. Aber das kann Tage dauern, und Beweise neigen nun mal dazu, sich in Luft aufzulösen oder platt getreten zu werden, wenn sie nicht beizeiten gesichert werden.«
C. J. wusste, dass ein Großteil der Beweise bei Bränden bereits unweigerlich zerstört wurde, wenn die Feuerwehrleute den Brand löschten. Aber es war dennoch immer sinnvoll, so schnell wie möglich das sicherzustellen, was den Flammen nicht zum Opfer gefallen war.
»Natürlich werde ich helfen«, antwortete sie letztlich. »Aber ich kann keine Beweise einsammeln und eintüten. Das würde sich auf die Dokumentation Ihrer Beweiskette auswirken.«
»Das müssen Sie auch gar nicht. Sagen Sie einfach Jefferson, was er tun soll«, versicherte er ihr. Die Verkrampfung seiner Schultern ließ ein wenig nach, nachdem sie ihr Einverständnis erklärt hatte. Sofort kam er um den Tresen herum und gab ihr einen Zettel mit der Adresse darauf.
»Da hat es gebrannt. Nehmen Sie Ihren eigenen Wagen, dann müssen Sie anschließend nicht warten, bis einer von uns zur Wache zurückfährt. Sie haben ein Navi?«
C. J. nickte, während sie die Adresse betrachtete.
»Gut, dann werde ich …«
»Captain!«
Der Ruf, der irgendwo aus dem hinteren Teil des Gebäudes kam, löste bei Captain Dupree Verärgerung aus, wie man seiner gereizten Miene unschwer entnehmen konnte. »Fahren Sie schon mal vor«, sagte er, als er eilig hinter den Tresen zurückkehrte. »Ich komme mit meinem Streifenwagen hinterher.«
Er wartete nicht ihre Erwiderung ab, sondern lief durch die Tür nach hinten und war schon nicht mehr zu sehen, als der Ruf nach ihm ein zweites Mal ertönte.
C. J. faltete den Zettel zusammen und ging nach draußen zu ihrem Wagen. So hätten ihre Ermittlungen eigentlich nicht verlaufen sollen, doch das störte sie nicht. Solche Ermittlungen verliefen selten genau nach Plan. Gleiches galt auch für das Leben als Ganzes, und sie hatte gelernt, das Leben so zu nehmen, wie es kam. Dennoch war die Verstrickung in polizeiliche Untersuchungen eines Brandes einigermaßen unerwartet und darüber hinaus nichts, worauf sie erpicht war, da es um ein »Grillhähnchen« ging. Sie zog die Nase kraus, als ihr diese Bezeichnung in den Sinn kam, die sie früher bei der Polizei verwendet hatten, wenn eine verkohlte Leiche im Spiel war. Überhaupt gab es eine Menge Spitznamen für die Opfer von Verbrechen. Zivilpersonen hätten sie größtenteils als herz- und geschmacklos empfunden, aber wenn man sich tagtäglich mit den Grausamkeiten befassen musste, die Menschen anderen Menschen antaten, dann musste man eine Methode finden, gefühlsmäßig auf Distanz zu gehen, wenn man nicht selbst daran zerbrechen wollte. Spitznamen waren da nur eine Methode.
Sandford war mit seinen zwölftausend Einwohnern eine recht kleine Stadt. Manchen mochte das gar nicht so klein erscheinen, gab es doch schließlich Städte, die noch viel kleiner waren. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass Sandford ein eigenes Police Department hatte, waren zwölftausend Einwohner relativ wenig. Die meisten Städte dieser Größenordnung in Ontario waren dazu übergegangen, die Kosten für ein eigenes Department einzusparen und stattdessen die Ontario Provincial Police mit dieser Aufgabe zu betrauen. In Sandford hatte man bislang davon abgesehen. Aber auch wenn die Stadt nicht über allzu viele Einwohner verfügte, war sie flächenmäßig weitaus größer, was den Farmbetrieben im Einzugsgebiet geschuldet war.
Daher brauchte C. J. auch fast zwanzig Minuten, ehe sie die Adresse erreicht hatte, die der Chief ihr gegeben hatte. Das Anwesen lag am Rand einer Landstraße, die zu beiden Seiten von weiten Feldern und vereinzelten Farmhäusern gesäumt wurde.
C. J. konnte das Haus schon sehen, als sie noch ein gutes Stück davon entfernt war. Oder besser gesagt, sie konnte die Flammen sehen, die dort wüteten. Das Gebäude war ein alter, aus Ziegelsteinen erbauter Bauernhof, der nach wie vor lichterloh brannte, obwohl die mit zwei Feuerwehrwagen angerückten Einsatzkräfte tapfer gegen die Flammen ankämpften. C. J. parkte ihren Wagen hinter der langen Reihe aus Pick-ups – vermutlich die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr –, die auf dem grasbewachsenen Seitenstreifen der langen Zufahrt abgestellt worden waren. Dann begab sie sich zu dem Gewirr aus Menschen, die sich rund um das Feuer tummelten. Sie hatte gut die Hälfte des Weges zurückgelegt, als sie die Sirene eines Rettungswagens hörte, der ihr vom Haus entgegenkam. C. J. musste auf den Rasen ausweichen, damit der Wagen vorbeifahren konnte, und ging dann zielstrebig auf den einzigen Mann zu, der eine Polizeiuniform trug.
Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Sie waren es, die Mac aufwachen ließen. Jede Faser seines Körpers tat höllisch weh, vom Kopf bis zu den Zehenspitzen. Jeder Quadratzentimeter Haut fühlte sich an, als würde er in Flammen stehen. Ein gequälter Schrei bahnte sich an, blieb ihm aber in der Kehle stecken, als er von Stimmen abgelenkt wurde, die den Nebel aus Schmerzen durchdrangen, der ihn umhüllte.
»Mein Gott.«
»Was ist, Sylvie? Ist er tot? Soll ich die Sirene ausschalten?«
»Nein, Artie, er lebt noch. Aber … aber, na ja, seine Wunden verheilen.«
»Wie?«, fragte Artie. »Was soll das heißen, seine Wunden verheilen?«
»Na, sie verheilen eben«, gab Sylvie mit einem fast erschrockenen Unterton zurück. »Die Brandblasen sind … du musst dir das ansehen, Artie. Das ist nicht normal. Fahr rechts ran und …«
Die Frau verstummte, als es Mac endlich gelang, die Augen aufzumachen.
»Die Augen«, flüsterte sie erstaunt, während der Wagen langsamer wurde. »Sie sind silbern.«
»Was hast du gesagt?«, fragte Artie, der vorn saß und das Fahrzeug lenkte, das Mac jetzt als Rettungswagen identifizierte. Die Uniform, die die Frau trug, und die Trage, auf der er lag, ließen keinen Zweifel daran.
Es bedeutete, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus war. Mac wusste, dass es dazu nicht kommen durfte. Er setzte sich auf, drückte seine Fangzähne in den Hals der Sanitäterin und begann zu trinken.
»Ich würde sagen, damit hätten wir’s«, merkte C. J. an, während der Officer die Zigarettenkippen aufhob, die sie entdeckt hatten. Vor über einer Stunde hatten sie ihre Suche nach Beweismaterial begonnen und sich Abschnitt für Abschnitt vom äußersten Rand des Grundstücks nach innen vorgearbeitet. Zum Glück war das Feuer zu dem Zeitpunkt, als sie den unmittelbar um das Haus herum gelegenen Bereich erreichten, bereits völlig gelöscht, sodass sich die Feuerwehrleute nur noch auf das Innenleben des Gebäudes konzentrierten.
»Ja, ich denke auch, dass wir hier draußen alles abgesucht haben«, stimmte Officer Simpson ihr zu und richtete sich auf, während er den Spurensicherungsbeutel verschloss.
C. J. nickte nachdenklich, ihre Aufmerksamkeit war ganz auf das Farmhaus gerichtet. Drinnen konnten sie sich noch nicht umsehen, doch sie bezweifelte, dass das überhaupt nötig sein würde. Benzin war als Brandbeschleuniger eingesetzt worden, was sie schon auf dem Weg zum Haus gerochen hatte. Der Geruch war genauso verräterisch wie die Überreste der drei leeren Benzinkanister, die sie in unmittelbarer Nähe des Feuers entdeckt hatten. Zwei Kanister waren zu Klumpen geschmolzen, der dritte war aber nur teilweise ein Raub der Flammen geworden. Der Griff und der Verschluss waren unversehrt geblieben. Es konnte sich als Glücksfund erweisen, sofern der Brandstifter keine Handschuhe getragen hatte. Auch die Zigaretten konnten von Nutzen sein, falls sie vom Brandstifter stammten. Es würden sich vielleicht DNS-Spuren an ihnen finden lassen.
»Und jetzt?«, fragte Simpson.
C. J. drehte sich zu Officer Simpson um. Nicht Jefferson, sondern Simpson. Officer Jefferson hatte den Ort des Geschehens zehn Minuten vor ihrem Eintreffen verlassen. Simpson hatte es ihr gesagt, nachdem er sich vorgestellt hatte, und erklärt, dass Jefferson wegen eines Einsatzes in Downtown zurückbeordert worden war. C. J. vermutete, dass der Einsatz etwas mit den aufgeregten Rufen auf der Wache zu tun hatte, die dem Captain gegolten hatten. Eine andere Erklärung dafür gab es nicht, da er entgegen seiner Ankündigung bislang nicht nachgekommen war.
»Ich glaube, das war’s für heute Nacht«, sagte C. J. und wunderte sich nicht über die Erleichterung, die Simpson sich bei diesen Worten anmerken ließ. Es war fast zwei Uhr in der Nacht, und sie vermutete, dass der junge Mann in der gleichen Schicht eingeteilt war wie Jefferson, was bedeutete, dass er schon um Mitternacht Feierabend hätte machen sollen. Er konnte es vermutlich kaum erwarten, nach Hause zu kommen und ins Bett zu gehen.
»Werden wir uns auch im Haus umsehen müssen?«
C. J. betrachtete die verkohlten Überreste dessen, was einmal ein bezauberndes Farmhaus aus der viktorianischen Zeit gewesen war. Das Feuer war gelöscht, trotzdem ließen ein paar Feuerwehrleute nach wie vor Wasser auf die rauchende Ruine herabregnen, um sicherzustellen, dass nicht irgendwelche Glutnester später erneut aufflammten. Sie wusste aus Erfahrung, dass mindestens für die nächsten ein, zwei Tage niemand das Haus würde betreten dürfen. Erst musste ein Gutachter vom Bauamt sich dort umsehen, um festzustellen, ob das Gebäude sicher war und nirgends der Fußboden unter einem nachgab. Vorausgesetzt, von den Holzböden ist überhaupt noch etwas übrig, überlegte sie, erwiderte dann aber: »Heute Nacht auf keinen Fall. Vielleicht in ein oder zwei Tagen … falls es überhaupt notwendig ist«, fügte sie an. »Ich glaube nicht, dass der Brandstifter sich die Mühe gemacht hat, drinnen auch noch Feuer zu legen. Für mich sieht es so aus, als hätte er nur auf der vorderen und der hinteren Veranda und auf den Büschen rund ums Haus Benzin ausgeschüttet und angezündet.«
»Ja, danach sieht es aus«, meinte auch Simpson, der das Haus genauso nachdenklich betrachtete wie sie.
»Falls nötig, können wir uns in ein paar Tagen hier umsehen, sobald der Chef der Feuerwehr grünes Licht gibt«, sagte sie. »Wird der Leichnam hier in der Stadt untersucht, oder ist dafür irgendeine andere Gerichtsmedizin zuständig?«
»Der Leichnam?«, fragte Simpson und drehte sich irritiert zu ihr um.
»Captain Dupree sprach davon, dass sich der Eigentümer noch im Haus befand, als das Feuer ausbrach, und dass das der erste Mord ist, der hier in der Stadt begangen wurde«, führte sie aus.
»Oh.« Simpson nickte, sein Blick wanderte zu den Wagen, die in der Auffahrt parkten. »Ja, der Mann, der hier wohnt, saß im Keller in der Falle, bis es den Feuerwehrleuten gelang, die Flammen so weit einzudämmen, dass sie durch eines der Kellerfenster einsteigen und ihn rausschaffen konnten. Soweit ich weiß, haben sie ihn unten in einer Badewanne entdeckt. Er muss das Wasser eingelassen haben und ist dann untergetaucht.« Er verzog den Mund und fuhr fort: »Sie haben gesagt, dass das Wasser bereits gekocht hat, als sie zu ihm vorgedrungen waren. Er hat noch gelebt, aber nur noch so gerade eben. Gesehen habe ich ihn nicht, als sie ihn rausbrachten. Aber Jefferson sagte, dass er so rot war wie ein Hummer, von oben bis unten mit blutenden Brandblasen übersät.« Er schüttelte sich, als er das sagte. »Sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht, unmittelbar bevor Sie hier eingetroffen sind. Die Sanitäter glauben aber, dass er die Fahrt gar nicht erst überleben wird.«
»Ja, den Rettungswagen habe ich wegfahren sehen«, murmelte C. J. und überlegte, in welcher Verfassung sich der Mann befunden haben musste. Bei lebendigem Leib gekocht zu werden, hörte sich für sie kein bisschen angenehmer an, als bei lebendigem Leib zu verbrennen.
»Mich wundert nur, dass sie zurückgekommen sind«, sagte Simpson plötzlich.
Erstaunt folgte C. J. seinem Blick dorthin, wo ein Rettungswagen gleich neben den Löschfahrzeugen auf dem Rasen stand. Er war ein Stück weit entfernt, trotzdem konnte sie erkennen, dass die Hecktüren des Wagens offen standen und sich mehrere Leute um die Trage drängten.
»Meinen Sie, einer der Feuerwehrleute ist verletzt worden?«, fragte Simpson besorgt.
»Entweder das, oder sie haben noch jemanden aus dem Haus geborgen«, überlegte C. J. und setzte sich in Richtung der Fahrzeuge in Bewegung. Simpson wich nicht von ihrer Seite.
Mehrere Feuerwehrleute und eine Rettungssanitäterin standen am Rand des Weges. Es wunderte C. J. nicht, dass Simpson auf die Gruppe zuging, anstatt ihr weiter zum Rettungswagen zu folgen. Sie ging davon aus, dass er sich bei seinen Kollegen erkundigen wollte, anstatt den Rettungssanitätern im Weg zu stehen. Also schloss sie sich ihm an, doch dann auf einmal blieb er kurz stehen und machte den Mund auf, als wollte er sie etwas fragen. Dann aber presste er abrupt die Lippen zusammen und nahm erneut Kurs auf den Rettungswagen.
Überrascht schaute sie ihm hinterher und folgte ihm schließlich. Als er dann aber in den Wagen einsteigen wollte, in dem ein Sanitäter und ein Feuerwehrmann über denjenigen gebeugt standen, der auf der Trage saß, fasste sie Simpson am Arm und zog ihn zurück.
»Die beiden versorgen den Mann! Warten Sie hier und lassen sie sie ihre Arbeit machen«, ermahnte sie ihn, als er sie mit leerem Blick ansah.
Officer Simpson erwiderte nichts, und er zeigte auch keinerlei Reaktion, wie ihr auffiel. C. J. wollte ihn fragen, ob mit ihm alles in Ordnung sei, als sie durch eine Bewegung im Rettungswagen abgelenkt wurde. Der Feuerwehrmann hatte sich aufgerichtet, so weit ihm das möglich war, und kam zur Tür, dicht gefolgt von dem Sanitäter.
»Haben Sie da ein zweites Opfer aus dem Haus? Oder ist einer von ihren Leuten beim Löschen verletzt worden?«, erkundigte sich C. J., als der Feuerwehrmann aus dem Rettungswagen kletterte. Zu ihrem großen Erstaunen reagierte der Mann nicht auf ihre Frage. Mit seltsam leerem Gesichtsausdruck ging er an ihr vorbei, ohne auch nur einmal in ihre Richtung zu blicken, und stellte sich zu der Gruppe ein paar Meter hinter ihr.
»Ich war das einzige Opfer.«
C. J. löste ihren überraschten Blick von dem unhöflichen Feuerwehrmann und sah wieder zum Rettungswagen, von wo die Stimme gekommen war. Den Sprecher konnte sie zunächst nicht sehen, da der Sanitäter aus dem Wagen stieg und mit seinem Körper die Sicht versperrte. Als er draußen war und dem Feuerwehrmann folgte, konnte sie einen ersten Blick auf den Mann im Wagen werfen. Die schlechte Beleuchtung im Inneren sorgte dafür, dass sie nicht allzu viel erkennen konnte. Auf jeden Fall war er ein muskulöser Mann mit breiten Schultern, und wahrscheinlich war er auch recht groß, was sie hätte sehen können, wenn es ihm möglich gewesen wäre, sich gerade aufzurichten. Die Haare waren kurz und dunkel, die Haut hingegen war sehr hell, wirkte aber in der schwachen Beleuchtung fleckig. Das konnte allerdings am Schattenwurf im Rettungswagen liegen, überlegte sie und fragte: »Entschuldigung, aber haben Sie gesagt, dass Sie das einzige Opfer waren?«
Der Mann schwieg so lange, dass sie bereits glaubte, von ihm keine Antwort mehr zu bekommen, doch dann endlich sagte er: »Ja. Ich lebe hier allein. Davon gehe ich jedenfalls aus. So, wie es aussieht, muss ich mir jetzt was Neues suchen.«
»Wen hat man dann mit dem ersten Rettungswagen weggebracht?«, fragte C. J. verwirrt.
»Mit dem ersten Rettungswagen?« Sein Tonfall klang scharf und hatte etwas Besorgtes an sich.
»Als ich hier ankam, fuhr ein Rettungswagen weg«, erklärte sie.
»Ah«, sagte er, als es ihm dämmerte. »Sie müssen hier eingetroffen sein, als die mich ins Krankenhaus fahren wollten. Zum Glück habe ich noch rechtzeitig das Bewusstsein wiedererlangt und konnte sie davon überzeugen, dass mit mir alles in Ordnung ist. Daraufhin sind sie umgekehrt und haben mich zurückgebracht.«
C. J. zog irritiert die Augenbrauen hoch. »Mir wurde gesagt, dass Sie beim Eintreffen der Feuerwehr in einer Wanne mit kochendem Wasser gelegen hätten. Officer Jefferson hat zu Simpson gesagt, dass Sie so rot wie ein Hummer und mit großen Brandblasen übersät waren. Man ging nicht davon aus, dass Sie überleben würden.«
»Wo ist dieser Jefferson?«, wollte der Mann prompt wissen.
»Der ist abgefahren, noch bevor ich hier eingetroffen bin«, antwortete C. J..
Der Mann schnalzte verärgert mit der Zunge und sagte schließlich: »Tja, es ist ja offensichtlich, dass sich dieser Officer Jefferson geirrt hat, nicht wahr? Vielleicht waren seine Augen auch nur durch die vielen blinkenden Lichter irritiert gewesen. Jedenfalls kann ich Ihnen versichern, dass es mir gut geht.«
C. J. reagierte zunächst nicht auf seine Worte. Zwar klang er ganz so, als würde es ihm gut gehen, doch sie konnte ihn nicht deutlich genug sehen, um mit Gewissheit sagen zu können, dass es auch so war. Die Innenbeleuchtung im Rettungswagen war mit Sicherheit zuvor eingeschaltet gewesen, nur war jetzt alles dunkel. Vermutlich hatten sie sie ausgemacht, als klar geworden war, dass sie ihn gar nicht versorgen mussten, wenn er tatsächlich nicht verletzt war. Aber was hatten dann die Männer im Rettungswagen gemacht, die bei ihm gewesen waren, als sie und Simpson dazugekommen waren? Und warum hatten sie ihn nicht ins Krankenhaus gebracht? Er sprach davon, dass er das Bewusstsein wiedererlangt hatte, bevor sie die Stadt erreicht hatten. Etwas musste bewirkt haben, dass er das Bewusstsein überhaupt erst verloren hatte. Vermutlich hatte er Rauch eingeatmet, überlegte sie. Aber in dem Fall hätten sie ihn unbedingt ins Krankenhaus bringen müssen, um ihn zu untersuchen. Der Mann wäre beinahe bei lebendigem Leib verbrannt oder in einer Wanne voll mit kochendem Wasser umgekommen, doch anstatt sich ins Krankenhaus bringen zu lassen, hatte er die Sanitäter dazu überredet, ihn zu seinem brennenden Haus zurückzubringen? »Mr …«
»Argeneau«, antwortete er auf ihre unmissverständliche Pause.
»Mr Argeneau«, begann sie von Neuem. »Sie sollten wirklich besser ins Krankenhaus gehen. Sie hatten ein traumatisches Erlebnis, Sie könnten unter Schock stehen oder eine Rauchvergiftung haben. Dann sollten Sie behandelt werden.«
»Man hat mir hier im Wagen Sauerstoff gegeben«, erklärte er. »Es geht mir gut.«
»Eine Rauchvergiftung ist eine ernste Angelegenheit, Sir«, sagte sie mit Nachdruck. »Da bekommt man nicht einfach mal ein bisschen Sauerstoff, und dann ist gut. Da gibt man Ihnen angefeuchteten Sauerstoff … manchmal kommen auch noch ein Saugrohr und ein Endotrachealtubus zum Einsatz und …«
»Ich brauche nichts davon«, unterbrach er sie.
»Das können Sie nicht wissen«, gab sie zurück und erklärte in ernstem Tonfall: »Sie hätten Ihre Lungen überprüfen lassen sollen. Sie mögen ja glauben, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist, aber Ihre Lungen oder Ihre Kehle können Verbrennungen erlitten haben. Wenn das der Fall ist, können Sie Bronchospasmen bekommen oder eine Lungenentzündung, die Lunge schwillt an, Wasser lagert sich ab und behindert Ihre Atmung, was unter Umständen zu Hirnschäden wenn nicht gar zum Tod führen kann.«
Anstatt erschrocken auf diese möglichen Folgen zu reagieren, hatte sie den Eindruck, dass er flüchtig lächelte, so als fände er ihre Sorge um sein Wohl amüsant. »Dann sind Sie also Ärztin?«, fragte er schließlich.
»Nein«, gab sie gereizt zurück. »Ich gehöre zur SIU.«
»Ah, eine Polizistin«, sagte er und nickte.
»Nein«, stellte sie sofort richtig. »Ich gehöre nicht zur Polizei.«
»Steht SIU nicht für Special Investigations Unit?«, fragte er erstaunt. »In den Fernsehserien, die ich mir ansehe, wird das immer als Teil der Polizeistreitkräfte dargestellt.«
»Das mag anderswo auf der Welt auch so sein, aber hier in Kanada sind wir eine von Zivilisten geführte Organisation, die gegen die Polizei ermittelt«, sagte sie in förmlichem Tonfall. »Ich bin keine Polizistin mehr, ich helfe heute Nacht nur aus, weil das örtliche Police Department vor Kurzem seinen einzigen Detective verloren hat und ich mich auf dem Gebiet auskenne.«
»Ah.« Der Mann nickte, nahm die Beine von der Trage und stand auf, soweit ihm das in dem engen Rettungswagen möglich war. Dann stieg er aus, kam zu ihr und blieb vor ihr stehen. Der Mann war gut fünfzehn Zentimeter größer als sie, und sie war schon eins achtzig. Aus einiger Entfernung waren ihr seine Schultern schon breit vorgekommen, aber jetzt erst sah sie, dass sie breit genug waren, um die ganze Welt hinter seinem Rücken verschwinden zu lassen.
Genau genommen stand der Mann nun unangenehm dicht vor ihr, sodass sie den Kopf ein wenig in den Nacken legen musste.
Ganz offenbar hatte er kein Gefühl dafür, wann er anderen Menschen zu nah kam, ging es C. J. durch den Kopf. Sie warf ihm einen finsteren Blick zu, machte aber keinen Schritt nach hinten, obwohl sie eigentlich das Bedürfnis verspürte. Aber sie war nun mal niemand, der vor einer Herausforderung zurückschreckte, denn genau danach fühlte es sich an – als würde er versuchen, sie einzuschüchtern.
»Sie riechen gut«, sagte er unvermittelt und verzog den Mund zu einem Lächeln.
C. J. versteifte sich bei dieser aus heiterem Himmel kommenden Bemerkung. »Und Sie riechen nach Rauch, der sehr wahrscheinlich bis in Ihre Lunge vorgedrungen ist. Jetzt steigen Sie wieder in den Rettungswagen, damit die Sanitäter Sie ins Krankenhaus fahren können.«
»Meine Lunge ist in Ordnung«, versicherte er ihr amüsiert.
Verärgert über sein ignorantes Verhalten hielt sie ihm seine eigene Frage vor: »Dann sind Sie also Arzt?«
»Ja.«
C. J. zwinkerte irritiert. Ihre Verärgerung verpuffte prompt, und sie konnte nur krächzend fragen: »Tatsächlich?«
»Ja«, wiederholte er und grinste sie breit an. »Darum kann ich versichern, dass es mir tatsächlich gut geht.«
»Aber das Feuer …«
»Rauch steigt immer nach oben«, unterband er den Einspruch, zu dem sie angesetzt hatte. »Dummerweise hatte ich im Keller gearbeitet, als das Feuer ausbrach, darum habe ich das Problem erst bemerkt, als vom Erdgeschoss aufwärts alles bereits komplett in Flammen stand und ich da unten in der Falle saß. Ich ließ die Feuerwehrleute wissen, dass ich da unten war, dann suchte ich im Badezimmer Schutz, ließ kaltes Wasser in die Wanne ein und tauchte unter, bis die Feuerwehr mich retten konnte.«
Er hielt kurz inne, dann wiederholte er: »Wie gesagt, Rauch steigt nach oben, und ich war in der alten Wanne so weit unten in meinem Haus, wie es nur ging. Also habe ich im schlimmsten Fall ein klein wenig Rauch eingeatmet. Meine Lunge ist in Ordnung.«
C. J. presste die Lippen zusammen, als sie das hörte, und drehte sich zu Simpson um, was unter anderem auch dem Zweck diente, diesen Mann nicht unentwegt so dicht vor sich zu haben. Es war gelogen gewesen, als sie gesagt hatte, er würde nach Rauch riechen. Das stimmte gar nicht. Vielmehr roch er richtig gut nach einer Mischung aus Gewürzen und Wald. Es war ein intensives Aroma, das ihr Denkvermögen durcheinanderbrachte, daher war sie dankbar dafür, dass sie einen Moment lang saubere, wenngleich von Brandgeruch durchsetzte Nachtluft einatmen konnte, die sein Aroma wegspülte.
Es gefiel ihr gar nicht, dass Simpson sich von ihr entfernt und sich stattdessen zu dem Kreis aus Feuerwehrleuten und Sanitätern gesellt hatte. Seine Anwesenheit hätte ein nützlicher Puffer zwischen ihr und diesem Mann sein können. Doch davon ganz abgesehen war Simpson der zuständige Polizist in diesem Fall, und daher sollte er es sein, der dem Mann Fragen zum Geschehen stellte. Offenbar war ihm das gar nicht in den Sinn gekommen, was bei ihr die Frage aufwarf, wie lange er wohl erst im Dienst war.
»Simpson«, rief sie aufgebracht.
Der Polizist drehte sich zu ihr um und sah sie mit ausdrucksloser Miene an, dann verließ er die Gruppe und kam zu ihr. Als er einfach nur teilnahmslos neben ihr stand, fragte sie giftig: »Gibt es nichts, was Sie Mr Argeneau fragen wollen?«
»Nein«, antwortete er tonlos.
C. J. sah den jungen Officer fassungslos an, dann schüttelte sie den Kopf und zog den kleinen Notizblock und den Stift aus seiner Hemdtasche. Sie blätterte bis zur ersten unbeschriebenen Seite. »Würden Sie mir Ihren vollen Namen nennen, Mr Argeneau?«
»Macon Argeneau«, sagte er unbekümmert. »Aber meine Freunde nennen mich Mac.«
C. J. notierte Macon (Mac) Argeneau. »Kein zweiter Vorname?«
»Nein.«
Sie nickte. »Geburtsdatum?«
»Einundzwanzigster Juni«, antwortete er.
»Und das Jahr?«, fragte sie, während sie das Datum mitschrieb. Als er zögerte, hob sie den Kopf und zog die Augenbrauen hoch. »Das Jahr?«, wiederholte sie.
»Sagen Sie mir Ihres, dann sage ich Ihnen meins«, sagte er kokett. Als C. J. ihn von seinem Scherz völlig unbeeindruckt ansah, seufzte er und erwiderte in einem fragenden Tonfall: »1985?«
Es kam ihr so vor, als wollte er herausfinden, ob sie ihm das abnahm. Sie tat es nicht, da er wie fünfundzwanzig aussah, seiner eigenen Angabe zufolge aber sechsunddreißig sein müsste. Sie sagte jedoch nichts dazu, sondern zog nur wieder eine Augenbraue hoch und fragte: »Ist das eine Frage oder Ihr Geburtsjahr?«
»Mein Geburtsjahr«, sagte er.
C. J. nickte und notierte es, setzte aber ein Fragezeichen dahinter. Sie vermutete, dass er log, was sein Alter anging, was bei ihr sofort die Alarmglocken auslöste. Jemand hatte sein Haus in Brand gesteckt, und er tischte ihr eine Lüge auf, was sein Alter betraf? Stimmte sein Name überhaupt? Sie hätte ihn nach seinem Ausweis gefragt, aber da er in Schlafanzughose und T-Shirt vor ihr stand und sein Haus soeben mit allem Hab und Gut ein Raub der Flammen geworden war, bezweifelte sie, dass er sich in irgendeiner Weise legitimieren konnte. Sie würde seine Angaben überprüfen, wenn sie zurück auf der Polizeiwache war. Dann wandte sie sich der nächsten Frage zu. »Wo arbeiten Sie?«
»Von zu Hause aus«, antwortete er prompt.
C. J. sah ihn an, der Stift schwebte dicht über dem Notizblock, aber sie schrieb nichts hin. »Sie haben doch gesagt, dass Sie Arzt sind.«
»Ja.« Er nickte.
»Und Sie arbeiten von zu Hause aus?«, hakte sie skeptisch nach.
»Ich habe als praktischer Arzt angefangen, aber dann bin ich zur Universität zurückgekehrt und habe mich auf Hämatologie spezialisiert. Inzwischen forsche ich in meinem Labor an Blut.«
»Von zu Hause aus?«, wiederholte sie noch skeptischer. Das kam ihr noch unwahrscheinlicher vor als eine Arztpraxis im eigenen Haus.
Mac zuckte mit den Schultern. »Ich forsche lieber zu Hause. Zum Glück ist das Unternehmen, für das ich arbeite, damit einverstanden.«
»Und welches ist das?«, wollte C. J. wissen, präzisierte aber sofort ihre Frage: »Das Unternehmen, für das Sie arbeiten?«
»Argentis Inc.«
C. J. notierte den Namen und setzte ein Fragezeichen dahinter. Den Namen hatte sie noch nie gehört. Den würde sie später auch recherchieren müssen. Vielleicht hatte sie ja Glück, und es gab im Internet eine Liste aller Mitarbeiter. Manche Unternehmen machten das, und in einigen Fällen gab es sogar Fotos zu den Namen. Allerdings galt das meistens nur für die Leute in Führungspositionen, und es war eher zweifelhaft, dass Argeneau eine solche Position innehatte, wenn er von zu Hause aus arbeitete.
Sie hob den Kopf und betrachtete ihn mit ernster Miene, schließlich sagte sie: »Sie sprachen davon, dass Sie im Keller gearbeitet haben, als Ihnen der Brandgeruch auffiel. Das heißt, Sie haben mit Blut gearbeitet?«
»Nein. Ich habe Kartons ausgepackt, um mein Labor einzurichten«, stellte er klar und fügte hinzu: »Ich bin erst gestern eingezogen.«
C. J. wollte das notieren, hielt dann aber inne und musste erst einmal die Tatsache verarbeiten, dass sein Haus unmittelbar nach seinem Einzug einem Brandstifter zum Opfer gefallen war. Sie räusperte sich und sagte: »Wir haben jetzt zwei Uhr am Samstagmorgen. Wenn Sie von gestern reden, meinen Sie dann, wir hätten noch Freitagabend, womit Sie am Donnerstag eingezogen wären? Oder wollen Sie damit sagen, dass Sie am Freitag eingezogen sind?«
»Ich bin am Donnerstagabend um elf Uhr hier angekommen. Die Möbelpacker trafen zehn Minuten nach mir ein und haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Gegen halb zehn oder zehn am Freitagmorgen waren sie fertig«, erklärte er bis ins kleinste Detail.
C. J. betrachtete das Haus, das nicht allzu groß war. Sie schätzte es auf drei Schlafzimmer, was bedeutete, dass ein Einzug überschlagsweise zwischen fünf und sieben Stunden dauerte, aber nicht elf Stunden, wie er es darstellte. Aber falls er für sein Labor viel Ausrüstung brauchte, konnte es sein, dass es etwas länger dauerte.
»Das Umzugsunternehmen bietet einen Rundumservice an«, fügte Mac hinzu, da er offenbar ahnte, in welche Richtung sich ihre Überlegungen bewegten. »Es waren sechs Leute, die alles aufgebaut und dort hingestellt haben, wo ich es haben wollte. Sie haben auch die Betten zusammengebaut und sogar bezogen sowie alle Bücher in die Regale geräumt«, sagte er. »Sie hätten auch noch mein Labor aufgebaut, wenn ich das gewollt hätte. Aber das habe ich dann lieber selbst übernommen, und genau damit war ich auch beschäftigt, als das Feuer ausbrach.«
C. J. nickte, fragte aber nach dem Namen des Umzugsunternehmens. Sie wollte einfach alles überprüfen, was dieser Mann ihr erzählte.
»Das Unternehmen wurde von Argentis Inc. beauftragt«, antwortete er leicht nachdenklich und zuckte bedauernd mit den Schultern. »Sie werden da nachfragen müssen, um den Namen zu erfahren.«
Sie ließ sich nichts anmerken, als sie das notierte. Wenn er wollte, dass sie in seiner Firma nachfragte, dann sagte er wahrscheinlich doch die Wahrheit. Es überraschte sie, da sie hätte schwören können, dass das nicht der Fall war. Normalerweise hatte sie ein ziemlich gutes Gespür für so was. Deshalb war sie als Detective auch so erfolgreich gewesen. Ihr damaliger Partner hatte außerdem immer gesagt, dass sie einen unglaublich sensiblen Sensor besaß, der sofort meldete, wenn irgendetwas nicht stimmte oder wenn jemand sie anlog. Normalerweise konnte sie sich darauf verlassen, doch dieser Kerl brachte sie völlig aus dem Konzept.
C. J. überflog ihre Notizen, warf einen kurzen Blick zum Haus und wandte sich erneut an Mac. »Sie sind also von Donnerstagabend bis Freitagmorgen eingezogen und haben gestern Abend beziehungsweise heute Nacht im Keller gearbeitet, um Ihr Labor einzurichten. Und da haben Sie Brandgeruch wahrgenommen und erkannt, dass das Haus in Flammen stand?«
Mac nickte.
»Haben Sie vor dem Brandgeruch irgendwelche Geräusche wahrgenommen?«, fragte sie. »Jemand, der sich draußen oder im Haus herumtrieb?«
»Nein«, antwortete er und schüttelte entschieden den Kopf. »Von draußen war kein Laut zu hören, und im Haus war auch niemand.«
»Was macht Sie so sicher?«
»Es ist ein altes Haus. Der Boden im Erdgeschoss ist aus Hartholz und knarrt wie verrückt, wenn jemand darüber geht. Das ist mir aufgefallen, als ich den Möbelpackern gesagt habe, wo sie die Kartons im Keller hinstellen sollen. Von da unten habe ich jeden Schritt gehört, den die Möbelpacker oben gemacht haben. Ich konnte sogar hören, wie sie auf der Treppe in den ersten Stock auf und ab gingen.« Wieder schüttelte er den Kopf. »Derjenige, der das Feuer gelegt hat, kann das nur draußen gemacht haben. Er ist auf keinen Fall ins Haus gekommen, sonst hätte ich es gehört und wäre nach oben gegangen, um nachzusehen.«
Es war genau das, was C. J. auch vermutet hatte, aber sie war froh, dass ihre Vermutung damit bestätigt wurde. Sie notierte es auf dem Block und sah dann erneut hoch. »Kommt Ihnen jemand in den Sinn, der Ihnen nach dem Leben trachten könnte?«
Diese schnörkellose Frage diente dazu, ihn zu überrumpeln und so zu erschrecken, dass er eine ehrliche Antwort gab, ohne erst darüber nachzudenken. Doch der Mann lächelte nur völlig unbeeindruckt.
»Ich bin wohl kaum lange genug hier, um mir schon Feinde gemacht zu haben«, stellte er amüsiert klar. »Ich habe meine Nachbarn noch nicht mal begrüßt, wie sollte ich da irgendwen so gegen mich aufgebracht haben?«
C. J. nickte nur. »Wo haben Sie gelebt, bevor Sie hierhergezogen sind?«
»In New York City.«
Als sie das hörte, verkrampfte sie sich innerlich. »Sie sind Amerikaner?«
»Nein, aber vor meinem Umzug hierher habe ich zehn Jahre in New York gelebt und gearbeitet.«
»Dann sind Sie Kanadier?«, fragte sie und kniff ein wenig die Augen zusammen, da er erneut zögerte.
»Ja.«
C. J. betrachtete ihn kurz und war sich sicher, dass er gelogen hatte. Dann fragte sie: »Wieso sind Sie hierhergezogen?«
»Um näher bei meinem Vater und meiner Schwester zu sein«, lautete seine Antwort, die die Vermutung nahelegte, dass es doch keine Lüge gewesen war und er tatsächlich Kanadier war. Wenn seine Familie von hier kam, dann galt das wohl auch für ihn.
Kopfschüttelnd notierte sie seine Antwort. Einmal mehr hatte ihr Bullshitmeter ausgeschlagen, und seine nächsten Worte ließen sie auch jetzt wieder glauben, dass ihr Meter falschlag. Das alles war ziemlich frustrierend.
»Also …«, schlussfolgerte sie aus dem, was er gesagt hatte. »Sie sind hier in Sandford aufgewachsen, und Ihre Familie lebt immer noch hier?«
»Nein.«
C. J. warf ihm einen giftigen Blick zu. »Nein was?«
»Ich bin nicht hier aufgewachsen, und meine Familie lebt auch nicht hier«, führte er aus, aber das war genauso wenig hilfreich wie das knappe Nein.
»Aber Sie haben doch eben gesagt, dass Sie hierher umgezogen sind, um näher bei Ihrer Familie zu sein«, stellte sie ein wenig verärgert fest.
»Ja. Ich bin nach Kanada umgezogen, um näher bei meiner Familie zu sein. Allerdings lebt mein Vater in Toronto, während meine Schwester in Port Henry lebt. Deshalb habe ich nach etwas gesucht, das möglichst in der Mitte liegt. Sandford schien mir eine schöne kleine Stadt zu sein, die genau diese Voraussetzung erfüllt«, stellte er klar.
C. J. notierte das alles, als er auf einmal von sich aus hinzufügte: »Meine Schwester ist Katricia Argeneau Brunswick. Sie arbeitet in Port Henry als Polizistin, und ihr Ehemann Teddy ist der dortige Polizeichef.«
Sie brauchte eine Weile, bis sie sich das alles notiert hatte, und sah den Mann dann abschätzend an. Er war nicht von hier, er war erst seit etwas mehr als vierundzwanzig Stunden in der Stadt, und schon hatte jemand sein Haus in Brand gesteckt, während er selbst sich noch darin befunden hatte. In der Regel war so etwas ein Versuch, jemandem nach dem Leben zu trachten. Aber wie er selbst gesagt hatte, war er nicht mal lange genug in der Stadt, um sich irgendjemanden zum Feind zu machen.
»Irgendwelche Feinde in New York?«, fragte sie, da ihr die Möglichkeit in den Sinn kam, dass ihm Ärger von dort bis hierher gefolgt war.
»Nei…iin.«
C. J. wurde hellhörig. Er hatte zu seiner Antwort angesetzt, als müsse er gar nicht erst darüber nachdenken. Dann jedoch hatte sich sein Tonfall verändert und zum Ende hin so geklungen, als wäre ihm auf einmal etwas eingefallen.
»Sie hören sich nicht gerade überzeugt an«, führte sie ihm vor Augen.
»Tja, also, mir fällt niemand ein, den ich in letzter Zeit vor den Kopf gestoßen hätte. Aber Tatsache ist nun mal, dass irgendwer mein Haus angezündet hat … und zwar, als ich zu Hause war, was den Gedanken nahelegt, dass da jemand ist, der es auf mich abgesehen hat«, resümierte er und verzog dabei missmutig den Mund. Er warf einen Blick auf die ausgebrannten Überreste seines Hauses und fuhr fort: »Ich nehme an, das heißt, dass derjenige es noch einmal versuchen könnte, wenn er herausfindet, dass ich dem Feuer nicht zum Opfer gefallen bin.« Er wandte sich wieder zu ihr um. »Das heißt vermutlich, dass Sie mich an einen sicheren Ort bringen und mir einen Leibwächter zuteilen müssen, bis die Angelegenheit geklärt ist.«
C. J. stutzte, als sie ihn reden hörte. Ein Leibwächter? Das war so ziemlich alles, was sie von seinen Ausführungen überhaupt mitbekommen hatte. Zumindest war es das Einzige, worauf sich ihr Verstand konzentriert hatte. Seinen Leib zu bewachen war tatsächlich gar keine so abwegige Idee, wenn es tatsächlich darum gegangen war, ihn umzubringen. Erst jetzt fiel ihr ein, dass der Brandstifter sich womöglich immer noch in der Nähe aufhielt und längst wusste, dass sein Opfer noch lebte. Derartige Straftäter blieben gern noch am Tatort, um ihr Werk zu bewundern. Sie drehte sich zu Simpson um und sagte: »Machen Sie Fotos von der gesamten Umgebung. Von der Straße, vom Acker, vom Hof und von allen Leuten, die sich ringsum aufhalten. Und versuchen Sie auch, die Kennzeichen aller Wagen zu fotografieren, die hier überall parken.«
Sie war froh darüber, dass der Mann nicht widersprach und auch keine Fragen stellte, sondern sofort sein Handy hervorholte und damit begann, Fotos zu machen. Sie sah sich flüchtig um, ob ihr jemand auffiel, der sich von der Menge abhob oder der nicht hierher zu passen schien. Doch so sehr sie sich auch auf die Umgebung zu konzentrieren versuchte, hing C. J’s Verstand immer noch an Macs Bemerkung vom Leibwächter fest. Natürlich hatte er recht, dass jemand Tag und Nacht in unmittelbarer Nähe dieses Mannes bleiben und auf ihn aufpassen musste, während er schlief, duschte und sich rasierte. So ungern sie das auch zugeben wollte, hätte sie unter normalen Umständen gegen eine solche Aufgabe nichts einzuwenden. Es wäre auch keine Belastung für sie, zumindest nicht für ihre Augen. Die blinkenden Lichter eines der Feuerwehrwagen zuckten immer wieder über seinen Körper, sodass sie den Mann etwas besser sehen konnte. Natürlich war ihr von vornherein aufgefallen, dass er zum Anbeißen war. Haare und Kleidung waren noch immer feucht vom Untertauchen in der vollen Badewanne. Deshalb klebte auch das T-Shirt an seiner Brust, wodurch sich die ausgeprägten Muskelpartien deutlich abzeichneten. Seine Schlafanzughose war ebenfalls noch nicht getrocknet und schmiegte sich so sehr an die interessanteren Körperpartien, dass schnell klar wurde, dass dieser Mann nicht nur eine breite Brust vorzuweisen hatte. Aber natürlich konnte das auch eine optische Täuschung sein, hervorgerufen durch das Spiel von Licht und Schatten, das durch die blinkenden Lichter des Rettungswagens und der Feuerwehrwagen erzeugt wurde. Andererseits war das auch egal, denn dies hier waren keine normalen Umstände. Schließlich war in ihrem Leben seit dreieinhalb Jahren so gut wie nichts mehr normal.
Und abgesehen davon war das Ganze ohnehin nicht ihr Problem, hielt sie sich vor Augen. Denn eine weitere Unterstützung der Polizei war ab jetzt nicht mehr erforderlich. Sie hatte ihre Aufgabe erfüllt und konnte nun gehen.
»Ich mach mich dann wieder auf den Weg«, verkündete sie laut genug, damit Simpson sie auch hörte. An Mac gewandt sagte sie: »Bleiben Sie in der Nähe von Officer Simpson. Er wird auf Sie aufpassen.«
»Sie wollen gehen?«, fragte Mac in einem Tonfall, der gleichermaßen bestürzt wie vorwurfsvoll klang.
Es hörte sich an, als würde sie ihn einfach im Stich lassen, dachte C. J., nickte aber und sagte: »Simpson hat hier das Sagen. Er wird Sie zur Polizeiwache fahren, und da wird sich Captain Dupree ganz bestimmt darum kümmern, dass Sie Personenschutz bekommen, Mr Argeneau.«
»Ich will Sie.«
2
Ich will Sie. Die Worte hallten in C. J’s Kopf nach und hatten für sie einen eindeutig zweideutigen Klang. Sie ließen ihr auch einen Schauer über den Rücken laufen, dessen Ursache sie auf gar keinen Fall auf den Grund gehen wollte. Sie hatte kein Interesse an Männern und an dem Chaos, das Beziehungen mit ihnen nach sich zogen. C. J. hatte während ihrer Ehe bittere Erfahrungen gemacht. Männer bedeuteten für sie nichts Gutes. In keiner Weise. Diese Lektion hatte sie so gründlich gelernt, dass sie sich längst damit abgefunden hatte, allein zu leben. Wer Gesellschaft wollte, konnte sich einen Hund anschaffen, und für den Abbau jeglicher Anspannung genügte es, sich einen Vibrator zuzulegen. Und wenn man dann wusste, wie man Reifen wechselte und einen tropfenden Wasserhahn reparierte, war man gut gegen so ziemlich alles gewappnet. Zum Glück beherrschte C. J. beides.
»Er hat recht. Wir sollten ihn zu seinem eigenen Schutz nicht aus den Augen lassen«, warf Simpson plötzlich ein.
Überrascht drehte sich C. J. zu ihm um. Der Mann hatte kein Wort gesagt, während sie alle Fragen gestellt hatte, und jetzt auf einmal kam er auf die Idee, sich an der Unterhaltung zu beteiligen? Allem Anschein nach hatte er die Fotos gemacht, um die sie ihn gebeten hatte. Allerdings konnte er noch keines der Kennzeichen an den Fahrzeugen in der Zufahrt gemacht haben. Vermutlich wollte er das erledigen, wenn sie das Anwesen verließen, überlegte C. J.. Auf seinen Kommentar reagierte sie zunächst nur mit einem finsteren Lächeln, während sie seinen Notizblock zuklappte und ihn zusammen mit dem Kugelschreiber zurück in die Hemdtasche steckte. Sie tippte gegen die Tasche und meinte beiläufig: »Ja, das sollten Sie machen. Am besten bringen Sie ihn zur Wache und fragen, was Dupree in der Sache unternehmen will.«
C. J. war im Begriff sich umzudrehen, als Simpson sagte: »Ich habe keinen Wagen.«
Sie hielt inne und sah ihn wieder an. »Wie bitte?«
»Ich war mit Jefferson hergekommen«, erklärte der Polizist, der noch immer seltsam ausdruckslos dreinschaute. »Er hat mich mit allem, was ich für die Beweissicherung brauche, hier zurückgelassen, ist aber mit dem Streifenwagen zu einem anderen Einsatz gefahren. Ich hatte gehofft, mit Ihnen zur Wache zurückfahren zu können.«
Was bedeutete, dass auch Mac Argeneau bei ihr mitfahren müsste, überlegte C. J.. Alles in ihr sträubte sich dagegen, ihr Einverständnis zu erklären. Warum das so war, wusste sie nicht. Schließlich war es nur ein Auto. Über die Jahre hinweg war sie immer wieder mit Opfern von Gewalttaten im gleichen Wagen unterwegs gewesen. Meistens jedoch hatte sie sich den Wagen mit Kriminellen geteilt, die in Handschellen auf dem Rücksitz gesessen hatten, von den vorderen Sitzen abgetrennt durch stählernen Maschendraht oder kugelsicheres Glas. Ihr eigener Wagen verfügte weder über das eine noch das andere, weil sie in ihm auch keine Kriminellen mitnehmen musste … und auch keine Opfer. Aber sie sah keine Möglichkeit, sich davor zu drücken, also murmelte sie: »Na, dann mal los.« Als ihr bewusst wurde, wie unhöflich das klang, fügte sie hinzu: »Ich habe für heute Nacht genug und will nur zurück in das Bed and Breakfast, in dem ich mich einquartiert habe. Auf dem Weg dorthin werde ich Sie beide an der Wache absetzen.«
C. J. drehte sich nicht um, da es keinen Grund gab, sich zu vergewissern, ob Simpson und Mac ihr auch tatsächlich folgten, als sie zu ihrem Wagen ging. Sie eilte einfach die Zufahrt entlang, weil sie so schnell wie möglich von hier wegkommen wollte. Erst als sie am Wagen angekommen war, zeigte ihr ein Blick über die Schulter, dass sie allein war.
Aufgebracht schnaubend stemmte C. J. die Hände in die Hüften und suchte die Zufahrt ab. Das Feuer war gelöscht, aber auch ohne die Flammen sorgten die Lichter der vielen Fahrzeuge rund um das Gebäude für genügend Helligkeit. Neben der langen Reihe aus Pick-ups auf dem Seitenstreifen standen etliche Fahrzeuge auf der freien Fläche vor dem Gebäude, darunter auch die beiden Feuerwehrwagen und der Rettungswagen. Trotz der vielen Lichter gab es immer noch einige dunkle Flecken, und hier und da bewegten sich seltsame Schatten. Dennoch konnte sie ohne Mühe die Feuerwehrleute ausmachen, die immer noch in Bewegung waren. Oder nur noch dastanden, musste sie sich korrigieren, denn es bewegten sich nur die beiden Männer, die mit dem Schlauch immer noch Wasser auf das verkohlte Gebäude herabregnen ließen.
Ihr Blick wanderte zu den Leuten, die sich am Rettungswagen versammelt hatten, doch die standen im Schatten, sodass sie nicht erkennen konnte, wer zu dieser Gruppe gehörte. Also ließ sie ihren Blick weiterwandern, bis sie schließlich Simpson entdeckte, der mit etwas hantierte, das nach einem großen Angelkasten aussah. Sie wusste aber, dass es sich in Wahrheit um die Tasche handelte, in der sich alles Notwendige für die Sicherstellung von Beweisen befand. Das hatte sie völlig vergessen, und prompt verrauchte ein wenig von ihrer Verärgerung. Er hatte zwar nicht daran gedacht, das Opfer zu befragen, aber wenigstens war ihm nicht entfallen, Beweise zu sichern. Das war immerhin etwas, sagte sich C. J., während sie zusah, wie der junge Officer zu der Gruppe ging, die beim Rettungswagen stand.
Dort angekommen, löste sich eine große Gestalt von der Gruppe und schloss sich Simpson an. Dass es Macon Argeneau war, wurde ihr klar, als beide die Zufahrt entlanggingen und an jedem Wagen anhielten, damit Simpson das Kennzeichen fotografieren konnte.
Argeneau bewegte sich wie ein Panther, ging es ihr durch den Kopf, während sie die beiden Silhouetten beobachtete, die allmählich näher kamen. Sein ganzer Körper schien aus Muskeln und geschmeidigen Bewegungen zu bestehen, was sie als unglaublich attraktiv empfand. C. J. hätte ihm allein schon beim Gehen stundenlang zusehen können, bis ihr bewusst wurde, wie sehr sie es genoss. Abrupt drehte sie sich weg und stieg in ihren Wagen.
»Männer«, murmelte sie, während sie die Tür zuschlug. C. J. verfügte weder über die Zeit noch die nötige Geduld, um sich mit Männern zu befassen. Sie mochte ihr Leben so, wie es war: angenehm, friedlich und ganz ohne Dramen. Sie brauchte keinen herumstolzierenden Hengst, der durch ihr Leben galoppierte und dabei Begierden weckte, wie sie sie seit Jahren nicht mehr verspürt hatte. Nicht, dass Mac Argeneau so etwas gelungen wäre, wie sie sich selbst versicherte. Okay, er sah gut aus. Das konnte sie zur Kenntnis nehmen, ohne dass es etwas bedeuten musste. Himmel, sie fand Rodins Denker auch wunderschön, trotzdem hieß das nicht, dass sie mit der Statue schlafen wollte.
C. J. tippte mit einem Finger auf das Lenkrad, während sie sich fragte, wie lange es noch dauern würde, ehe sie sich ins Bett legen und schlafen konnte. Sie war ganz offensichtlich müde, was vermutlich auch der Grund war, wieso sie Mac für attraktiv hielt: Erschöpfung und Übermüdung. Daran würde sie schnell etwas ändern. Sie würde Officer Simpson und das Opfer der Brandstiftung zur Polizeiwache bringen und nachfragen, ob Jefferson noch Dienst hatte. Sollte er dort anzutreffen sein, würde sie ihn befragen. Andernfalls musste sie nur wissen, wann seine nächste Schicht begann, um sich gleich darauf in die Sicherheit des Bed and Breakfast zurückzuziehen, in dem sie sich einquartiert hatte.
Jefferson war schließlich auch der Grund dafür, dass sie hergekommen war, hielt sie sich vor Augen. Sie würde die Untersuchung so schnell erledigen wie möglich, damit sie umgehend von hier verschwinden konnte. Sie würde auf direktem Weg nach Mississauga zurückkehren und ihrem Vorgesetzten Bericht erstatten, damit sie Macon (den höllisch heißen Mac) Argeneau aus ihrer Erinnerung streichen konnte. Dann konnte sie sich ganz ihrem schönen, ruhigen und friedlichen Dasein widmen, in dem ihre Hormone Verstecken spielten, anstatt beim Geruch nach Wald und Gewürzen Amok zu laufen.
Die Beifahrertür ging auf, und genau dieser Duft strömte in den Wagen und stieg ihr in die Nase, worauf die Synapsen in ihrem Hirn zu explodieren begannen. Sie kniff ein Mal die Augen fest zu und ignorierte das plötzliche Chaos in ihrem Kopf, während sie zusah, wie Mac neben ihr Platz nahm.
»Ich hoffe, wir haben Sie nicht zu lange warten lassen«, sagte er und setzte zu einem Lächeln an, das sie nur für einen kurzen Augenblick sehen konnte, da er schon im nächsten Moment die Tür zuzog und die Innenbeleuchtung ausging. Doch selbst dieser kurze Augenblick genügte, um ihren Puls in die Höhe zu jagen, als wäre sie eine viktorianische Jungfrau, die drohte, vergewaltigt zu werden. Der Anblick seines Gesichts war wie in ihr Gehirn eingebrannt. Was sah dieser Mann doch hinreißend aus: eindringliche silbrig-blaue Augen, volle sinnliche Lippen, gemeißelte Wangenknochen, ein straffes Kinn und eine hübsche, makellose gerade Nase. Sein Haar war dunkelbraun, doch diese Bezeichnung war viel zu unzulänglich. Sein Haar war überwiegend dunkelbraun, doch überall mischten sich andere Töne darunter, die das ganze Spektrum der Farbe Braun abdeckten – von blassem Sand bis hin zu den dunkelsten Kaffeebohnen. Und hier und da war auch mal ein Hauch von Rot zu sehen. Mit seinem Aussehen hätte der Mann auch als Model arbeiten können, fand C. J.. Im nächsten Moment ging das Licht wieder an, da die hintere Tür geöffnet wurde.
»Tut mir leid, ich musste noch den Spurensicherungskoffer holen«, erklärte Officer Simpson, während er sich mit seinem Angelkasten auf die Rückbank setzte.