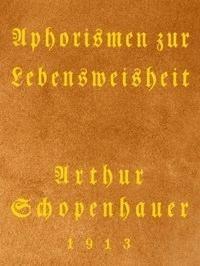0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Ähnliche
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt.
Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet.
Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so ausgezeichnet.
Weitere Anmerkungen zur Transkription finden sich am Ende des Buches.
Eine dänische Geschichte.
Roman
von
Adele Schopenhauer.
Braunschweig, Druck und Verlag von George Westermann.
1848.
Auf der süd-östlichen Küste der Insel Laaland erhebt sich das alte Städtchen Nysted, welches sich zu den frühesten Dänemarks zählt, da es schon im Jahr 1409 durch Erich von Pommern Stadtrechte erhielt. Wie aus einem dicken Laubkranze schaut es von seinem grünenden Hügel aus weit hinein in das Land – über Laaland und Falster hin, ja dem Meer entlang bis nach Femern und Rostock, und seine berühmten Lindengänge erzählen sich im Abendwind ganz wundersame Geschichten: der träumerische Nachthauch streicht über heidnische Grabhügel, über verfallene Gerichts- und Opferstätten hin, und hilft dem kundigen Greis die in seinem Kopf zerstreuten, halbverlorenen Klänge der alten Saga zusammensuchen, die ihm vom Ur-Ahn auf Großvater und Vater vererbt sind. Denn der Nordländer, besonders aber der Landbewohner hört gar gern erzählen von lang vergangenen Tagen, wenn der strenge Winter ihm Thor und Fensterladen schließt und ihn zurückdrängt in die engen Kammern.
Auf dem höchsten Steine der ehemaligen Schanze, an der Mündung des Hafens, saß ein junger Mann, nachdenklich beide Arme auf ein Mauerstück gelehnt und schauete bald zum bewölkten Himmel auf, bald in die frische Landschaft hinein, sah aber dabei aus, als gedenke er gar anderer Ruinen, gar anderer Hügel und Meere; ihm war das Herz sichtlich schwer. Auch er war ein beliebter Erzähler des Städtchens; er hatte oft und gern seinen staunenden Zuhörern den bunten Schleier seiner südlichen Anschauungen über dies stille Grau der Nebel hingebreitet, in denen der Frühling, wie ein Kind in seinen Windeln, tief in's Jahr hinein schläft, und dann mit einem Male aufspringt, da ist in voller Schöne und Kraft und wie ein junger Herkules die alte Winterschlange zerdrückt. Das hat der höhere Norden mit dem Süden gemein, daß dort wie hier der ganze Lenz, wie seine einzelne Blüthe, in der geschwellten Knospe steckt; und ihn der heiße Sonnenstrahl plötzlich erweckt zum üppigsten Leben, während man in Mittel-Deutschland ihn lange kommen sieht, und heute die Primel, morgen die Kirschenblüthe findet, eine Woche lang das Maienglöckchen erwartet, und so allmälig Blume um Blume willkommen heißt und begrüßt.
Drei Monate schon war der Reisende in Nysted; seit drei Wochen liebte er; seit drei Wochen war ihm, außer dem kleinen Fleck Erde Laaland, die übrige Welt dunkler geworden als der bewölkte Himmel, den er anstarrte. – Darum also war er in Italien gewesen, hatte Rom gesehen, dort und in Florenz Jahre lang studirt, um hier hoffnungslos einem bleichen Mädchenantlitz gegenüber festzuwurzeln? – Wo waren dann seine Wünsche und Träume geblieben, und all die weitausgreifenden Pläne der Seinen? – Wie welke Blätter im Sturm kreisten und wirbelten Erinnerungen und Vorstellungen durch seine Seele: – er gedachte seiner Mutter in Plön, wohin sie von Copenhagen gezogen, um wohlfeil zu leben, einsam mit einer alten Magd, jeden Pfennig zu sparen und mitten in den Unruhen des Kriegs ihn zum Künstler zu bilden; er gedachte seines Ohms, des Rathsverwandten Hagemeister, der als solcher eine kleine Anstellung in Roeskilde erhalten, und mit unsäglicher Mühe durch des Bischofs Gnade den Auftrag ihm verschafft hatte, der zuerst ihn nach Nysted geführt. – Eben durchbrach die Sonne, mit hellem blassen Strahl sie durchschneidend, die schwere Wolkenhülle; aufblitzte der goldne Thurmknopf der das ganze Städtchen hoch überragenden Kirche; die Arbeitsstunde war gekommen, und die Möglichkeit im alterthümlichen Bau des Gotteshauses die Farben zu sehen und scharf zu unterscheiden; – der Maler warf alle Gedanken zur Seite und eilte der Bucht entlang den Weg zurück in die Stadt, die steile Gasse hinauf zur Kirche; sie war geschlossen am Werkestag; das Frühgebet war längst vorüber. Thorald mußte herumgehen bis an des Küsters Haus; er klopfte leise an die runden Scheiben des kleinen Fensters, es öffnete sich sogleich und ein feiner Mädchenkopf beugte sich hervor.
»Ei guten Morgen, Herr Eynerssen! Der Vater ist nicht mehr daheim, er ist auf Schloß Aalholm zum Grafen, und ich soll Euch führen; die Schlüssel hat er mir gelassen, ich komme gleich hinab!«
Im Augenblicke stand sie, in ein bescheiden Mäntelchen gehüllt, neben ihm, – »aber laßt Ihr mich nun auch das Gemälde sehen, lieber Herr? ich habe mich so lange darauf gefreut, allein der Vater ist so streng; der hält am gegebenen Wort wie eine Eisenklammer. Ihn kümmert es gar nicht, daß mich die Christine und Elisabeth und Sophie verspotten, weil ich, gleichsam ein Kirchenkind, das Bild noch nicht gesehen, da Ihr es doch schon vor drei Tagen hingebracht.« –
»Wenn es fertig ist, Gianina, sollst Du es zuerst sehen, früher als alle Anderen; heute aber kann ich Dir den Gefallen nicht thun, ich muß den Eindruck, den es macht, an Ort und Stelle selbst betrachten, ihn wohl berechnen, manches ändern und hineinmalen.« –
»Da verwälscht Ihr mir wieder meinen ehrlichen Christennamen und thut mir dennoch nicht das kleinste zu Liebe! Johanna heiß ich, hundertmal habe ich's Euch schon gesagt! Würde das klingen ›Gianina Kaalund‹? hört doch selbst, wie das acht und kracht! Es paßt zusammen wie die Faust auf's Auge.«
Während dem Sprechen hatte das Mädchen die schweren Schlösser geöffnet; sie traten durch die Sacristei, welche der Kirche anhing wie ein unförmliches Schwalbennest, in die dämmernde Stille des Seitenschiffs. Die weißgetünchten Räume gehörten dem normannisch-romanischen Styl an, der edle Bau war frei und nicht durch schwerfällige Mittelchöre verunstaltet; ein frommes, freudiges Dankgefühl schlug an des Malers Herz – rasch schritt er vor nach der Mitte des Altars und überflog mit flammendem Auge die seiner Tafel bestimmte Stelle; hinter derselben stand das wohl verhangene Bild. Daneben lehnten eine Leiter und eine staffeleiartige Vorrichtung, um das Gemälde in die ihm bestimmte Höhe zu bringen und ihm das passende Licht zu geben. Der Maler hatte die Absicht, an Ort und Stelle das Gemälde zu vollenden, und dann erst dem Magistrat, welcher es für die Stadtgemeine bestellt, zu überantworten.
Unterdessen war Carlson, ein langer blonder Knabe, welcher dem Maler aufwartete, mit dem Malergeräth angelangt. Thorald und er gaben sich sogleich daran die Tafel aufzustellen. Das Mädchen hatte der Künstler längst vergessen.
Die Kleine war scheinbar hinausgegangen, dann umgekehrt und hinter einen der großen Pfeiler geschlüpft; sie schaute von dort sachte hervor auf Beider Treiben, in der Hoffnung, wenigstens von weitem ihre Neugier befriedigen zu können.
Jetzt war das Bild mit dem leeren Altarraum in gleiche Höhe gebracht, es stand demselben zur Seite; Carlson ward entlassen. Zögernd blieb der Meister mit verschränkten Armen vor seinem Werke stehen, als scheue er die Enthüllung desselben. – Carlson strich dem Pfeiler vorüber, welcher Johannen barg; sie glitt geschickt um denselben herum und war nun dem Gemälde um so näher. Endlich flog der Vorhang zurück. »Mein Jesus, das Schloßfräulein!« schrie Johanna sich selbst vergessend auf. Wie von einem elektrischen Schlage getroffen taumelte der Maler zurück. »Du hier, Johanna? und Sie – Helene? das Fräulein von Gejern wollte ich sagen – aber wo, um Gotteswillen, wo ist sie? sprich doch Mädchen!«
»Was fällt Euch ein! Ihr träumt, lieber Herr. Das Fräulein außer aller Kirchenzeit hier in dem verschlossenen Gotteshause? ich meine da die heilige Martha neben unserer Herrgottsmutter auf dem Gemälde, sie ist ihr ja wie aus den Augen geschnitten! Wird sich die wundern, und der Herr Graf! – aber der Johannes sieht ihr wahrhaftig auch etwas ähnlich! – und davon sagt mir der Vater kein Sterbenswort!«
Heiß erröthete der junge Mann, ob aus Liebesentzücken oder Scham ist schwer zu sagen, denn die in's Auge fallende Aehnlichkeit war ihm unbewußt aus der Seele in die Farbe seiner Pinsel gedrungen; dann versuchte er des Mädchens Ausspruch zu widerlegen, ja, er schalt ihn sogar eine thörichte Einbildung, der des Fräuleins Ohr ja nicht berühren dürfe; er bewies ihr den Irrthum in tausend Abweichungen des Originals vom Bilde. –
»Meinetwegen, lieber Herr Eynerssen, ich gebe Euch gern zu, daß unser Fräulein weder so betrübt aussieht – Gott sei Dank! noch so fromm; aber das sind ihre schönen lichtbraunen Haare, ihre klaren Augen – das ist die schmale Unterlippe, mit der sie so drollig trotzen kann, das ist ihre freie gerade Nase; es ist ja zum Sprechen! Und so narret mich doch nicht, indem Ihr mir weiß machen wollt, es sei das Alles ganz von selbst gekommen, habt Ihr doch eben das Conterfei der drei Fräulein im Schlosse vollendet, da hattet Ihr ja die allerbeste Gelegenheit, dasselbe Gesicht hier zu wiederholen. Die Lisbeth hat die Bilder gesehen und kann gar nicht aufhören, die Aehnlichkeit derselben zu rühmen!«
»Ich bitte, Kind, jetzt laß mich arbeiten,« bat der Maler. »Geh' jetzt – thu' mir den Gefallen! Drei Stunden lang habe ich auf den hellen Tag und auf das Sonnenlicht gewartet.« – –
»Ja wohl, ich gehe schon, aber ich hätte Euch doch gern noch viel gefragt; mir ist, als müsse ich Euch danken für Labung und Gottesgabe! Die heilige Mutter am Kreuz ist gar so schön, und Christus sieht auf uns mit solcher Barmherzigkeit hernieder, daß man so recht im Gemüthe fühlt, wie er für uns gestorben ist!«
Als sie draußen war, schob Thorald die Riegel vor und kehrte dann zu seinem Bild zurück; er wollte die Aehnlichkeit wegbringen durch ein paar kühne Pinselstriche, wär's auch auf Kosten seines Bildes, aber den geliebten reinen Zügen gegenüber sanken ihm Hand und Muth. – »Haben es doch Rafael und Andrea auch gethan!« flüsterte er vor sich hin – »vielleicht gewahrt sie es nicht einmal; mir ist's wie eine Todsünde, die wunderbare Harmonie dieses Antlitzes zu zerstören! Was auch für Herzeleid und Verdruß mir daraus erwachse, ich vermag es nicht.«
In einem nicht eben uneleganten, nur etwas schwerfälligen Pavillon in chinesischem Geschmack, der sich neben dem alten gothischen Schloßbau drollig genug ausnahm, und recht wie zum Spott unserer schwächlichen Modernität mit dessen vier, fünf Ellen dicken Mauern contrastirte, saßen am Abend desselben Tages drei junge Mädchen, zwei von ihnen mit Nähen und Spitzen-Klöppeln emsig beschäftigt; – Laaland bewahrt noch seine primitive Fabriken- und Lädenscheu, und Nysteds 800 Einwohner gehen alle, von der Mode unberührt und unbelästigt, im großväterlichen und großmütterlichen Schnitt einher. Die Damen mußten also nothgedrungen zu ihrer eigenen Modernisirung Hand anlegen. Den beiden fleißigen Schwestern gegenüber saß Helene, mit dem Rücken nach dem Fenster gekehrt, und schaute verstohlen über die Schultern hinweg, der Lindenallee entlang, welche Schloß und Städtchen verbindet. Sie beachtete keines der Copenhager Gesellschaftsbilder, welche jene Beiden mit unerschöpflicher Phantasie ihr entwarfen; wie aus einer weitentlegenen Welt schaute sie sichtlich, ohne alles Verständniß des ihr Vorgetragenen, über den kleinen schmalen Theetisch zu den lustigen Schwätzerinnen hin, die, glücklicherweise viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, ihre Zerstreutheit nicht bemerkten. –
»Bruder Joachim und Elisabeth kommen auch zum Pferderennen nach Copenhagen,« sagte Amalie, »Christian will nur ein halb Dutzend Ackerpferde zum Verkauf hinüberschicken – wird sie nicht Staat machen, die Gnädige. Nun, da bekommen wir wenigstens neue Muster.«
»Nach Wallöe? o ja! aber schwerlich bis hieher nach Laaland! Und alles können wir doch nicht selbst machen, oder gedenkst Du in Nysted eine Putzmacherin zu suchen? Danke Gott, wenn Du einen Schuster findest!«
»Wie Du nun wieder übertreibst, Annette, Dir ist der Aufenthalt hier zuwider, und doch ist er so friedlich, so recht gleichförmig und ruhig, wie ich immer leben möchte; ich habe diese grünen fetten Weiden gern.«
»Gern? ist's etwa angenehm zwischen Ochsen und Kühen, durch Dick und Dünn in schweren Holzschuhen dem Sonnenuntergange entgegen zu waten, im Moor stecken zu bleiben und dann allenfalls vom alten Niels gerettet, wie ein nasser Sack in irgend einem Bauernhofe als »Gräfliches Eigenthum« abgeliefert zu werden?«
»Uebt man doch kein Morast-Strandrecht an uns aus! Ich bin lieber hier als in Wallöe; das Stift wird mir nicht zum Vaterhause. Hätte Christian mein Herz für Aalholm, es sollte bald hier anders werden. Es war auch anders zu der Mutter Zeit, sogar noch in des Vaters Witwen-Jahren, ehe all die Modernisirungsversuche den Bauernstand uns fern stellten; es war etwas patriarchalisches in der Abhängigkeit.«
»Ich meine, der Bauernstand sei unserer Gegenwart etwas näher getreten, als für unser Aller Glück nothwendig,« erwiederte Annette; das hübsche Milch- und Rosen-Gesichtchen überflog ein Zug seltsam spöttischer Bitterkeit.
Am gegenüberliegenden Ende des Gartens erschien jetzt eine bleiche noch jugendliche Frau; sie trat aus dem Schlosse und schritt mühsam die hohe Steintreppe hinab in den Gang, der zum Pavillon führte; ihr etwas trüber Blick überflog die Kieswege und die steifgeschnittenen Taxuswände, als suche er etwas; ein leises, fast unmerkliches Kopfschütteln sprach aus, daß sie es nicht gefunden; – so näherte sie sich langsam den Schwestern. Helene, ihren wogenden Träumen hingegeben, bemerkte es nicht; die andern Beiden blieben in plötzlich veränderter Haltung sitzen, etwas Gliederpuppenartiges und angestrengt Eckiges legte sich über dieselben und es breitete sich eine feine, doch keineswegs grelle Affectation über den ganzen Ausdruck ihres eben noch so ganz natürlichen Wesens aus.
Eva, so hieß die Neuhinzugetretene, grüßte freundlich ihre Schwägerinnen und setzte sich zu ihnen; sie athmete beklommen. In Laaland geboren, hatten ihr dennoch der feuchte Moorboden und dessen ungesunde Ausdünstungen geschadet; ihre Gesundheit war zerstört. Sie hatte mit ihrem Gemahl, dem Grafen Christian, fünfzehn Jahre in Jütland zugebracht, bis das ihm nach seines Vaters Tode zufallende Majorat sie veranlaßte, nach Aalholm zu ziehen. Jütland aber ist der romantische Theil Dänemarks; es hat weder Fühnens überreiche Vegetation, noch Seelands städtischen Reiz, aber es vereinigt den Wechsel wilder, rauher und fruchtbarer Gegenden; es hat die höchsten Berge, Waldungen und Seen, anmuthige Buchten und Flüsse – und sein kaltes Klima ist nicht schädlich wie das des kaum sich über den Meeresspiegel erhebenden Laaland.
Eva legte leise ihre schmale abgemagerte Hand auf Helenens Schulter, um sie aus ihren wachen Träumen zu erwecken; »es ist schön heute Abend,« sagte sie, »seit dem Mittag hat sich der Horizont entwölkt, wolltest Du nicht ausgehen oder ausfahren?« »Meinst Du, daß es schön bleiben wird, bis Sonntag und wir Alle nach Nysted in die Kirche gehen können?« fragte, gleich in ihre Gedanken ganz zurücksinkend, das Mädchen. Sie schüttelte die lichtbraunen Locken aus dem Gesicht und hob das von Johannen beschriebene Antlitz zu der vor ihr Stehenden empor; man fühlte die Wärme und Innigkeit des strahlenden Blickes, die vertrauende Liebe, die sie der Schwägerin verband. »Ich glaube,« fuhr sie leicht erröthend fort, »das Altarblatt wird fertig sein, es könnte wohl zur Feier des Johannistages aufgestellt werden.« –
»Freilich haben wir lange genug darauf gehofft, aber Du vergißt, liebes Kind, daß unsere Herren nach Copenhagen wollten.« –
»Bewahre! Christian schickt nur seine Pferde hin und Joachim und Friedrich gehen von ihren Gütern aus direct, ohne mit uns zusammen zu treffen; sie gedenken zum Erntefest hier auf Aalholm uns zu besuchen,« sagte Annette. Die arme Gräfin wurde noch ein wenig bleicher als sie gewesen, Christian hatte ihr von all diesen Veränderungen seiner Pläne nichts gesagt!
Helene sah sie sorglich an, »Christian,« sagte sie, »hat erst gestern Abend die Briefe erhalten, er ist mit dem Inspector nach Engholm; Du weißt, heute Morgen hat er eine Kiste Bücher bekommen, und vermuthlich über die Geistesverwandten die Brüder vergessen!« – Schmeichelnd streichelte sie die zitternde Hand, welche von der Schulter herabgeglitten jetzt in der ihren lag. »Oder mich!« – seufzte Eva, unhörbar leise.
Ein Männertritt erklang über den Kies der Gartenwege; während des kurzen Gesprächs war nun, doch von Helene nicht unbemerkt, Thorald am Pavillon vorbei und durch die kleine Gartenpforte hereingekommen; er trat, sich entschuldigend, daß er nicht angemeldet, zu den Damen. –
Er mochte Helenen früher auf diese Weise allein angetroffen haben, denn Beide waren sichtlich verlegen, und die andern Schwestern flüsterten sich etwas zu: Annette zuckte lächelnd die Achseln. Die Gräfin blieb verstimmt und wurde mit jedem Augenblicke trauriger. Das Gespräch drehte sich um die Politik des Auslandes und die damals noch wie elektrisch auf die Gemüther rückwirkenden Nachrichten aus Frankreich. Thoralds Aufenthalt als Künstler in Italien, auf dem so vielfach erschütterten Boden, in der von tausend Freiheitsträumen und Kriegsereignissen bewegten Zeit, hatte für die Frauen etwas Fabelhaftes, das ihn wie mit einer Aureola umwob.
Endlich kam auch Graf Christian; eine edle Erscheinung. Er ging ein wenig vorn übergebogen aus übler Angewöhnung; richtete er in irgend einer Geistes- oder Gemüthsanregung sich auf, so gewann seine Gestalt etwas Ritterliches, das an Majestät grenzte. Seine Züge hatten eine formelle Strenge angenommen, die nicht mit physischer Kraft gepaart, fast unnatürlich erschien; die schmale kleine Hand und die dünnen Knöchel derselben verriethen sogar eine körperliche Schwäche, die jedoch nicht ohne Anmuth hervortrat. Ohne unbeholfen sich zu zeigen, war der Graf leicht, selbst im engsten Familienkreise verlegen, seine etwas ungelenke Vornehmigkeit und der seinen Tagen anhangende Mangel einer vollendeten Erziehung, welche überall Sicherheit gewährt, trugen Schuld daran. Unendlich schön waren seine dunkelgrauen Augen; sie hatten einen wunderbaren Reiz, den man sich nicht zu erklären vermochte, denn sie belebten sich selten; eine Art schwermüthiger Düsterheit war in ihm allmälig zu der stillen Beschaulichkeit geworden, die ihn fast zum Gelehrten stempelte. Fünfzehn Jahre hindurch hatte er in einem jütländischen Dorfe gelebt, und war auch dort ein Träumer geblieben, den nur momentane Noth zum Handeln zwang, den selbst die Beschränkung der Armuth nicht zum praktischen Menschen auszubilden vermochte. Er war zeitgemäß elegant gekleidet, hatte feine Wäsche und ungepudertes Haar, überhaupt aber eine gewisse Zierlichkeit, welche gegen die Derbheit seiner Gutsnachbarn abstach.
Im Eintreten fiel sein Blick auf den Maler, seine Stirn umwölkte sich.
Thorald unterhielt die Damen voller Laune und Gewandtheit, kaum unterbrach des Hausherrn Ankunft das Gespräch, denn die Mädchen dürsteten in ihrer Abgeschiedenheit nach überseeischen Neuigkeiten; Besuche waren bei der Unfahrbarkeit der Wege selten.
Als Thorald endlich neben Helenen einen unbemerkten Augenblick gewann, flüsterte er ihr die Bitte zu, wo möglich sein nun aufgestelltes morgen zu vollendendes Bild vor dem Sonntagsgottesdienste in der Kirche zu sehen. Glühend vor innerer Lust und in gegenseitig sie überwältigender Leidenschaft ganz versunken standen Beide vor einander, ihn steigerte ein stolzes Selbstgefühl, sie berauschte der Gedanke an seinen künftigen Ruhm; denn selten nur kamen Künstler auf die stille Insel. Der nur von Ackerbau lebende Laaländer vermag sie nicht herzulocken! Seit Menschengedenken hatte man keinen Maler in Nysted gesehen, und die beiden schönen Gemälde der alten Kirche dankten ihr Entstehen katholischen Donatoren, und gehörten weit früheren Jahrhunderten an.
»Graf Brahe Trollenburg« meldete ein vierschrötiger Diener, welcher trotz seiner Livrée einem deutschen Großknecht nicht unähnlich sah – Fräulein Annette erröthete zur Rose! – Der reiche Gutsbesitzer aus Seeland war ihr nicht fremd! Während ihres Winteraufenthaltes in der Residenz, so kurz er gewesen, hatte sich in dem jungen Manne eine dauerndere Empfänglichkeit für des Laaländer Fräuleins Reize erzeugt, als den Copenhager Damen billig schien. Der Graf war reich und eine vortreffliche Partie. Er war nach Aalholm gekommen, um das Herzensterrain seiner Schönen zu sondiren und im Ehestandshafen zu ankern.
An der Art, mit welcher Graf Christian ihn bewillkommnete, erst seiner Gemahlin vorstellte und ihn dann seinen Schwestern zuführte, errieth Thorald sogleich den künftigen Schwager, – eine unaussprechliche Beklommenheit bemächtigte sich seiner, die eben noch so fließenden Erzählungen aus Italien stockten, des Hofmanns Gegenwart drückte ihn zurück in den Schatten. Es war bei dem sehr abgeglätteten Tone des Trollenburg nicht leicht zu durchschauen, welcher der drei Damen die Bewerbung des vor kurzem Majoratsherr Gewordnen gelte – es drückte dem Maler fast das Herz ab; in verzweifelnder Stimmung verließ er die Gesellschaft, man machte keinen Versuch ihn zurück zu halten; trostlos kehrte er zu dem Städtchen zurück.
Unweit des Thores begegnete ihm Johanna, sie hatte den Leuten auf dem Felde ihr Vesperbrot gebracht, und trug eine Menge Geräthschaften und einen großen schweren Wasserkrug heim. Sie näherte sich Thorald, um ihn zu fragen, ob er in die Kirche verlange, der Vater sei auf der Feldarbeit mit dem Knecht; sie hätten's eilig, denn morgen sei an ihnen die Frohnfuhre, der Acker aber erst halb bestellt.
»Frohndienst? Ihr als Bürger? unmöglich!«
»Doch, lieber Herr, wir haben von Alters her Land in Pacht vom Herrn Grafen; obschon wir eines Theils losgekaufte Bauern sind, stehen wir ihm noch in Frohn und Zehnten. Der Herr aber ist glimpflich, allein der Vogt! Erbarme sich Gott! Ehmals, da wir Leibeigne waren, mag es noch schlimmer hergegangen sein; Großvater hat uns oft geklagt, wie die Verwalter zu seiner Zeit den Bauern geschunden! Wie er in der Kornschatzung nicht nur gehäuftes Maß, sondern noch eine Zugabe für's Schwinden oder Senken habe liefern müssen – wie nicht nur bloß die armen Gäule ihm zur Ackerfrohne eingespannt wurden, o nein, wie sie zum eignen Dienste jedes Knechtes, jeder Magd des Herrnhofes bereit sein mußten; konnte doch damals nicht einmal der Hundejunge zu Fuße durch das Moor, stand gleich der Bauer bis zum Knöchel d'rin, und watete selbst schwerbelastet neben seinem Vieh, um das Getreide zur Mühle zu fahren, den Sand vom Strande zu holen für den Vogt – o lieber Herr! es war eine harte, schwere Zeit! Selbst unsre liebe Gräfin weiß ein Lied von ihr zu singen; helf' ihr Gott! und sie ist doch uns Allen eine so gnädige Herrschaft!«
So unbequem Thorald die Anrede der Dirne empfunden, so ganz verloren ihr frischer Reiz dem Jüngling gegenüber blieb, so blitzstrahlartig traf ihn dieses Wort. »Was meinst Du, Mädchen?« fragte er harsch ihren Arm ergreifend, »was soll das heißen?«
»O nichts für ungut, lieber Herr, verzeiht! Ihr wißt ja selber wohl, daß unsre Gräfin die Tochter des Peter Owens ist, der den großen Hof zu Engbolle in Pacht hat; es ist freilich nicht gut davon reden, die gnädige Herrschaft hört's nicht gern; aber Ihr, was geht es Euch an! da droben zu Aalholm, ja, das ist etwas anders, ein Jeder sagt, es sei ein Nagel zum Sarg des Hochseeligen gewesen und geblieben!« Sie hob den Krug, den sie neben sich auf einen Stein gestellt, mühsam auf, um weiter zu gehen, Thorald stand ihr freundlich bei – »was hast Du denn da?« fragte er zerstreut, all seine Gedanken waren noch bei ihrer Erzählung. –
»Wasser vom Bärenborn für Fräulein Helene.«
»Seit wann thust denn Du Schloßdienste?«
»Ei im Schloß bin ich wohl selten genug! Aber das Fräulein wäscht sich nur mit dem Bärenborn, und wir Töchter der Frohn- und Festebauern müssen ihr Reihe herum das Wasser holen. Es ist freilich ein wenig weit,« setzte sie hinzu, indem sie mit dem Schürzenzipfel die Stirne trocknete, »es sind wohl anderthalb Stunden Wegs von uns aus dorthin, darum hat mir's warm gemacht!« –
»Aber wer hat Euch denn befohlen das Wasser zu holen?«
»Wer anders als der Vogt? die Herrschaft weiß wohl kaum davon! Er ist es noch von Alters her gewohnt, die Bauern zu Paaren zu treiben! Die Alten sind alle so; macht es doch unserer Gräfin Vater nicht besser! Der nimmt das Joch aus Gewohnheit selbst über den Nacken! Nun, kommt's nicht arg, fügt man sich schon.«
Lustig schritt sie mit ihrem Kruge weiter.
Die Gräfin eines Pachters – Peter Owens Kind? Das also ist die unsichtbare dunkle Last, an welcher das arme Weib so schwer trägt? ihr Großvater Leibeigener, der Vater Frohnpflichtiger, wenn auch wohl längst abgekaufter Bauer – und sie die Gutsherrschaft – die Gräfin! Also da sind wir noch? seufzte der junge Mann. O wahr, trotz den Bestrebungen der Edelsten unseres Volks, trotz Moltke, Reventlov und Colbiornsen noch nicht weiter? Wie unsäglich langsam reift die Saat des Guten – bedarf sie denn wirklich des blutgetränkten Bodens? –
In Italien und Frankreich, die er durchreis't, standen damals Bildung und Volksgesinnung auf einem so andern Höhepunkte. Napoleon hatte eben Italien unterjocht, indem er es republikanisirte; es war ein Lichtblick seines gewaltigen Lebens, – die vorangegangenen Uebertreibungen der Schreckenszeit hoben die Gegenwart glänzender hervor; Jeder wollte dort wenigstens einen Theil der ihr entströmenden Freiheit für seine oder seiner Kinder Existenz, während im Norden die Meisten vor dem Gedanken an die ihr gefallenen Opfer zurückbebten, und deren Vollgewinn in seiner damaligen Form kaum angenommen haben würden, hätte er sich ihnen geboten.
Anders freilich dachte und fühlte die Jugend, ihr war der Blutsaum des Gewandes der Freiheit Morgenröthe geblieben. Der gestörte Zustand der aus ihren Angeln gerissenen Maschine, die wir Bürgerlichkeit nennen, erschien ihr minder grell und qualvoll, als den Alten, welche der verarmten Familienväter, der kinderlos gewordnen Mütter, der Gattinnen, die ihr Theuerstes auf der Guillotine verloren, gedachten. – Frankreichs glänzende Redner hatten auch in Dänemark den heißen Durst nach einer nie empfundenen Gleichheit der Stände erweckt, versprach er doch dem edlern Individuum den unermeßlichen Reichthum einer vollständigen Entfaltung, den der innerlich Hochbegabte am schmerzlichsten entbehrt, und heißer ersehnt, als der Bettler das materielle Gut des Vornehmen.
Dem rohen Rausch vernichtender, zerstörender Bestialität des französischen Pöbels lag eigentlich das nämliche Gefühl zu Grunde, das hier und da den Schwärmer verleitete: eine Ueberschätzung seiner selbst. Umsonst haben tausendjährige Erfahrungen uns die Lehre wiederholt, daß dem wirklich bedeutenden Menschen, dem Genie, der vollständigen Geisteskraft weder äußere Verhältnisse, noch irgend eine andre Zeitgewalt hemmende Fesseln anzulegen vermögen; für die Meisten sind der obscure Mönch Luther, der Schiffsjunge Peter von Rußland, und der uns viel näher stehende Napoleon Bonaparte keine Beispiele.
Ist nun dem Menschenherzen so natürlich, im angeborenen Streben nach Glück den größten Maßstab für die eigenen Forderungen zu wählen, ohne sie mit den eigenen Leistungen irgend in ein Gleichgewicht zu bringen, um wie viel edler erscheinen jene seltenen Naturen, die ohne persönliches Bedürfen, unter günstigen Verhältnissen, nur für die Menge fordern und, ihre Nation vertretend, sich selbst aufopfern für ein allgemeines Wohl! Fast alle wahren Wohlthäter der Menschheit haben jedoch nicht bloß gewaltig, sondern eben so mild als besonnen gehandelt. Sie sind Sterne gewesen, welche nicht nur das Dunkel des Augenblicks durchleuchteten, sondern in jeder Nacht von neuem auftauchten und hinter den sie bergenden Wolken fortschimmerten, bis ihr Strahl sie zu durchbrechen vermochte.
Die Namen der hochherzigen Männer, welche unter Friedrich V. und Christian VII. es unternahmen, Dänemarks Bauern allmälig Freiheit und Wohlstand zu bereiten, werden nie in seiner Geschichte verklingen, so langsam auch ihr oft unterbrochenes Werk vorwärts schritt, ihre Beharrlichkeit brachte sie an das Ziel. –
Wie aber die Natur den festen Eichenwald gern mit Vögeln und Schmetterlingen durchjauchzt und belebt, so stehen immer zwischen solchen ernsten, tiefen Charakteren, aus deren Reichthum Tausende ihren kurzen Lebensfaden spinnen, leichte harmlose Wesen, welche gern überall das Schönste und Beste fördern möchten, es auch manchmal zu erfassen, in der Regel aber nie es festzuhalten vermögen.
Dieser höchst nothwendigen Mehrzahl der Menschen, welche das eigentliche Element gesellschaftlicher Verbindungen ausmachen, werden allerdings nur die ihnen durch Geburt, Reichthum oder Zufall gegebenen Verhältnisse zum äußern Halt, daher die vielen Klagen über verfehlte Existenz und gehemmtes Talent. Ich glaube aber, daß wir kein einziges Beispiel haben, daß die ganze Gesellschaftswelt, in Bausch und Bogen genommen, je im Stande gewesen ist, den Außerordentlichen zu hemmen, das gesunde Genie zu zerstören! –
Thorald fand den Gang der Umstände zu langsam;