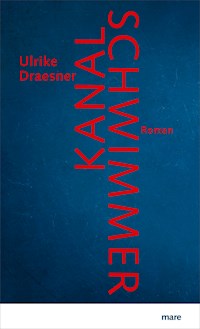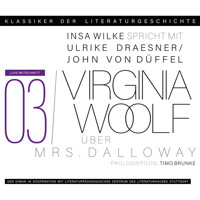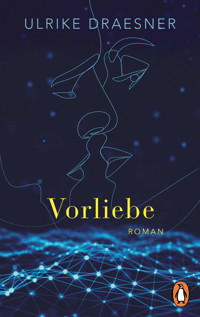16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn Frauen nicht mehr 35, nicht mehr 45 und bald nicht mehr 55 sind...
Frauen wollen immer 39 bleiben, sagte ihre Mutter und färbte sich die Haare bis weit über 80. Sie selbst hat inzwischen auf Partys manchmal den Eindruck wie ein sprechendes Möbelstück behandelt zu werden. Wie sehen sich Frauen eigentlich in der Mitte des Lebens? Mit oder ohne Mann, mit oder ohne Kind, jedenfalls mit sich veränderndem Körper, Denken, Fühlen. Ulrike Draesner hat einen glänzenden Text geschrieben, am eigenen Leben und dem anderer Frauen entlang erkundet sie die Vielschichtigkeit dieses Lebensabschnitts, in dem alles nebeneinander vorkommt: Sie weiß noch, wie sie als Mädchen unbedingt älter werden wollte. Und nun tun alle so, als gäbe es so etwas wie Wechseljahre gar nicht? Pointiert, scharfsinnig und heiter findet Draesner einen neuen Umgang mit dem Verstreichen der Jahre: Aufbruchsgeist, Feuer statt Herd. Zuhause in der eigenen Verwandlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Wenn Frauen nicht mehr 35, nicht mehr 45, und bald nicht mehr 55 sind …
Frauen wollen immer 39 bleiben, sagte ihre Mutter und färbte sich die Haare bis weit über 80. Sie selbst hat inzwischen auf Partys manchmal den Eindruck, wie ein sprechendes Möbelstück behandelt zu werden. Wie sehen sich Frauen eigentlich in der Mitte des Lebens? Mit oder ohne Mann, mit oder ohne Kind, jedenfalls mit sich veränderndem Körper, Denken, Fühlen. Ulrike Draesner hat einen glänzenden Text geschrieben, am eigenen Leben und dem anderer Frauen entlang erkundet sie die Vielschichtigkeit dieses Lebensabschnitts, in dem alles nebeneinander vorkommt: Sie weiß noch, wie sie als Mädchen unbedingt älter werden wollte. Und nun tun alle so, als gäbe es so etwas wie Wechseljahre gar nicht? Pointiert, scharfsinnig und heiter findet Draesner einen neuen Umgang mit dem Verstreichen der Jahre: Aufbruchsgeist, Feuer statt Herd. Zu Hause in der eigenen Verwandlung.
ULRIKE DRAESNER, 1962 in München geboren, eine der profiliertesten deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen, lebt in Berlin. Vor allem für ihre Gedichte und Romane wurde Ulrike Draesner mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Joachim-Ringelnatz-Preis und dem Nicolas-Born-Literaturpreis. Zum Thema erschien von ihr bei Supposé das Hörbuch »Happy Aging«, ein rein mündliches Erzählprojekt. Erst im Nachhinein entstand der vorliegende literarische Essay »Eine Frau wird älter«.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Ulrike Draesner
Eine Frau wird älter
Ein Aufbruch
Die Warnung
Ich hatte Glück: Der Stillewaggon im ICE von Berlin Richtung Südwesten war leer und daher tatsächlich still. Zufrieden saß ich an meinem Tisch, arbeitete und las, bis wir Hannover erreichten. Vier Frauen stiegen zu.
Bereits als wir aus dem Bahnhof rollten, wusste ich, dass die vier zum 50. Geburtstag einer gemeinsamen Freundin unterwegs waren. Taschen wurden hin- und hergeschoben, Jacken verstaut, man lachte, packte Mobiltelefone auf den Tisch, nicht zu nah an den Bechern voller Kaffee. Eines der Telefone war zehn Jahre alt, »ein Methusalem«. »Im Gegensatz zu mir«, sagte die Älteste der Gruppe, die mit dem Patchworkstirnband. »Wie wir alle«, sagte die Frau ihr gegenüber, schwarzer Pagenschnitt, Nasenring. Zwei der Reisenden zählten, bald wusste ich auch das, über 50 Jahre, die anderen beiden standen in der zweiten Hälfte ihrer Vierziger, waren also so alt wie ich damals.
Ihre Stimmen wurden leiser. Was, wie jeder aus eigener Erfahrung weiß, unausweichlich dazu führt, dass man als Mensch, den das Gespräch nichts angeht, besser hört. Sie berieten, »ernsthaft jetzt«, ob sie »es« der Freundin sagen sollten.
»Es wird nicht besser.«
»Hast du ihr wirklich auch noch Hanteln gekauft?«
»Und ein Stretchband.«
Es?
»Früher haben Frauen sich Pads in die Kleider genäht, unter den Achseln. Die konnte man schnell auswaschen.«
Meine Nachbarinnen flüsterten angeregt. »Es« war unangenehm, unvermeidlich, bedrohlich, als Gesprächs- wie Hörstoff mithin ideal. Allmählich dämmerte mir, dass das Lebensjahrzehnt gemeint sein musste, das die Freundin erwartete. »Es«, Jahrzehnt Nummer sechs. »Es«, die Wechseljahre, jedenfalls deren zweiter Teil, das dicke Ende, der Horror schlechthin.
Die Gruppe beschloss, dem Geburtstagsküken nichts von seiner Zukunft zu erzählen. Zumindest nicht sogleich.
Meine Nachbarinnen kicherten. Das Geschenk würde die heute zu Feiernde bald verstehen: ein Gutschein für ein Wochenende in München zum Oktoberfest. Damit sie auch mal äußerlich Achterbahn fuhr.
»Da sind die Männer so besoffen, dass sie sogar uns wieder anschauen.«
»Anflirten!«
»Antatschen!«
»Aber nur, weil sie glauben, du bist ein Bierkrug«, sagte die mit dem Pagenschnitt.
Ich fand das alles höchst erstaunlich. »Wechseljahre«. Bis dato hatte ich noch nicht einmal den Begriff, geschweige denn das Phänomen sonderlich ernst genommen. Ich? Hormonumstellung? Altern? Das war weit weg. Es gab auch Tage, an denen ich mir mit dem Optimismus einer 47-Jährigen dachte, so übel klinge es nicht. »Jahre des Wechsels«, Vorteile gebe es gewiss, die gab es schließlich immer. Tage mit derartigen Gedanken waren übrigens deutlich definiert: Jedes Mal, wenn meine Periode just wieder im Zug, im Flugzeug oder auf einer Bühne einsetzte, wusste ich, worauf ich mich freute.
Während des nächsten Besuchs in meinem Elternhaus kam mir beim Karottenschneiden in der Küche erneut die Fahrt in den Sinn, und ich fragte meine damals 80-jährige Mutter nach ihren Wechseljahren. Ich war, als sie ihre »zweite Pubertät« erreichte, wobei sie als Kriegskind vielleicht eine erste Pubertät nie erlebt hatte, bereits aus dem Elternhaus ausgezogen und hatte keine Ahnung davon, wie sie ihre Wechselzeit empfunden haben mochte.
Meine Mutter verdrehte die Augen, was sie anders als ich selten macht, und sagte: »Das schlimmste Jahrzehnt.«
Alles danach sei Zuckerschlecken im Vergleich. Der 60. Geburtstag der beste überhaupt.
Das war eine Aussicht.
Aber erst musste ich 50 werden.
Ein neuer Spiegel
50 wird man, wie man sagt, »ganz von selbst«, und doch kam alles anders als gedacht.
Ich war 37 geworden, hatte geheiratet, ich war 40 geworden, wir hatten gefeiert, ich war 47, wir versorgten ein dreijähriges Kind, ich wurde 49 und machte kein Geheimnis daraus, ich arbeitete, es ging mir gut. Kaum sah ich mich um, wurde ich 50, ich feierte diesen Geburtstag, nicht wir, kaum hatte ich mich umgesehen, bestand meine Familie nur mehr aus mir und meinem Kind. Als alleinerziehende Mutter war ich nun exakt das, wovor ich ein Leben lang davongelaufen war.
Eine Bekannte, jünger als ich, fragte ein paar Wochen später unverblümt: »Hat er dich des Alters wegen verlassen?«
So deutlich hatte ich mir das selbst nie vorgesprochen. Die Frage erschreckte mich. War es so?
Nach 20 Jahren Gemeinsamkeit geht eine Beziehung aus einer Reihe von Gründen auseinander. Wie man sich entwickelt hat, welche Zukunftsvisionen Phantasie und Verstand beleben, welche Ängste einen umtreiben, wie lebendig man als Paar geblieben ist, spielen eine Rolle. Alter ist ein Teil jedes dieser Aspekte.
»Genau«, sagte ich. »Er hat mich des Alters wegen verlassen. Seines Alters!«
Der Satz überraschte mich selbst. Ich hatte bislang nicht gewusst, dass ich ihn wusste.
Für meinen Mann bedeutete der 50. Geburtstag gewiss etwas anderes als für mich, doch auch ihm stellten sich Fragen zur Bedeutung des Älterwerdens. Männliche Körper verändern sich ebenfalls. Unsere Aussichten unterschieden sich, zum Teil aus biologischen, vor allem aber aus gesellschaftlich-kulturellen Gründen. Jeder musste mit seinem Päckchen umgehen.
Er hatte sich eine jüngere Frau gesucht. Oder sie sich ihn. »Zurück auf Start« war die Option, für die er sich entschied. Die neue Frau war so alt wie ich, als wir uns kennengelernt hatten. 17 Monate später kam das erste Kind.
»Er brauchte einen anderen Spiegel«, sagte meine Bekannte.1
Das stimmte. Aber ich brauchte diesen neuen Spiegel ebenfalls. Was war wirklich passiert? Wo befand ich mich – und wie wollte ich in Zukunft leben?
Die üblichen Zuschreibungen (Wechseljahre, ältere Frau, nicht mehr familiengründungsfähig, asexuell) fand ich, gelinde ausgedrückt, nicht ideal. Da ich den Spiegel nirgends entdeckte, beschloss ich, mich auf die Suche nach ihm zu machen. Ich begann, über die Wechseljahre nachzudenken. Dass ich mit meiner Mutter nie anders als in Kurzfloskeln über diese Zeit gesprochen hatte, fiel mir erst jetzt auf. Unterhaltungen mit gleichaltrigen Freundinnen halfen, aber auch hier blieb oft ein Gefühl der Leere zurück. Sie verfügten nicht über mehr Sprache zum Thema als ich, und wenn wir auf »Hormonschübe und Folgen« kamen, schweiften wir bald und gern ab: Trennungsgeschichten und Patchworkunfälle – wir schienen davon in zahlreichen Varianten umgeben – waren einfach spannender. Das Wechseljahresthema versteckten sie in etwa so geschickt, wie wenn sich die hochattraktive Claire Underwood aus der Serie House ofCards in einem engen, ärmellosen Kleid beim Weinholen kurz mit dem gesamten Oberkörper in den Kühlschrank lehnt. Ihr Gast, eine Frau ihres Alters, macht eine andeutende Bemerkung dazu. Claire antwortet, das alles sei ihr neu. Für einen Augenblick scheint Unsicherheit, ja Schüchternheit auf. Dann ist das Thema weggedrückt.
»Alles neu.« Dass meine erste eigene Ahnungslosigkeit über das Altern als Frau zwischen 40 und 60 damit zu tun hatte, dass der gesamte Bereich für viele der älteren (und nicht nur dieser) Generation mit Scham besetzt und von sprachlicher Hilflosigkeit und Einsamkeit geprägt ist, war mir inzwischen deutlich. Es fehlen gesellschaftlich etablierte Formen, über das Altern als Frau anders als im Modus des Defizits und seiner Behebung (»so bleibst du attraktiv für deinen Mann«) oder medizinischer Fürsorge zu sprechen. Dieses Fehlen ist schmerzlich: Es bedeutet, dass das, was erlebt wird, schon in diesem Erleben diffus bleibt. Es kann nur unzureichend ausgedrückt und daher auch nur unzureichend erinnert werden. Die Sprachlosigkeit wird an die nächste Generation weitergegeben.
Auch ich fühlte mich unsicher und schüchtern der neuen Lebensphase gegenüber. Weder mit bloßen Gedanken, bloß praktischen Tipps (Lagenlook, Coolpacks, Pflanzenmedizin) oder bloßen Gefühlen kam ich weiter. Der neue Spiegel würde sich nur aus Lebensgeschichten zusammensetzen lassen. Ich brauchte Mütter, Großmütter, Töchter – Frauen in allen Altersstufen.
Vor allem aber, und zuallererst, brauchte ich die richtigen Fragen. Was finden wir vor zu dem Thema Älterwerden – und was erleben wir? Was stellen wir an mit der Sphinx und dem Altersmodell, das Ödipus ihr anbietet? Ohne Nachdenken über unseren generellen Lebensgang durch die Zeit ist die Epoche der Wechseljahre nicht zu verstehen. Beides gehört zusammen: Die hormonelle Umstellung ist ein spezifischer Fall innerhalb des dauerhaften Prozesses, den man Altern nennt. Wie macht man dieses doppelte Erleben als Raum von Verwandlung für sich fruchtbar, neugierig darauf, was kommt angesichts des Weges, den man bereits gegangen ist. Und wie erzählen wir uns und anderen die Geschichte dieses Lebensabschnitts, der, schwer und leicht gleichermaßen, voller Überraschungen steckt.
Neutrum sein
Die Sonne scheint, es riecht nach Abgasen, Pommes, Ferien. Meine Tochter sitzt im Auto und weigert sich auszusteigen. Kopfhörer, Handy. Sie hört Harry Potter, auf Englisch. Unsere Welten überschneiden sich. Neben mir wird türkisch gesprochen. Ein Bus fährt auf den Parkplatz der Raststätte, etwa hundert über 80-Jährige steigen aus. Minuten später ein weiterer Bus, erneut voller Greise und Greisinnen. Alte Menschen haben Zeit. Alte Menschen und das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik stellen eine innige Verflechtung dar. Ich bin froh, dass ich die Toilette bereits besucht habe. Für die nächste halbe Stunde wird sie unbenutzbar sein. Ich schwöre mir, egal wie alt ich werde, niemals auf eine Altenbusreise zu gehen.
Jede Generation findet ihre eigenen Formen, mit den Lebensjahrzehnten umzugehen. Es gibt also Hoffnung, sage ich mir, auch wenn, wie wir alle wissen, die Zahl der über 60-, über 70-, über 80-Jährigen steigen wird. Und dann noch einmal steigen.
Die Sonne scheint, hat sich aber hinter Wolken versteckt. Mir ist angenehm warm. Genauer gesagt, ziemlich warm.
Nur mir?
Ich sehe mich um. Niemand beachtet mich. Jede Menge Männer unterwegs auf so einem Parkplatz. Was ist los mit den Männern, denke ich, was hat sich verändert, sie sind so zurückhaltend. Nach einer Weile ist klar: Nichts hat sich verändert. Es wird geschaut. Hinterhergeschaut. Jetzt fällt es mir wieder ein: Ach so, es liegt an mir. Ich bin es, ich stehe hier offensichtlich in dieser neuen Verborgenheit herum. Im Harry-Potter-Universum ist das praktisch. Harry wirft sich den Umhang über, der unsichtbar macht. Wenn er will. Hat er genug, zieht er ihn ab.
Als ältere Frau wirft man sich nichts um, sondern bekommt etwas übergestülpt. Schon ist man verschwunden, allemal neben einer jüngeren Frau. Höflichkeit oder Zuvorkommenheit verabschiedet sich gleich mit. Der Taxifahrer jüngst nahm das Trinkgeld, stellte die Quittung aus und dachte gar nicht daran, den Koffer aus dem Kofferraum zu hieven. Souverän blieb er sitzen, drückte den Knopf neben dem Steuer, damit die Klappe sich hob. Selbst ist die ältere Frau, die noch beweglich wirkt, nützlich, Eigenversorgerin doch mindestens.
Die Frau? Oder doch: das Neutrum?
Grotesk wurde es neulich in der Bankfiliale, als die Auszahlungsautomaten nicht funktionierten. Ich war die Letzte in der Schlange. Ein Mann meines Alters, einen Kopf kleiner, dicker Bauch, stellte sich vor mich. Als ich mich beschwerte, sagte er: »Du hast doch eh nichts mehr zu tun.«
Grotesk auch das Wesen, das in dem Haus putzt, in dem ich wohne. Um die 35, vierschrötig, Raucher. Vier Wochen lang ignoriert er mich. Ich grüße, wenn ich aus dem Lift komme, er sagt nichts. In der fünften Woche motzt er mich an. Ich habe zu viel Papier in die Tonne gesteckt. Die Tonne ist halb leer, aber er möchte seinen Müll bequem hineinschütten können. Interessanter Fall: Er versucht es mit Einschüchterung. Ich bekomme ab, wie es »normalerweise« zugeht zwischen jungen Machos und älteren Frauen. Freundlich führe ich das »Sie« zwischen uns ein, stelle mich vor und frage den charmanten Herren nach seinem Namen. Er setzt sich und raucht. Nun ist er kleiner als ich. Ungeschickt. Seinen Namen, sagt er, sage er nicht. Da die Hausgemeinschaft den Mann bezahlt, kenne ich seinen Namen so oder so. Wenigstens das muss ihm doch klar sein. Sein Gesicht hat sich verwandelt, ich sehe das schmollende Kind in der Schulbank. Offensichtlich nimmt er mich als Lehrerin wahr.
Auch das freundlichere, weiblich-männlich gemischte Umfeld, in dem ich mich im Alltag bewege – beim Einkaufen, in der Straßenbahn, als Publikum im Kino oder bei einem Konzert, als Mutter in der Schule, als fernere Bekannte, als Verwandte in der Familienkonstellation –, spiegelt mir überwiegend und mit einer Leichtigkeit, die verrät, wie tief die Klischees sitzen, dass ich nützliches Neutrum sein darf. Ich begegne Männern mit 45 Jahren, mit 60 Jahren, und bemerke an ihren Augen sowie in jeder ihrer Gesten, dass sie mich nicht als Frau wahrnehmen. Ich bin Hindernis, grau wie der Einkaufskorb, ein Zwischending. Dieses »Ding« darf auftreten als Vermittlerin, Helferin, Erzählerin, Essenslieferantin, Patientin, Konsumentin, ehrenamtliche Hummel, Bezahlerin und praktisch-fleißiges, mit Armen und Beinen ausgestattetes Menschmodul, das den Zwischenjob übernimmt. Auf einer Party fungiere ich als eine Art sprechfähiges Möbelstück: »Weißt du, wo der Flaschenöffner ist?« Fünf Minuten später erkennt mich der Frager nicht mehr. Er hat mich gar nicht gesehen. Zunehmend fühle ich mich umgeben von einer Watteschicht, durch die hindurch man mich für eine Art Wand hält.
Dieses mir angetragene, auf mir durchgeführte Frauenwesen, das so herrlich neutralisiert aussieht, so schweigsam und nützlich, ist eine Chimäre. Ganz wie die schöne Zweiteilung der Frau in hinten und vorn. Mit einem Lächeln, das ihren Schmerz nicht vollständig verbarg, erzählte mir eine Bekannte, Mitte 50, lange, blond(gefärbt)e Haare, ihr Mann habe jüngst ihr Äußeres kommentiert: »Hinten Lyzeum, vorne Museum.«
Munter nach der Devise: Das hast du nun davon. Dich gepflegt, Sport getrieben, Diät gehalten. Und ich sage dir das ins Gesicht.
Man sieht einen knackigen Po. Seine Besitzerin dreht sich um. Die Prägung durch Kultur, Bild und Werbung ist so stark, dass immer, automatisch, ein junges Gesicht erwartet wird. Doch da steht meine Bekannte, in ihrem Alter. Eine Person, weder in vorn noch hinten geteilt.
Eben dies soll offensichtlich nicht sein; hier muss man sich lustig machen. Eine Frau darf nicht alt sein, aber ist sie älter, darf sie erst recht nicht jung wirken (außer auf Bildschirmen). Sie darf nicht anders aussehen, als das Altersklischee »Neutrum« es vorsieht, und eines soll sie allemal nicht: auf »wirkliche«, heterogene, individuelle Weise in ihrem Alter sein.
Anders gesagt: Wo, wie und als wer kommt die Frau in den Wechseljahren in unserer Gesellschaft vor?
Manchmal ist mir nun doch, als wären die Männer ausgetauscht worden. Betroffen sind vor allem, aber nicht nur, die unter 60 Jahren. Also auch jene, die sich im gleichen Alter befinden wie ich. In der Regel unterhält man sich mit mir (nur), wenn ich Teil einer größeren Gruppe bin. Manchmal hat man auch Zeit für eine Begegnung mit mir zu zweit. Gesucht werden Rat, Coaching, Halbmütterlichkeit. Ebenso deutlich ist, was nicht interessiert.
Wie soll ich damit umgehen, nein: gut zurechtkommen? Ich fühle mich dabei lächerlich. Mich bedrückt, was mir widerfährt. Zugleich will ich mir diesen Schuh (Pause, Jenseits, auf dem Omaweg) nicht anziehen. Da ich keinen Verhaltenscode entdecken kann, der mir passt, muss ich ihn erfinden. Das ist sehr viel leichter gedacht als getan. Wie sagt man auf Englisch: I am at a loss. Ich weiß nicht weiter. Aber auch: Ich gehe verloren; etwas ist mir geht verloren. Ich brauche nicht danach zu suchen, denn nicht, was war, muss wiederhergestellt werden. Ich brauche etwas Anderes: mich selbst in meiner neuen Form. Als Frau, die weiß, wer sie in diesem Alter ist, welche Bedürfnisse sie hat, und die sich trotz Einschüchterungen nicht davon abhalten lässt, diese Bedürfnisse auszudrücken.
Hilfe kommt von völlig unerwarteter Seite, aus meiner Erinnerung. Hauptakteure: zwei ältere Männer.
Füße in der Luft
In meiner Kindheit hieß Älterwerden für mich, beim Sitzen in Bussen oder der Straßenbahn mit den Beinen auf den Boden zu reichen. Ich hatte diese Festigkeit der Füße auf dem Grund stets bewundert, stets darauf geachtet, wie andere das machten, während ich noch immer in der Luft pendelte wie meine jüngere Schwester. Endlich war es so weit. Welch Erfolg. Irritiert bemerkte ich, dass auch etwas verloren ging. Es hatte jedes Mal Spaß gemacht, frei im Sitzen mit den Beinen hin und her schlenkern zu können. Mein gesamtes Leben bis zu just diesem Tag hatte ich so unbehindert vor mich hin gestrampelt wie einst im Kinderwagen. Das war dahin.
Bis auf eine Ausnahme.
Zu verdanken hatte ich sie dem vornehmsten meiner Onkel. Er war fast zwei Meter hoch, breit und kräftig, ohne schwerfällig zu sein. Kinder, mich zumindest, setzte er gern auf dem Wohnzimmerschrank ab, vermutlich weil er sich dann besser unterhalten konnte; von seinem Kopf nach unten war es weit. Onkel Schrank gehörte zur Familie meines Vaters. Wie mein Vater war er nach dem Zweiten Weltkrieg aus »dem Osten« nach Bayern gekommen. Er hatte noch vor 1933 Jura studiert und war in den 50er-Jahren in München in den Vorstand einer Versicherungsgesellschaft aufgestiegen, die in einem Jugendstilpalais residierte, dessen lange, spiegelnde Parkettgänge ich mit dem immergleichen Bedauern betrat: Hier musste man Rollschuh laufen. Und durfte es nicht.
Kam dieser Onkel zu Besuch, brachte ich mich bereits an der Haustür in Flugposition. Ehe ich mich versah, wurde ich mit zwei Fingern in die Luft gehoben und auf Vaters heiliger Wohnzimmer-Einbaufront platziert. Die Fugen, der Lack, das Geld. Wäre es nach dem Hausherrn gegangen, hätte mein Po niemals das wertvolle Holz berührt; meine Mutter wäre nicht hinaufgekommen und hätte es ohnehin nicht gewagt, Vaters Regeln zu missachten. Nur der sagenhafte Onkel ließ mich schweben und auf meinem Thron landen.
Für ein Mädchen von drei oder vier Jahren stellt ein Zwei-Meter-Schrankonkel den Inbegriff von Erwachsensein dar: so groß werden. Auch wenn diffus klar ist, dass das nicht eintreten wird. Der Unterschied ist bereits rein körperlich überwältigend. Dieser Mensch wiegt zehnmal mehr als man selbst, er ist riesig (Gulliver ein Nichts gegen ihn), man sieht die Nasenlöcher von unten, sprich das Gesicht stets nur in der Perspektivverkürzung. Auf seinen Kopf blickt man nie. Und allein der Oberarm. So dick wie das gesamte eigene Ich an seiner stärksten Stelle, dem Bauch.
Der große Onkel allerdings hatte ein Gegenstück. Während er regelmäßig zu Besuch kam, reiste Onkel zwei nie. Er gehörte zur Familie meiner Mutter und war wie der Schrankonkel nach 1945 nach Bayern geflohen. Er arbeitete als Metzger in Niederbayern, ein Zwerg von höchstens 1,55 Meter mit großem, eckigem Kopf und langem Haar, das er zum Arbeiten unter einer Plastikhaube versteckte. Mit Worten ging er äußerst sparsam um.
Besuchte man ihn, wurde man irgendwann in den Kühlraum geführt, in dem das Schlachtfleisch hing. In Gummistiefeln und einer weißen, ihn ganz und gar bedeckenden Plastikschürze, die zwar sehr sauber war, aber schon lange nicht mehr weiß, zerteilte dieser Onkel die vor dem Kühlraum immerhin felllos, aber keineswegs zehen-, schwanz-, huf- oder kopflos angelieferten Kadaver. Der Kühlraum lag neben der Garage. Über der Garage befand sich das Wohnzimmer. Manchmal stand das angelieferte Fleisch auch vor der Garage in Wannen auf einem Tisch. Riesenwannen. In die eine, leere, wurden Innereien und andere Reste geworfen, um weiter sortiert zu werden. Die Tiere waren tot, doch lebendig glitschten die Därme. Die kopfüber von den Deckenhaken hängenden Ferkel sahen nach rosig echten Ferkeln aus; süß roch das frische Fleisch. Am Boden vor den Wannen krochen noch kleinere Wesen als ich, die Katzen. Sie tatzten nach dem einen oder anderen heruntergefallenen Brocken und nagten ihn an; stumm stand ich dabei. Das Klatschen der Fleischstücke, der Onkel bis zu den Ellbogen in blutigen Lappen, was für eine Wirklichkeit. Ich galt darin als eine Art Zwischenwesen. Kein Ferkel, nur rosig, keine Katze, schon sprechfähig. Auch dies also war Älter- und Erwachsenwerden: Man stand, man schwieg, man verrichtete Arbeiten, die keiner sehen wollte, eklig und faszinierend, es gab eine Seite, da verkaufte man, und einen Raum, in dem, was verkauft wurde, tatsächlich war, was es hieß: roh.
Dies allerdings ist erst die erste Hälfte der Geschichte. Beide Onkel zählten, als meine Erinnerung an sie einsetzt, über 60 Jahre. Von beiden ging Selbstsicherheit aus, und beide waren mehr als »nur männlich«: Etwas Weibliches gehörte zu ihnen. Onkel Großschrank hatte nicht nur einen Bauch , sondern auch einen Busen, dazu ein rundes, immer perfekt glatt rasiertes Gesicht. Männlich an Größe und Stimme, weiblich die Züge: eine gealterte Riesin. Der Metzgeronkel hielt es nicht anders mit den doppelten Zeichen: Bart und Zopf, frauenkleine Hände und Schuhe, leise die Stimme.
Auch diese Onkel, 20 Jahre älter als meine Eltern und ihre Freunde, waren Zwischenwesen. Männer, gewiss, verheiratet, mit Familien. Und doch trat auch das andere Geschlecht an ihnen hervor und vermischte sich mit ihrer Männlichkeit. Später erst lernte ich ältere Frauen kennen, bei denen es sich spiegelnd verhielt: weibliche Kleidung, weiblicher Knochenbau und ein Gesicht, das seine eindeutige »Geschlechtlichkeit« verloren hatte. Es war mit dem dritten Lebensdrittel allgemein-menschlicher geworden.
Auch dies also hieß Altern: hineinwachsen in die eigene Geschlechtlichkeit – und wieder aus ihr heraus?
Onkel Schrank hatte als Einziger der Familie ein altphilologisches Gymnasium besucht. Kaum saß ich über ihm und pendelte mit den Beinen, sprach er auf Lateinisch mit mir. Latein war die Schranksprache. Naturgemäß verstand ich nichts, nach einiger Zeit aber doch. Esel kamen darin vor, Elefanten, Kriege und Siege. Was er sagte, war nicht unbedingt unverständlicher als das, was ohnehin unter den Erwachsenen verhandelt wurde oder wenn jemand in dem alten Bayerisch, wie es im Herkunftsdorf meiner Mutter manchmal zu hören war, etwas zu mir sagte. Im Gegensatz zu dieser Sprache am Erdboden, bei fauligen Äpfeln und Wespen im Gras, war die Schrankreise eine Himmelfahrt. Ich stand unter dem Schutz eines »närrischen« Onkels, dem erstaunlicherweise alle mit höchster Achtung begegneten.
Onkel Schrank, von meinem Thron aus entdeckte ich es, hatte eine Glatze.
Sie leuchtete.
Man zollte ihm Respekt. Hatte dies mit seinem Umfang zu tun? Oder mit dem Unfug, den er mit mir betrieb? Erst heute weiß ich, dass, geht alles gut, Bildung wesentlich dazu beitragen kann, das Spaßpotenzial im Leben zu steigern und sich eine so heitere wie kluge Kindsköpfigkeit zu bewahren. Die Freude daran, etwas auszuprobieren, kennzeichnet diese Geisteshaltung ebenso wie gedankliche Spiellaune und eine Portion Mut zu Unkonventionalität.
Im Zeichen dieser Haltung steht die Reise, die dieses Buch unternimmt. Es denkt nach. Und erzählt.
Vom Schrank blickte ich auf die mir nächsten Menschen. Die kahlen Stellen ihrer Köpfe spiegelten. Ich sah in ihre Leben hinein.
»Ich kann gar nicht sterben«
Bekannte, die bereits Nachwuchs aufzogen, verkündeten mit halb ironischem, halb überlegenem Blick, man werde sich noch wundern, wenn das Kind erst einmal da sei. Nach dem x-ten Kommentar dieser Art wunderte ich mich in der Tat: Worum wurde hier ein Geheimnis gemacht? Sollte es dabei allen Ernstes nur um ausgefallene Kinobesuche und verändertes Partyleben gehen?
Ich bekam eine Tochter. Von Schlaflosigkeit und ihren Langzeitauswirkungen hatte ich, wie ich bald wusste, nichts gewusst; ich lernte auch neu, was Wiederholung bedeutet. Ausgehen oder Nichtausgehen erwies sich nicht als schwierig, dafür war ich die meiste Zeit ohnehin zu müde. Zu meiner Überraschung allerdings gab es tatsächlich ein Geheimnis:
Mit dem eigenen Kind rückte ich eine Stufe in der Generationenfolge voran. Das war, rein rechnerisch, auch zuvor klar. Doch mich überraschte, wie sehr sich unter der Hand mein Selbstverständnis wandelte. Wie bei einem Erdrutsch geriet es in Bewegung. Nicht dort, wo ich nachdachte oder Entscheidungen traf, sondern im Bereich tiefster Bilder, seelisch oder psychisch, auf der Ebene der ersten Fragen und Träume, trat die Veränderung ein.
Seltsam, bei welchen Vorstellungen ich mich ertappte. Offensichtlich hatte ich noch immer wie als Mädchen gedacht, als ich sehr deutlich empfunden hatte: Da bin ich, ganz jung, ich sterbe jetzt nicht. Vor mir stehen meine Eltern, sie sind mittelalt, auch sie sterben jetzt nicht. Zum Sterben haben wir ja die Großeltern. Die sind alt und gehen als Nächste, so funktioniert die Welt. Als Kindergartenwesen lebte ich außerordentlich sicher, sozusagen doppelt abgepuffert.
Insbesondere bei Familienzusammenkünften trat diese Gewissheit hervor. Häufig waren meine Schwester und ich die einzigen Kinder, litten also unter extremer Langeweile, was meine Schwester damit löste, in den Garten zu verschwinden (sie mochte Würmer). Mich interessierten Nacktschnecken und Maden nur mäßig. Da schien es mir immer noch besser, den Erwachsenen zuzuhören.
Zu dieser schönen Übung verkroch ich mich mit Vorliebe unter den Tisch, an dem Bärenmarke-Kondensmilch mit Kaffee getrunken und extra Schlagsahne auf den bereits großzügig mit Buttercreme gefüllten Frankfurter Kranz geschlagen wurde.
Unter einem Tisch herrscht extremes Leben. Es gehört Füßen, Beinen, Säumen, Kniescheiben. An ihnen erkannte man, um wen es sich handelte, sah aber über Alter und Geschlecht hinaus immer auch Details zum Zustand der Person, die die oberirdische Erscheinung verdeckte oder zu leugnen suchte. Wie dick war der Stützstrumpf? Wie braun der Schuh? Mit welcher Art von Absatz? War das Bein rasiert oder nicht, guckte wieder bei einem der Männer der weiße Hautrand über dem Sockengummi heraus? Mutter rieb sich ein Hühnerauge am Tischbein. Andere kippelten mit dem Stuhl, einer Tante fiel der Schuh halb vom Fuß. Und wie bewegten sich die Beine mit den Mündern und den Worten, die ich von oberhalb der Tischplatte vernahm? Und wie im Widerspruch zu ihnen?
Die Ordnung der Unterwelt war großartig und klar. Unter einer Tischplatte wird nicht gelogen. Großeltern links, die Jüngeren beweglich um sie herum. Sie starben später, ganz wie ich auf dem Teppich, so perfekt versteckt unter dem Nussbaumholz mit seinen Scharnieren, dass der Tod mich niemals finden würde. Diese Stufenfolge, sagte das Gewissen, ist vollkommen richtig, eine Art versprochene Lebensgerechtigkeit.
Mit 14 Jahren verliebte ich mich in Holly. Holly war der bestaussehende Junge weit und breit. Kaum erschien er, knallte es nur so – in unseren Mädchenköpfen. Ich wagte kaum je, überhaupt mit ihm zu sprechen. Er kam bei einem Mokick-Unfall ums Leben; den vorgeschriebenen Helm hatte er getragen, aber nicht geschlossen. Ich erinnere mich daran als Zeitenwende: Damals zerbrach sie, die Immunität des Kindes vor der Vergänglichkeit.