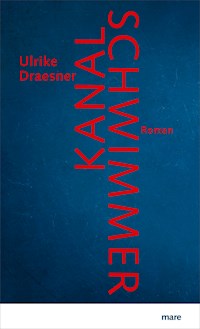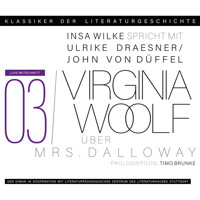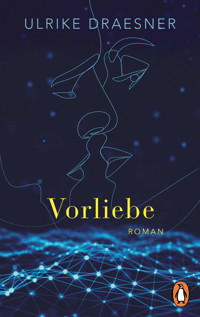21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ulrike Draesner knüpft mit dem aus Liebe gesponnenen Band zwischen Mutter und Kind ein Textgewebe – so dicht, dass es auch ein Roman über unsere Gegenwart ist.« Cornelia Geißler, Berliner Zeitung
Mit einem Flug nach Sri Lanka, wo ein Kind auf seine zukünftigen Eltern wartet, beginnt in Ulrike Draesners »zu lieben« eine Reise ins Ungewisse. »Ich hatte mir immer eine Familie gewünscht. Irgendwann dachte ich, dieser Wunsch erfüllt sich nicht mehr. Da kam ein Anruf, und ich wusste, es wird einen neuen Menschen in meinem Leben geben. Davon will ich erzählen: von Hürden, Begegnungen, der ersten Nähe. Von Fremdheit. Es ist die Geschichte vom Ernstnehmen eines Kindes. Die Geschichte einer Mutter, deren Mutterschaft immer gefährdet ist. Unsere Geschichte.«
Wie wird man eine Familie? Was bedeutet Elternschaft in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen nach neuen Formen des Zusammenlebens suchen? In der das Leibliche und Soziale, Herkunft und Identität ideenreich verhandelt werden müssen – und können? Unkalkulierbar der Prozess, groß die Überraschungen, notwendig der Humor. Was denkt wohl Mary, das dreijährige Mädchen, das die Welt wechseln muss? Was geschieht mit den Eltern als Paar? Und wie findet man sich, ist der Rückflug erst einmal geschafft, als bunte Familie im Deutschland der weißen Menschen zurecht?
Voller Lebenserfahrung erzählt Ulrike Draesner eine tief berührende Geschichte über die Liebe zwischen Mutter und Kind. So nah, so offen und warm, wie man sie noch nie gelesen hat.
- Die kluge und zärtliche Geschichte einer von Beginn an ungewöhnlichen Elternschaft - Ulrike Draesners persönlichster Roman jetzt erstmals im Taschenbuch
- »Ulrike Draesner, Sprachkünstlerin und mit dem Talent ausgestattet, Sätze zum Klingen zu bringen, hat ein Buch geschrieben, das nachhallt, aufwühlt, froh macht. Was kann einer Schriftstellerin Besseres gelingen?« Melanie Mühl, FAZ
- »Ein kluges, bereicherndes und berührendes Buch.« Bettina Balàka, Die Presse
- »Es gab in den letzten Jahren zahlreiche Bücher über Elternschaft. ›zu lieben‹ ist eines der vielschichtigsten, dabei offensten und empathischsten.« Nico Bleutge, Deutschlandfunk Büchermarkt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
»Ich hatte mir immer eine Familie gewünscht. Irgendwann dachte ich, dieser Wunsch erfüllt sich nicht mehr. Da kam ein Anruf, und ich wusste, es wird einen neuen Menschen in meinem Leben geben. – Davon will ich erzählen: von Hürden, Begegnungen, der ersten Nähe. Von Fremdheit. Es ist die Geschichte vom Ernstnehmen eines Kindes. Die Geschichte einer Mutter, deren Mutterschaft immer gefährdet ist. Unsere Geschichte.«
Mit einem Flug nach Sri Lanka, wo ein Kind auf seine zukünftigen Eltern wartet, beginnt in Ulrike Draesners persönlichstem Buch eine Reise ins Ungewisse. Sie handelt von Ängsten, Zärtlichkeit, von Identitäten zwischen den Kontinenten, von Missverständnissen und Gefahr. Wie wird man eine Familie? Was bedeutet Elternschaft in einer Gesellschaft im Umbruch, in der immer mehr Menschen nach neuen Formen des Zusammenlebens suchen? Unkalkulierbar der Prozess, groß die Überraschungen, notwendig der Humor. Was empfindet wohl Mary, das dreijährige Mädchen, das die Welt wechseln muss? Was geschieht mit dem Elternpaar? Und wie findet man sich, ist der Rückflug erst einmal geschafft, als bunte Familie im Deutschland der weißen Menschen zurecht?
Voller Lebenserfahrung erzählt Draesner eine tief berührende Geschichte über die Liebe zwischen Mutter und Kind. So nah, so offen und warm, wie man sie noch nie gelesen hat.
»Ulrike Draesner ist eine der bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen der Gegenwart.« Times Literary Supplement
www.penguin-verlag.de
Das Geschriebene kommt wie der Wind, es ist nackt, es ist Tinte, es ist das Geschriebene, und es geht vorüber, wie nichts anderes im Leben vorübergeht, nichts weiter, außer das Leben.
Marguerite Duras
»Ach was«, sagte Pippi. »Wenn das Herz nur warm ist und schlägt, wie esschlagen soll, dann friert man nicht.«
Astrid Lindgren
wahren, Verbum, ›in acht nehmen, hüten, schützen, (einen Zustand) aufrechterhalten‹, mittelhochdeutsch war(e)n ›aufmerken, achten, beachten‹, ist im Sinne von ›unter seine Aufmerksamkeit, Obhut nehmen‹ von dem im Althochdeutschen belegten Substantiv wara ›Wahrnehmung, Beobachtung, Aufmerksamkeit, Obhut‹ abgeleitet. Dieses ist mit den unter gewahr angeführten Formen verwandt, außergermanisch mit griech. horān (ὁρᾶν) ›schauen, aufmerksam sein, betrachten, sehen‹. Zugrunde liegt eine Wurzel indoeuropäisch *uer(e)- ›achten, gewahren‹. (Wörterbuch der Brüder Grimm)
– eine Wahre-Geschichte
ULRIKE DRAESNER
zu lieben
Roman
Alle Figuren dieses Textes sind so frei erfunden, wie man es sich nur denken kann.
Die Buchstabenbilder stammen von der Autorin.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagabbildung: © Andrew Macara All rights reserved 2024/Bridgeman Images
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31478-1V003
www.penguin-verlag.de
1
Die Nachricht
Als die Nachricht kam, saß ich mit einer Germanistin in einem Café in München. Es war das Omacafé. Meine Oma kaufte dort Katzenzungen, solange sie lebte. Schon allein deshalb gehe ich kaum in dieses Café. Ich mochte meine Oma. Sehe ich die Katzenzungen, vermisse ich sie. Auch Katzenzungen mag ich, trotz des Namens. Katzen haben Glück, dass ihre echten Zungen nicht schmecken und in Schokolade nachgeformt werden müssen. Wer isst was, wer bekommt wen, was haben Mutterschaft und »ich verschlinge dich« miteinander zu tun?
Aus Zufall waren wir in dem Omacafé gelandet. Die Germanistin kannte ich nicht, sie hatte um ein Gespräch gebeten für einen Lexikonartikel, an dem sie arbeitete, und ich sah sie danach nie wieder. Die Nachricht kam über das Telefon. Nachdem ich aufgelegt hatte, umarmte ich die mir nicht weiter vertraute Frau. Die nun ebenfalls gerührt war. Die Hasen in ihrer Wohnung durften frei laufen, sie nagten Elektrokabel an – mit Glück, Pech oder Lernerfolg. Die Wohnung, in die sie mich in ihrer Aufregung an diesem Vormittag führte, roch nach den Tieren. Es war nicht unangenehm. Das Stroh lag in der Küche. Die Hasen waren Kaninchen, die Germanistin ohne Kind.
In dem Café hatte ich vergessen, die Katzenzungen zu kaufen, die meine Oma gekauft hätte. Meine verlorene Oma, so die Nachricht, würde nun Urgroßmutter werden. Meine Mutter würde sich in eine Großmutter verwandeln, wäre sie das nicht längst gewesen. Drei Kinder hatte meine Schwester in die Welt gebracht, die Lieblingsnichte meines Vaters vier, In-vitro-Fertilisation nur beim letzten. Vollkommen selbstständig waren sie alle gewachsen, eigenfamiliäre, blutsverwandte, sogenannt natürliche, nackt und schmierig, mit allen Gliedern geborene Namensträger, die insbesondere meinem Vater als die richtige Verwandtschaft am Herzen lagen. Dagegen war nichts einzuwenden, es handelte sich um ein verständliches Gefühl, Teil der Welt meines Vaters (»Namensträger«), die ich nicht teilte, die sachlich nicht einmal mehr stimmte, doch dieses Denken und der damit verbundene Blick standen im Raum und schmerzten.
Auch wir würden nun ein Kind bekommen, so die Nachricht. Auf dem Weg in die germanistische Hasenwohnung rief ich meinen Mann an. Er war damals noch mein Mann, nicht mein Exmann. Für Sekunden, die sich dehnten wie die süßen Bohnenpastekugeln, die wir auf der Hochzeitsreise in Japan beim Stichwort »honeymoon« ständig ungefragt serviert bekommen hatten, blieb es sehr ruhig. Hunter saß in unserer Wohnung in Berlin, nahm ich an, zumindest sagte er nichts Gegenteiliges. Dass die Nachricht in einem Café gekommen war, in dem es Katzenzungen gab, die ich nicht gekauft hatte, interessierte ihn weniger. Ich weiß auch nicht, warum ich ihm dies als Erstes erzählte.
Die Ruhe inmitten des Landes
Der Rest des Tages ist verschollen. Ich glaube, ich traf noch den Rheumatologen Herrn Dr. F. Ich hatte keine Schmerzen, keine Ausfälle, keine geschwollenen Gelenke, nur Blutwerte, die auf eine rheumatische Erkrankung deuteten. Die Diagnose stellte sich später als falscher Alarm heraus, was auf die Nachricht, die über das Telefon gekommen war, glücklicherweise nicht zutraf. Sie war ein Alarm, wenngleich nicht falsch. Und vielleicht auch kein Alarm, wenn man es richtig bedenkt.
Mit dem Rheumatismusdoktor besuchte ich ein bayerisches Restaurant, das ich ohne den Wunschdruck eines anderen niemals betreten hätte. Wir verabschiedeten uns vor der Tür. Bäume kahl und kaum vorhanden, Sträucher kahl und kaum vorhanden, glatte Fassaden, Nachkriegsarchitektur, schachtelig, niedrig, Beton. Licht fiel auf den verschlossenen Boden, schattenlos. Mitte März. Eine Polizeistreife kontrollierte die parkenden Wagen, eine der Frauen, blond und pobreit in der unvorteilhaft geschnittenen Uniformhose, hatte einen stark russischen Akzent.
In dem Lokal hatte man nur Fleisch und Fleischartiges wie Leberkäse (überbacken oder nicht überbacken) serviert. Doktor F.s Frau war in einer Schleife verunfallt. So drückte er sich aus. Es handelte sich um die Auffahrtschleife vor dem S-Bahnhof, der zufällig der S-Bahnhof des Ortes war, in dem ich aufgewachsen war und in dem meine Eltern noch immer wohnten. In der Mitte der Unfallkehre lagen der Eingang zum Bahnhof sowie ein Kiosk, in dem mein Vater, der nun ein Großvater werden würde, wäre er nicht schon einer gewesen, regelmäßig (überaus regelmäßig) seinen Tabak kaufte.
Doktor F., der sich bereit erklärt hatte, mir von medizinischen Fällen zu erzählen, konnte meine Kind-Aufregung nicht teilen. Ich versuchte, sie zu verstecken, zum Ausgleich bebte sie umso entschiedener in meinem Untergrund (Magen und tiefer), was uns beiden (der Aufregung und mir) guttat.
Um mich abzulenken, schimpfte ich mit Herrn F. darüber, dass in dem Ort fast nur mehr alte Männer und Frauen Auto fuhren, was daran lag, dass nur mehr Menschen über siebzig dort wohnten. Es war ein stiller Ort, durchdrungen vom nahezu unhörbaren Summen der Batterien in PKWs, Rollatoren, Rollstühlen, Hörgeräten und Herzschrittmachern. Man saß in diesem Reichenort allein oder paarweise in überdimensionierten, oft mit Hirschgeweihen und Schnitzbalkonen geschmückten und ausnahmslos mit Sicherheitsschranken versehenen Häusern und fuhr in gleichermaßen überdimensionierten, ungeschnitzten Limousinen umher. Auch mein Vater hielt Autofahren für einen natürlichen Vorgang, der im Alter auf natürliche Weise weiter ausgeführt wird, sprich wie von selbst, war nur erst der Schlüssel in die Zündung gebracht. Der Abstand zwischen den Menschen blieb groß, metallgesichert und bakterienfrei, um sechs Uhr abends senkte sich der Frieden der Fernsehprogramme über den mitten in Deutschland liegenden, von Grenzbewegungen unberührten Ort.
Zufälle
Dass ich die Nachricht in München erhielt, verdankte sich einem Zufall. Ebenso wie der Umstand, dass ich selbst einst in München zur Welt gekommen war. Schon die Begegnung der Samenzelle und des Eis, aus denen ich zusammengesetzt wurde, war hochzufällig. Das ist bei allen Menschen so (Wettrennen, Einnistung und und), wir vergessen es bereitwillig. Meine Eltern betonten, dass sie sich nicht sicher waren, ob sie wirklich Großeltern wurden bei einem Vorgang, wo jemand (ich) ein Kind nur adoptierte, statt ihm mithilfe des eigenen Körpers das Leben zu schenken. Ihr »das ist ein fundamentaler Unterschied« war für sie so unumstößlich wahr wie »der Storch bringt die Kinder nicht«. Und das, obwohl sie mich kurz nach meiner Geburt auf der Entbindungsstation mit einem anderen Baby verwechselt und ohne fremde Hilfe nicht wiedergefunden hatten.
Waren sie mit Zufällen also nicht vertraut?
Neugeborene wurden ihren Müttern in den 60er-Jahren nur zum Stillen gebracht. Den Rest der Zeit lagen sie im Säuglingszimmer, ein wiegenartig geformtes Kunststoffbettchen am anderen, und konnten sich allein fühlen, was als hygienisch und praktisch galt. Bloß nicht verzärteln, den Balg, bloß nicht zu viel Bindung Mutter–Kind. Johanna Haarers nationalsozialistisches Erfolgsbuch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, leicht modifiziert, verkaufte sich unvermindert bestens. Besichtigende Eltern betrachteten den Nachwuchs durch die große Besucherscheibe. Die Babys lagen nicht unbedingt jeden Tag an der gleichen Stelle, man suchte das eigene, das man selbstverständlich erkannte, und bezog dort Position, von wo man es am besten betrachten konnte. So hatten es auch meine Eltern unter Führung meiner Mutter gehalten. Alles reine Freude, bis ein anderes Paar erschien und dasselbe Kind von derselben idealen Stelle aus bewundern wollte.
Vier Erwachsene, ein Säugling. Die herbeigerufene Schwester stellte fest, dass das Neugeborene, das meine Mutter so sicher als eigene Tochter erkannt hatte, den anderen gehörte. Meine Eltern, die damals nicht oder nur auf anstrengend unsichere Weise meine Eltern waren, standen mit einem Mal kindlos an der vermaledeiten Scheibe. Die Schwester suchte in den Babykörben nach einem Nachwuchs, an dessen Arm der richtige Name hing, ebenjene Buchstabenfolge, die heute als mein Nachname gilt. Dass ich offensichtlich nicht so aussah wie das Baby, an das meine Mutter sich vor dem Besichtigungsglas erinnerte – jenes frischgeborene feuchte Wesen, das ihr nach der Entbindung in den Arm gelegt und von ihr gehalten und gedrückt worden war –, wurde stillschweigend ignoriert.
Dank dieser Erfahrung sollten meine Eltern ein differenzierteres Verhältnis zu etwas wie »natürlicher Verbindung« oder »automatischem«, quasi eigenleiblichem Bonding haben. Doch wenn ich sage, dass nicht alles, was eindeutig scheint, dies auch ist, wollen sie nichts davon hören.
In der Tür
Nach dem Zufall, die Nachricht in München zu bekommen, flog ich nach Berlin. Falsch, ich fuhr mit dem Zug. Das ist heute ausnehmend korrekt und war schon damals richtig. Ich fliege nicht so gern, dass ich dauernd fliegen müsste, allemal nicht von München, wo bereits der Weg zum Flughafen eine Dauerkatastrophe ist. Sie dauert so lange an, wie es die Münchner S-Bahn und den Flughafen gibt, der seinerseits immer schon eine Umweltkatastrophe war, die noch dadurch vergrößert wird, dass er nur mit dem 150-Euro-Taxi oder der nichtfahrenden S-Bahn zu erreichen ist. Vor Jahren bereits hatte ich einen Flug verpasst, weil ich in der S-Bahn zum Flughafen eingesperrt worden war. Türblockade. Wer sich auskannte, stieg ohnehin nur mit Wasserflasche und Notfallbonbon ein.
Nach der Nachricht war mir dies alles egal. Die innere Unruhe summte auch an dem Tag nach dem Anruf vor sich hin und dehnte sich aus, im Schlaf, im Wachzustand, in der tuckelnd vorankommenden S-Bahn. Ich fuhr in einer Wirklichkeit umher, die ich kaum wahrnahm. Durch die Unruhe war ich mindestens einen Zentimeter größer als am Vortag, was ich vor den Menschen um mich herum zu verstecken suchte, obwohl es ihnen nicht auffallen konnte. Am Ende stand ich im Hauptbahnhof von München für eine Zeit zwischen den makellos sauberen Türen der Eingangsschleuse in das sogenannte Reisezentrum, die aufeinander zuglitten, sich berührten, sich erneut öffneten, und holte still und ganz für mich allein Luft.
Wie der Hase läuft
Die Woche nach dem Alarm, der kein falscher war, verging mit hektischen Bewegungen.
Über eine glühend heiße Autobahn rollte das Auto zum Beispiel zu einem Möbelhaus. Die saßen eines am anderen, wir gingen in das, bei dem wir den besten Parkplatz fanden, und kauften ein wie jeder vernünftige Mensch und jede schwangere Frau. Schwangere Frauen entwickeln Nesttrieb, heißt es. Ich war keine schwangere Frau, meine Triebe waren nicht generell unterentwickelt, der Nesttrieb fiel mir daher leicht.
Im Möbelhaus kauft man ein Mitnehm-Bettchen, das hoffentlich die richtige Größe hat, denn wie groß ist ein dreijähriges Kind, das man nie gesehen hat und das nun das eigene Kind sein wird.
Vielleicht kommt man am Ende von der Abholreise auch ohne das Kind zurück (»Uh, den Kleinen nehme ich nicht« oder: »Ah, die Kleine geben wir Ihnen nicht«), und dann ist es blöd, das Bettchen zu haben. Ich war mir allerdings sicher, dass uns das nicht passieren würde, und außerdem ist, wenn man mit dem Kind auf dem Arm zurückkehrt, nur eines noch blöder als ein überflüssiges Bettchen, nämlich kein Bettchen.
Zuhause bauten wir auf. Eine Freundin hatte sofort nach der kirchlichen Trauung, also um überhaupt aus der Kirche heraustreten zu dürfen, gemeinsam mit dem ihr frisch fürs Leben an die Seite gebundenen Mann einen Baumstamm durchsägen müssen. Danach war das Brautkleid völlig verschwitzt gewesen, sodass jeder, der an diesem Abend mit der Braut sprach, ununterbrochen an den Baumstamm denken musste.
Im Vergleich dazu war das Bettchen nichts. Wie alle in unserer Generation, aufgewachsen ohne Hilfe-Apps, hatten wir Möbelaufbauübung für mindestens drei Leben. Auch daran, wie leicht mir der Nesttrieb oder die Imitation des Nesttriebes fiel, störte ich mich nicht. Man könnte darüber nachdenken, ob diese Frauentriebe ohnehin Erfindung sind, aber ich hatte diese Frage für mich bereits geklärt (Ja und Nein) und musste mich nicht weiter damit beschäftigen.
Hunter fand das richtig oder störte sich zumindest nicht daran. Wir waren wirklich fabelhaft für eine Adoption geeignet. Sicher als Paar, sicher in unseren Rollen. Mein Mann erledigte trotz aller »Wir-teilen-fair«-Absprachen keineswegs die Hälfte der Hausarbeit, bestenfalls so etwas wie 35 Prozent. Er sagte vierzig, ich dreißig. Damit (Selbsteinschätzung er, Selbsteinschätzung sie, reale Arbeitslast bei Absprache halbe-halbe) lagen wir gemütlich im bundesdeutschen Durchschnitt.
Wir hatten das auch vor den Adoptionsbehörden zugegeben – zunächst testete uns der Verein, über den wir das Kind adoptieren wollten und den wir brauchten, da es sich angesichts unseres (vor allem meines) Alters um eine Auslandsadoption handeln würde, dann kamen das Sozial- und Jugendamt in verschiedenen Ausprägungen (immer weiblich, immer bissig). Unser Realitätssinn und unsere Offenheit hatten uns, so unser Eindruck, Bonuspunkte eingebracht. Optimistisch hatten wir im Möbelhaus auch eine Kommode erworben, einen Lampenschirm mit Blümchen und einen roten Teppich, auf dem ein rückhaltlos grüner Frosch Hochrad fuhr.
Den Teppich rollten wir als Letztes aus, ich setzte mich darauf. Das Zimmer war fertig und ich begann zu weinen.
Auf dem Boden der Tatsachen
Keine Frage, auch ohne Hormone war ich in einem hormonellen Zustand. Das Zimmer sah nun zwar hübsch aus, fröhlich mit Frosch, doch auch hilflos und leer. Ich spürte, dass ich mich vor dem, wonach ich mich seit vielen Jahren am meisten gesehnt hatte, auch am allermeisten fürchtete: dem Kind.
Die Testphase
Als Mädchen schon hatte ich Kinder gewollt. Man könnte dies leicht für einen von meiner Mutter induzierten Wunsch halten. Sie »arbeitete nicht«, wie es hieß, und machte kein Geheimnis daraus, dass sie ihre Arbeit als Sekretärin mit Freude zugunsten des Hausfrauenmodells aufgegeben hatte. Kinder waren Erfüllung, so das Programm. Dennoch glaube ich, dass mein Kinderwunsch etwas Eigenes war, etwas aus meiner Seele und mir.
In meiner Herkunftsfamilie erinnerte man mich großzügig an meine kindlichen Familienpläne (»vier mindestens«) und fand sehr lustig, was daraus geworden war. Meine Schwester triumphierte: drei Söhne. Ich keinen.
Keinen Sohn, keine Tochter.
Unveränderlich null. Von Jahr zu Jahr schien diese Ziffer größer zu werden.
Null.
Ich erzähle dies nicht, um meine Erstfamilie oder mich bloßzustellen. Ich erzähle es, weil es mich, bereits lange bevor wir uns um die Adoption bewarben, dazu zwang, meinen Kinderwunsch zu hinterfragen. War das Gefühl »in dein Leben gehört ein Kind« eine Täuschung? Hatten meine nächsten Verwandten, früher bedenkenlos »Blutsverwandte« genannt, nicht recht?
Am Ende blieb auf meiner Seite kaum etwas übrig. Begründungen? Gewiss. Doch jedes Mal konnte man weiterfragen: und warum? Ich fand weniger und weniger Worte.
Darauf lief es hinaus: Ich wusste es einfach. Dieses »es« hatte mit Wärme, Öffnung und Vollständigkeit zu tun.
Damit, ganz lebendig zu werden.
Auskunft
Klingt ärmlich?
Vielleicht. Im Lauf des Adoptionsverfahrens mussten Hunter und ich so oft zu dieser Frage »warum wollen Sie überhaupt ein Kind« Auskunft geben, dass wir die Frage immer weniger verstanden.
Wie wenn man ein Wort wiederholt und wiederholt, bis es nichts mehr bedeutet: wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen wollen.
Eines lernte ich: Keine Begründung (siehe »etwas Eigenes«) stimmt je ganz. Niemand kann die ganze Geschichte erzählen.
Dies ist kein Fehler. Es ist eine Gnade.
Gehorsam
War eine der BesichtigungenBeurteilungen Begutachtungen von Hunter und mir abgeschlossen, wurde die nächste Testrunde eröffnet und alles von Neuem in Frage gestellt: Hunter als Person, ich als Person, Einkommen (= Steuertreue), Wohnung, Durchhaltevermögen (»wir haben entdeckt, dass Sie zusätzlich diese notarielle Beglaubigung brauchen«, »das Finanzamt hat den letzten Bescheid zur Überprüfung der Überprüfung zurückgenommen«), Grad der Verzweiflung (bloß nicht zu groß), Vorgeschichte bis zur eigenen Geburt (s. o.), innere Freiheit, Souveränität, Gehorsam den Behörden gegenüber, Unterwerfungswille den Behörden gegenüber, Erziehungsmodelle, Psyche, Paar-»Status«, Treue, Krisenfestigkeit, Gesundheit, Alterungsprognose etc.
Insgesamt erstreckte dieses Einschätzen sich über mehrere Jahre, in denen zu unserem Leidwesen meistenteils nichts geschah. Dieses Nichts trug den Namen »Warten« oder »Ihre geduldige Latenz«. Jeder weiß, was Warten ist, ein von Bushaltestellen, Post-, Kassen- und Amtsschlangen bekannter Zustand, der sich dank der Corona-Pandemie kollektiv zu Erfahrungen mit wochen-, wenn nicht monatelangem Warten auf eine Impfung, Besuchsmöglichkeiten und Arzttermine erweitert hat.
Damals hingegen fühlte sich ein derartig langes, tatsächlich jahrelanges Warten für uns als ehemalige Westmenschen vollkommen unbekannt an. Erschwerend kam hinzu, dass man nichts tun konnte. In einer Postwarteschlange kann man von einem Fuß auf den anderen treten, die angebotenen unsinnigen Waren und/oder die Mitwartenden betrachten und mit imaginären Preisen Eigenschaften behängen, beim jahrelangen Adoptionswarten hingegen durfte man keinen Finger heben, keinen Muckser tun, es war bestenfalls erlaubt, alle paar Monate mit der gebotenen Servilität Bescheidenheit bei dem Verein in Deutschland anzurufen, über den man versuchte, das Kind zu adoptieren.
Es ging um ein internationales Kind, mit der Frage nach seiner Adoption war ein internationales, globales Geschehen in Gang gesetzt, international verregelt.
Wir unterstützten das mental und erlitten es praktisch.
Präpariert
In der zweiten Stufe musste ein Psychologe ein Gutachten über uns verfassen. Er wurde uns zugewiesen. Der erste sagte mehrere Termine kurzfristig ab, sodass ein weiteres halbes Jahr verging. Als endlich der Ersatzmann bei uns in der präparierten Wohnung saß (wir hatten nicht nur aufgeräumt, sondern auch darauf geachtet, was er finden würde, sollte er Schubladen aufziehen – was er nicht tat), stellte sich heraus, dass er Verkehrspsychologe war. Er hatte bereits viele präparierte Wohnungen gesehen und durchschaute auch unsere hübsch aufgeräumte garantiert auf den ersten Blick.
Wechselweise kritisierte er an Hunter oder mir herum. Die Grundsituation: Wir hatten keinen Kinderführerschein. Sollten wir einen bekommen?
Ich übertölpelte den Mann ohne Absicht, als ich auf eine seiner Fragen antwortete, das hätte ich an ihm, Hunter, ertragen – aus Liebe. »Das nennt man Liebe«, sagte ich. Ich glaubte es in diesem Moment und war erstaunt von der Erkenntnis, die aus meinem Mund spazierte. Noch heute denke ich darüber nach und halte, was ich sagte, für richtig.
»Die haben Hund«
Der Verkehrspsychologe war fertig mit uns. Ich wusste, wir hatten gewonnen, wenn das auch der falsche Ausdruck ist oder die falsche Haltung. Die Wohnung war picobello kindgemäß, der Hund todmüde, drei Stunden lang hatten wir ihn vor der Ankunft des Psychologen Gassi geführt, nun schlief er, freundlich, friedlich, brav.
Selbstverständlich war der Hund ein Trost und ein Kinderersatz. Hierbei handelt es sich um eine altehrwürdige Hundeaufgabe. Nur dass dieser Eindruck in unserem Fall unbedingt vermieden werden musste, nicht dass der Mann zu dem Schluss kam: Die haben Hund, was brauchen die Kind.
Oder: Niemals können die Kind, die kriegen schon Hund nicht hin.
Ein aggressiver Hund wäre ungeeignet gewesen, das war rational. Ein aggressiver Hund hätte vielleicht irgendwann das Kind oder zumindest einen Teil des Kindes verschlungen oder wenigstens seine Zähne in einen Kinderteil versenkt. Diese Gefahr war bei unserem Hund geringer als gering. Er gehörte zu jenen Caninen, die in todmüdem wie nicht todmüdem Zustand jeden Einbrecher zuverlässig zum Kühlschrank führen. So würde es auch mit dem Kind gehen, dessen waren wir uns sicher: Hund voran, Kind hinterher, Kühlschrank.
Zum Besten geben
Der Psychologe, der sich mit der Beurteilung von Adoptiveltern ein Zubrot verdiente, sich dabei aber vermutlich langweilte, denn regelmäßig kam er in superpräparierte, also gefakte Wohnungen zu Menschen, die er nie wiedersehen sollte, war gern bereit, einige seiner Verkehrsgeschichten zum Besten zu geben. Man kann sagen, er blühte richtiggehend auf, als auf Nachfragen deutlich wurde, dass ein von ihm betreuter Mann eine Frau angeschossen hatte. Die Frau hatte mit ihrem Wagen den Wagen des Mannes geschnitten oder auch nur überholt. Daraufhin hatte der Fahrer, nicht unvorbereitet, bei voller Fahrt eine Polizeisirene auf sein Dach gesetzt, seinerseits die Frau überholt und zu einem Halt am Straßenrand gezwungen. Da er nicht ausstieg, verließ schließlich sie ihr Auto, trat an das Seitenfenster des falschen Polizisten, der die Scheibe sorgfältig herabließ, um sodann ohne potenziellen Schaden für das Glas seine vorgebliche Dienstpistole auf die unverschämte Überholerin zu richten.
Und abzudrücken.
Der Psychologe schüttelte noch im präparierten, hundehaarfreien Sessel den Kopf. Seine Aufgabe war es gewesen, die Geistesverfassung des Mannes zu bestimmen, es war ihm hingegen nicht einmal gelungen zu klären, wohin der Schütze gezielt hatte. Mordabsicht oder nicht?
Wir hatten bereits geahnt, dass es aus verschiedensten Gründen gefährlich war, in Berlin Auto zu fahren. Seit Jahren stieg der gesellschaftliche Aggressionslevel, insbesondere bei der Parkplatzsuche litt man immer von Neuem darunter. Und spürte die eigene Wutbereitschaft. Vor Kurzem hatte ich, nach der Heimkehr, Lust gehabt, das längste Küchenmesser aus dem Messerblock zu ziehen, um dem Parkplatzwegnehmer, dessentwegen ich eine halbe Stunden länger um den Block gekreiselt war, mindestens die Reifen aufzuschlitzen. Glücklicherweise gelang es Hunter, das Gespräch abzubrechen, bevor ich zu diesem Teil der Geschichte kam. Hunter kannte mich. Er war, in der Regel, viel ruhiger als ich, und ich hatte im Lauf des Bewerbungsprozesses gelernt, Hunter fraglos aussprechen zu lassen und seinen Ideen zu folgen. Er tat dies ebenso, versteht sich. Sanfte Kritik aneinander war erlaubt, Offenheit für alle Vorschläge unserer Gesprächspartner entscheidend, auch mal ein Scherz, da musste Hunter aufpassen, sein Humor konnte untergründig vernichtend sein. Diesmal beherrschte er sich perfekt.
Vorsichtig optimistisch verabschiedeten wir den Psychologen. Er war ein Psychologe, da wusste man nie. Tatsächlich verfasste er einige Wochen später ein uns wohlgesonnenes Gutachten.
Tabelle der verborgenen Zweifel
Gesellschaftsbezogene Zweifel
– Profitieren wir von Hunderten von Jahren Kolonialgeschichte?
– Wenn Ja: Was tun wir dagegen?
– Nutzen wir eine Notsituation in Sri Lanka aus?
– Nehmen wir das Kind jemandem weg?
–
–
–
Zweifel als Paar
– Werden wir als Paar damit zurechtkommen?
– Wollen wir das Kind nur, um als Paar sozialer auszusehen?
–
–
–
Zweifel als Ich
– Werde ich genug Kraft für alles haben?
– Wird meine Liebe reichen?
– Wird das Kind glücklich sein?
– Was wird dem Kind fehlen?
– Wie kann ich das Kind behüten?
–
–
–
Zweifel angesichts des Unwägbaren/des Gewichts der Welt
– Werden wir gesund bleiben?
– Was ist, wenn dem Kind etwas zustößt, was ihm in seinem Heimatland nie geschehen wäre (ein Unfall, eine Krankheit …)?
– Wie leben wir damit, falls das Kind einen anderen Menschen ernsthaft verletzt?*
–
–
–
Glühen
Nach dem Möbelkauf blickte ich jeden Abend und Morgen in das neue Zimmer: Bettchen, roter Teppich mit Hochrad fahrendem Frosch, kinderbunte Lampe.
Und Leere.
Am Abend holte Hunter die Leiter und schraubte eine der letzten Glühbirnen in die Fassung. Der Hund setzte sich auf den Kopf des Frosches, schaute aufmerksam zu und fing an zu bellen.
Das Amt
Der nächste Weg führte erneut über die Möbel-Autobahn, wenngleich in die Gegenrichtung. Ein weiteres Mal fuhren wir an den Rand der Stadt. Es war nun der andere Rand, sozusagen Schweden gegenüber, sah aber identisch aus. Wenn Schweden auf der Drei saß, dann saß das Gebäude, das wir suchten, auf der Neun. Doch dieser Anschein trog. Tatsächlich saß das Gebäude auf der Kurz-vor-Zwölf, denn es war das Ausländeramt. Im Ausländeramt kamen wir uns seltsam vor, da wir allzu eindeutig keine ausländischen Menschen waren. Ich dachte normalerweise nicht über mich als Aus- oder Inländerin nach, auch nicht auf Reisen, allemal nicht in Europa. Allein hier gab es nichts anderes. Aus unseren Mündern drang hochkorrektes Dialektdeutsch, also eingefärbt, wie kein beginnender Ausländer es je benutzt, denn er oder sie wird korrekter sprechen, manche nennen es sauberer. Im Übrigen sahen wir so durchschnittlich-weiß-mitteleuropäisch-älter und un-divers aus, wie man es sich nur vorstellen kann. Und wie wir es waren. Ich befürchtete, dass man uns anmerkte, dass wir in unserer Kindheit mit Kartoffeln, Würsten und Kohl gefüttert worden waren, eine Jugend fast ohne Kiwis verbracht und lange nicht gewusst hatten, wie man einen Granatapfel isst.
Im Ausländeramt eröffnete sich zum ersten Mal eine neue Identitätsmöglichkeit auch für uns. Waren wir vielleicht getarnte Auslandsmenschen? Ausländisches in einer gestohlenen nur angenommenen Deutschenhaut?
So wurden wir jedenfalls angeschaut, wir wurden ausländisch behandelt und von unseren deutschen Amts-Mitbürgern und -Mitbürgerinnen mit den Das-sind-Ausländer-Augen betrachtet, um nicht zu sagen durchleuchtet. Ich hatte das Gefühl, die anderen Auslandsmenschen, die mit uns warteten, erkannten auf Anhieb, dass wir falsche Ausländer bzw. »falsche Hasen« waren. Die Hasen der Germanistin leben vermutlich nicht mehr, es ist ein paar Jahre her, und ich weiß nicht, wie alt Hasen in Gefangenschaft werden, allemal wenn sie in Wirklichkeit Kaninchen sind, aber Hasen heißen, was sie als ihr eigenes Hasenausländersein nicht bemerken. Wir saßen wie falsche Hasen oder Kaninchen auf den Stühlen in dem berlindreckigen Gang. Die Wand glänzte in dem unnachahmlichen Behörden-Gelb, in dem sich all die Gedanken und Ängste der Menschen festgesetzt hatten, die je hier hatten warten müssen, und wir warteten darauf, vor das Amt gerufen, identifiziert und zur Schnecke gemacht zu werden, da das Wesen, in dessen Namen wir handeln wollten, weder bereits überprüfbar war (vor Ort) noch in irgendeiner Weise amtlich mit uns verbunden.
Das Amt, das uns schließlich zu sich bat, bestand aus einem Schreibtisch und einer Person hinter einem elegant kleinen Computerbildschirm.
Wir beantragten nun für das Ausländerkind, das doch unser Kind sein sollte, obwohl wir keine Ausländer waren, man sagte das vor ein paar Jahren einfach so, und das Amt hieß auch einfach Ausländeramt oder Amt für Ausländer und hatte kein Gendersternchen, also wir beantragten für das ausländische Kind, das ein Adoptivkind sein würde, somit ein inländisches Kind, wenn auch gleichzeitig ein ausländisches, also für dieses auf einer fernen Insel erst noch einzusammelnde (zu findende und von der Insel mitzubringende) Adoptivkind, für unseren weißen Hasen, sagte Hunter beim Rausgehen aus dem Amt, und wer zieht den jetzt aus dem Hut?, beantragten wir mittels eines faktischen Ausländeraufenthaltsantrags eine prophylaktische Ausländeraufenthaltsgenehmigung.
Prophylaktisch faktisch. Es war nicht schön, in diesem Ausländeraufenthaltsgenehmigungsbüro als Nichtausländer zu sitzen. Es ist auch nicht schön, dort als Ausländer zu sitzen, obwohl ich das nicht wirklich, sondern nur nachvollziehend sagen kann, da ich keine Nichtnichtausländerin bin. Wir konnten es allerdings deutlich fühlen. Wir würden ein ausländisches Kind haben, das ein inländisches Kind sein würde, jedoch permanent aussehen würde wie ein ausländisches Kind.
Wir hatten das gewusst, selbstverständlich, das Bild begleitete uns seit Jahren, aber wir verstanden es von Tag zu Tag nicht mehr nur mit dem Kopf, sondern überall. Wie die deutsche Flagge würden wir herumlaufen, zumindest was unsere Haarfarben betraf: Kind schwarz, Hunter rot, ich blond. Wir hatten darüber gelacht, vielleicht aus Hilflosigkeit; was uns erwartete, wussten wir nicht.
Dort im Amt fühlten wir zum ersten Mal, dass das Ausländische nichts Festes war, und nichts Beherrschbares. Ich glaube nicht, dass wir es damals bereits so erkannten, in so many words, wie Hunter gern sagt, wenn er auf seine irischen, sprich amerikanischen Vorfahren hinweisen will, um Aufmerksamkeit auf sein feuriges, bitte herrliches, ausländisches Haar zu lenken. Tatsächlich ist Hunter so geburts-, sprach-, pass- und ausbildungsdeutsch wie ich, die wandernden Vorfahren, 19. Jahrhundert, machen ihm einfach Spaß.
Nun war es befremdlich, als inländische Eltern eines ausländisch-inländischen Kindes zwischen den Amtstüren mit ihren Hunderternummern zu sitzen: 105, 107, 108 und 112–115 unter einem dicken schwarzen Pfeil. Vor lauter Warten und Nachdenken kam ich mir selbst mit einem Mal ausländisch vor, dieses Empfinden fing dort an, es war ein durchaus anfängerischer Anfang und so, etwas verwundert und unbeholfen, erinnere ich mich auch an ihn. Verstohlen rückte ich meinen Wartestuhl näher an Hunter heran und griff nach seiner Hand, ich dachte, es würde vielleicht gegen das Gefühl helfen, zwischen allen Stühlen zu sitzen.
*Über mehrere Ecken hatten wir von einem Streit auf einem Spielplatz gehört, bei dem ein Adoptivsohn aus Südamerika ein anderes Kind verletzt hatte. Der genaue »Tathergang« blieb unklar. Hatten die beiden Jungen Zweige von den Büschen gerissen und waren damit aufeinander losgegangen? Oder mit Holzstäben aus einem Spiel? Das angegriffene Kind verlor ein Auge. Die Adoptiveltern berichteten von Hatemails, Schmierereien an ihrer Haustür, Go-Home-Zetteln mit dem Foto ihres Kindes an Lampenpfosten und auf Elektrokästen im Kiez.
2
Der Hase (und wie er wittert)
Zu dem Zeitpunkt, als die Nachricht kam, half ich in einem Tierheim aus, in dem Hasen und ähnliche Wesen, vor allem Kaninchen, doch ebenso Hamster, Mäuse, Meerschweinchen, Hunde und Katzen auch nachts abgegeben werden konnten. Spinnen und exotische Echsen nahmen wir nicht. Es war eine ehrenamtliche Arbeit. Wir erweiterten das reale Tierheim mit seinen bundesdeutschen Öffnungszeiten in die globale Welt hinein, also erst einmal in die Nacht. 24/7 war unser Ziel, 24/6 hatten wir erreicht. Montags blieben unsere Pforten geschlossen. Montags sollte ohnehin kein Tier abgegeben werden. Man sollte sich bei dem Tier für das Wochenende-mit-Tier durch einen Montag-mit-Tier bedanken.
Ich hatte die Aufgabe aus Tierliebe und Trostbedürfnis (Fell streicheln) übernommen. Zudem, dachte ich, konnte ich so meinen Organismus kindvorbereitend auf Nachtarbeit trainieren. Dem Verkehrspsychologen hatte ich davon nichts erzählt, ich hatte erst nach seinem Besuch damit angefangen. Selbst nachdem er uns ein Gutachten geschrieben hatte, das eine Art passbildlosen Elternführerschein darstellte, warteten und warteten wir. Das Warten fing damit, so der Psychologe, erst eigentlich an, denn als in Deutschland genehmigte Eltern durften wir uns dank seiner Unterschrift, die unsere »parentale Unbedenklichkeit« bestätigte, in die internationale Warteschlange einreihen. Für eine innerdeutsche Adoption waren wir um mehr als zehn Jahre zu alt. Innereuropäische Adoptionen gab es nicht. In Europa wurden alle zur Adoption freigegebenen Kinder inländisch vermittelt. In Gesamteuropa, außer Russland, gab es einen starken »Warteüberhang«, der tatsächlich ein Überhang kinderloser Paare war, die sich ein Kind wünschten. Alleinerziehende durften, anders als noch in den 80er-, ja 90er-Jahren, prinzipiell nicht mehr adoptieren, da angesichts der Kinderknappheit verheiratete Paare vorgezogen wurden. Der Eheschein war Voraussetzung; man durfte auch nicht gerade eben erst geheiratet haben, obwohl da auch mal, zumindest bei den deutschen Adoptionsvereinen oder Sachbearbeiterinnen (wir begegneten nur Frauen) ein »Auge zugedrückt werden konnte«, wenn das Paar zuvor bereits jahrelang nachweislich zusammengewohnt hatte.
Die internationale Warteschlange war »naturgemäß«, so der Psychologe, länger als die deutsche. Wie lang, konnten wir uns »gar nicht vorstellen«. Wir ließen es also besser sein, allemal ich, die schon aus beruflichen Gründen zu intensiven Vorstellungen neigt.
Nachts, im Bett, fiel das Nichtvorgestellte umso heftiger über mich her: Ich träumte von Brötchenfabriken, einer Wasserabfüllanlage auf Sylt, die ich einmal aus Versehen besucht hatte, einer Nudelfabrik, in der es unerträglich laut gewesen war, weil die fertigen Nudeln aus zahllosen, über Fließbändern aufgehängten Kesseln ununterbrochen in die darunter vorbeigeschobenen Kartonpackungen rasselten.
Wenn stimmt, dass alles, was einem im Traum begegnet, ein Teil von einem selbst ist, dann existierten wir als Brötchen in der Fließbandschlange, Wasserflaschen in der Abfüllschlange, Einzelnudeln im Kessel, kurz vor dem Sturz, oder auch als auffangbereite Nudelkartons. Was das Einreihen und Voranruckeln, das Abwarten und Unfertigsein anging, machte es keinen Unterschied.
Im Vergleich dazu wirkten Nachtschichten im Tierheim erholsam. Unsere 24/6-Auffangstation war nicht sonderlich groß, ein Bungalow mit luftdurchlässigen Anbauten, Holzställen und einem Zwinger, die sich nach hinten in den verwilderten Garten erstreckten. Dort gab es für den Sommer einen Hasenauslauf, Mister und Mississ Lampe mümmelten inmitten einer Verwilderung, die ihnen gefiel, hinter einem grün gestrichenen Lattenzaun. Er war eine Spende vom Erben eines Einfamilienhauses, das lückenlos von grünem Lattenzaun umschlossen gewesen war. Zweireihig. Wir hatten die Lücken zwischen den Latten, einreihig, mit Draht verspannt. Die Hasen, die Hasen und Kaninchen waren, konnten im Auslauf hoppeln, sich sonnen und schatten, mümmeln und nach Belieben erschrecken. Wir lasen viel über Tiere, ich lernte. Kaninchen brauchten zwei Paniken pro Tag für den Kreislauf und die Herzgesundheit. Ich konnte darauf verzichten.
Meerschweinchen krochen zwischen ihnen herum. Die Hamster lagen entspannt im Heu, sie arbeiteten exklusiv nach Sonnenuntergang. Das war etwas unpraktisch, wenn man selbst im Tierheim schlief, was man während der Nachtschicht regelmäßig mehr als einmal versuchte. Dämmerte es, wurden die Nager ins Haus verbracht, um sie gegen äußere Gefahren (Füchse, Bussarde) und gegen innere (ihr eigenes Weglaufenwollen) zu schützen. Sowohl in den Freigehegen als auch in den Hauskäfigen herrschte strikte Geschlechtertrennung. Wir hatten per Definition zu viele Tiere, jedes Tier bei uns war bereits ein Tier-zu-viel, ein Tier-ohne-Zuhause, das wir wieder in ein Tier-Normal (mit Zuhause) zu überführen suchten. Da konnten wir auf keinen Fall sozusagen kollateral noch mehr Tier erzeugen. Die strikte Geschlechtertrennung ist bei Nagern und Hasenartigen, allemal zappelnden mit dichtem Bauchfell, nicht anspruchslos. Man könnte auch sagen unmöglich. Zu langsam Umgehend entwickelten wir den Expertenblick: hochheben, Hödchen suchen (Zitzen hatten sie alle) und ins richtige Gehege absetzen, nur dass selbst das Expertinnentum, auf das ich stolz war, in so many words, nicht wirklich half. Nicht alles, was man sucht, findet man auch – selbst wenn es vorhanden ist.
Die Gehege hatten wir nach einigem Zögern rosa und hellblau markiert. Mit diesem Farb-Coding fühlte sich niemand wohl außer den Aktionären der Kinderkleidungs- und Spielzeugindustrie, die das Klischee rücksichtslos propagierte. Nach einer Phase der gelb-grün-Unterscheidung (gelb für Männchen, grün für Weibchen), in der es innerhalb weniger Wochen zu einer Vervierfachung unserer Kaninchenpopulation gekommen war, kehrten wir demütig zu rosa-hellblau zurück. »Ab in die Rosa-hellblau-Falle«, sagten wir den betroffenen Vielzahnigen, sagten es zu uns. Diese Ironie half uns über die Niederlage hinweg. Nun ja, ein wenig.
Unsere Tiere entwickelten den Springtrieb. Als er nichts nützte, erfanden die Rammler eine bis heute wissenschaftlich unbeschriebene Technik der Penisverlängerung durch Maschendraht hindurch. Ich nehme an, das gilt als »natürlich«.
Als reichte das nicht, verspürten die Häsinnen danach den Ausbüxtrieb. Er wühlte sich von ihren Vaginen unmittelbar in ihre Herzen und von dort weiter ins Gehirn, wo er Hochleistungen ermöglichte. Natur! Tage später kamen unsere Felligen, geleitet vom Nestbautrieb, rund und beseelt zu uns zurück.
Derartige Unfälle kaschierten wir, indem wir nicht darüber sprachen. Wir feierten die unbefleckte Empfängnis, ja freuten uns über den Nachwuchs, wenn wir uns unbeobachtet glaubten. Frischgeborene Hasen sehen aus wie nackte Mäuse. Eine Woche später sind sie unwiderstehlich. Wir schalteten Anzeigen: »Süüüüße Kaninchen abzugeben« oder »Jedes Kind braucht einen Hasen«, und lockten auf diese Weise Menschen ins Tierheim, die anders nie ins Tierheim gekommen wären. Nach Hunters und meinem Besuch im Ausländeramt stellten wir die hasigen Sprüche in mehreren Sprachen ins Netz. Ausgesprochen stolz waren wir auf:
Eine weltoffene Idee. Menschen, die frisch umgezogen waren, konnten ein Tier in besonderem Maß gebrauchen. Ein Tier betrachtete einen niemals mit diesem Ausländerblick, den Menschen, die unsere Annonce auf Chinesisch lasen, vermutlich jeden Tag auf sich fallen fühlten. Für ein Tier waren alle Menschen gleichermaßen außer-tierisch, also ausländisch. Die Schrift suggerierte zudem eine Heiterkeit der Dächer und geknickten Beine, der eckigen Hasenaugen und hängenden Arme, die leider zu keinerlei Steigerung unserer Kaninchenrate (Vermittlungsquote) führte.
Auch der Sex zwischen Hunter und mir war merklich maschendrahtumzäunt. Wir näherten uns der Nullfrequenz. Eine Steigerung wurde nicht erreicht. Bei meiner Nachtarbeit war das kein Wunder.
Das war vielleicht das Beste daran. An der Nachtarbeit. Wenn ich nachts nicht zuhause war und abends, wenn Hunter zurückkam, längst in meiner Rettungskleidung steckte und also nach Tier roch, musste es niemandem von uns auffallen, dass wir fast keinen, also so gut wie keinen und vielleicht auch gar keinen Sex mehr miteinander hatten.
800 Meter
War man im Tierheim für den Nachtdienst eingeteilt, konnte man sich in dem Kabuff hinter unserem Tischchen Empfangstresen auf die Couch legen. Es gab sogar ein Fenster. Die Couch hatte vieles gesehen, sie machte Geräusche, sie war nachgiebig, sie barg Tierhaar, mit dem sie nicht geizte. Das nächtliche Dauerrennen der Hamster in ihren Rädern unter und auf dem Rezeptionstisch erschwerte das Einschlafen auf gezielte Weise. Die Räder ratterten nicht, wir ölten sie regelmäßig, also rauschten sie. Die Hamster arbeiteten in der Windkraft, leider ungenutzt. Man sollte als Nachtwache allerdings ohnehin nicht schlafen, bestenfalls dösen. Ich lag auf der Couch, lauschte dem Hamsterraddrehen und dachte an das Kind, das ich nicht bekommen hatte, und dann an das Kind, von dem ich nichts wusste.
Ich war eine traurige Frau. Von außen sah man es mir nicht an, oder meistens nicht oder nur, wenn man mich gut, sehr gut kannte. Ich war eine unfruchtbare Frau. Der Verdacht stand im Raum wie ein in Stein gehauener Abraham Lincoln (seine Felsenskulptur war die überzeugendste Verkörperung eines Riesen, die ich kannte). Eine genauere biologische Feststellung hatten Hunter und ich bislang vermieden. Die Unfruchtbarkeit hätte auch meinen Mann betreffen können. Dass wir beide unfruchtbar wären, galt als unwahrscheinlich. Da lagen wir, jeder für sich, 800 Meter voneinander entfernt, unter einer Decke (Hunter) und einer schäbigen Decke (ich) und fragten uns Dinge, die wir uns nicht fragen wollten, und vermissten einander.
Und hatten Angst vor Sex.
Die 800 Meter entsprachen ziemlich genau dem Gleichgewicht dieser Kräfte, also der Sehnsucht und der Angst, dem Wunsch, einander körperlich nahe zu sein, und der Unmöglichkeit, dabei nicht auch an Zeugung, Schwangerschaft und eine erneute Fehlgeburt zu denken. Unter der Decke im Tierhaar dachte ich doch daran, und da Hunter nicht da war, kam dieses Darandenken, Erinnern und nicht ein weiteres Mal Sehenwollen als
oh
…
…
oh
…
…
oh
…
…
aus mir heraus. Die Hamster störte es nicht, ja, sie liefen ausdauernd rund, sie hörten es wohl nicht einmal.
Das Fenster des Kabuffs ging auf die Auffahrt des Hasenheims. Sie war gekiest, sodass man den Fuchs schleichen hörte. Er besuchte uns, auch am lichten Nachmittag, trat freilich nie auf den Kies. Am Zaun zum Nachbarn wuchs eine Reihe alter Föhren. Kam Wind auf, rauschten sie und warfen Zapfen. Mitunter glaubte ich, sie zu riechen. Dort, wo unser Kind lebte, roch es nicht nach Tannen- oder Föhrenzapfen. Nachdem der Psychologe uns den Elternführerschein ausgestellt hatte, hatten wir uns bei unserem Adoptionsverein für das Land entscheiden dürfen, oder müssen, aus dem unser Kind kommen sollte. Der Verein arbeitete mit sechs Ländern zusammen. Die Entscheidung musste getroffen werden, da wir uns, nachdem wir das deutsche Verfahren »geschafft« hatten (oder es uns), in dem Staat unserer Wahl erneut dem dort geltenden Auswahlverfahren stellen mussten. So kam es zu den doppelten Wartezeiten: erst in Deutschland. Und dann zurück auf Start in Land X.
Land X: Der Wind rauschte durch Bananenstauden und Palmwedel, die Sterne standen verdreht am Himmel. Halt: Standen die Sternbilder in Sri Lanka tatsächlich auf dem Kopf, für unsereins? Ich hätte nachschauen können, doch es war verlockender, es mir vorzustellen: ein Mond, der aufging wie trunken, ein Himmel, geschrieben von rechts nach links.
Ins Heim geben
Wir bemühten uns, für jedes unserer Tiere einen guten Platz zu finden.
Nachts herrschte reger Verkehr. Menschen, die sich von ihrem Tier trennen wollten, bevorzugten die Abgabe im Dunkeln. Tatsächlich gehörte es zu unseren Serviceleistungen, Tiere für bis zu vier Wochen in Urlaubspflege zu nehmen. Dabei handelte es sich um ein human-animalisches Angebot. Die Halter und Halterinnen konnten sich auf diese Weise sagen, dass sie das Tier nicht weggaben. Eine Brückenofferte also. So mussten sie kein schlechtes Gewissen haben. Wir förderten amoralisches Verhalten, schon möglich (war es auch amoralisch, ein Kind aus einem fernen Land zu adoptieren? Wie sah es mit den anderen Möglichkeiten aus? Bezahlte Samenspende? Leihmutter?). Das ethisch dubiose Agieren der Tierhalter und -halterinnen war uns gleichgültig. Falls es überhaupt vorhanden war. Sie brachten ein Tier zu uns, statt es an der Autobahn auszusetzen. Wie sollten wir das verurteilen? Wir begrüßten es.
Im Vergleich zur Menschenwelt war die Tierwelt ehrlich. Sie erlaubte klare Gedanken.
Wir wussten, dass die meisten Personen, die »in Urlaub« fuhren, ihr Tier nicht abholen würden. Auch sie wussten es vermutlich, gestanden es sich aber nicht ein. Es kamen auch Menschen, die es von sich selbst wussten, dies aber vor uns zu verbergen suchten. Das Tier wurde bei uns versorgt, der Abgebende bezahlte im Voraus für das Quartier. Die ganz Schlauen sagten: Ich bin übermorgen zurück, zwei Tagessätze.
Darauf ließen wir uns nicht ein.
Wir lächelten freundlich und lasen die Daten der Bankkarte ins System. Automatische Abbuchung für vier Wochen. Wurde das Tier früher geholt, zahlten wir den Überschuss aus. Das kam vor, Menschen besannen sich, vermissten das Tier, nahmen es zurück. Das Tier war begeistert (Hund), gleichgültig (Nager), undurchsichtig (Katze), souverän (Schlange), nicht mehr da (Giftschlange). Menschen mit schlechtem Gewissen bezahlten für sechs Wochen. Sechs Wochen waren unsere Höchstzeit. Manche spendeten sogar. Das war ein sicheres Zeichen dafür, dass das Tier bleiben würde. Manche Nichtabholer und Nichtabholerinnen erkannte man daran, dass sie ständig davon sprachen, wie sie ihr Tier abholen würden. Tag, Uhrzeit, Pflegestand, alles schien ihnen wichtig.
Andere zögerten sichtlich, sie waren mir am liebsten. Wirkte das Tier besonders jung oder hübsch, versuchte ich es mit einem Gespräch. Es hatte sich bewährt, nicht direkt nachzufragen. Also sagte ich: »Ich kann nicht garantieren, dass das Tier noch da ist, wenn Sie in vier Wochen wiederkommen. Manche Tiere laufen weg oder werden gestohlen.«
Erstaunlich viele der Abgebenden begriffen unverzüglich, was ich meinte. Das wäre ausgesprochen traurig, sagten sie, trotzdem würden sie sich damit abfinden. Oder: Ich brauche sie nicht anzurufen, wenn dies geschehe.
In diesen Fällen setzte ich, noch bevor ich nach Hause ging, die Anzeige ins Netz: Tier X und Tier Y, Foto, begeisterte Beschreibung. Ich gewöhnte mir an, nur das Beste an einem Gesicht und Körper zu erkennen. Hunter und ich wussten, dass wir das Kind, »unser Kind«, in Sri Lanka nicht würden aussuchen dürfen. Was sage ich: nicht würden aussuchen müssen. Ich war so froh darum.
Hunter erzählte ich nur die glücklichsten Tiergeschichten. Er beschäftigte sich in seinen Nächten mit Schlafen, allein im Bett für zwei. Immerhin konnte er auf diese Weise schnarchen, ohne jemanden zu stören außer sich selbst. Ich weiß nicht genau, was er von meiner Art hielt, die Nächte zu verbringen. Es passte zu uns, damals. Wir warteten gemeinsam auf das Kind, doch jeder wartete auch allein.
Was außerdem zu uns passt
Die ältere Dame, die exakt in ihrem Abholfenster kam, um ihr silberfarbenes Kaninchen namens Freddy in den Transportkäfig zu setzen und mit nach Hause zu nehmen, regte sich leider mächtig auf. Als ich ihr Freddy brachte, behauptete sie, wir hätten ihn verändert. Freddy habe ein Leben lang die gleiche Farbe gehabt wie ihr Haar. Ihre Haare waren schwarz, ihr Gesicht runzelig. Der Fall war eindeutig. Sie hatte sich die Haare gefärbt und es vergessen. Mich schmerzte, wie untröstlich sie war. In Fällen dieser Art servieren wir Kaffee. Da jeder, was Kaffee angeht, so unendlich verwöhnt ist, bieten wir von vornherein nur löslichen Kaffee an. Ohne Koffein oder mit, nachhaltig gehandelt. Wir unterstreichen damit unseren tier- und menschenschützenden Standpunkt und lassen die untröstlichen Abgeber oder Abholer selbst rühren. Süßstoff halten wir bereit. Etwas Heißes hilft immer. Es ist ja dann schon dunkel oder noch dunkel oder dämmert gerade. Der lösliche Kaffee spricht auf seine Weise davon, wie ein Heimleben sich für ein Tier anfühlt. Es ist nur Ersatz, flüsterte ich der Falschschwarzhaarigen zu.
Sie rührte und nahm auch etwas Milch. Ich leitete auf Helles, ja Silberfarbenes über: wie lebenswichtig es sei, wie leer die Welt wäre ohne das Silber der Blätter, das Silber des Wassers, das Silber der Steine, das Silber des Blickes, das Silber der Schnecken, das Silber der Insektenflügel, ohne silbernes Haar. Als sie mich leicht lächelnd (ein Mundwinkel) ansah, wusste ich, dass wir eine Lösung finden würden. Am Ende nahm sie das silberne Kaninchen mit und ein schwarzes, das sie für Freddy hielt. Ich wusch die Kaffeetasse ab, schraubte das Glas mit den Kügelchen zu und hoffte, ihr wirklich zwei Weibchen mitgegeben zu haben.
Über das Tierheim war auch der Kontakt mit der Germanistin zustande gekommen. Sie war Germanistin erst im zweiten oder dritten Aspekt ihres Lebens (ihr Ausdruck), im ersten war sie Hasenbesitzerin (Wunsch) und Kaninchenretterin (Wirklichkeit, auch sehr angenehm). Inzwischen (eben habe ich sie gegoogelt) ist sie nicht mehr Germanistin (sonst fände man sie), sondern nur mehr Hasenbesitzerin (wünsche ich ihr). Dabei war sie auffällig mehr Germanistin, als ich je Germanistin geworden war. Als abgebrochene Germanistin hatte ich, um Geld zu verdienen, nur abgebrochene Germanistinnenarbeiten verrichtet. Ab und an übersetzte ich aus dem Englischen. Dafür benutzte ich eine KI und mich selbst.
Immer wieder musste ich im Tierheim daran denken, wie ich nach dem Mittagessen mit Doktor F. vor dem Lokal gestanden hatte, in einer Ecke der Stadt, die ich nicht kannte, und die Sonne am Himmel anstaunte als etwas, das auf mein weit entferntes Kind und mich gleichermaßen schien.
Das Ah und Oh
Die Nachricht im Omacafé war viel zu groß gewesen für eine Stunde oder einen Tag oder eine Woche. Sie gehörte in eine eigene Kategorie, zu jenen Botschaften, Gesten und Szenen, die einem, wenn man aufwacht oder unerwartet allein ist und vor sich hin denkt, gern wie neu, als weltumstürzendes Ah und Oh, als eine Explosion, ein Schlag der Erkenntnis, jedenfalls als etwas Herz und Hirn für alle Zeit Verrückendes erscheinen.
Kein Stein lag mehr auf dem anderen. Mir war, als wäre ich Kopf voran gegen eine Mauer gefahren und sie wäre endlich zerbrochen. Am Nachrichtentag in München war mir erst nach einer Weile eingefallen, dass es in Sri Lanka Stunden später und somit bereits dunkel war. Meine Güte! Nicht einmal eine derartig prominente, ständig wiederkehrende Bewegung wie den Sonnengang begriff man über den Rand des eigenen Topfes hinaus.
Ich hatte Hunter angerufen und ihm von meinem Gedanken erzählt, und er sagte:
glaube ich,
ah
…
…
und: ah
…
…
und war der einzige Mensch auf der Welt, der mich in diesem Augenblick verstand.
3
Alles, was hier zu lesen ist, hat sich mehr oder minder zugetragen. Vor allem mehr. Die Abschnitte, die meine Tochter betreffen, konnten nicht erfunden werden. Erfindung hätte meine Tochter beleidigt.
Doch soll ich weitererzählen? Darf ich?