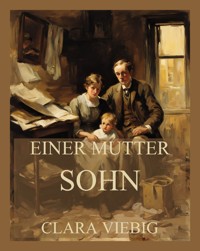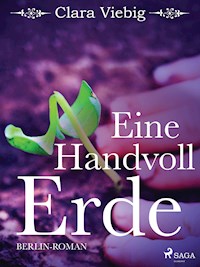
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Eine Handvoll Erde" gehört zu den besten Berlin-Romanen des frühen 20. Jahrhunderts. Mit psychologischem Feingefühl schildert die spätnaturalistische Erfolgsautorin das Schicksal der Arbeiterfamilie Reschke, die eine kleine Ackerparzelle pachtet und sich damit den Traum vom eigenen Stückchen Grund und Boden erfüllt. Dem Familienglück scheint Bahn gebrochen: Tochter Frida kann sich von der mühseligen Schneiderei erholen, Sohn Max und Vater Reschke werde vom Wirtshaus abgelenkt. Aber es kommt alles ganz anders als erwartet ...AutorenporträtClara Viebig (1860–1952) war eine deutsche Erzählerin, Dramatikerin und Feuilletonistin, die insbesondere der literarischen Strömung des Naturalismus zugerechnet wird. Aufgewachsen an der Mosel in Trier, verbrachte sie die meiste Zeit ihres Lebens in Berlin. Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ihre Werke zählten damals in den bürgerlichen Haushalten zur Standardbibliothek. Bekannt wurde die Autorin vor allem durch den Roman "Das Weiberdorf", der 1900 erschien. Die Stärke Viebigs liegt unter anderem in der äußerst komplexen, oft symbolhaft wirkenden Darstellung der spröden Landschaft und ihrer Bewohner. Ihre Werke wurden insbesondere ins Französische, Spanische, Englische, Italienische, Niederländische, Norwegische, Schwedische, Finnische, Tschechische, Ukrainische, Slowenische und ins Russische übersetzt, einige auch in Blindenschrift übertragen. Clara Viebig, die mit einem jüdischen Verleger verheiratet war und nach 1935 im nationalsozialistischen Deutschland nicht mehr publizieren durfte, geriet nach dem Krieg für lange Zeit in Vergessenheit und wird nun endlich wiederentdeckt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Eine Handvoll Erde
Saga
1.
Reschkes saßen in ihrer Küche. Sie hatten eben gegessen, Mittag und Abendbrot gleich zusammen, denn er kam erst gegen Sieben aus der Kartonagenfabrik, und sie wartete mit ihrer Mahlzeit auf ihn. Nun hatte er das letzte Stückchen Hammelfleisch aus der Gemüsebrühe herausgefischt und legte die Gabel hin, während sie sich noch den Rest der Tunke, der in der Schüssel zurückgeblieben war, in ihren Löffel goß. Das bißchen Fleisch ließ sie ihm immer, denn wenn es auch nicht mehr so knapp zuging wie in früheren Jahren, als die Kinder noch klein waren, es war doch alles sehr teuer.
Der Mann lehnte sich in seinen Stuhl zurück, streckte die Beine lang unter den Küchentisch und gähnte: »Ich wer’ nachher mal rüber gehn, ’ne Partie spielen.«
»Spielste Billard?« fragte sie und sah ihn forschend an.
»Weiß nich!« Er zuckte die Achseln. »Kommt drauf an, wer grade da is.« Er steckte die Hände in die Hosentaschen und kippte mit seinem Stuhl hin und her. »Hier unsre Küche kenn ich nu in- und auswendig und drin die Stube auch – man sehnt sich doch mal nach ’m bißchen was andrem. Abwechslung muß der Mensch haben, sonst geht er ein.« Er seufzte auf.
»Biste denn krank?« fragte sie fast ängstlich. Man sah es ihrem Blick an, daß sie ihn noch lieb hatte, daß sie in ihm immer noch den sah, dem sie in ihrer Jugend willig das hingegeben hatte, was ihr einziges Besitztum war.
»Krank? Bewahre! So ’ne Knochen wie du wer’ ich freilich nie kriegen« – er zog sie mit einer etwas spöttischen Miene zu sich heran – »was, Alte?! Dafür bist du aber auch vom Land und ich aus der Stadt.«
Sie hielt geduldig still, ließ ihn ihre starken Arme befühlen und ihn auf ihren breiten Rücken klopfen. Sie war größer als er und sah auf seine schmächtige Gestalt herab. Gutmütig lachend gab sie zu: »Ja ja, Knochen hab ich – Gott sei dank!« Sie sah auf ihre verarbeiteten Hände, und ihr Gesicht wurde nachdenklich: was hätte sie denn wohl anfangen sollen ohne die Knochen?! Denen hatte es nichts ausgemacht, wenn die Last auch einmal schwer war; sehr schwer.
»Na, warum denn so ernsthaft? Du machst ja ’n Gesicht auf einmal – na ich danke! Bist wohl beleidigt?«
Sie sah ihn freundlich an. »O nee, so dumm bin ich nich. Aber weißte, Arthur, ’s wär’ mer doch lieber, wenn de nich drüben nach ’s Kaffee Amor tätst gehn. Da gibste immer viel aus, du verlierst bei die Karten. Un denn haste morgen Kopfweh. Bleib doch hier – um Neune kommt ja ooch Fridchen!«
»Wenn schon!« Die Lockung mit der Tochter verfing nicht bei ihm, er lachte kurz auf. Die Frida war ja gewiß ein braves Mädel, aber genau so wie die Mutter. Und drüben die freundliche Bedienung von jungen, »schicken« Damen war amüsanter. Aber er traute sich nicht recht, jetzt zu gehen, wenn Mine so ein Gesicht machte.
Verdrossen saß er am Küchentisch und beobachtete seine Nägel.
Die Frau fing an, das Geschirr abzuwaschen, verstohlen blickte sie dabei nach ihrem Mann. Er saß gelangweilt da, ach ja, sie wußte es ja selber, sie war nicht sehr unterhaltend, dazu hatte sie zu viele Sorgen gehabt in ihrem Leben. Und sie hatte auch die Bildung nicht, die er verlangen konnte; denn er war mal drei Jahre aufs Gymnasium gegangen. Die Schwiegermutter hatte noch auf dem Totenbett gejammert: warum ihr Arthur bloß nicht ein studierter Herr Doktor geworden war?!
Mine Reschke machte ein ernstes Gesicht, sie sah ein, für Arthur war es wirklich nichts, hier immer nur bei ihr in der Küche zu sitzen. Aber war’s denn drüben was für ihn? Abspenstig machen würde ihn ihr wohl keine – die Zeiten waren vorbei – aber sie wollte es nicht, nein, sie mochte es durchaus nicht, daß ihr Mann, ihr Arthur, Fridchens Vater, da drüben saß. Sie zog die Stirn nachdenkend in Falten. Wenn sie nur etwas Besseres wüßte für ihn! Wo man auch zum Vergnügen hingehen konnte, es kostete alles sündhaftes Geld, das Café drüben war am Ende doch noch das Billigste; und er hatte es so nah gegenüber. Und rechts so eines, und links so eines, und ein Haus weiter eines, und zwei Häuser weiter auch. Überall Restaurants: Haus bei Haus, die ganze Straße. Im ersten Stock Hotel, im zweiten Stock Pension, im dritten Stock Privatlogis, im vierten möbliertes Zimmer mit Separateingang; und unten in jedem Parterre das Restaurant mit freundlicher Damenbedienung.
Mine ließ mutlos die Hände herunterhängen. »Wären wer bloß nich hergezogen!« Sie wußte nicht, daß sie es laut herausstieß mit einem Seufzer.
»Ja, schön is anders!« Er empfand besonders die schlechte Luft. Da war es doch im Westen, als sie noch Portiers waren, besser gewesen. Jetzt mochte freilich auch alles zugebaut sein. Mutter und Vater Reschke und der kleine Willi und dann das Lieschen, die sie dagelassen hatten auf dem Schöneberger Kirchhof, würden sich auch wundern, wenn sie heraussehen könnten aus ihren Gräbern. Berlin war eben eine große Stadt, wurde alle Tage noch größer.
Mine nickte: »Ach ja!« Nun waren sie schon viel herumgekommen in den zwanzig Jahren, von der Göbenstraße nach der Neuen Winterfeldstraße in Schöneberg, von da nach dem Kreuzberg, dann Blücherplatz, von da wieder in eine funkelnagelneue Straße nach Wilmersdorf; und da hatte es ein Ende genommen mit dem Portiersein. Arthur wollte nicht länger das Haus mehr reinmachen: nur ein Weibsbild könnte sich so etwas gefallen lassen. Und Mine mußte doch auf Waschstellen gehen.
So hatte denn die große Wanderung angefangen. Immer dahin, wo man gerade Verdienst fand. Für Arthur durfte es nur leichte Beschäftigung sein, und die traf sich selten. Sie waren gezogen fast rund um Berlin. Vom Westen in die Gegend am Urban, vom Urban nach der Frankfurter Allee, von da bis nach Moabit in die Togostraße, und dann wieder tief hinein ins Herz von Berlin. Mine konnte von einer Hofwohnung fünf Treppen hoch in der Mulackstraße erzählen und von ein paar verwanzten Stübchen am Arconaplatz. Aber am wenigsten gern wohnte sie doch jetzt hier. Wenn der Tag hell war, sah die Straße gar nicht so unangenehm aus: hohe Häuser wie überall, Grünkramkeller und Schlächter und Kaufmannsläden. Die Häuser zwar altmodisch und verwohnt, an mancher Fassade sogar der Putz abgeblättert, innen hölzerne Treppen, winklige Gänge, viele Türen und Türchen, Höfe drei, vier hintereinander; aber morgens gingen fleißige Männer zur täglichen Arbeit heraus und Kinder zur Schule, und Frauen, die Markttasche am Arm, holten ein. Doch wenn es dämmerte, der Abend sank –?!
Die Mutter sah unruhig nach der Uhr: noch kam Fridchen nicht!
Der Mann hatte das Fenster aufgemacht, aber man sah gegen eine graugelbe, verstaubte, rissige Hinterwand. Und daß Luft ins geöffnete Fenster kam, merkte man auch nicht. Die war genau so verbraucht, von allerlei Gerüchen dick, wie die Luft der Küche. Arthur hatte den Arm ums Fensterkreuz geschlungen, den Oberkörper vorgeneigt und blickte da hinaus, wo man den Himmel vermuten konnte.
»Du, ich glaube, ich seh ’nen Stern!«
»Ach nee!« Mine sagte es traurig. »Wo soll wohl hier ’n Stern herkommen!«
»Na, erlaube mal!« Arthur ärgerte sich: Wenn sie nur was auf Berlin sagen konnte. »Als ob hier nich ebenso gut Sterne am Himmel stehen könnten wie draußen auf ’m Feld.«
»Ja, aber mer sieht se nich! Mach’s Fenster zu, Arthur, es stinkt rauf.«
Er schlug das Fenster zu: Nicht mal Luft konnte man schöpfen. Pfui Teufel! »Mir hätten doch lieber nach vorne raus ziehn sollen, da hätten sie wenigstens nichts rausgießen können. Heut is ’s ganz toll. Oder merk ich’s heut nur so?«
»’s wird Regen geben. Nötig tät der schon lange sein. Sonst wird’s nischte mit die Frühkartoffeln.«
»Was gehn mich Frühkartoffeln an!« Ungeduldig ging es hin und her. »Ich bin kein Bauer – wo heut nur die Zeitung bleibt! – aber besser hat’s so einer doch. Wenn er Stunk riecht, riecht er wenigstens seinen eigenen!«
Es raschelte. Jemand versuchte, von außen eine Zeitung durch die Tür zu schieben. Nun klopfte es.
»Siehste, da is se schon!« Mine öffnete. Draußen stand das kleine Mädchen von gegenüber. Sechs Parteien, allein hier im Haus, nahmen teil an der Zeitung, die der Budiker gegenüber hielt. Es wurde meist Abend, bis Reschkes die »Morgenpost« bekamen.
Arthur verfehlte nicht, zu fragen: »Nanu, ich dachte schon, ihr lerntet se auswendig!«
Die Kleine machte einen Knicks; das bleiche Gesichtchen, von auffällig frisierten, in langen Locken gedrehten Haaren umwogt, errötete. »Ich kann wirklich nichts dafür«, sagte sie ängstlich.
»’s macht ja auch nischte.« Die gutmütige Mine wußte selber nicht, warum ihr dieses Kind so leid tat. Es schien doch so weit ganz ordentlich drüben zuzugehen, man hörte kein Gezänk, und das hätte man hören müssen, die Wände waren ja so dünn. »Was se für schöne Locken hat«, sagte sie bewundernd, »un so ’ne feine blauseidene Schleife übers Ohr!«
Die Kleine duckte sich, der rauhen Hand ausweichend, die ihr übers Haar streichen wollte. Mit einem verschüchterten »Guten Abend!« knickste sie und lief hinüber zu ihrer Küchentür.
»Warum die bloß drüben so zusperren, man kuckt ihnen doch nischte ab!« Mine schüttelte den Kopf.
»Na, wer weiß auch!«
Mine wurde neugierig: was dachte Arthur denn? Oder wußte er was? Aber Arthur hörte gar nicht hin, er studierte die Zeitung.
Plötzlich legte er die Hand auf den Tisch, so kräftig, daß die kleine Küchenlampe, die er sich nahe herangezogen hatte, wakkelte. »Was die jetzt billig Land anbieten! Einer, der gar nichts hat, kann sich jetzt schon ’n Haus bauen!« Er schob ihr das Zeitungsblatt über den Tisch hin: »Da, lies mal!«
»Les du lieber!« Mine war ein wenig verlegen.
»Baustellen, Baustellen, mit und ohne Baugeld. – Kleine Anzahlungen, Vorortgrundstück, Zehnpfennig-Tour. – Berliner Laubenkolonisten, pachtet kein Stück Land zu teuren Pachtpreisen, sondern kauft Parzellen zu ein bis fünf Morgen, nur dreihundert Mark Anzahlung! – Achtung! Baugrundstück, gelegen inmitten herrlicher Wälder. – Eigenheim! Jedermann kann sich heutzutage ein eigenes Heim schaffen.
»Glücklich und heiter, früh und gesund,
Lebt man nur auf eigenem Grund!«
Arthur hatte mit steigendem Ausdruck gelesen; jetzt ließ er das Blatt sinken. Durchs Fenster jagte ein plötzlicher Zugwind einen Dunst herein, der einem fast den Atem benahm, und aus dem unteren Stockwerk tönte ein jämmerliches Weibergekreisch und dann ein schimpfender Männerbaß.
»Da gibt’s wieder irgendwo Krach!«
Mine nickte: das war man ja gewohnt, aber jedesmal war es aufs neue gräßlich; besonders jetzt, wenn Arthur vorlas von Wald und Wasser und Eigenheim. Sie seufzte und schob das Zeitungsblatt weit von sich ab: »Das ’s ja nischte for uns.«
»Warum denn nich?!« Arthur ereiferte sich: Das sah er gar nicht ein, daß sie allein leben sollten wie die Galeerensklaven, die angeschmiedet waren an der Ruderbank. Er stemmte beide Ellbogen auf den Tisch und stierte, den Kopf zwischen die Hände gestützt, auf die Zeitung, deren letztes Blatt ganz angefüllt war mit fettgedruckten, in die Augen fallenden Annoncen des Grundstück- und Hypothekenmarktes. Landhaus, Waldheim, Villa, Seegrundstück, Unter den Eichen, Laubenkolonie, Gartenland, Eigenheim – immer wieder Eigenheim! Die Ansiedlerbank gab bereitwillig jede Auskunft. Und da war auch ein Pächter, der wollte billig abverpachten: kleine Stücke, ganz in der Nähe von Berlin, seltenstes Angebot, Sommerlauben in schönstem Garten!
Arthur Reschke atmete tief. Er, der immer nur das Pflaster Berlins getreten hatte und den Asphalt, der in der Hitze klebt, fühlte plötzlich einen Ekel. Im Keller geboren, im Keller aufgewachsen, dann viele Treppen heraufgeklommen, dann viele wieder heruntergeklettert – herauf, herunter und herunter, herauf – sollte er denn immer nur ein klägliches Stückchen Himmel suchen? Den nie sehen ohne dies angerauchte Grau? Über dem Feld aber stand der Himmel wie eine Glocke, reinblau wie die Blume des Flachses, von der Mine erzählte. Schön mußte es sein, wenn man sich hinausflüchten konnte auf ein stilles grünes Plätzchen, das einem allein, ganz allein gehörte. Bis hier in den Hof, vier Treppen hoch, hörte man das Rollen der Elektrischen, es ging durch die Straßen wie ein dumpfes Donnern; und Geschäftswagen polterten vom Stettiner Bahnhof her, es tönten die Hupen.
Arthur Reschke hielt sich die Ohren zu: ja, so über vierzig Jahre Berlin nehmen mit. So lange man jung ist, macht es Spaß, aber wenn die Ohren nicht mehr so scharf sind, die Beine nicht mehr so geschwind, wenn die Lunge zu viel eingeatmet hat von dem Staub und dem Dunst, dann braucht der Mensch ein Plätzchen, wo er frei atmen kann. Er hüstelte.
»Du wirst doch nich wieder deinen Husten kriegen?« Die Frau sah besorgt nach ihm hin.
»Hör mal!« Und er las mit erhobener Stimme die Verse vor, die sein auf die Landangebote stierendes Auge eben entdeckt hatte:
»Mein Heim, mein liebes kleines,
Voll Sonne und voll Ruh,
Wie eil ich deinem Frieden
Am Feierabend zu!«
»’s scheene«, sagte sie und machte ein ganz andächtiges Gesicht. Wie der Prediger in der Kirche las er’s. Ach ja, da draußen, sie wußte es ja so genau, wie schön es da draußen war! Ihre Jugend auf dem Lande hatte sie nie, nie vergessen. Aber daß der Arthur sich so danach sehnte?« Sie ahnte es nicht, daß ihre eigenen Erzählungen von Luft und Sonne, von grünender Saat und duftendem Klee, von wogendem Korn und von Himmelsbläue – Erzählungen, die wie Märchen klangen – daß die den ersten Keim der Sehnsucht in seine Brust gepflanzt hatten. Sie faltete die Hände: »Ach ja, wenn man mal wieder raus könnte!«
Da schrie er sie unwirsch an: »Mach nich so ’n dämliches Gesicht«, knüllte die Zeitung zusammen und schleuderte sie in eine Ecke. »Wozu ’s erst lesen, wenn man’s doch nicht kriegt. Ich geh jetzt rüber – ich hab’s satt.« Er nahm seinen Hut und lief die Treppe hinunter.
Sie hörte ihn poltern und leuchtete mit der Küchenlampe übers Geländer nach: der Wirt ließ das Gas immer nur halb aufdrehen. Ach, und die Miete war trotzdem so hoch!
Mit einem Seufzer ging die Frau in ihre Küche zurück. Da saß sie nun und stopfte Strümpfe und hörte die stetige Unruhe des eingepferchten Hofes, die beständige Unrast des vollgepfropften Hauses, den immerwährenden Umtrieb der immer vollen Stadt; all den Lärm, von dem das einzelne nicht erkennbar ist, der aber wie ein ewig wogendes, dumpfes Brausen das Ohr belästigt. Endlich flaute er ab und wurde leiser.
Durchs Fenster kam jetzt ein nächtliches Wehen, ein Luftzug, der sich irgendwo eine Ahnung von Reinheit aufgesammelt hatte, und der nun seinen Atem schlafbringend in die kleine Küche hauchte.
Der Frau war der Kopf herabgesunken. Das vergebliche Warten auf die Tochter hatte sie abgespannt: mein Gott, warum Fridchen heut nur so besonders lange ausblieb? Sie hatte gegähnt, nach der Uhr geblickt – halb zehn, – nun schlief sie, die Stirn auf dem Tischrand. Plötzlich schreckte sie auf, ein unterdrückter Aufschrei hatte sie geweckt. Unten aus dem Flur kam er.
Die Mutter riß die Küchentür auf: auf den Treppen war es schon stockdunkel. Nun kam es die Stufen heraufgelaufen, ganz eilig, wie verfolgt, in die Küche stürzte es hinein, und Frida Reschke sagte ganz atemlos: »Mutter, mach zu, mach zu!«
Frida Reschke war Schneiderin; keine perfekte, sie schneiderte für Kinder Schulkleider, für Hausmädchen Servierkleider, für die Damen besserte sie nur aus. Sie hatte ihre feste Kundschaft, und wenn die Arbeitswoche sieben Tage statt sechs gehabt hätte, so hätte sie auch die besetzt gehabt. Aber auf den Sonntag hielt sie, schon der Mutter wegen. Frau Reschke hätte es nicht zugegeben, daß ihr Fridchen an diesem geheiligten Tage wie an allen anderen Tagen frühmorgens um acht mit der Tasche, darin Schere, Nadelbüchse, Zentimetermaß, Fingerhut und das sorgfältig zusammengerollte Modenblatt, zur Kundschaft ausgezogen wäre. Denn Gott sprach: »Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebenten sollst du ruhen von allen deinen Werken« – das wußte Mine noch von der Dorfschule her.
Heute hatte Frida einen weiten Weg gehabt. Ganz oben in der Wilhelmstraße, dicht am Belleallianceplatz, schneiderte sie für die Hausdame von Doktor Hirsekorn einen Morgenrock. Früh langte die Zeit manchmal nicht, aber abends ging sie immer zu Fuß, auch diesen weiten Weg. Es tat ihr gut, daß sie sich Bewegung machte, sie hatte eine üppige Figur, eine volle Brust, und doch zeigte ihr rundes Gesicht das weiche Wachsblaß der Bleichsüchtigen.
Jetzt stand sie in der Küche und rang nach Luft.
»Na, was denne?« Mine war ein bißchen ängstlich, nicht weil es so spät war – es wurde schon ab und zu einmal halb elf – aber weil Frida so nach Luft schnappte. Sie sollte sich doch nicht so abjagen. »Warum biste denne so gerannt? Hast du unten so ufgequiekt?«
Unter des Mädchens blasse Haut schoß eine Blutwelle, sie schüttelte stumm den Kopf.
»Is dir niemand begegnet?«
»Nein«, sagte Frida, aber ihr Gesicht wurde noch röter. Mit einem gewissen Mißmut zog sie die Jacke aus und nahm den Hut ab. Hübsch war sie eigentlich nicht, aber im Dunkeln konnte sie wohl locken mit der üppigen Brust und dem mächtigen Knoten der starkblonden Haare.
»Ist das heut abend noch warm, schrecklich warm! Machs Fenster weit auf, Mutter! Zum Ersticken!«
Was war denn die Frida heut so aufgeregt? Mine sah stillschweigend zu, wie die Tochter die Taille, die sie einzwängte, auszog, hinter die Gardine an der Wand hing und in ihre Nachtjacke schlüpfte. Sie saß dann auf dem Küchenschemel, schlang die Hände um die Knie, beugte den Oberkörper vor und blieb so wie in Gedanken.
»Haste Verdruß gehabt?« fragte die Mutter. Sie sah es der Tochter doch an.
Frida nickte. Und dann lösten sich plötzlich zwei Tränen aus ihren starrenden Augen und fielen ihr in den Schoß.
»Haste was verschnitten?« Nun war Mine ernstlich beunruhigt. »Sag doch, Fridchen, was haste denne?«
»Meine beste Kundschaft, meine allerbeste Kundschaft – ach Mutter, der Doktor zieht von Berlin weg!«
»Na, für den machste doch nich de Kleider!« Mine war etwas verdutzt; dann tröstete sie: »Du wirst wieder ’ne andere gute Stelle kriegen. Zieht denn seine Mamsell, das Fräulein Zimmer, auch mit weg von Berlin?«
»Sie sagt: ›Nein, auf keinen Fall‹. Aber –« das Mädchen konnte sich gar nicht beruhigen – »ich bin doch so traurig, so traurig!«
Das war doch kein Grund gewesen, um zu weinen! Die Mutter hatte die Tür der Stube nach der Küche zu aufgelassen. Sie hörte, wie die Tochter sich dort im Bette warf. Arthur war noch nicht da, sie waren beide ganz allein. »Fridchen«, rief die Mutter, »schläfste noch nich?« Aber die Tochter antwortete nicht.
Frida Reschke schlief nicht. Sie lag ganz still auf dem Rücken und sah nach dem Fenster, dessen unverhängte Scheiben ein mattes, trübes Gelbgrau durchließen. Kein Mond, kein Stern warf Silberlicht herein. Das war alles so traurig, wie der ganze Tag heute gewesen war. Fröhlich war sie heut morgen zur Arbeit gegangen, das heißt, so fröhlich wie man sein kann, wenn man Tag für Tag immer dasselbe tun muß: nähen, immer nähen und flicken und stopfen. Jede Stunde am Tag gehört der Kundschaft, jede Minute; gerade daß man aussetzt, wenn einem das Essen gebracht wird. Wer doch einmal aufhören könnte zu nähen, immer zu nähen! Aber das würde nie aufhören, man nähte sein ganzes Leben lang. Man blieb sitzen in dieser Nähstube, hinten am langen Gang, durch den die Mägde trappeln, wenn es vorne schellt, in dieser Nähstube, die so voll ist von Schränken, daß gerade die Maschine noch Platz hat und ein Tisch. Wenn die Kinder aus der Schule kommen, rufen sie herein: »Frida, machen Sie doch meiner Puppe ein neues Kleid, ja?!« Und der Kleinste tippt auf die Maschine: »Laß mich auch mal drehen –rrrrrr!« Das war die einzige Abwechslung – und ein ganzes Leben so?!
Frida stieß mit einem heftigen Ruck die Füße unten gegen die Eisenbettstatt. Da hatten es die Mädchen bei Wertheim doch besser, oder in irgend einem anderen großen Geschäft, wo die Käufer ein und aus fluten und man etwas sieht von der Welt. Nein, die hatten es auch nicht besser! Nein, alle Mädchen, die im Trott gehen müssen einen Tag wie den anderen, haben’s nicht besser!
Frida schloß die Augen, sie schämte sich vor sich selber: was war ihr doch nur angeflogen, daß sie heute solche Gedanken hatte?
Das kam von dem lauen Abend, an dem es einen förmlich heraus aus den Straßen trieb. Wer doch Zeit genug hätte, spazieren zu gehen! Denn das war kein Spazierengehen, dieses Laufen durch die Straßen. Ja, die Mutter, die hatte es gut gehabt, die war aufgewachsen auf dem Lande, darum war sie auch jetzt noch stark und fast jugendlich, trotzdem sie ein so schweres Leben gehabt hatte. Sie, die Näherin, würde nicht so lange jung bleiben. Bleichsüchtig – bleichsüchtig. Der Herr Doktor war heut einmal in die Nähstube gekommen – der gestreifte Morgenrock lag auf der Maschine, dieses ewige Gestreift-Sehen machte ganz schwindelig – er sagte: »Sie sehen blaß aus, mein Kind, Sie müssen diesen Sommer mal ein bißchen heraus!«
Ja wohl, heraus! Wovon denn? Wohin denn?! Sie mußte doch sparen. Die Mutter sparte, die Tochter sparte – die Mutter wusch und wusch, sie nähte und nähte – die Mutter sparte für das kommende Alter, die Tochter sparte für den künftigen Hausstand. O Gott nein, nur nicht! Nur nicht so heiraten, wie die Mutter geheiratet hatte!
Frida schauderte. Sie konnte sich gut erinnern an ihre Kinderzeit. Da war es ihnen sehr schlecht gegangen. Sie war oftmals hungrig ins Bett gekrochen, sie hatte oftmals gefroren. Nur die Liebe der Mutter hatte ihr weggeholfen über Hunger und Frost.
Wie war es heiß und beklemmend hier! Frida warf die Decke ab. Wäre sie doch heut abend nur nicht zu Fuß nach Hause gegangen! Sie war schon verstimmt gewesen, es konnte ihr doch nicht einerlei sein, daß der Doktor, der immer so freundlich zu ihr war, in dessen Haus ihre beste Stelle war, daß der nun ganz fortzog von Berlin.
Er könnte es nicht mehr aushalten hier, sagte Fräulein Zimmer. Die begriff das nicht. Gerade in der Wohnung, in der er mit seiner Frau so glücklich gelebt hatte und in der sie ihm gestorben war, müßte er doch wohnen bleiben. Nicht, daß er immer zu ihr nach dem Kirchhof zu laufen brauchte, wie das übrigens eigentlich zu begreifen wäre, wie sie es wenigstens tun würde, sagte Fräulein Zimmer, wenn sie einen Mann da begraben hätte – aber es wäre eine fixe Idee von ihm, daß er sich draußen besser fühlen würde, daß er da auch leichter wegkäme über den Verlust.
Frida richtete sich halb auf, ihre Augen wurden groß. Wenn sie nun heute mit dem Herrn gegangen wäre, der sie verfolgt hatte von der Friedrichstraße an – ?! Wie sie nur plötzlich darauf kam, sie war doch bei ganz anderen Gedanken gewesen?! Jetzt fühlte sie es: dieser Gedanke hatte auf sie gelauert die ganze Zeit.
In der Friedrichstraße hatte er sich ihr angeschlossen; er war wohl schon eine Weile hinter ihr her gewesen, sie hatte es nur nicht bemerkt, nun aber, da sie an einem Schaufenster stand, sprach er sie an. Sie wurde öfters abends angeredet; das passiert allen Mädchen, aber dieser Mann zog den Hut dabei. Und wenn sie ihm auch gar nicht antwortete, ihn nicht einmal ansah, er blieb immer hinter ihr. Die ganze Friedrichstraße hinunter, über die Weidendammer Brücke, die Chausseestraße entlang. Sie wurde ganz verwirrt: hatte der eine Ausdauer!
Es gingen viele Füße hinter ihr. Aber diesen Tritt hörte sie ganz genau heraus. Sie ging rascher, da wurde der auch rascher – sie ging langsamer, da verlangsamte sich der auch. Und je weiter sie in die Chausseestraße hineinging, desto näher kam er ihr; er war ihr dicht auf den Fersen. Als sie in die Tieckstraße einbog, wo es schon anfängt mit den Hotels, mit den Türen, darüber auf den matterleuchteten Milchglasscheiben zu lesen steht: »Zimmer zu 1 M. 50’ sprach er sie wieder an. Es war, als ob er hier doppelt dreist wäre. Und er drückte sich an ihren Arm und drängte sie dicht an so ein Haus heran.
Lange genug hatte sie hier in der Gegend gewohnt, die hatte keine Geheimnisse mehr für sie. Aber was dieser Mann sich eigentlich dachte! Sie war doch ein anständiges Mädchen! Sie beeilte sich immer mehr, sie mußte machen, daß sie nach Hause kam – ach, morgen früh ging’s wieder los, nähen, immer nähen, alle Tage nähen!
Ein plötzlicher Ekel hatte sie überkommen; ein Ekel an ihrer Arbeit, ein Ekel am Leben überhaupt.
Er hatte sie unablässig bedrängt. Er sollte sie in Ruhe lassen – sofort! Nein, nie würde sie sich in solch einen Eingang drängen lassen, niemals so eine Treppe hinauf, die leise knarrt, wenn man sie betritt, nie dann hinein in den winkligen Flur nach dem verschlossenen Eingang hin, wo beim Porzellanknopf der Schelle das Schildchen hängt: Hotelglocke.
Aber der Freche hatte sie weiter verfolgt bis an ihr Haus, sich mit hineingedrängt, als sie das Tor aufschloß. Hinter ihr her war er im Durchgang zum Hof, hatte sie im gähnenden Dunkel des Hintergebäudes umgefaßt, daß sie aufschrie aus gepreßter Brust. Er war erst zurückgeblieben, als die Mutter oben die Tür aufmachte und herunterleuchtete.
Ach, es war etwas Schreckliches, arm zu sein und dann in Berlin zu wohnen! Warum es so schrecklich war, darüber war Frida sich nicht klar, aber sie weinte heiße Tränen.
Herr Reschke kam spät, vielmehr früh nach Haus; es wurde ihm immer schwer, sich drüben loszureißen. Als er leise die Treppe hinaufschlich und dann versuchte, ganz unhörbar den Schlüssel ins Schloß seiner Küchentür zu stecken, wurde gerade drüben bei Riedels die Tür des Separateingangs zugedrückt. Sie schloß sich hinter der Gestalt einer Dame in Herrenbegleitung. War das nicht die älteste Riedel gewesen? Arthur lächelte befriedigt in sich hinein: die da drüben hatte doch richtig taxiert!
Mine schlief ganz fest, sie blies durch die Nase, daß es hauchte und fauchte. Der so spät Heimkommende durfte es sogar wagen, die Kerze anzuzünden: friedlich lag sie da, die Hände auf der Brust gefaltet. Er betrachtete sie mit einer gewissen Rührung: seine gute Alte, die merkte von gar nichts!
Aber Mine schlief nicht; sie ließ es sich nur nicht merken, daß sie wachte. Sonst hätte sie doch sagen müssen: »Aber Arthur, so spät, wie kannste bloß?!« Und das wollte sie nicht, denn dann wurde er verdrießlich und sie verdrießlich, ein Wort gab das andere – nein, nützen tat das Reden über das lange Ausbleiben doch nichts.
Sie hatte die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie sie ihm wohl etwas verschaffen könnte, das ihm so viel Vergnügen machte, daß er Café Amor drüber vergaß. Und da fiel ihr auf einmal ein, was er heute aus der Zeitung vorgelesen hatte. Und sie sah ihn wieder am Küchenfenster stehen, den Arm ums Fensterkreuz geschlungen, den Oberkörper weit hinausgebeugt: »Ich glaube, ich seh ’nen Stern!«
Ach, was konnte man für Sterne zu sehen kriegen draußen auf freiem Feld! Da standen sie groß und leuchtend über der dunklen Erde; man sah sie blitzen und funkeln an den stillen Abenden, als wären sie neupoliert. Sonne, Mond und Sterne – die großen Lichter bei Tag und bei Nacht – wenn man sie immer hat, achtet man ihrer gar nicht mehr so; wenn man sie aber nie mehr sieht in ihrem vollen Glanz, nie ganz ungetrübt, dann freut man sich sehr darüber. Was waren alle Gaslampen, all das elektrische Licht hier in der Stadt dagegen?! Die waren von Menschenhänden angezündet. Aber Gottes Hände steckten die Sonne an, daß sie alles hell beschien und wachsen ließ: Gras und Klee, Roggen und Weizen, Rüben und Kartoffeln. Und den Mond ließ der liebe Gott aufgehen wie ein gutes, rundes Gesicht, das über den Acker guckte und aufs Dorf: ist auch alles hübsch in Ordnung? Und die Sterne sind die Augen von den vielen Engeln. Ach! Mine hatte aufgeseufzt, halb froh, halb zag – ein Gedanke zog wie erleuchtend durch ihren Kopf – wenn sie ihrem Arthur das schaffen könnte!
Aber wie nur, wie? Sie hatten doch nicht Geld genug, um sich draußen gleich ein Häuschen zu kaufen und ein Stück Acker dazu, und eine Kuh und ein Schwein – ach Gott, wenn es zu so viel langte?!
Sie überschlug in Gedanken, was sie sich erspart hatte die letzten acht Jahre. So lange die Kinder klein waren, hatte sie keinen Pfennig zurücklegen können, nun aber verdiente Fridchen doch schon seit ihrem sechzehnten Jahr, und Max, der jetzt bei den Soldaten war, hatte auch schon für Kost und Logis sein Teil beigetragen. Ob sie wohl schon die tausend Mark voll hatte, die sie sich gesetzt hatte als höchstes Ziel? Sie wußte es nicht; Frida hatte es nicht anders getan, sie hatte ihr eigenes und der Mutter erspartes Geld immer auf die Sparkasse getragen. Mine hätte es viel lieber selber verwahrt; da – da! Sie drehte im Dunkeln den Kopf nach der Seite, wo die Kommode an der Wand stand mit der weißen Häkeldecke und den Photographierähmchen darauf. Wenn sie es doch da hätte, ganz zu unterst unter ihrer Wäsche! Sehnsüchtig seufzte sie.
Aber sie konnte ja nachsehen im Sparkassenbuch; da stand es drin. Doch das war nicht dasselbe. Fühlen muß man’s, mit den Fingern halten, was man sich erarbeitet hat, dann weiß man erst, daß man’s wirklich hat.
Sollte sie aufstehen, Licht machen, nachsehen, was im Buche stand? Nein, Frida würde aufwachen darüber. Und Arthur könnte ihr auch drüber zukommen. Es war besser, sie ließ das Sparkassenbuch, wo es war. Sie bezähmte ihre Ungeduld, aber sie konnte nicht einschlafen.
Stunde um Stunde verstrich. Sie drückte die Augen zu, es war alles ganz dunkel um sie, und doch sah sie immer ein helles Feld. Und auf dem Feld stand ein Häuschen mit einem Fenster rechts von der Tür und einem links von der Tür, und hinter dem Häuschen war ein Gärtchen, da stand sie selber und pflanzte Kohl. Und Arthur stand in der Tür und guckte ihr zu und rauchte. Die Sonne blendete. O so hell, so hell! Tränen schossen ihr in die Augen. Sang nicht ein Vogel? Quakte nicht ein Frosch?
Und sie hörte ein immerwährendes Rauschen. Ha, das war der Sommerwind, der strich durchs reifende Korn! Sie lächelte im Finstern ganz entzückt: ja, ja, Sommer, Sonne, Wind und Korn. Und wie das duftete: nahrhaft und frisch!
In der Stube war es dumpf und schwül, sie merkte es nicht; all ihre Sinne waren wie benommen und ihre Gedanken auch. Wenn sie doch das Geld dazu hätte! Wenigstens ein Stückchen, ein winziges Stückchen von der großen Erde, auf das sie treten könnte und sprechen: »du bist mein!« Auf dem sie aussäen könnte und pflanzen, zu eigener Ernte. Sollte es denn wirklich nicht möglich sein, wirklich nicht?! Ihr Kopf war heiß.
Der Wunsch, dem Arthur nachgegangen war in einer plötzlichen Laune, wurde ihr zu einer himmlischen Eingebung. Die alternde Frau faltete die Hände wie ein junges Kind und betete zum Vater im Himmel, daß er doch so gut sein möchte und ihr helfen. Was würde das ein Segen für Arthur sein, dann ließ er das Wirtshausgehen, dann ging er nur noch auf sein Land. Dann wurde ihm Café Amor das, was es wirklich war: eine eklige, dunstige Stube, in der Leute zusammengepfercht saßen und qualmten und Karten spielten und tranken und Witze rissen und Weibsbilder pussierten und grölten und lachten; Leute, deren Seele doch so weit von Freude war, wie der fruchtbare Acker von der dürren Asphaltstraße ist.
Es kostete Mine eine große Überwindung, sich schlafend zu stellen, als Arthur kam. Sowie er sich aber niedergelegt hatte und sie ihn schnarchen hörte im tiefen Bierschlaf, stand sie auf. Es litt sie nicht länger. Sie tappte auf bloßen Füßen hin zur Kommode. Leise zog sie das Schubfach auf. Licht anzuzünden getraute sie sich nicht; aber sie fand auch das Buch im Dunkeln. Es lag hier unter dem Hemd, das Fridchen genäht als Meisterstück, als sie ausgelernt hatte. Die Mutter hob es auf wie ein Heiligtum: darein sollte man sie kleiden, wenn’s mit ihr zu Ende war.
Mine trat mit dem Büchelchen dicht ans Fenster; schon graute der Tag, über den Hof zog ein bleichrötliches, schmutziges Dämmern. Und sie las mit erschrockenen Augen, daß sie erst vierhundertundzwanzig Mark auf der Sparkasse hatte. Mehr war’s wirklich nicht?! Gewiß, das war ja schon was – ganz viel – aber sicherlich, sicherlich lange nicht genug! Manchen Monat hatte sie eben nichts beiseite legen können.
Eine tiefe Niedergeschlagenheit bemächtigte sich der Frau, sie hätte weinen mögen vor Enttäuschung. Was war ihr denn beigekommen, daß sie gedacht hatte, sie wäre so reich? Sie schlug sich vor die Stirn: so dumm! Es war eben nichts mit der Hoffnung, die war vorbei; sie hatte geträumt, einmal schön geträumt.
Mine Reschke duckte den Kopf, wie eine, die wieder ihre Last auf den Buckel nimmt, und seufzte ergeben – da legte sich Fridas Arm um sie.
»Mutter, kannst du auch nicht schlafen? Warum schläfst du denn nicht?«
2.
Doktor Hirsekorn, bei dem Frida Reschke nähte, rüstete zum Umzug. Noch immer hatte die Hausdame gehofft, es würde nichts daraus werden, denn manchmal schien es dem alten Mann doch bange zu sein, sich so zu verändern. Dann war er ja auch noch so viel weiter weg von seiner Frau, das sagte Fräulein Zimmer ihm alle Tage. Hier oben von der Wilhelmstraße brauchte er nur eine Viertelstunde bis hinters Hallesche Tor, oder er konnte mit der Elektrischen fahren – ein paar Minuten, dann war er bei ihr.
Aber der Doktor sah sie mit seinen Augen, die noch immer scharf waren, halb spöttisch, halb traurig an. Als wenn ein Leib, der da im Kirchhofsgrund verwest, das einzige wäre, was an Geliebtes bindet! Die Sehnsucht nach der geistigen Gegenwart des geliebten Menschen ist überall, und gerade am Grabe wird sie übermächtig, peinvoll. Lieber draußen in Wald und Wiese, in Heide und Acker der Dahingegangenen nachspüren. »Ich hoffe, die Natur steht mir bei!«
Wie der Doktor doch so merkwürdig redete! Es wurde dem Fräulein ganz unheimlich. Sie sprach sich auch bei der Näherin darüber aus: und wie komisch er überhaupt war! Abends, wenn es ganz still wurde in der Wohnung, und sie noch einmal an seiner Stube vorbeiging, hörte sie ihn drinnen sprechen: »Gute Nacht, geliebtes Herz, schlaf wohl!« Das ging einem dann ordentlich durch und durch, ein Frösteln kroch über den Rücken. Der arme Mann! Sie mußte aber auch wirklich nett gewesen sein, die Frau Doktor!
Fräulein Zimmer war erst nach dem Tode der Frau ins Haus gekommen, bis zu ihrem letzten Tag hatte Frau Marianne die Wirtschaft selber geführt, obgleich sie schon ein paar Jahre gekränkelt hatte; nicht innerlich, da war sie gesund, aber mit den Füßen war es nicht mehr voran gegangen, sie war zu stark geworden. Der Herr hatte sie die letzte Zeit immer draußen im Rollstuhl gefahren. Und die Treppe hinauf hatte er sie mit dem Portier getragen. Sie hatte dann immer gelacht und ihm das Gesicht gestreichelt: »Bin ich dir auch wirklich nicht zu schwer, mein guter Mann?!« Wirklich, die Frau Doktor war nicht wie eine gewesen, sie so viel Geld hat. Die »Millionenwitwe« hieß sie, als der Doktor sie geholt hatte vor den Toren, draußen aus Britz. Sie stammte aus Tempelhof, da waren ihre Eltern noch simple Bauern gewesen, und ihr erster Mann auch nur ein Landmann, aber alle schwer reich durch den Verkauf ihrer Äcker. Sie aber hatte nichts Protziges an sich gehabt, sie sollte sehr bescheiden gewesen sein, eine liebe Frau. Und immer heiter. Eigentlich kein Wunder, daß der Doktor noch heute, nach zwei Jahren, so tat, als lebte er fort mit ihr. Oder ob er an Geister glaubte? An das Erscheinen der abgeschiedenen Seele in einem Astralleib?
Des Fräuleins Augen wurden ganz starr und groß. Julie Zimmer schwor darauf, daß es etwas Übernatürliches gäbe, aber die Näherin lachte sie aus: an so etwas glaubt kein Berliner Kind. Was war denn auch Wunderbares dabei, daß der Herr Doktor noch an seiner Frau hing? Sie waren doch so lange verheiratet gewesen, ihre Kinder waren erwachsen und nicht mehr im Haus, die beiden waren allein geblieben, immer zusammen Tag und Nacht; es war doch ganz natürlich, daß er manchmal glaubte, sie wäre noch da. Nur daß er sagte: »Mein geliebtes Herz«, so wie ein Verliebter spricht, das war etwas Wunderbares – so alte Leute!
»Oh,« sagte Fräulein Zimmer, »alte Männer können auch noch verliebt sein – überhaupt sich auch noch mal verlieben.« So alt war der Doktor ja doch eigentlich gar nicht! Sie hatte sich nun entschlossen, so weit sie auch anfänglich diese Zustimmung von sich gewiesen hatte, mit dem armen einsamen Mann hinauszuziehen nach der Gartenstadt.
In der Gartenstadt, die im Norden von Berlin nach einer halben Stunde Fahrt vom Stettiner Bahnhof aus zu erreichen ist, hatte Hirsekorn sich ein Haus gekauft. Die Terraingesellschaft hatte es gerade fertig gehabt, als er es sah, und es gefiel ihm. Es lag tief in den Kiefern, ein gutes Stück vom Bahnhof ab und von der Post und dem Kaufladen. Aber das war ihm gerade recht.
Seine alte Liebe für das Land war wieder erwacht. Er hatte ja auch nichts mehr in der Stadt zu tun. Seine Praxis hatte er aufgegeben, schon die letzten Jahre vorm Tode seiner Frau, denn wer sonst sollte Marianne stützen, im Rollstuhl fahren, sie hinauf- und hinuntertragen? Und nun sie tot war, war es ihm, als sei er zu gar nichts mehr nütze auf der Welt. Die Wochen, die Monate, die geflogen waren an ihrer Seite – Stunden wie Minuten – Jahre wie Tage – die waren nun endlos. Sie dehnten sich zur quälenden Ewigkeit.
Es trieb ihn in die Straßen hinein, es trieb ihn wieder aus den Straßen heraus. Aber nicht in jene Gegend trieb es ihn, woher er sich einst die geliebte Frau geholt hatte: das Tempelhof von heute war nicht mehr der Rahmen für ihr liebes Bild. Da bauten sie Häuser wie die Kasernen, von dem einstigen Dorf war so gut wie nichts mehr da, die alten Linden kümmerten, städtische Blumenparterres wurden angelegt, Elektrische blitzten, Bahnzüge donnerten, es raste und ratterte, rollte und rasselte – für ihr blondes Haupt mit dem Flechtenkranz, für ihre weiche Gestalt mit der behaglichen Fülle war das keine Umgebung. Das weite Feld, über das er einst mit ihr geschritten war Hand in Hand in einer ersten und doch hoffnungsreichen Stunde – Marianne hatte ihre Mutter begraben, und sie selbst sollte bald Mutter werden – war jetzt eine Wüste. Und alle waren schon hingegangen, die damals mitgelebt hatten. Er allein war übrig geblieben von dieser Generation, und er hatte das Gefühl: geh auch du aus der vieltausendköpfigen Menge heraus, in der du doch so einsam bist, und suche dir für deinen Abend einen Fleck Erde, dem du noch etwas sein kannst, und der dir noch etwas ist: einen Garten, der dir blühend seine Dankbarkeit zeigt, der dankbarer ist, als ein Kind es je sein kann. Richte dir da ein Haus auf, so fern von dem Lärmen und Treiben, so wie du sie einstmals gefunden hast!
Fräulein Zimmer hatte ganz recht, der Doktor war etwas merkwürdig geworden. Das fanden auch seine Kinder. Die Tochter war in Magdeburg verheiratet; ihr Mann war Großkaufmann und sehr wohlhabend. Und sie hatte drei allerliebste blonde Kinder.
Hanna besuchte den Vater öfters, fast alle Vierteljahr, aber sie fand, daß er sich eigentlich nicht genug darüber freute. »Vater ist doch auf einmal recht alt geworden,« sagte sie zu ihrem Bruder Wilhelm, dem Regierungsrat. »Er kann sich gar nicht mehr so mit einem freuen, und wenn man wieder fortgeht, ist es ihm auch ziemlich gleichgültig. Das ist aber wohl nicht anders bei alten Leuten; die Empfindungen stumpfen sich ab.«
Der Sohn, der, obgleich er weit im Westen wohnte, aber doch alle paar Tage nach dem Vater sah, gab ihr recht. Hätte man nicht annehmen können, daß der alte Herr, nun die Mutter tot war, ganz aufgehen würde in Kindern und Enkeln?! Beide Kinder waren sich darüber einig, was sie beim Vater vermißten.
Und was vermißte der Vater bei ihnen? Hirsekorn sagte es seinen Kindern nicht. Nicht alle ihre Interessen konnten seine Interessen sein. Ja, Marianne, ach die, die hatte es verstanden, mit den Kindern jung zu sein oder wenigstens zu scheinen! Sie war eine Mutter – eine Großmutter – und was vermöchte die nicht? Es war ihr gewiß manchmal zu viel geworden, wenn die Tochter aus Magdeburg Besorgungen auf Besorgungen schickte, die immer alle so rasch als möglich erledigt sein sollten; es war auch wenig nach ihrem Herzen, daß Wilhelms Frau von Schneiderin und Putzmacherin erzählte, als seien das die wichtigsten Personen in ihrem Leben; es griff sie sicher oft an, wenn die Enkel um ihren Sessel tobten. Aber sie war immer voller Verstehen gewesen. Wilhelms Frau war eine schöne junge Frau, es war natürlich, daß sie Wert auf ihre Kleidung legte – und Hanna bekam in Berlin alles besser und auch billiger – und wenn die Enkelkinder sie auch heute müde gemacht hatten, sie konnte ja morgen ausruhen, es war doch eine Freude, daß die Kinder so gesund und lebhaft waren.
Der Mann senkte den Kopf: ja, seine Marianne, die war eine Frau wie sie sein soll: die kann sich selber verleugnen, die kann lächeln, wenn es ihr auch zum Weinen ist, die kann Interesse zeigen, Geduld, Teilnahme auch in der größten Ermattung – aber er, er als Mann? Nein, so alt war er denn doch noch nicht, daß ihn jeder persönliche Wunsch verlassen hätte, noch nicht so ohne allen Egoismus, daß er jedes Recht seines Ichs einfach aufgab, sich den Kindern anpaßte, als hätte er vor ihnen kein Leben geführt. Er wollte auch jetzt noch sein eigenes Leben haben.
Das war der Hauptgrund, weshalb Doktor Hirsekorn sich das Haus unter den Kiefern zum Wohnplatz aussuchte.
Seine Kinder waren durch diesen Entschluß unangenehm überrascht, die Tochter war fast beleidigt. Sie schrieb an Fräulein Zimmer: konnte die es denn nicht möglich machen und den Vater bewegen, diese unglückliche Idee aufzugeben, wenn er denn schon so wenig auf seine Kinder gab? Der Regierungsrat redete aufs ernsthafteste ab, er fühlte sich verpflichtet: der alte Mann so weit draußen und so ganz allein?!
Es schien ein gewisser Eigensinn, mit dem der Doktor auf seinem Willen bestand: »Ihr tut ja, als zöge ich in eine Einöde. Laßt mich nur!«
»Du wirst aber sehr allein sein. Man kann dich beim besten Willen dann nicht so häufig besuchen. Schon allein diese Reise bis zum Stettiner Bahnhof!«
Da lächelte der Vater; es war ein feiner Spott in seinem Lächeln und zugleich etwas wie Gram: »Wenn ihr mich brauchen werdet, werdet ihr mich auch da schon zu finden wissen. Im übrigen bin ich ja nicht allein.« Er sagte das so, daß keine Erwiderung mehr am Platze war.
Die Zimmer war sehr schlechter Laune. Beide Dienstmädchen, die noch von Frau Doktors Zeiten her im Hause waren, kündigten; zwar mit Tränen, denn es wurde ihnen wirklich schwer, die gute Stelle zu verlassen. Aber die Köchin hatte einen Bräutigam, mit dem sie alle Abend unten auf und ab spazierte, und das Hausmädchen amüsierte sich gern. Beides war da draußen ausgeschlossen. »Sehen Sie, Herr Doktor«, sagte die Hausdame fast weinend, »das ist nun schon das erste!«
Es kostete viel Geld, Herumlaufen und Zureden, zwei neue Mädchen zu finden. Wenn die Mietsfrau denen auch versicherte: »Sie denken sich det draußen viel schlimmer als det in Wirklichkeit is, feine Filla, jesunde Luft, Se kriejen da schöne rote Bakken« – die meisten Mädchen waren von auswärts zugezogen, und nun wollten sie erst einmal Berlin auskosten.