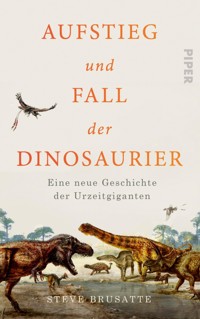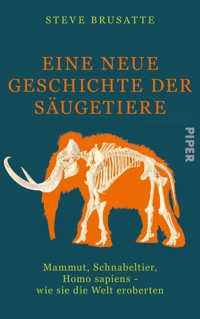
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 27,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der lange Weg des Menschen Das Aussterben der Dinosaurier war die große Chance der Säugetiere: Jahrelang lebten sie im Schatten der Ungetüme, nun eroberten sie sich die Erde zurück. Heute gibt es nur noch 6000 Säugetierarten – Überlebende eines einst üppigen Stammbaums, der durch Naturkatastrophen und nicht zuletzt die Klimakrise beschnitten wurde. Steve Brusatte porträtiert Mammuts und Säbelzahntiger, eierlegende Schnabeltiere, Koalas, die ihre Jungen in winzigen Beuteln aufziehen, und natürlich den Homo sapiens. Ein faszinierendes Buch voll bahnbrechender Erkenntnisse über unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Aus dem amerikanischen Englisch von Katja Hald
Für Anthony, mein kleines Lieblingssäugetier
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel The Rise and Reign of the Mammals bei Mariner Books, New York – Boston
© 2022 Stephen L. Brusatte
Für die deutsche Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Illustrationen: Todd Marshall und Sarah Shelley
Covergestaltung: Cornelia Niere
Covermotiv: akg-images / Leonello Calvetti/Science Photo Library
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zeitachse der Säugetiere (in MIllionen Jahren)
Stammbaum der Säugetiere
Einführung
Unsere Familie, die Säugetiere
1
Vorfahren der Säugetiere
2
Entstehung der Säugetiere
3
Säugetiere und Dinosaurier
4
Die Revolution der Säugetiere
5
Säugetiere überleben, Dinosaurier sterben aus
6
Die Säugetiere werden modern
7
Extreme Säugetiere
8
Säugetiere und Klimawandel
9
Säugetiere der Eiszeit
10
Menschliche Säugetiere
Epilog
Säugetiere der Zukunft
Anmerkungen
Danksagung
Stichwortverzeichnis
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Register
Einführung
Unsere Familie, die Säugetiere
Zum ersten Mal seit Jahren durchbrachen wieder Sonnenstrahlen den finsteren Himmel. Rauchschwaden trieben unter den grauen Wolken und überzogen den Boden mit düsteren Schatten. Das Land war verwüstet. Dreckiger Schlamm, so weit das Auge reichte, eine farblose Einöde ohne Grün oder andere bunte Tupfer. In der Luft hing eine gespenstische Stille. Nur das Plätschern eines Flusses war zu hören, dessen Lauf von Stöcken, Steinen und verrottenden Pflanzen behindert wurde.
Am Flussufer lag das Skelett einer Bestie, Fleisch und Sehnen waren längst verschwunden, die Knochen von einem stockfleckigen Beige. Aus dem wie zum Schrei aufgerissenen Kiefer waren die Zähne herausgeschlagen und lagen verstreut neben dem Schädel. Sie waren groß wie Bananen und messerscharf, mörderische Waffen, mit denen dieses Ungeheuer seine Beute zerfetzt und ihr die Knochen zermalmt hatte.
Es war das Skelett eines Tyrannosaurus Rex – einst König der Dinosaurier, ein Echsentyrann, der den gesamten Kontinent unterdrückte. Nun gab es seine Spezies nicht mehr. Und auch sonst schien kaum etwas überlebt zu haben.
Plötzlich drang aus dem Inneren des toten Giganten ein leises Geräusch. Ein Rascheln und Trippeln, dann tauchte zwischen zwei T.-rex-Rippen eine winzige Nase mit zitternden Tasthaaren auf, zögernd zunächst, als witterte sie Gefahr, aber da war nichts.
Die Zeit war gekommen, aus dem Versteck zu kriechen. Schnell huschte die Kreatur ins Licht und erklomm die Knochen.
Mit ihrem fellüberzogenen Körper, den Knopfaugen, dem dünnen, langen Schwanz und der Schnauze voller Zähne, die an Berggipfel erinnerten, hätte sie einem T. rex nicht unähnlicher sein können.
Sie hielt einen Moment inne, kratzte sich das Nackenfell und stellte die Ohren auf, bevor sie sich auf allen vieren auf den Weg machte. Hände und Füße stabil unter dem Körper, kletterte sie flink und zielsicher über die Rippenbögen nach oben und dann entlang der Wirbelsäule auf den Dinosaurierschädel.
In einer der Augenhöhlen, durch die der T. rex einst Triceratops-Herden beobachtet hatte, blieb das Fellknäuel sitzen, drehte sich Richtung Brustkorb und stieß ein grelles Quieken aus. Aus dem Monster krochen zwölf etwas kleinere Fellknäuel und flitzten zu ihrer Mutter. Noch keine Minute an der Erdoberfläche, drängten sie sich um ihren Bauch und schlabberten gierig ihre Frühstücksmilch.
Während sie ihre Babys säugte, blinzelte die Mutter ins Sonnenlicht. Die Welt gehörte nun ihr, ihr und ihrer Familie. Die Herrschaft der Dinosaurier war vorüber. Die feurige Zerstörungswut eines Asteroiden und ein langer, globaler nuklearer Winter hatten sie beendet. Die Erde war im Begriff zu heilen, und es war ein neues Zeitalter angebrochen – die Ära der Säugetiere.
Rund 66 Millionen Jahre später stand an ebenjener Stelle ein anderes Säugetier mit einer Kreuzhacke in der Hand. Sarah Shelley war meine erste Doktorandin, nachdem ich meinen Job als Paläontologe an der Universität von Edinburgh in Schottland angetreten hatte. Wir waren auf Fossilienjagd in den USA, in New Mexico, und suchten nach Knochen, Zähnen und Skeletten, die uns helfen sollten zu verstehen, wie die Säugetiere den Asteroideneinschlag überlebt hatten und die Dinosaurier bis heute überdauert haben. Wie haben sie sich die Welt zu eigen gemacht und sind zu den pelzigen Gesellen geworden, die wir auch heute noch kennen, lieben und manchmal fürchten?
Säugetiere sind – bei allem Respekt für Reptilien, Vögel und die anderen über acht Millionen Tierarten, die nicht zu den Säugern zählen – die charismatischsten und meistgeliebten Lebewesen auf unserem Planeten. Teilweise liegt das wohl einfach daran, dass die meisten von ihnen niedlich und flauschig sind, teilweise aber auch daran, dass wir eine Beziehung zu ihnen herstellen können und uns selbst in ihnen wiedererkennen. Auf dem Bildschirm verfolgen wir gebannt das Drama einer von einem Gepard gejagten Gazelle, geraten in Verzückung über eine Ottermutter, die auf dem Cover einer Zeitschrift mit ihren Jungen spielt, unsere Kinder betteln, dass wir mit ihnen im Zoo die Elefanten und Nilpferde besuchen, und während uns die meisten Spendenaufrufe nur nerven, erregen bedrohte Pandas unfehlbar unser Mitleid. Füchse und Eichhörnchen haben sich an unsere Städte gewöhnt, und selbst Rehe und Hirsche wagen sich bis in die Randbezirke. Wir sind schwer beeindruckt von Walen, die länger sind als ein Basketballfeld und meterhohe Geysire aus ihren Blaslöchern in die Luft prusten, gruseln uns vor Vampirfledermäusen, die tatsächlich Blut trinken, und der Anblick eines Löwen oder Tigers jagt uns ein Schaudern über den Rücken. Wir lieben knuddelige Haustiere, Katzen, Hunde oder auch exotischere Arten. Als Rindersteaks, Schweinswürstchen oder Lammkoteletts sind Säugetiere für viele von uns Nahrung. Und natürlich zählen wie Bären oder Mäuse auch wir selbst zur Familie der Säugetiere.
Sarah Shelley und ich in New Mexico auf der Suche nach Zähnen von Säugetieren, die kurz nach dem Aussterben der Dinosaurier lebten. (Foto: Tom Williamson)
Während in der Ferne eine Horde Präriehunde heulte, schwang Sarah unbeirrt ihre Kreuzhacke. Mit jedem Schlag stieg eine faulig nach Schwefel stinkende Staubwolke aus dem Gestein auf, und jedes Mal wartete Sarah geduldig, bis der Staub sich gelegt hatte, um nachzusehen, ob der Boden etwas Interessantes preisgegeben hatte. Über eine Stunde lang kam jedoch nichts anderes zutage als gewöhnlicher Stein. Bis dann nach einem Schlag plötzlich eine Form mit einer anderen Beschaffenheit und Färbung zu erkennen war. Sarah kniete sich auf den Boden, um sich die Stelle genauer anzusehen. Dann stieß sie einen so lauten und spontanen Freudenschrei aus, dass mir hier schlicht die Worte fehlen, um ihn zu beschreiben.
Sie war auf ein Fossil gestoßen, den ersten großen Fund ihrer Studentinnenlaufbahn.
Als ich zu ihr lief, um ihren Schatz zu begutachten, händigte sie mir zwei an der Spitze zusammenhängende Kieferknochen aus. Die mit Gipsspat überzogenen Zähne glitzerten in der Wüstensonne, und ich sah sofort, dass es sich um scharfe Eckzähne und die dahinterliegenden Mahlzähne handelte. Ein Säugetier! Aber nicht irgendein Säugetier. Sondern jene Gattung, die die Thronfolge der Dinosaurier angetreten hatte.
Wir klatschten uns ab und machten uns sofort wieder an die Arbeit.
Der von Sarah gefundene Kiefer gehörte zu einer Gattung namens Pantolambda, und er war groß, ungefähr so groß wie der eines Shetlandponys. Die Pantolambda lebten »nur« ein paar Millionen Jahre nach den Dinosauriern, also einige Generationen, nachdem die kleine Säugetiermutter in meiner fiktiven, aber durchaus realistischen Eingangsgeschichte zwischen den Rippenbögen des T. rex hervorgekrochen war. Die Pantolambda waren bereits bedeutend größer als alle Säugetiere, die T. rex oder Brontosaurus je zu Gesicht bekommen hatten. Nachdem ein paar dieser genügsamen Geschöpfe den Asteroiden dank ihrer geringen Größe – keines von ihnen war größer als ein Dachs – überlebt hatten, fanden sie sich plötzlich in einer dinosaurierfreien Welt wieder. Sie wurden größer, breiteten sich aus, und es entstanden neue Arten, die bald komplexe Ökosysteme bildeten, die jene der Dinosaurier – die mehr als 100 Millionen Jahre über die Erde geherrscht hatten – ersetzten.
Dieses spezielle Pantolambda lebte im Dschungel am Rand eines Sumpfgebiets (daher der üble Geruch des Gesteins, in dem es begraben lag). Es war in der Gegend der größte Pflanzenfresser, und wenn es nach einem Mittagessen aus Blättern und Bohnen durch das kühle Wasser watete, sah oder hörte es eine Vielzahl anderer Säugetiere. Über seinem Kopf turnten kätzchengroße Akrobaten, die sich mithilfe ihrer Greifhände durch die Äste der Bäume schwangen. Am Sumpfrand steckten Köter mit Gesichtern wie gotische Wasserspeier ihre Schnauzen in den Schlamm und gruben mit ihren Krallen nach nährstoffreichen Wurzeln und Knollen. In den lichteren Teilen des Waldes tänzelten auf behuften Zehen anmutige Ballerinas über die Wiesen, während verborgen hinter den subtropischen Gewächsen des paläozänen Urwalds der Tod in Form eines Spitzenprädators lauerte: gebaut wie eine Bulldogge mit scharfen, gebleckten Zähnen.
Das Ende der Dinosaurier hatte den Aufstieg dieser Säugetiere begünstigt – nicht nur in New Mexico, sondern überall auf der Welt. Die Anfänge ihrer Geschichte liegen jedoch sehr viel weiter zurück. Die Säugetiere – oder besser wir – entstanden vor über 200 Millionen Jahren, in etwa zur selben Zeit wie die Dinosaurier, als die Landmasse noch ein einziger Superkontinent war, übersät mit den Brandflecken ausgedehnter Wüsten. Das Erbe dieser ersten Säugetiere wiederum lässt sich zurückverfolgen bis in die feuchten Steinkohlesümpfe vor rund 325 Millionen Jahren, in denen sich die Linie unserer Säugetiervorfahren auf dem Stammbaum des Lebens von der Linie der Reptilien trennte. Von da ab entwickelten die Säugetiere über die immense Dauer mehrerer geologischer Zeitalter ihre typischen Merkmale: Fell, einen ausgeprägten Geruchs- und Hörsinn, große Gehirne und einen scharfen Verstand, schnelles Wachstum und einen warmblütigen Stoffwechsel, spezifische Zahnreihen (Schneidezähne, Eckzähne, Prämolaren, Molaren) und Milchdrüsen, über die weibliche Tiere den Nachwuchs mit Milch versorgen.
Auch die heutigen Säugetiere sind Teil dieser langen und reichen Evolutionsgeschichte. Momentan teilen wir den Planeten mit über 6000 Arten – unter den Millionen je existierender Spezies unsere engsten Verwandten. Sämtliche modernen Säugetiere können einer von drei Gruppen zugeordnet werden: den Eier legenden Kloakentieren (Monotremata), zu denen das Schnabeltier zählt; den Beuteltieren (Marsupialia) wie Kängurus oder Koalabären, die ihre winzigen Jungen in Bauchtaschen großziehen; oder den Plazentatieren (Placentalia), die ihren Nachwuchs wie wir relativ weit entwickelt zur Welt bringen. Diese drei Säugetiertypen sind jedoch nur die spärlichen jüngsten Triebe eines einst weitverzweigten Familienstammbaums, den die Massenaussterben im Laufe der Zeit stark beschnitten haben.
Zu unterschiedlichen Zeiten gab es einst Legionen von Fleischfressern mit Säbelzähnen (nicht nur die berühmten Tiger, auch Beuteltiere mit Eckzähnen wie Speere), schreckliche Wölfe, riesige Elefanten mit dickem Fell und Hirsche mit lächerlich großen Geweihen. Es gab XXL-Nashörner, die zwar keine Hörner hatten, dafür aber lange Hälse, dank derer sie hoch oben in den Baumwipfeln die Blätter abrupfen konnten, die ihre fast 20 Tonnen Lebendgewicht nährten. Diese Säugetiere machten Brontosaurus Konkurrenz und gelten als die größten behaarten Tiere, die je auf diesem Planeten gelebt haben. Viele dieser fossilen Säuger sind heute Ikonen der Vorgeschichte, die wir aus Zeichentrickfilmen oder als Exponate in renommierten Naturkundemuseen kennen.
Noch faszinierender sind jedoch einige ausgestorbene Säugetierarten, die es nie unter die Stars der modernen Popkultur geschafft haben. So gab es einst winzige Säuger, die über die Köpfe der Dinosaurier hinwegsegelten, und andere, die Saurierbabys zum Frühstück verspeisten, Gürteltiere von der Größe eines VW-Käfers, Faultiere, für die ein Dunking im Basketball eine Leichtigkeit gewesen wäre, und »Donnerdrachen« mit Rammbockhörnern von einem Meter Länge. Es gab schräge Gestalten wie das Chalicotherium, optisch eine missratene Kreuzung aus einem Pferd und einem Gorilla, das auf den Knöcheln ging und mit seinen ausgefahrenen Krallen Baumzweige zu sich herunterzog. Bevor es an Nordamerika andockte, war Südamerika mehrere zehn Millionen Jahre ein Inselkontinent, auf dem eine ganze Dynastie exzentrischer Huftierarten beheimatet war, deren frankensteinartiges Sammelsurium an anatomischen Eigenheiten Darwin einst in großes Erstaunen versetzte – und deren Verwandtschaft mit anderen Säugetieren erst vor Kurzem durch die bahnbrechende Entdeckung sehr alter DNA nachgewiesen wurde. Elefanten waren einmal nicht größer als Zwergpudel. Kamele, Pferde und Nashörner galoppierten durch eine amerikanische Savanne, und Wale hatten funktionstüchtige Beine.
Die Entwicklungsgeschichte der Säugetiere umfasst eindeutig mehr als das, was wir heute noch von ihr sehen, und reicht weit über die Ursprünge des Menschen und dessen Ausbreitung in den letzten paar Millionen Jahren hinaus. All die fantastischen Säuger, die ich gerade erwähnt habe, werden Sie auf den folgenden Seiten kennenlernen.
Meine wissenschaftliche Karriere begann mit der Erforschung der Dinosaurier. Deren Entwicklungsgeschichte bis zu ihrem apokalyptischen Ende habe ich vor ein paar Jahren in meinem Buch Aufstieg und Fall der Dinosaurier bereits erzählt. Ich liebe Dinosaurier und werde mich auch weiterhin mit ihnen befassen, aber seit ich Professor bin und in Edinburgh lebe, bin ich von diesem Thema ein wenig abgekommen. Vielleicht nur eine logische Konsequenz meiner bisherigen Arbeit, denn nachdem ich intensiv zum Aussterben der Dinosaurier geforscht hatte, wollte ich unbedingt wissen, was danach geschah. Und so verfiel ich den Säugetieren.
Manchmal fragen mich die Leute, wieso. Jedes Kind träumt davon, Dinosaurierknochen auszugraben. Warum also nach etwas anderem suchen? Und warum ausgerechnet nach Säugetieren? Meine Antwort ist einfach: Dinosaurier sind der absolute Wahnsinn, aber sie sind nicht wir. Die Geschichte der Säugetiere hingegen ist unsere Geschichte. Indem wir unsere Vorfahren erforschen, begreifen wir unsere eigene Natur besser – warum wir aussehen, wie wir aussehen, wie wir uns entwickeln und Kinder großziehen, weshalb wir Rückenschmerzen haben, teure Zahnbehandlungen brauchen und weshalb wir in der Lage sind, über unsere Umwelt nachzudenken und sie derart stark zu beeinflussen.
Und falls Ihnen das noch nicht genügt, hier noch ein Grund: Manche Dinosaurier waren riesig, so groß wie eine Boeing 737. Aber die größten Säugetiere – Blauwale und ihre Verwandten – sind noch größer. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Säugetiere ausgestorben sind und nur noch fossile Knochen von ihnen existieren. Mit Sicherheit wären sie ebenso berühmt und kultig wie die Dinos.
Das Tempo, in dem wir über die Entwicklungsgeschichte der Säugetiere dazulernen, ist atemberaubend. Es werden mehr Säugetierfossilien gefunden als je zuvor, die wir mit einer Vielzahl von Technologien – CT-Scans, Hochleistungsmikroskopen, Computeranimationen – untersuchen können und die uns offenbaren, wie die Tiere gelebt, geatmet, sich bewegt, gefressen, sich fortgepflanzt und weiterentwickelt haben. Aus manchen Säugetierfossilien – wie beispielsweise der seltsamen südamerikanischen Spezies, die Darwin einst so faszinierte – lässt sich heute sogar DNA gewinnen, die uns wie ein Vaterschaftstest über die Verwandtschaftsverhältnisse zu modernen Arten aufklärt. Die von Männern im viktorianischen England begründete Säugetierpaläontologie wurde im Laufe der Zeit immer differenzierter und internationaler. Ich hatte das große Privileg von Mentoren, die mich – noch einen dieser Dinofreaks! – in ihrem Spezialgebiet, der Säugetierforschung, herzlich willkommen hießen, weshalb es mir heute die allergrößte Freude bereitet, der nächsten Generation wie Sarah Shelley (deren Illustrationen auch diese Seiten zieren!) und vielen anderen herausragenden Studierenden, die mit ihren Entdeckungen die Geschichte der Säugetiere weiterschreiben werden, meinerseits ein Mentor zu sein.
In diesem Buch werde ich die Evolutionsgeschichte der Säugetiere so erzählen, wie wir sie heute kennen. Ungefähr die erste Hälfte des Buchs wird dabei die frühen Entwicklungsstadien abdecken, beginnend mit der Abspaltung von den Reptilien bis zum Aussterben der Dinosaurier. In diesem Zeitraum entwickelten die Säugetiere nahezu alle ihre typischen Merkmale – Fell, Milchdrüsen und so weiter – und verwandelten sich nach und nach von eidechsenähnlichen Vorformen in Tiere, die wir heute als Säugetiere wahrnehmen würden. Die zweite Hälfte des Buchs beschreibt, was nach dem Ende der Dinosaurier geschah: wie die Säugetiere ihre Chance nutzten und die Herrschaft übernahmen, wie sie sich an das ständig wechselnde Klima anpassten, mit den Kontinenten auseinanderdrifteten und so die unglaubliche Artenvielfalt an Läufern, Gräbern, Fliegern, Schwimmern und Leserinnen und Lesern mit großen Gehirnen entwickelten, die wir heute kennen. Ich möchte Ihnen auch erzählen, wie wir uns die Geschichte der Säugetiere anhand fossiler Funde Stück für Stück erschlossen haben, und Ihnen dadurch einen Eindruck vermitteln, was es bedeutet, Paläontologe zu sein. Ich werde Ihnen meine Mentoren vorstellen, meine Studierenden und all die Menschen, die mich bei meiner Arbeit inspirierten und deren Entdeckungen die Beweise lieferten, die mir die Niederschrift dieser Chronik der Säugetiere überhaupt erst ermöglichten.
Dieses Buch konzentriert sich nicht in erster Linie auf den Menschen. Bücher, die das tun, gibt es viele. Auch ich werde natürlich die Ursprünge der Menschheit thematisieren und darlegen, wie wir uns von den Primaten weiterentwickelten, uns auf zwei Beine stellten, unsere Gehirne aufblähten und – nachdem wir lange Zeit Seite an Seite mit anderen frühen menschlichen Spezies gelebt hatten – schließlich die gesamte Welt kolonisierten. Aber ich werde das in einem einzigen Kapitel abhandeln und den Menschen nicht mehr Aufmerksamkeit schenken als den Pferden, Walen oder Elefanten. Denn letztendlich sind wir nur eine unter vielen Glanzleistungen in der Evolutionsgeschichte der Säugetiere.
Und doch muss unsere Geschichte erzählt werden, weil wir, obwohl wir als einzelne Art nur einen Bruchteil der Evolutionsgeschichte ausmachen, diesen Planeten verändert haben wie kein anderes Säugetier vor uns. Unsere phänomenalen Erfolge beim Errichten von Städten, beim Anbau von Nahrung und beim Ausbau von globalen Straßennetzen und Flugrouten haben für unsere nächsten Verwandten verheerende Folgen. Seit Homo sapiens die Wälder verlassen und sich über die gesamte Erde ausgebreitet hat, sind mehr als 350 Säugetierarten ausgestorben und viele andere Arten bedroht (denken Sie nur an Tiger, Pandas, schwarze Nashörner oder Blauwale). Entwickeln sich die Dinge im aktuellen Tempo weiter, wird die Hälfte der Säugetierarten bald dasselbe Schicksal ereilen wie die Wollhaarmammuts und Säbelzahntiger. Sie werden aussterben, und von ihrer majestätischen Erscheinung wird nichts bleiben als geisterhafte steinerne Schatten.
Die Säugetiere stehen an einem Scheideweg. Sie – oder wiederum besser wir – befinden uns am prekärsten Punkt unserer Geschichte, seit wir dem Asteroiden, die Dinosaurier die Existenz kostete, die Stirn geboten haben. Und was für einer Geschichte! Während unseres evolutionären Langstreckenlaufs gab es Zeiten, in denen die Säugetiere den anderen Tieren nahezu unbemerkt hinterherschlichen, und Zeiten, in denen sie das Feld anführten. Streckenabschnitte, in denen es ganz großartig lief, und andere, in denen sie zurückfielen oder durch Massenaussterben um ein Haar ganz aus dem Rennen geworfen wurden. Zeiten, in denen die Dinosaurier sie in Schach hielten, und Zeiten, in denen sie die Oberhand hatten. Zeiten, in denen keines von ihnen größer war als eine Maus, und Zeiten, in denen sie die größten Lebewesen der Erde waren. Es gab Phasen, in denen sie extremer Hitze ausgesetzt waren, und Phasen, in denen sie es mit Gletschern und kilometerdicken Eisschichten zu tun hatten. Zeiten, in denen sie in der Nahrungskette die untersten Ränge belegten, und Zeiten, in denen ein paar von ihnen – wir – ein Bewusstsein entwickelten und die Welt nach ihren Vorstellungen gestalteten, im Guten wie im Schlechten.
Die Gesamtheit dieser Geschichte bildet die Grundlage für unsere moderne Welt, für uns und unsere Zukunft.
Steve Brusatte
Edinburgh, Januar 2022
1
Vorfahren der Säugetiere
Dimetrodon
Vor ungefähr 325 Millionen Jahren – auf ein paar Millionen Jahre mehr oder weniger kommt es hier nicht an – klammerte sich eine Gruppe schuppiger Gesellen an ein Floß, das aus einem wilden Gewirr aus Farnen und abgebrochenen Baumstämmen bestand. Normalerweise waren sie als Einzelgänger unterwegs und hockten getarnt im dichten Grün des Urwalds, aus dem sie nur gelegentlich auftauchten, um sich ein Insekt zu schnappen und dann wieder in die Anonymität abzutauchen. Aber die Zeiten waren schlecht, und das hatte sie zusammengeführt. Ihre Welt veränderte sich rasant, und das Meer war im Begriff, sich ihr sumpfiges Paradies zwischen Wasser und Land zurückzuholen.
Die kleinen Abenteurer, die größten von ihnen waren gerade mal 30 Zentimeter lang, sahen sich nervös um. Mit ihren seitlich abstehenden Beinen und dem langen Schwanz, den sie hinter sich herzogen, erinnerten sie an Geckos oder Leguane. Die Jüngeren unter ihnen kraxelten mit ihren langen, dünnen Zehen noch auf dem verrottenden Grünzeug hin und her, aber die älteren Tiere schaukelten bereits reglos in den Wellen und starrten züngelnd hinaus auf die unendliche Weite des Meeres, während das Wasser gegen ihre Körper schlug.
Vor ein paar Wochen schien noch alles normal zu sein. Aus ihren gut versteckten Höhlen spähten sie in den vor Feuchtigkeit triefenden Urwald, umgeben von Pflanzen in allen Grüntönen, die man sich nur vorstellen kann. Der Waldboden war überzogen von Farnen, deren Sporen nach jeder willkommenen Windbö durch die stickige Luft tanzten. Die mittlere Schicht des Waldes bildeten samentragende Stauden, einige von ihnen entfernte Verwandte heutiger Nadelbäume, die, wann immer es regnete – was es fast immer tat –, murmelgroße Samen abwarfen und den Boden in ein Kugellager verwandelten, auf dem das Gehen äußerst tückisch war.
Die Wipfel der Bäume, die scheinbar unendlich hoch in den Himmel aufragten, konnten die schuppigen Gesellen mit ihren winzigen Augen nicht sehen. Das dichte Blätterdach des Urwalds bildeten zwei bis zu 30 Meter hohe Baumarten: Kalamiten, die mit ihren geraden, bambusähnlichen Stämmen, die in unregelmäßigen Abständen Äste mit Quirlen aus nadelförmigen Blättern austrieben, aussahen wie dürre Weihnachtsbäume, und Lepidodendron, deren Stamm bis zu zwei Meter dick wurde und bis auf ein Dickicht aus Ästen und Blättern an der obersten Spitze nackt war – ein gigantischer Blättermopp an einem langen Stiel. Diese Bäume wuchsen bemerkenswert schnell. Von der Spore über den Schössling bis zur vollen Höhe dauerte es nur 10 bis 15 Jahre. Dann starb der Baum, verrottete zu Kohle und wurde von der nächsten Generation ersetzt.
Die schuppigen Gesellen waren eine von mehreren Hundert Arten, die, zumindest bis zu jenem Tag, in den Sumpfwäldern zu Hause waren. Ihre Vielfalt reichte von gewöhnlich bis äußerst ungewöhnlich. Es gab unzählige Insekten, die eine perfekte Nahrungsquelle abgaben. Spinnen und Skorpione krabbelten durch Laubhaufen und die Baumstämme hoch, und an den vor Fischen strotzenden Bächen versammelten sich primitive Amphibien. Auch Eurypteriden patrouillierten an den Ufern, gepanzerte Wesen – manche so groß wie ein Mensch –, die an riesige Skorpione erinnerten und sich mit Nussknackerzangen ihre Beute schnappten. In jenen noch beschaulichen Zeiten plätscherten die Bäche in einen Fluss, der sich zu einem Delta verzweigte, das wiederum in die ruhige Gezeitenströmung einer Brackwasserbucht überging.
Gelegentlich durchbrach ein unheimliches Schlurfen die Stille, ein Arthropleura, ein monströser, über zwei Meter langer Tausendfüßler, der nach Sporen und Samen suchte. Oder es wehte ein noch Furcht einflößenderes Geräusch über den Sumpf: das Flattern einer Meganeura, einer taubengroßen Libelle mit vier riesigen transparenten Flügeln. Normalerweise war sie auf der Jagd nach Käfern, aber wenn sie hungrig genug war, griff sie auch die schuppigen Gesellen an – noch ein Grund, weshalb diese lieber im Verborgenen blieben.
Als sie auf ihr improvisiertes Floß kletterten, war die Angst vor einer Meganeura-Attacke jedoch nebensächlich, denn die Gefahr, die ihnen aktuell drohte, war sehr viel größer. Sie waren umgeben von Wasser, und die Strömungen wurden immer stärker. Weit im Süden schmolz eine gewaltige Eiskappe, die Wasser ins Meer leitete und den Meeresspiegel ansteigen ließ. Auf der ganzen Welt wurden die Küstengebiete überschwemmt, und die Mangrovenwälder aus Kalamiten und Lepidodendron gingen samt ihren tierischen Bewohnern in den Fluten unter. Doch davon wussten die schuppigen Gesellen nichts. Alles, was sie wussten, als sie auf ihrem Floß durch schäumende Strudel aus toten Krabben und Quallen schaukelten, war, dass es ihren Wald nicht mehr gab.
Ein Blitz zuckte über den Himmel, gefolgt von einem mächtigen Donnerschlag. Der Sturm peitschte das Floß gegen eine gewaltige Wasserwand, sodass es kippte und in zwei Hälften brach. Ein paar der Schuppentiere wurden von Bord gespült, und ihre schlaffen Körper gesellten sich zu den toten Quallen und Krabben, aber die meisten konnten sich auf eine der beiden Floßhälften retten. Während der Regen auf die Bucht niederprasselte und der Sturm weitertobte, teilte sich mit einem Mal die Strömung, und die beiden Floßhälften trieben samt ihrer schuppigen Fracht in unterschiedliche Richtungen davon: die eine Hälfte nach Osten, die andere nach Westen.
Ein paar Tage später ließ der Sturm nach, und die Floßhälften wurden an unterschiedliche Ufer gespült. Als die beiden Abenteurergruppen sich aufmachten, ihre neue Heimat zu erkunden, sahen sie sich entsprechend mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert – mit unterschiedlichen Lebensräumen, Klimata und Raubtieren. Beide Gruppen passten sich ihrer neuen Umgebung über viele Generationen immer weiter an, bis es schließlich zwei Spezies waren, die ihrerseits neue Arten hervorbrachten, und so entstanden zwei Hauptlinien. Die eine entwickelte zwei fensterähnliche Öffnungen hinter der Augenhöhle, um Raum für größere und kräftigere Kiefermuskeln zu schaffen, die andere eine einzelne, breite Öffnung.
Die erste Gruppe mit den zwei Schädelöffnungen waren die Diapsiden, die sich zu Eidechsen, Schlangen, Krokodilen, Dinosauriern, Vögeln und Schildkröten (bei denen sich die Schädelfenster allerdings wieder schlossen) weiterentwickelten. Die zweite Gruppe mit der einzelnen Schädelöffnung waren die Synapsiden. Auch sie sollten eine unglaubliche Artenvielfalt entwickeln, zu der – mehr als 100 Millionen Jahre später – auch die Säugetiere zählten.
Das alles ist nur eine Geschichte, und die Ereignisse haben in exakt dieser Abfolge vielleicht nie stattgefunden. Fakt ist jedoch, dass vor ungefähr 325 Millionen Jahren – in einer Phase der Erdgeschichte, die sich Pennsylvanium (oder auch Spätkarbon) nennt – eine bescheidene Anzahl kleiner, mit Schuppen überzogener Kreaturen in üppigen Sumpfwäldern lebte, die regelmäßig von den ansteigenden Meeren überflutet wurden. Ebenso wahr ist, dass ihre Entwicklungslinie sich trennte und ein Zweig des Stammbaums zu den Reptilien führte und der andere zu den Säugetieren.
Woher wir das wissen? Paläontologen – also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wie ich frühe Lebensformen erforschen – haben dafür zwei grundsätzliche Methoden der Beweisführung, derer auch ich mich hier bediene.
Zum einen sind da die Fossilien und das Gestein, in das diese eingebettet sind. Fossilien sind ein direkter Nachweis früher Lebensformen, entscheidendes Beweismaterial, für das Paläontologen um die ganze Welt reisen und jedem Ungemach – Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Regen, Geldmangel, Moskitos und sogar Kriegen – trotzen. Viele von uns verstehen sich als Detektive, die in den Tiefen der Zeit ermitteln. Entsprechend sind Fossilien für uns Indizien, vergleichbar mit am Tatort zurückgelassenen Haaren oder Fingerabdrücken. Sie offenbaren uns, was wo wann lebte. Manche Fossilien zeugen von prähistorischen Dramen. Wir finden von Räubern zerfleischte Beutetiere, die Opfer von Flutkatastrophen oder die Überlebenden eines Massensterbens. Weithin bekannt sind die sogenannten Körperfossilien: von einst lebenden Organismen erhaltene Teile, wie Knochen, Zähne, Panzer oder Blätter. Weniger bekannt sind die Spurenfossilien. Sie dokumentieren das Verhalten eines Organismus oder sind etwas, das er zurückgelassen hat, wie Fußspuren, eine Erdhöhle, Eier, Bissspuren, oder Koprolithe, fossiler Kot.
Fossilien findet man nicht einfach auf der Straße oder beim Umgraben des Gartens, eher in Sand- oder Schlammstein. In unterschiedlichen Milieus haben sich unterschiedliche Gesteinsschichten gebildet, von denen manche mit einer chemischen Methode datiert werden können. Dabei wird das Alter des Gesteins anhand der Anzahl seiner radioaktiven Mutter- und Tochterisotope bestimmt, basierend auf Werten ihres radioaktiven Zerfalls, die man wiederum aus Laborexperimenten kennt. Das alles liefert den entscheidenden Kontext, um verstehen zu können, wann und in welcher Art von Lebensraum die versteinerte Kreatur gelebt hat.
Ein zweites Beweismittel für die Existenz früherer Lebensformen findet man tatsächlich überall. Man braucht dazu weder besondere Fähigkeiten noch Glück. Ich spreche von der DNA, die wir und alle anderen Organismen in unseren Zellen mit uns herumtragen. Die DNA enthält den Bauplan, der uns zu dem macht, was wir sind. Sie ist der genetische Code, der festlegt, wie wir aussehen, unseren Körperbau bestimmt, unser Wachstum und wie wir zukünftige Generationen zeugen. Die DNA ist aber auch eine Art Archiv, denn in die Milliarden von Basenpaaren, die unser Erbgut ausmachen, ist unsere Evolutionsgeschichte eingeschrieben. So wie sich die Arten im Laufe der Zeit verändern, verändert sich auch ihre DNA. Gene mutieren, bewegen sich und werden aus- oder eingeschaltet. DNA-Stränge werden vervielfältigt oder ausgelöscht, neue DNA-Teile eingebaut. Die DNA zweier Spezies mit denselben Vorfahren unterscheidet sich im Laufe der Zeit folglich immer mehr, da jede Art ihren eigenen Weg geht und sich an spezielle Gegebenheiten anpasst. Nimmt man also die DNA-Sequenzen heutiger Spezies und vergleicht diese, lässt sich, indem man Arten mit einer ähnlichen DNA zusammengruppiert, ein Stammbaum erstellen. Aber es gibt auch noch einen anderen, raffinierteren Trick. Dazu nimmt man die DNA zweier beliebiger Spezies und zählt die Unterschiede. Anhand der aus Laborexperimenten bekannten Geschwindigkeit, mit der sich die DNA verändert, lässt sich zurückrechnen, wann sich die Evolutionslinien dieser Arten getrennt haben.
Meiner Geschichte über den von der Flut zerstörten Sumpf liegen beide Arten von Beweismitteln zugrunde. DNA-Studien legen nahe, dass sich die Linien von Reptilien und Säugetieren vor ungefähr 325 Millionen Jahren getrennt haben, während Fossilien und Gestein uns verraten, wie die verlorene Welt, in der dies geschah – eine Landschaft, die sich von der heutigen stark unterschied –, ausgesehen hat.
Auf einer Weltkarte des Pennsylvaniums würden wir die Erde kaum wiedererkennen. Es gab nur zwei große Landmassen: Gondwana, in dessen Mitte sich der Südpol befand, und Laurasia mit seinen im Osten von Inseln ausgefransten Rändern, das sich um den Äquator legte. Über mehrere Millionen Jahre driftete Gondwana mit ungefähr derselben Geschwindigkeit, in der unsere Fingernägel wachsen, nach Norden, bis es schließlich auf Laurasia prallte. Das war die Geburtsstunde der Pangäa, eines Superkontinents, der später die frühen Stadien der Evolution der Säugetiere und Dinosaurier erleben sollte. Als die beiden Erdkrusten gegeneinanderkrachten, entstand parallel zum Äquator eine lange Gebirgskette mit den Ausmaßen des heutigen Himalajas. Die im Vergleich dazu eher bescheidenen Appalachen im Osten der USA sind ein Überbleibsel dieses einst alles überragenden Gebirges.
Die tropischen und subtropischen Gebiete zu beiden Seiten des Äquatorgebirges boten himmlische Lebensbedingungen. Heute spricht man von Kohlesümpfen, da der Großteil der Kohle, mit der im 19. Jahrhundert die industrielle Revolution befeuert wurde, in eben diesen Sümpfen aus den abgestorbenen und komprimierten Überresten der riesigen, schnell wachsenden Lepidodendron und Kalamiten entstand. Mit den Palmen, Magnolien und Eichen, die wir heute in ähnlich grünen Regionen finden, hatten diese Bäume wenig gemeinsam. Als nahe Verwandte der Bärlapppflanzen und Schachtelhalmgewächse trieben sie weder Blüten, noch brachten sie Früchte oder Nüsse hervor – primitive Pflanzen, die heute als traurige Überreste ihrer einstigen Größe nur noch im Unterholz zu finden sind. Die Baumriesen des Pennsylvaniums – und auch die gigantischen Libellen, die in ihren Ästen brummten, oder die Monstertausendfüßler, die über ihre Wurzeln krabbelten – hatten ihre Größe dem damaligen Sauerstoffgehalt der Luft zu verdanken, der ungefähr 70 Prozent über dem heutigen lag.
Die Bäume bildeten riesige Regenwälder, die die Ufer der flachen, weit in den wachsenden Superkontinent hineinschwappenden Meere und die vielen Bäche, Ströme, Deltas und Flussmündungen säumten. Auf Luftbildern hätten diese Sümpfe wahrscheinlich große Ähnlichkeit mit den Bayous des Mississippi-Deltas im modernen Louisiana: eine dichte Decke eng verflochtener Bäume und Pflanzen in einem Gewirr aus langsam fließenden Gewässern, teils zusammengedrängt auf schlammigen Inseln, teils mit Wurzeln, die wie Spinnenbeine ins Wasser ragten, und dazwischen kletterten, krochen, hüpften und flogen die verschiedenartigsten Kreaturen. Aber es waren keine Vögel, Moskitos, Biber, Otter oder sonstige mit Fell bedeckten Säuger. Diese werden, auch wenn ihre Vorfahren alle Kohlesumpfbewohner waren, erst sehr viel später auftauchen, in einer völlig anderen Welt.
Wie kam es, dass so viele Bäume unter Sedimenten begraben und zu Kohle wurden? Das lag daran, dass sich der Meeresspiegel in einem pulsierenden Rhythmus hob und senkte und das Meer die Sümpfe regelmäßig überflutete. Das Pennsylvanium war ein Gletscherzeitalter – die letzte große Eiszeit vor der jüngsten, in der Mammuts und Säbelzahntiger die Welt beherrschten (aber dazu später mehr). Nicht die ganze Welt war gefroren, die Kohlesümpfe waren es nicht, aber den Südpol von Gondwana, später Pangäa, bedeckte eine enorme Eiskappe, die ihre Existenz diesen Kohlesümpfen verdankte. Die Baumriesen zogen beim Wachsen Kohlendioxid aus der Atmosphäre, und je weniger von diesem Treibhausgas den Planeten isolierte, umso weiter fielen die Temperaturen. Über mehrere zehn Millionen Jahre nahm die Eiskappe dadurch regelmäßig zu und wieder ab und regulierte so die Höhe des globalen Meeresspiegels. Das Eis schmolz, der Meeresspiegel stieg, die Sümpfe wurden überflutet, die Bäume starben und wurden unter Sedimenten begraben. Die Eisdecke wurde wieder größer, sog das Wasser aus den Meeren, der Meeresspiegel sank und machte Platz für Sumpfgebiete, in denen Baumriesen wuchern konnten – ein ständiges Hin und Her, von dem wir wissen, weil Gestein aus dem Pennsylvanium häufig Barcodesequenzen, sogenannte Zyklotheme, aufweist. Es handelt sich dabei um wiederkehrende Abfolgen dünner, an Land oder im Wasser entstandener Schichten, die mit Kohleflözen durchsetzt sind.
Aus jener Zeit gibt es zahlreiche Fossilien, insbesondere im Norden von Illinois, wo ich aufgewachsen bin. Man findet sie, eingebettet zwischen zwei Kohleschichten, überall in den Zyklothemen. Aber die besten verbergen sich an den Ufern des Mazon Creek, eines ruhigen Nebenflusses des Illinois River, oder in den Tagebauminen im Osten, wo im Pennsylvanium Meer und Sumpf aufeinandertrafen. Dort spülte es die Bewohner des Regenwalds ins Meer, wo sie auf den Grund sanken und in ihren Gräbern aus Eisenstein eingeschlossen wurden – flachen, ovalen Klumpen aus rostfarbenem Stein, die man heute im Flussbett oder im Abraum der Minen findet. Als Teenager suchte ich nach genau diesen Klumpen und grub mich durch die Abraumhalden der längst geschlossenen Minen. Wenn ich Glück hatte, ließ sich der Klumpen teilen und enthüllte einen Schatz: ein Fossil auf der einen Seite, den Abdruck davon auf der anderen. Das Gefühl, der erste Mensch zu sein, der dieses Ding zu Gesicht bekam – das vor 300 Millionen Jahren gelebt hatte! –, war unbeschreiblich. Viele der Klumpen enthielten Pflanzen: Blätter von Farnen, ein Stück Rinde von einem Kalamiten, Wurzelteile eines Lepidodendron. Besonders gern mochte ich Quallen, ich erfreute mich aber auch an einer Krabbe oder einem Wurm.
Was ich jedoch wirklich suchte – und nie das Glück hatte zu finden –, war ein Tetrapode, ein an Land lebendes Tier mit Knochen. Aus den Lehrbüchern, die ich verschlang, wusste ich, dass Tetrapoden von Fischen abstammten und vor ungefähr 390 Millionen Jahren, also noch vor dem Pennsylvanium, an Land gekrochen waren. Die ersten Tetrapoden waren Amphibien, die, um ihre Eier abzulegen, noch ins Wasser zurückmussten. Ein paar Skelette von primitiven Amphibien – entfernten Verwandten von Fröschen und Salamandern – hatte man auch am Mazon Creek gefunden.
Irgendwann im Laufe des Pennsylvaniums spaltete sich von diesen Amphibien eine neue Gruppe ab – die Amnioten. Sie waren spezialisierte Tetrapoden, die ihren Namen ihren amniotischen Eiern verdanken, deren Innenmembran den Embryo schützte und vor dem Austrocknen bewahrte. Diese neue Art von Eiern eröffnete viele neue Möglichkeiten. Die Amnioten waren nicht länger auf Gewässer angewiesen, sondern konnten ihre Eier auch an Land ablegen, was ihnen neue Lebensräume erschloss. Baumkronen, Höhlen, Ebenen, Berge, Wüsten. Erst mit dem Aufkommen des amniotischen Eis konnten die Tetrapoden die Meere hinter sich lassen und das Landesinnere erobern.
Von den Amnioten zweigen die Linien der Reptilien und Säugetiere ab – der Diapsiden und Synapsiden –, die fortan getrennte Wege gehen, wie zwei Geschwister, die ihr Elternhaus verlassen. Das ist nicht nur ein simpler Vergleich, genau so bringt die Evolution neue Arten, Familien und Dynastien hervor. Die Arten verändern sich mit ihrer Umgebung: Darwins Evolution durch natürliche Auslese. Manchmal werden Populationen einer Spezies getrennt – durch eine Überschwemmung, ein Feuer oder ein Gebirge –, und die Gruppen entwickeln sich durch natürliche Selektion unabhängig voneinander weiter. Bleiben sie getrennt, wird sich jede Gruppe auf ihre Art immer weiter verändern und ihrer ganz spezifischen Situation anpassen, bis die Populationen nicht mehr gleich aussehen, sich nicht mehr gleich verhalten und sich auch nicht mehr paaren können: Aus einer Spezies sind zwei geworden. Werden die neuen Spezies wieder getrennt, werden aus zwei vier, aus vier acht und so weiter. Auf diese Weise diversifiziert sich das Leben immer weiter, verzweigt sich wie ein über vier Milliarden Jahre gewachsener Baum. Aus diesem Grund bilden wir Abstammungslinien nicht als Netze, Straßenkarten, Pyramiden oder sonstige Grafiken ab, sondern als Stammbäume – nicht nur die ausgestorbener Tierarten, sondern auch unsere eigenen.
Die Trennung in Diapsiden und Synapsiden – die sich tatsächlich ganz unspektakulär mit der Trennung einer kleinen, geschuppten Spezies vollzog – war ein Meilenstein in der Entwicklung der Wirbeltiere. Dass Diapsiden und Synapsiden – die sich durch ihre charakteristischen Schädelfenster und ihre Kiefermuskulatur unterschieden – genau in jener Zeit getrennte Wege einschlugen, als auch die Mazon-Creek-Klumpen entstanden, wusste ich, und so hoffte ich mit jedem Hammerschlag, auf den fossilen Heiligen Gral zu stoßen, der einen entscheidenden Beitrag zu dieser Geschichte leisten würde. Leider habe ich ihn nie gefunden.
Fossilienjäger in anderen Teilen Nordamerikas hatten mehr Glück. Im Jahr 1956 machte ein Forscherteam der Harvard-Universität unter der Leitung des legendären Paläontologen Alfred Romer in einer verlassenen Kohlemine bei Florence in der kanadischen Provinz Nova Scotia nahe der Atlantikküste eine wichtige Entdeckung. Einem der Techniker, Arnie Lewis, fielen mehrere versteinerte Stümpfe einer Baumart namens Sigillaria auf, nahe Verwandte des Lepidodendron, deren Kronen sich sehr weit oben verzweigten und den Bäumen das Aussehen riesiger Bürsten verlieh. Die Stümpfe standen da, als hätte der ansteigende Meeresspiegel sie erst gestern überflutet – und nicht vor 310 Millionen Jahren, was ihrem tatsächlichen Alter entsprach. Das Team watete durch die engen Gänge der unter Wasser stehenden Mine und fand insgesamt fünf Stümpfe, in deren Innerem eine weitere Überraschung auf sie wartete: Dutzende fossile Skelette! Wahrscheinlich hatten die armen Geschöpfe in den hohlen Bäumen Schutz vor dem näher rückenden Meer gesucht, ohne zu ahnen, dass ihr Schicksal damit besiegelt war. In einem der Baumstümpfe fand man mehr als zwanzig Tiere, darunter Amphibien, Diapsiden und Synapsiden: das Dreigestirn der frühen, an Land lebenden Tetrapoden.
Archaeothyris (Illustration: Todd Marshall)
Etwas später wurden die Synapsiden dann von Robert Reisz, einem Masterstudenten, als zwei getrennte Gattungen beschrieben, Archaeothyris und Echinerpeton. Heute einer der weltweit anerkanntesten Paläontologen, sammelte Reisz mit diesen frühen Synapsiden seine ersten Erfahrungen. Mit dem Namen Archaeothyris – »altes Fenster« – hob er das wichtigste Merkmal dieser Gattung hervor: die große, bullaugenförmige Öffnung hinter der Augenhöhle, in der sie einen deutlich kräftigeren Kiefermuskel unterbrachte als ihre Vorfahren. Diese einzelne Öffnung, die im Fachjargon als laterales Schädelfenster bezeichnet wird, definiert die Synapsiden, die – angefangen bei den Kohlesumpfpionieren bis zu den heutigen Fledermäusen, Spitzmäusen und Elefanten – alle dieses besondere Schädelfenster oder eine veränderte Form davon aufweisen. Auch wir haben dieses Fenster und spüren es jedes Mal, wenn wir den Kiefer schließen. Legen Sie die Hand auf Ihren Wangenknochen, und beißen Sie die Zähne aufeinander. Spüren Sie die Kontraktion Ihrer Wangenmuskulatur? Die Muskeln drücken durch die Überreste des Schädelfensters, das bei modernen Säugetieren mehr oder weniger in die Augenhöhle übergeht, aber noch immer den Musculus temporalis verankert, der sich über die Seite unseres Kopfes bis zum Unterkiefer zieht und dafür sorgt, dass wir ordentlich zubeißen können. Die einzelne Öffnung hat sich bei den Synapsiden schon sehr früh herausgebildet, direkt nach der Trennung von den Diapsiden, die zwei dieser Öffnungen hinter der Augenhöhle entwickelten.
Hätten wir ein Archaeothyris durch den Kohlesumpf huschen sehen, wäre es uns wahrscheinlich nicht weiter aufgefallen. Von der Schnauze bis zur Schwanzspitze war es ungefähr 50 Zentimeter lang, mit einem kleinen Kopf auf einem langen, schlanken Körper. Über seine Gliedmaßen weiß man nicht sehr viel, aber die erhaltenen Vorder- und Hinterbeine lassen keinen Zweifel daran, dass diese wie bei einer Eidechse oder einem Krokodil seitlich vom Körper abstanden. Schnelligkeit war eindeutig keiner seiner besonderen Vorzüge, bei genauerem Hinsehen gibt es jedoch andere Auffälligkeiten. So hatte es neben der kräftigeren Kiefermuskulatur, die sich in seinem Schädel verbarg, eine Reihe gebogener spitzer Zähne im Maul. Einer der vorderen Zähne war auffällig länger als die anderen und sah aus wie ein kleiner Eckzahn. Amphibien, Eidechsen und Krokodile haben keine Eckzähne. Sie haben ein einheitliches Gebiss mit Zähnen, die im gesamten Kiefer gleich aussehen. Säugetiere haben im Vergleich dazu sehr viel abwechslungsreichere Zahnreihen, mit Schneidezähnen und Eckzähnen sowie vorderen und hinteren Backenzähnen, die sich die Arbeit teilen – weshalb wir gleichzeitig zubeißen, kauen und mahlen können. Das komplette Säugetiergebiss, wie wir es kennen, formierte sich erst später in unzähligen evolutionären Schritten, aber die winzigen Eckzähne von Archaeothyris waren bereits die ersten Anzeichen einer dentalen Revolution.
Zusammen waren die großen Kiefermuskeln sowie scharfen Zähne und Eckzähne ein Waffenarsenal, das es Archaeothyris ermöglichte, sich von großen Insekten und vielleicht sogar anderen Tetrapoden wie Echinerpeton zu ernähren. Dieser zweite Nova-Scotia-Synapside hätte zusammengerollt locker zwischen die Seiten dieses Buches gepasst. Die dürftigen Fossilien, die wir von ihm haben, weisen jedoch ein besonderes Merkmal auf, dem Echinerpeton auch seinen Namen verdankt: »stacheliges Reptil«. Hals- und Rückenwirbel – die Knochen, aus denen sich die Wirbelsäule zusammensetzt – weisen senkrecht nach oben stehende Dornfortsätze auf, die als Reihe gesehen ein kleines Segel entlang des Rückens bildeten. Dieses Segel könnte dazu gedient haben, Partner anzulocken, oder als Sonnenkollektor, mit dem das Tier an kühlen Tagen seinen Körper wärmte, oder als Fächer an heißen Tagen oder auch als etwas völlig anderes.
Es gibt noch ein ausgestorbenes, sehr viel bekannteres und größeres Tier mit Rückensegel: Dimetrodon. Es lebte im Perm, dem Zeitalter nach dem Pennsylvanium. Dimetrodon posiert auf Dinopostern oft neben T. rex oder steckt mit Brontosaurus und Stegosaurus in einer Spielzeugschachtel, weshalb es häufig für einen Dinosaurier gehalten wird. Aber das war es nicht, sondern eine primitive Gattung der Synapsiden, um genau zu sein, ein sogenannter Pelycosaurier.
Pelycosaurier waren die erste große evolutionäre Welle der Synapsiden-Linie, die Ersten, die sich diversifizierten und auf dem wachsenden Superkontinent Pangäa ausbreiteten. Und sie waren auch die Ersten, die ein paar der Charakteristika entwickelten, die etwas über 300 Millionen Jahre später noch immer zu den Merkmalen zählen, durch die sich Säugetiere von Amphibien, Reptilien und Vögeln unterscheiden – wie das Fenster für den Musculus temporalis oder Eckzähne. Wir finden diese Merkmale auch schon bei Archaeothyris und Echinerpeton, was schlicht daran liegt, dass diese beiden Nova-Scotia-Gattungen die allerältesten Pelycosaurier überhaupt sind, die Gründer der ersten großen Dynastie auf dem Weg zu Dimetrodon und schlussendlich den Säugetieren.
Als das Pennsylvanium sich dem Ende zuneigte, lebten in den Äquatorgebieten der Pangäa zu beiden Seiten des immer noch wachsenden Gebirgszugs synapside Pelycosaurier. Manche ernährten sich von Insekten, andere jagten kleine Tetrapoden oder Fische, und ein paar begannen, mit einer Art von Nahrung zu experimentieren, die sie bis dahin ignoriert hatten: Blättern und Zweigen. Sie diversifizierten sich, machten aber dennoch nur einen geringen Anteil ihrer Ökosysteme aus, die von Amphibien überschwemmt wurden, weil diese sich in den feuchten Wäldern der Kohlesümpfe hervorragend vermehren und ausbreiten konnten.
Dann, vor 303 bis 307 Millionen Jahren, erfuhr die Welt durch den Kollaps des Karbonregenwalds eine dramatische Veränderung. Das Klima wurde trockener, die Temperaturen schwankten zwischen kalt und heiß, die Eiskappen tauten und verschwanden im darauffolgenden Perm vollständig. Da die hoch aufragenden Kalamiten, Lepidodendron und Sigillaria in dem trockeneren Klima nicht mehr gediehen, gingen die Karbonwälder ein und wurden durch trockenresistentere Nadelbäume, Palmfarne und andere samentragende Pflanzen ersetzt. Immerfeuchte Tropenlandschaften wichen semiariden Trockengebieten, deren Klima von Jahreszeiten beherrscht wurde, während andere Teile der Pangäa sich in ausgedörrte Wüsten verwandelten. In den Gesteinsschichten lässt sich diese Entwicklung am plötzlichen Wechsel von Kohlen und Zyklothemen zu »roten Schichten« ablesen, die mit im trockenen Klima entstandenem rostigem Eisen angereichert sind.
Diese Veränderungen hatten verheerende Auswirkungen auf die Biodiversität. Besonders hart traf es die Pflanzenwelt. Nicht nur, dass die Karbonwälder des Pennsylvaniums von besser an das trockene Klima angepassten Samenpflanzen verdrängt wurden, es kam auch zu einem Massenaussterben, bei dem viele Pflanzenarten des Pennsylvaniums für immer verschwanden. Manche hinterließen gar keine Nachkommen oder Verwandten, andere nur ihre kleinwüchsigen, nicht annähernd so beeindruckenden Cousins. Alles in allem starb etwa die Hälfte der Pflanzenfamilien des Pennsylvaniums aus. Es war eines von nur zwei Massenaussterben, die uns aus der fossilen Überlieferung der Pflanzen bekannt sind. Das zweite, auf das wir auch noch zu sprechen kommen, ereignete sich Ende des Perms. Aus botanischer Sicht war der Kollaps des Karbonregenwalds also eine größere Katastrophe als der endkreidezeitliche Asteroideneinschlag, der die Dinosaurier ausrottete.
Und was geschah mit den Tieren, die in den Karbonwäldern lebten? Über ihr Schicksal klärt eine Studie der jungen Forscherin Emma Dunne auf. Sie ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten einer neuen Generation von Paläontologen. Auch sie sammelt Fossilien, hat sich zusätzlich aber auf Big Data und fortschrittliche Methoden der Statistik spezialisiert. Um die Muster und Prozesse der Evolution wirklich zu verstehen, denkt Emmas Generation wie Börsenanalytiker. Sie sammeln Unmengen von Daten, benutzen Statistikmodelle, um Unsicherheiten auszuloten, und stützen sich beim Abwägen von zwei Hypothesen nicht auf ihre Intuition, sondern auf Zahlen.
Mit diesem Ansatz legte Emma eine Datenbank mit über 1000 Fossilien von Tetrapoden aus dem Karbon und Perm an und verzeichnete darin deren Gruppenzugehörigkeit und Fundorte. Um Stichprobenverzerrungen auszugleichen, die in der Paläontologie, die zu großen Teilen von zufälligen Fossilienfunden an den wenigen Orten abhängt, an denen sich Knochen und Zähne Millionen von Jahre erhalten, natürlich nicht auszuschließen sind, bediente sie sich statistischer Tools und erstellte Modelle, anhand derer sie feststellen konnte, wie sich die Artenvielfalt und die Verbreitung der Spezies – darunter auch Amphibien, Diapsiden und Synapsiden – durch den Kollaps des Regenwalds verändert haben.
Die Ergebnisse waren beunruhigend. Der Wechsel vom Karbon zum Perm ging mit einem massiven Rückgang der Artenvielfalt einher, bei dem zahlreiche Karbonwaldtetrapoden ausstarben. Das geschah sicher nicht von heute auf morgen, sondern innerhalb mehrerer Millionen Jahre, in denen die Trockengebiete auf ihrem Vormarsch von Osten nach Westen den tropischen Karbonwald nach und nach verdrängten. Die Veränderung der Lebensräume – eher ein Übergang als ein Kollaps – führte zu mehr offenen Landschaften, die wiederum die Migration förderten. Tetrapoden, die dem trockeneren Klima standhielten, hatten mehr Bewegungsfreiheit. Amphibien, die die Feuchtgebiete des Pennsylvaniums lange dominierten, konnten diese aufgrund ihrer Fortpflanzungsstrategien, die sie ans Wasser banden, nicht nutzen, während Diapsiden und Synapsiden für die neuen Gegebenheiten perfekt gerüstet waren. Plötzlich verliehen ihnen ihre amniotischen Eier mit Membranen, die die Embryonen ernährten, schützten und feucht hielten, Superkräfte. Sie waren frei, umherzuziehen und Verbindungen in Regionen herzustellen, die zuvor isoliert gewesen waren, wodurch neue Spezies entstanden, mit neuen Körperformen, neuen Ernährungsweisen und neuen Verhaltensmustern.
Mit der Verwandlung der Kohlesümpfe in offene Trockengebiete im voranschreitenden Perm wurde die Erde zum Planeten der Pelycosaurier. Keine Gattung versinnbildlicht dieses neue Zeitalter besser als Dimetrodon. Eine Ikone mit Rückensegel, die uns insbesondere von Dutzenden Fossilienfunden in Texas bekannt ist. Dass Dimetrodon oft mit einem Dinosaurier verwechselt wird, hat seine Gründe. Groß, kräftig, mit einem langen Schwanz, scharfen Zähnen und auf seinen kurzen, nach außen abstehenden Beinen eher langsam unterwegs, lässt es sich mangels eines passenderen Begriffs am besten mit »reptilienartig« beschreiben. Auch sein kleines, röhrenförmiges Gehirn ähnelte mehr dem eines Dinosauriers als einem Säugerhirn, dessen großflächigem, an Spaghetti erinnerndem Zerebrum die Säugetiere ihre Intelligenz und scharfen Sinneswahrnehmungen verdanken. Was das anging, hatte Dimetrodon sich gemessen an seinen kleinen, schuppigen Vorfahren, die sich im Pennsylvanium einst in Diapsiden und Synapsiden trennten, kaum verändert.
Es hatte jedoch andere Merkmale, durch die es sich von seinen Vorgängern deutlich unterschied. Am besten ist dieser Unterschied am Gebiss zu erkennen, das mit den uniformen Zahnreihen aus Schneide- oder Kegelzähnen, die man von Amphibien und Diapsiden kennt, nichts mehr gemein hat. Vorne im Maul wuchsen ihm große, abgerundete Schneidezähne, dahinter lange Eckzähne, gefolgt von mehreren kleinen, spitzen postcaninen Zähnen entlang der Wangen. In der Entwicklung des klassischen Säugetiergebisses war das nach dem Auftauchen der Eckzähne bei früheren Pelycosauriern – wie beispielsweise dem sich in Baumstümpfe verkriechenden Archaeothyris – der nächste Schritt. Gemeinsam mit den Zähnen veränderte sich auch die Kiefermuskulatur. Sie wurde größer und hing an einem stärkeren und tieferen Unterkiefer, der es ermöglichte, noch kräftiger zuzubeißen. Auch die Verbindung zwischen den Rückenwirbeln veränderte sich, sodass die für die Fortbewegung bei Reptilien und Amphibien typische seitliche Wellenbewegung der Wirbelsäule stark eingeschränkt wurde.
Pelycosaurier, primitive synapside Vorfahren der Säugetiere: Dimetrodon mit Rückensegel (oben), kugelbäuchiges, pflanzenfressendes Caseidae (unten). (Fotos: H. Zell [oben] und Ryan Somma [unten])
Dimetrodon weist also sowohl primitive als auch fortschrittliche Merkmale auf, eine Art Frankensteinmix, der ältere, reptilienartige Eigenschaften mit bereits weiterentwickelten Säugetierkennzeichen kombiniert – was bei seiner Position auf dem Familienstammbaum auch zu erwarten war. In älteren Lehrbüchern werden Dimetrodon und vergleichbare Gattungen oft als »säugetierähnliche Reptilien« bezeichnet, ein Begriff, der zwar bildhaft, aber längst überholt i st. Denn trotz seines Aussehens ist Dimetrodon kein Reptil. Es stammt noch nicht einmal von echten Reptilien ab – denn diese sind Nachfahren der Gruppe der Diapsiden. Seine »reptilienartigen« Merkmale sind lediglich primitive Überbleibsel, die es erst noch ablegen musste. Mittlerweile spricht man in der wissenschaftlichen Klassifizierung bei Dimetrodon und anderen Pelycosauriern von »Stamm-Säugetieren«: ausgestorbene Gattungen in der Evolutionslinie zu den modernen Säugetieren, die mit diesen näher verwandt sind als mit jeder anderen heute noch lebenden Gruppe. Entlang dieser Stammlinie entstand über Millionen von Jahren Stück für Stück der Bauplan für den Körper eines Säugetiers.
Kreaturen, die aussahen wie Reptilien – was sie aber nicht waren! –, verwandelten sich also nach und nach in haarige, warmblütige Säugetiere mit großen Gehirnen.
Das bedeutet, Dimetrodon ist mit Ihnen und mir näher verwandt als mit T. rex oder Brontosaurus.
Vor 299 bis 273 Millionen Jahren, im frühen Perm, der Blütezeit von Dimetrodon, existierten Säugetiere also nur als ein Konzept, das die Evolution erst noch realisieren musste. Es ist richtig, dass Dimetrodon und seinesgleichen bereits Merkmale entwickelten, die wir heute als typische Säugetiermerkmale einstufen, aber sie entwickelten diese nicht, um letztendlich zu Säugetieren zu werden. Die natürliche Auslese plant nicht für die Zukunft, sie wirkt ausschließlich in der Gegenwart, indem sie Organismen an ihre aktuellen Lebensbedingungen anpasst. Im großen Kontext der Erdgeschichte gesehen, handelt es sich dabei meist um Nichtigkeiten: lokale Veränderungen des Klimas oder der Topografie, die Ankunft neuer Prädatoren in einem bestimmten Waldgebiet oder die plötzliche Verfügbarkeit eines neuen Nahrungsmittels. Bei Dimetrodon und anderen Pelycosauriern war wahrscheinlich Nahrung die treibende evolutionäre Kraft, was auch die Entwicklung der frühen Säugetiermerkmale erklärt.
Mit Dimetrodon war nicht zu spaßen. In seinem Ökosystem – bewaldetem, mit Seen gesprenkeltem und von Flüssen durchkreuztem Tiefland – war es das gefährlichste Raubtier. Obwohl die Kohlesümpfe längst Geschichte waren, gab es in seinen Ökosystemen zahlreiche Moore und Gewässer, und das um die 4,5 Meter lange und 250 Kilogramm schwere Dimetrodon fraß, was immer ihm über den Weg lief. Auf seinem Speiseplan standen andere an Land lebende Tetrapoden, Diapsiden und Synapsiden, Amphibien, die es entlang der Bachläufe fand, und Süßwasserhaie, die es aus den Flüssen fischte. Das Rückensegel bedrohlich aufgerichtet, stapfte es durchs Nadelgehölz und die Ufer entlang, schnappte sich mit den gerade erst entwickelten Schneidezähnen sein Opfer und erledigte es mit einem tödlichen Biss seiner gebogenen Eckzähne. Danach trennte es mit den Backenzähnen Muskeln von Sehnen, bevor es seine Beute verschlang. Versuchte sein Opfer zu entkommen, hielt Dimetrodon es mit seinen gewaltigen Kiefermuskeln fest. Es war der erste große, an Land lebende Spitzenprädator, der Gründer einer Nische, die später entfernte Säugetierverwandte wie Löwen oder Säbelzahntiger besetzen würden.
War Dimetrodon besonders übermütig oder hungrig, griff es auch andere Pelycosaurier an, wie beispielsweise seinen Doppelgänger Edaphosaurus. Dieses Geschöpf war ebenfalls mit einem Rückensegel ausgestattet, insgesamt aber ein wenig kleiner als Dimetrodon, dafür schwerer, mit einem runden Bauch und kleinen Kopf. Sobald Edaphosaurus das Maul aufmachte, war jedoch sofort klar, dass er nicht nur einer anderen Gattung angehörte, sondern sich auch völlig anders ernährte. Anstelle von Schneide- und Eckzähnen hatte Edaphosaurus ein einheitliches Gebiss aus scharfen, dreieckigen Zähnen und eine zweite Batterie merkwürdig flacher Zähne am Gaumen und der Innenseite des Unterkiefers. Diese Doppelbesetzung war ideal, um Pflanzen zu fressen. Mit den Backenzähnen des Ober- und Unterkiefers schnitt Edaphosaurus wie mit einer Gartenschere Blätter und Zweige ab, und die inneren Zähne übernahmen dann das Kauen und Mahlen.
Pflanzen zu fressen, unter heutigen Tieren eine gängige Art und Weise zu überleben, scheint nichts Besonderes zu sein. Im Perm war es allerdings ein brandneuer Trend. Edaphosaurus war einer der ersten Tetrapoden, die auf eine rein pflanzliche Diät umstellten. Seine Vorfahren im Pennsylvanium hatten mit dieser Ernährungsform zwar auch schon vor dem Kollaps des Karbonwalds experimentiert, zu einem weitverbreiteten Lebensstil wurde sie aber erst in der trockeneren, von Jahreszeiten bestimmten Welt danach, die reich an samentragenden Pflanzen war. Tatsächlich entwickelten verschiedene Familien von Pelycosauriern unabhängig voneinander eine Vorliebe für Grünzeug – ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die pflanzliche Ernährung sich von einer Modeerscheinung schnell zum Mainstream auswuchs. Eine dieser Familien, die Caseidae, waren die vielleicht skurrilsten Synapsiden überhaupt. Mit ihren winzigen Köpfen und breiten Brustkörben erinnerten sie mehr an die Geschöpfe der Macher von »Star Wars« als an eine überlebensfähige, von der Evolution hervorgebrachte Tierart. Aber es gab sie, und sie waren hervorragend ausgerüstet zum Pflanzenfressen, weshalb ein paar von ihnen – wie beispielsweise der eine halbe Tonne schwere Cotylorhynchus – sich zu den stämmigsten Synapsiden ihrer Zeit entwickelten. Um all die Zweige und Blätter, die Cotylorhynchus in sich hineinstopfte, verdauen zu können, brauchte es einen enormen Bauch. Gemeinsam mit den Caseidae schuf die Edaphosaurus-Gruppe in der Nahrungskette eine Nische für die breite Basis der Pflanzenfresser, die nach ihnen von sehr vielen Säugetieren wie Pferden, Kängurus, Hirschen und Elefanten besetzt werden sollte.
Das fleischfressende Dimetrodon, der pflanzenverschlingende Edaphosaurus und die moppeligen Caseidae waren aber nur ein paar wenige der sich im frühen Perm tummelnden Pelycosaurier, denen für mehrere zehn Millionen Jahre die Welt gehörte – insbesondere die Tropen, die feuchter und nicht so sehr den Jahreszeiten ausgesetzt waren wie andere Gebiete der Pangäa. Doch dann, in der scheinbaren Hochzeit der Pelycosaurier, ging es mit ihnen plötzlich bergab. Die Gründe dafür sind unklar, es könnte jedoch an der mit dem Kollaps des Karbonwaldes einsetzenden zunehmenden Hitze und Trockenheit und dem endgültigen Verschwinden der Eiskappe gelegen haben. In der Übergangsphase vom frühen zum mittleren Perm, vor ungefähr 273 Millionen Jahren, nahm in den Tropen, die immer trockener wurden, die Artenvielfalt der Pelycosaurier jedenfalls massiv ab. Auch das war keine plötzliche Katastrophe, sondern ein langsames Sterben, das sich über Millionen von Jahren hinzog. In den höher gelegenen, gemäßigten Regionen kam es ebenfalls zu starken Veränderungen mit einem nahezu kompletten Austausch der Arten. Sowohl in den Tropen als auch in den gemäßigten Zonen tauchte ein neuer Typus von Synapsiden auf, der sehr schnell zu einer vielfältigen Horde aus Fleischfressern und Pflanzenfressern, Winzlingen und Giganten mutierte.
Ich spreche von den Therapsiden, die aus Dimetrodon-ähnlichen Pelycosauriern hervorgingen und zahlreiche fortschrittliche Eigenschaften wie ein schnelleres Wachstum, einen besseren Stoffwechsel, schärfere Sinne, effizientere Fortbewegungsarten und ein kräftigeres Gebiss entwickelten. Sie waren der nächste große Schritt in der Evolution der Säugetiere.
Die Karoo in Südafrika ist eine wunderschöne, aber erbarmungslose Gegend, deren unendlich blauer Himmel eine unvergleichliche Ruhe verbreitet. Die wolkenlose Szenerie bedeutet sehr wenig Regen, was die Karoo zu einer klassischen Halbwüstenlandschaft macht, die tagsüber in der Sonne schmort und nachts vor Kälte zittert, während die reglose, trockene Luft den Aloen und anderen hitzeresistenten Stauden, die dort zwischen Sand und Gestein sprießen, kaum ein Rascheln entlockt. Die ersten europäischen Eindringlinge versuchten mehrfach, das Land zu besiedeln, jedoch ohne Erfolg, während die indigenen Völker das Leben hier problemlos meisterten.
Stein ist in der Karoo überall. Er formt Berge und Täler oder liegt verstreut auf dem Wüstenboden. An einer Stelle türmen sich die überwiegend aus Sand- und Schlammstein bestehenden Gesteinsschichten früherer Flüsse, Seen und Dünenfelder zu einer rund zehn Kilometer dicken Hochzeitstorte auf. Im Karbon und Perm, aber auch noch in der darauffolgenden Trias und im Jura war die Karoo ein großes, von Pflanzen und Tieren bevölkertes Becken, in dem sich der sandige Schlamm sammelte, den die Flüsse aus den Bergen anschwemmten. Die Karoo war ein gieriger Landstrich, der den Hals nicht vollbekommen konnte. Während die Flüsse dort unablässig ihre Fracht abluden, sorgten Verwerfungen im Gestein dafür, dass sich der Boden immer weiter absenkte. Als dieses ewige Füllen und Absenken dann doch einmal ein Ende hatte, konnte die Karoo mit mehr als 100 Millionen Jahren dokumentierter Erdgeschichte aufwarten – Weltrekord! An ihren Sedimentschichten lassen sich der Kollaps des Karbonwaldes ablesen, das Austrocknen der Landschaft im Perm, der Übergang vom Gletscherkühlhaus zum Treibhaus und die Entstehung des Superkontinents Pangäa.
Um durch diese Gesteinsschichten Straßen zu graben, brauchte es gute Ingenieure, und einer der besten war Andrew Geddes Bain. Der im schottischen Hochland geborene Bain zog schon als Teenager nach Südafrika, wo sein Onkel, ein Colonel in der damals britischen Kapkolonie, stationiert war. Nachdem er sich bereits in verschiedenen Berufen versucht hatte – Sattler, Schriftsteller, Captain bei der Armee, Farmer –, wurde Bain vom Militär damit beauftragt, Straßen in der Karoo zu bauen. Je mehr Kilometer Straße er baute, umso vertrauter wurde er mit dem Gestein und fügte seiner beeindruckenden Liste an Tätigkeiten schließlich auch noch die des Geologen hinzu, indem er die erste detaillierte geologische Karte Südafrikas erstellte. Dabei sammelte Bain auch Kuriositäten, die er zwischen den Gesteinsschichten entdeckte, unter anderem einen hundegroßen Schädel mit Fangzahn aus dem Perm, der keinem der bis dahin aus der modernen südafrikanischen Savanne bekannten Tier ähnelte. Den ersten dieser Schädel entdeckte er 1838 bei der Arbeit in der Nähe von Fort Beaufort, einem kleinen Dorf, das als religiöse Mission errichtet und später zu einem Militärlager umfunktioniert wurde. Da es vor Ort keine Museen gab, in denen er seine Fossilien hätte ausstellen können, schickte Bain ein paar davon nach London. Es stellte sich heraus, dass die Geologische Gesellschaft bereit war, dafür zu bezahlen, und so schickte er immer mehr.
In der britischen Hauptstadt fanden die Fossilien ihren Weg zu Richard Owen, dem berühmten Naturforscher und Anatom. Damals in den Vierzigern, war Owen im viktorianischen Großbritannien ein Titan des wissenschaftlichen Establishments und hatte erst ein paar Jahre zuvor das Wort »Dinosauria« geprägt, mit dem er die Skelette uralter Giganten beschrieb, die man in Südengland gefunden hatte. Jede Medaille und jeden Preis, den man im viktorianischen Königreich für wissenschaftliche Leistungen erhalten konnte, gewann er in seiner langen Karriere einmal, was wohl für die Genialität dieses angriffslustigen, paranoiden und heuchlerischen Egomanen spricht, der stets zu einem Streit aufgelegt war und sehr viel mehr Feindschaften als Freundschaften pflegte.
Im Jahr 1845 beschrieb Owen in einer Publikation einige von Bains Fossilien, von denen er eines Dicynodon nannte. Ein wirklich erstaunliches Tier mit reptilienartigem Kopf, einem Schnabel wie eine Schildkröte, aber auch zwei Furcht einflößenden Eckzähnen, die ihm seinen Namen einbrachten, der »Zwei-Hundezahn« bedeutet. Einer anderen Gattung, die er in einer späteren Publikation beschrieb, gab er den Namen Galesaurus, »Wieseleidechse«. Owens Namensgebung spiegelt, was er in dem Fossil erkannte: eine ungewöhnliche Mischung aus eidechsenähnlichen und säugetierähnlichen Merkmalen. Ganz besonders faszinierten ihn jedoch die Zahnreihen, die er in vielen von Bains Schädeln fand und die bekannte Unterteilung in Schneidezähne, Eckzähne und Backenzähne eines Säugetiergebisses aufwiesen. Ansonsten sahen diese Tiere, was Körperbau und Proportionen anging, aber aus wie Reptilien, weshalb Owen ein paar von ihnen fälschlich als Dinosaurier klassifizierte.
Er ermutigte Bain, noch mehr Fossilien zu sammeln, die er, sobald sie aus der fernen Kolonie bei ihm eintrafen, studierte und benannte. Obwohl sein Bestand an Karoo-Fossilien immer größer wurde, wusste Owen nicht so recht, wie er sie einordnen sollte. Sie wiesen zahlreiche Ähnlichkeiten mit Säugetieren auf, was er in Essays und Vorträgen und später auch seinem wegweisenden, 1876 veröffentlichten Katalog südafrikanischer Fossilien einräumte. Dennoch wollte er sie nicht als Vorfahren der Säugetiere oder Bindeglieder in der Evolutionskette zwischen primitiven, reptilienartigen Tieren und modernen Säugetieren anerkennen. Das lag vor allem daran, dass er mit Charles Darwin in einem Dauerclinch lag, bei dem es um nichts Geringeres als die Evolution selbst ging. Als standhafter Konservativer und feuriger Verfechter des Status quo lehnte Owen Darwins Evolutionstheorie der natürlichen Auslese rigoros ab und brachte eine bissige Kritik an Darwins Über die Entstehung der Arten zu Papier, die bis heute als eine der verfehltesten Schriften in der Geschichte der Wissenschaft gilt. Nicht, dass Owen nicht geglaubt hätte, dass die Arten sich verändern, das schon. Aber die Mechanismen, die Darwin dahinter sah, hielt er für komplett falsch. Hinzu kam, dass er schlicht einen persönlichen Groll gegen den Konkurrenten hegte.
Dicynodontier, primitive synapside Vorgänger der Säugetiere: Schädel (oben) und Skelett (unten) eines Dicynodon aus Richard Owens Monografie aus dem Jahr 1845. (Foto: Christian Kammerer)
Kein Wunder also, dass Darwins treuester Verteidiger, der Naturforscher Thomas Henry Huxley, die Säugetiermerkmale von Owens Karoo-Reptilien oder die Möglichkeit, dass die Säugetiere von diesen abstammten, nicht anerkennen wollte. Stattdessen stellte er eine These auf, die im Nachhinein wie eine Farce wirkt: Säugetiere, so Huxley, stammten von salamanderähnlichen Amphibien ab. Die Jahre zogen ins Land, und Owen und Huxley zankten sich immer weiter. Als sie in den 1890er-Jahren beide starben, war der Streit noch immer nicht beigelegt – obwohl die meisten neuen Funde für Owens Theorie sprachen. Eine dieser Neuentdeckungen war ein »Reptil« mit Rückensegel: Dimetrodon. Der Paläontologe Edward Drinker Cope – merken Sie sich diesen Namen, wir werden ihm später in einem noch abenteuerlicheren Kontext wieder begegnen –, der Dimetrodon und andere Fossilien aus Nordamerika beschrieb, sprach sich für eine Verbindung zwischen den »reptilienähnlichen« Pelycosauriern, Owens Karoo-Fossilien und den heutigen Säugetieren aus.
Endgültig bestätigt wurden Owen und Cope dann schlussendlich ein paar Jahrzehnte später von einem anderen Schotten, Robert Broom. Er war auf den Spuren Bains ebenfalls nach Südafrika
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: