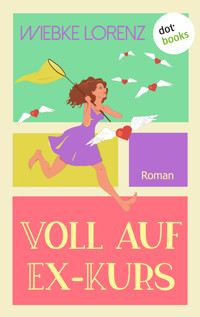9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Sie ist allein im Haus. Allein mit ihrer Angst. Sie kann mit niemandem sprechen. Nicht einmal mit ihrem Mann. Was wissen die Leute im Auto? Und vor allem, was werden sie tun? Eines Morgens steht es plötzlich da. Das schwarze Auto. Mitten in der ruhigen Blumenstraße in einem gehobenen Wohnviertel. Darin ein Mann und eine Frau, die reglos dasitzen. Stundenlang, tagelang. Nach und nach macht diese stumme Provokation die Anwohner nervös. Allen voran Stella Johannsen, die sich immer und immer wieder die eine Frage stellt: Was wissen sie? Über die schreckliche Nacht vor sechs Jahren, als Stella und ihr Mann Paul einen schweren Unfall hatten. Einen Unfall, bei dem ein Mensch starb. Sind sie deswegen hier? Was werden sie tun? Und wie viel Zeit bleibt Stella noch? »Ich habe mich völlig in dieser Geschichte verloren und wusste irgendwann nicht mehr, wo oben und unten ist. Wahnsinnig spannend. Unbedingt lesen!« Melanie Raabe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Sammlungen
Ähnliche
Wiebke Lorenz
Einer wird sterben
Psychothriller
FISCHER E-Books
Für meinen Vater Volker Lorenz
Am Ende
Wie sehr musst du mich lieben, dass du so etwas für mich tust?
Dein Gesicht. Dein unfassbar hübsches Gesicht. Zerschmettert, zerschlagen, deine Züge bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Aber für mich, für mich, bist du immer noch dieser wunderschöne Mensch von damals.
Vor sechs Jahren, als wir uns zum ersten Mal angesehen haben. Gesehen haben. Erkannt. Als uns beiden von einer Sekunde auf die nächste klargeworden ist, dass wir an die Seite des jeweils anderen gehören. Dass wir nicht mehr auf einsamen, sondern gemeinsamen Pfaden wandeln wollen.
Schsch, mein Herz! Versuch nicht, zu sprechen. Es geht nicht. Es geht doch einfach nicht, dein Mund gibt keine Worte mehr preis. Und das muss er auch nicht, es ist alles gesagt. Alles – und mehr als das. Komm, ich bette deinen Kopf in meinen Schoß, streiche dir durchs Haar, sehe, wie es meine Finger färbt in ein tiefes und warmes Rot. Leuchten, meine Hände leuchten.
Es musste so enden, mein Herz, das war uns beiden klar. Nur wann, wie und wo, das konnte keiner von uns sagen. Aber dass es so kommen würde, war uns schon in dem Moment bewusst, in dem wir unseren geheimen Pakt schlossen. In dem wir einen Bund miteinander besiegelten, einen, den nichts und niemand würde auflösen können. Bis auf den Tod. Und jetzt ist jener Tod eben da und hat entschieden, dich zuerst mitzunehmen auf die letzte lange Reise.
Aber sorge dich nicht, ich werde dir folgen. Bald, schon sehr bald. Nur einen Wimpernschlag wird es dauern verglichen mit der Ewigkeit.
Ich habe dich geliebt, mein Herz. Vielleicht glaubst du mir nicht, aber das ist die Wahrheit, so mir Gott helfe. Ich weiß, du würdest jetzt gern lachen, wenn du könntest. Würdest sagen, dass Gott damit nichts zu tun hat, rein gar nichts. Und wenn doch – dann wäre es ein ziemlich gottloser Gott.
I don’t want to start any blasphemous rumours but I think that God’s got a sick sense of humour. And when I die I expect to find Him laughing. Damals, in unserem ersten Sommer, nach dem Depeche-Mode-Konzert. Auf der Fahrt nach Hause haben wir lauthals diesen Song mitgesungen, haben ihn fast trotzig dem Fahrtwind entgegengeschrien. Deine Hand in meiner oder meine in deiner, ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es in diesen fast schon unerträglich glücklichen vier Wochen war. Vier Wochen, die mich durch die Jahre getragen haben; getragen bis zum heutigen Tag. Die mich alles haben vergeben und vergessen lassen, alles, was war und was noch sein würde.
Komm, du darfst jetzt die Augen schließen und dich davonträumen in eine bessere Welt. Dorthin, wo es weder Schmerz noch Kummer gibt, keine Angst und keine Sorge mehr, nur Leichtigkeit und Freude, so viel davon, dass es bis in die Unendlichkeit reichen wird. Wehr dich nicht, mein Herz, es ist alles gut.
Warte. Ich helfe dir.
1
Donnerstag, 21. Juni
Als sie am Nachmittag nach Hause kam, stand das Mercedes Cabriolet immer noch da. Parkte auf der anderen Straßenseite, direkt gegenüber ihrer Villa vor dem Haus der Sanders. Sein Verdeck war trotz des guten Wetters geschlossen, hinterm Steuer saß eine blonde Frau, auf dem Beifahrersitz ein Mann mit dunklen Haaren. Wie Puppen sahen sie aus, und wenn Stella nicht ein paar kleine Bewegungen wahrgenommen hätte – hier eine Hand, die übers Lenkrad strich, dort ein Kopf, der sich ein wenig zur Seite neigte –, hätte sie tatsächlich angenommen, dort in dem Auto säßen nur zwei leblose Pappkameraden.
Verstanden hätte sie es trotzdem nicht. Verstanden, weshalb in ihrer Straße seit morgens um neun, als sie das erste Mal aus dem Fenster geschaut und das Fahrzeug bemerkt hatte, bis jetzt um halb drei am Nachmittag ein schwarzes Cabrio stand, dessen Insassen sich kaum rührten.
Stella holte den Schlüssel aus ihrer Handtasche, steckte ihn in den Zylinder der Haustür und drehte ihn nach rechts. Sie hielt in der Bewegung inne. Wandte sich noch einmal zu dem Wagen um, betrachtete die zwei reglosen Gestalten und zog für den Bruchteil einer Sekunde in Erwägung, hinüberzugehen und gegen die Scheibe zu klopfen, um nachzufragen, ob sie helfen könne. Dann aber schüttelte sie den Kopf, fast amüsiert über diesen Anflug des Sich-Einmischen-Wollens, der eher zu ihrem Nachbarn Egon Scharff passte, der zwei Häuser weiter links direkt am Wendehammer wohnte.
»Renata?«, rief sie nach ihrer Haushälterin, sobald sie die Villa betreten, Sommermantel und Tasche an die Garderobe gehängt sowie ihre Mokassins abgestreift und ins Schuhregal gestellt hatte. »Ich bin wieder da!« Sie nahm den kleinen Stapel Post, der auf dem Sideboard neben der Tür lag, und ging damit in den Flur.
»In der Küche!«, erklang dumpf die Stimme der älteren Frau, die ihr und Paul zweimal pro Woche zur Hand ging, immer montags und donnerstags von halb elf bis halb drei. Stella fuhr in dieser Zeit zu ihrer Personaltrainerin und machte Pilates oder Yoga, danach holte sie sich noch etwas zum Mittagessen und setzte sich damit in den nahe gelegenen Park, um für die Haushälterin das Feld zu räumen. So war es beiden am liebsten.
Paul nannte Renata Graubert »seine gute Seele«. Sie war schon seit vielen Jahren für ihn tätig, länger, als er und Stella sich kannten. Anfangs hatten die zwei Frauen ein paar Anlaufschwierigkeiten miteinander gehabt, zu unterschiedlich ihre Auffassung von einer ordentlichen Haushaltsführung. Aber seit Paul seine Frau davon überzeugt hatte, Renata einfach freie Hand zu lassen, hatten sich alle Probleme in Wohlgefallen aufgelöst.
»Hallo«, begrüßte Stella die Putzfrau, als sie im Türrahmen zur Wohnküche stand. Sie kniete auf allen vieren vor dem Edelstahlherd im freistehenden Kochblock und hatte den Kopf in den Backofen gesteckt. »War heute alles in Ordnung?«
»Hm«, kam es bejahend zurück, wenige Sekunden später tauchte Renata aus dem Ofen hervor, schloss die Klappe, kam auf die Füße und beförderte ein Knäuel schmutziger Küchenrolle in den Paperboy neben der Arbeitsplatte. Dann zog sie sich mit einem geräuschvollen Flutschen die Gummihandschuhe aus. »Das Ceranfeld unten links funktioniert nicht«, sagte sie, während sie die Handschuhe in der Schublade für die Putzutensilien verstaute. »Ich habe schon mit dem Kundendienst telefoniert. Wir haben für Montagmorgen um acht einen Termin ausgemacht, ich hab’s eingetragen.«
»Um acht?« Stella warf die Post auf den Küchentresen.
»Später ging leider nicht. Soll ich am Montag einfach früher kommen?«
»Nein, kein Problem, ich kümmere mich darum.«
»Ich kann aber wirklich …«
»Wie gesagt, es ist kein Problem, den Mann reinzulassen. Machen Sie sich keine Gedanken.«
»Sonst würde ich einfach schon mittags gehen, das würde mir nächste Woche ohnehin ganz gut passen.«
»In Ordnung«, stimmte Stella nun doch zu. »War sonst noch was?«
Renata zuckte mit den Schultern. »Nein, nichts. Der Schornsteinfeger war da und hat die Rauchmelder geprüft. Sind alle in Ordnung.«
»Prima. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.«
»Ich Ihnen auch, Frau Johannsen. Paul ist nicht da, oder?«
»Nein, er kommt erst Ende nächster Woche zurück.« Sie nickten sich freundlich zu, und Renata machte sich daran, sich ihrer Schürze zu entledigen, um nach Hause zu Mann und Dackel zu eilen.
»Ach, Renata?«, hielt Stella sie zurück.
»Ja?«
»Ist Ihnen draußen auf der Straße auch das Auto aufgefallen?«
»Welches Auto?«
»Da parkt seit heute früh ein schwarzer Mercedes mit zwei Leuten drin, aber keiner steigt aus.«
Die Haushälterin schüttelte den Kopf. »Habe ich nicht bemerkt.« Sie ließ ihren Blick durch Küche und Wohnzimmer schweifen. »Aber ich hatte ja auch anderes zu tun.«
»Natürlich. Natürlich hatten Sie das.«
»Sind vielleicht wegen des Neubaus hier«, überlegte Renata. »Der ist doch jetzt fertig, oder?«
»Ich glaube schon.«
»Na, dann werden das Mietinteressenten sein.«
»Seit heute früh um neun?«
Renata sah sie fragend an.
»Um neun Uhr habe ich den Wagen zum ersten Mal gesehen. Seitdem hat er sich nicht von der Stelle bewegt, und da sitzen einfach nur eine Frau und ein Mann drin.«
»Keine Ahnung«, gab sie zurück. »Vielleicht wollen die sehen, was in der Straße so los ist.« Sie lachte leise. »Sonderlich viel ist das ja nicht.«
»Nein«, gab Stella ihr recht und nickte zerstreut. »Werden wohl tatsächlich Interessenten für eine der Wohnungen sein.«
Renata verabschiedete sich und ließ ihre Auftraggeberin allein in der Küche zurück.
Eine Weile blieb Stella unschlüssig stehen, dann ging sie hinüber in den Wohnbereich, setzte sich seufzend aufs Sofa und griff nach einer der Zeitschriften, die hier ordentlich gestapelt auf einem Beistelltisch lagen.
Aber sie konnte sich nicht aufs Lesen konzentrieren, permanent wanderten ihre Gedanken zu diesem seltsamen Paar draußen im Auto ab. Also stand sie wieder auf, ging zu einem der Fenster, die zur Straße lagen, und spähte durch eine Lücke zwischen den cremefarbenen Schiebegardinen.
Das Cabriolet parkte unbewegt an Ort und Stelle, die beiden Menschen rührten sich ebenfalls nicht, hockten da wie tot. Ansonsten sah alles aus wie immer.
Es war nicht so, dass Stella sich sonderlich darum scherte, was vor ihrer Haustür passierte. Zum einen hatte auch sie Besseres zu tun, als auf ein Kissen gestützt am Fenster zu lehnen und ihre Nachbarn zu beobachten. Zum anderen hatte Renata Graubert recht: Es gab da schlicht nichts, was der Beobachtung lohnen würde. Stella schob die Gardinen ein Stückchen weiter auseinander, ließ ihren Blick von links nach rechts wandern.
Die Blumenstraße war eine kurze Sackgasse und mündete in einen kleinen Wendehammer. Höchstens sechzig oder siebzig Meter lang, Kopfsteinpflaster, von mächtigen Linden gesäumt. »Gehobene Lage« würden Immobilienmakler es nennen. Mitten im Zentrum, sämtliche Einrichtungen des täglichen Bedarfs in fußläufiger Distanz: Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Banken, Schulen, U-Bahn, Bus, sogar das Universitätskrankenhaus war nur wenige hundert Meter entfernt. Ebenfalls direkt um die Ecke lag ein großer Park mit Grillplätzen, Abenteuerspielplatz, Laufpfaden, Hundewiese und See; im Sommer war der Rasen unter zahlreichen ausgebreiteten Picknickdecken kaum auszumachen.
Vier ehrwürdige Bauten aus der Gründerzeit standen rechts und links der Straße. Vorn an der Ecke ihr und Pauls eigenes Haus, dann das von Marlies und Hermann Wagner, einem älteren Rentnerpaar, beide weit über siebzig – sie an Muskelschwund erkrankt, er stets sorgenvoll um sie bemüht, Marlies hin und wieder im Rollstuhl durch die Gegend schiebend, weil ihre Beine kaum noch laufen wollten –, und schließlich noch die schöne, aber heruntergekommene Villa von Egon Scharff; ebenjenem Nachbarn, den sie alle hinter vorgehaltener Hand nur »den Blockwart« nannten. Denn niemand fühlte sich wie er dazu berufen, auf die nachbarschaftliche Ordnung zu pochen. Ob es die Gelben Säcke waren, die man für die Abfuhr nicht sichtbar genug am Straßenrand positioniert hatte, oder der Umstand, dass der TÜV des eigenen Fahrzeugs eine Woche überfällig war – schneller, als man Luft holen konnte, wies der 63-jährige Lehrer in Altersteilzeit seine Mitbürger auf solche Verfehlungen hin und gab den reuigen Sündern so die Möglichkeit zur Nachkorrektur.
Auf der anderen Straßenseite, vis-à-vis von Paul und Stella und damit genau dort, wo der Mercedes parkte, bewohnten Michael und Nina Sanders mit Sohn und Tochter ihr Haus im Jugendstil und betrieben gleichzeitig die Apotheke in dem kleinen Anbau daneben. Bereits in vierter Generation führte Michael Sanders das Geschäft. Manchmal, wenn Stella ihn und seine Frau durch das große und nackte Panoramafenster ihres Wohnzimmers miteinander diskutieren sah, kamen sie ihr hektisch und aufgeregt vor. Sie hatte sich deshalb schon gefragt, ob es mit der Apotheke nicht zum Besten stand, was sie in Anbetracht der etwas abgeschiedenen Lage nicht weiter verwundert hätte. Allerdings machten sowohl er als auch sie stets einen entspannten und freundlichen Eindruck, wenn Stella gelegentlich ein paar Kopfschmerztabletten oder einen Hustensaft bei ihnen kaufte, so dass die abendlichen Debatten wohl einen anderen Grund haben mussten.
Wahrscheinlich die Kinder, bei Eltern ging es ja meist um die Kinder. Lilly Sanders, gerade siebzehn geworden, war ein hübsches und nettes Mädchen, das zumindest dem äußeren Anschein nach keinen Anlass zur Sorge gab. Ganz im Gegensatz zu ihrem Bruder Leon, der mit Anfang zwanzig und nach einer geschmissenen Zahntechnikerlehre seine Füße vor drei Monaten wieder unter den elterlichen Tisch gestellt hatte. Erzwungenermaßen, wie Stella vermutete, denn glücklich wirkte der Junge nicht. Tagsüber war er nie zu sehen, nur abends huschte er aus dem Haus und kehrte weiß Gott wann zurück, immer schwarz gekleidet, immer die Stöpsel eines Kopfhörers in den Ohren und den Blick hypnotisch auf sein Smartphone geheftet.
Dem strengen Egon Scharff war Leon Sanders ein Dorn im Auge, natürlich war er das. Und das schon seit Jahren. Seit der fünften Klasse hatte er den Jungen am nahe gelegenen Gymnasium in ein paar Fächern unterrichtet und war laut eigener Aussage wenig überrascht gewesen, als Leon zwei Klassen wiederholen musste und schließlich wegen zu schlechter Leistungen von der Schule geflogen war.
»Keine Disziplin und vor allem keinerlei Respekt!«, hatte der Herr Oberstudienrat erst kürzlich Stella gegenüber ungefragt festgestellt, als sie sich auf der Straße begegnet waren. »Die Lilly, die wird ihren Weg gehen, die macht Abitur und studiert. Aber ihr Bruder ist schlicht ein Taugenichts. Früher hätten wir so einen zum Bund geschickt. Da hätten sie ihm die Flausen schon ausgetrieben.«
Doch noch mehr als über »so einen« konnte Egon Scharff sich über Marius Marquardt erregen. Nicht nur dass der fünfzigjährige Architekt mit seiner jungen Frau Chloé – knapp zwanzig Jahre trennten die beiden – auf der gegenüberliegenden Straße kurz vor dem Wendehammer einen protzigen Kubus aus Stahl, Beton und Glas hatte errichten lassen, der so gar nicht ins Viertel passte. Nein, auch das Endgrundstück der Sackgasse gehörte Marius Marquardt, und er hatte trotz des erbitterten Widerstands der Nachbarn, genauer gesagt des Nachbarn Scharff, den Neubau einer großen Wohnanlage durchgesetzt.
Vier Jahre lang war es dem Blockwart – vermutlich unter Aufwendung sämtlicher ihm zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel – gelungen, das Flower-Bay-Quartier mit diversen Widersprüchen und Eingaben zu verhindern. Aber vor zwei Jahren hatten die Bauarbeiten begonnen. Da hatte die wilde Wiese mit ihren hübschen Birken, Feldblumen und sogar einer mächtigen Kastanie Marquardts Projekt weichen müssen. Ebenso wie der praktische Trampelpfad, über den die Anwohner bis dahin zu Fuß eine Abkürzung zum nächsten Supermarkt nehmen konnten, der ihnen aber dann durch die Baustelle abgeschnitten wurde. In dieser Zeit war in der Blumenstraße dann doch etwas los gewesen, allerdings nur der Lärm von Baggern und Presslufthammern, und nun standen vierzehn Luxuswohnungen bereit, neue Mieter zum Preis von zwanzig Euro kalt pro Quadratmeter zu begrüßen. Dafür durften sie dann auch exklusiv den nun gepflasterten Fußweg nutzen, der nur noch durch den Hinterausgang des Mehrfamilienhauses zu erreichen war. Es sei denn, man wollte sich links oder rechts am Quartier vorbei durch Rhododendronbüsche kämpfen.
»Wer weiß, wer da alles einzieht?!«, hatte Egon Scharff auf der letzten von ihm einberufenen Versammlung im Clubraum seines Kegelvereins gewettert, zu der sie alle nur gekommen waren, um den nachbarschaftlichen Frieden aufrechtzuerhalten. Stellas Mann hatte Glück und in der Regel eine gute Ausrede für sein Fernbleiben von diesen Veranstaltungen parat gehabt: Er hatte sich meist schlicht irgendwo anders auf der Welt befunden. »Ein Kommen und Gehen wird das werden, ständig Menschen, die wir nicht kennen!«, hatte Egon Scharff sich wie ein Wanderprediger in Rage geredet. »Ein solches Gesocks wollen wir in unserer Straße nicht haben!«
Den Hinweis von Michael Sanders, bei einem derart horrenden Quadratmeterpreis sei vermutlich keinerlei »Gesocks« zu erwarten, hatte er mit einem »Und was ist mit der Parkplatzsituation?« vom Tisch zu fegen versucht. Hier allerdings hatte Hermann Wagner eingeworfen, dass das neue Quartier zum einen eine Tiefgarage habe, die übrigen Anwohner außerdem allesamt einen Stellplatz direkt vor ihrem Haus. »Aber da werden ja auch jede Menge Besucher kommen!«, hatte der Lehrer sich weiter ereifert. »Und was ist denn mit unseren Gästen, wo parken die? Wir sollten bei der Stadt beantragen, in der Blumenstraße eine Anwohnerparkzone einzurichten.« Sie alle – ohne Ausnahme – hatten Egon Scharff mit belustigten bis mitleidigen Blicken bedacht. Denn jeder wusste: Gerade er bekam nie Besuch.
Stella hatte die Diskussion nicht im Geringsten interessiert. Ihr war es komplett egal, wer in die Blumenstraße kam und ging, wer wen besuchte oder wer wo parkte. Soweit es ging, hielt sie sich aus allem heraus. Ohnehin war Egon Scharffs Empörung nur noch Makulatur, das Flower-Bay-Quartier stand, die Sache war damit erledigt.
Jetzt allerdings, während Stella sich auf die Suche nach ihrem Kater Paulchen begab und hoffte, dass er zu Hause war und nicht draußen durch die Gegend streunte – sie brauchte ein wenig warmes Fell im Arm –, wünschte sie sich, sie hätte sich an Egon Scharffs Seite entschiedener gegen den Neubau zur Wehr gesetzt. Denn ob die beiden dort draußen im Auto nun Mietinteressenten waren oder nicht – der Umstand, dass da seit Stunden zwei fremde Menschen quasi vor ihrer Haustür parkten, machte sie …
Sie horchte in sich hinein und fragte sich, was genau es mit ihr machte.
War sie nervös?
Einfach nur unruhig?
Ihr Blick fiel auf den Wandkalender neben der Küchentür, in den Renata den Termin mit dem Kundendienst am Montag eingetragen hatte. Heute war der einundzwanzigste Juni, der längste Tag des Jahres.
Nein, Stella war weder unruhig, noch war sie nervös.
Sie hatte Angst.
2
An meiner Seite wirst du oft einsam sein.
Als Stella zwei Stunden später aus einem tiefen Nachmittagsschlaf hochschreckte und ihr Blick auf das leere Laken neben sich fiel, ging ihr dieser Satz durch den Kopf.
Paul hatte ihn zu ihr gesagt. Vor über fünf Jahren, als er sie gebeten hatte, seine Frau zu werden. Da hatte er sie in einem Atemzug mit seinem Antrag darauf hingewiesen, was sie von einer Ehe mit ihm zu erwarten hätte. Trotzdem hatte Stella mit ihrem »Ja« nicht gezögert, nicht eine Sekunde lang, und sich von ihm den kostbaren Verlobungsring mit großem Solitär an den Finger stecken lassen, den sie von diesem Moment an stolz wie eine Trophäe trug und den sie niemals ablegte, nie. Genauso wenig wie den schlichten Ehering, der nur vier Wochen später gefolgt war.
Damals, am schönsten Tag ihres Lebens, als sie zu Frau Johannsen wurde, hatte sie nicht ahnen können, wie wahr Pauls Satz sein würde. Wie wahr – und wie schrecklich. Hatte gedacht, dass sie das schon aushalten würde. Dass sie diese Zeit für sich ganz allein unglaublich genießen werde. Niemand da, der sie störte. Niemand, der etwas von ihr verlangte. Niemand, dem sie Rechenschaft schuldig war darüber, was sie den gesamten Tag über tat oder bleiben ließ. Vollkommen frei. Und dennoch behütet in der geborgenen Sicherheit, dass da jemand war, den sie liebte und der sie zurückliebte. Wenn auch nicht hier bei ihr, dann aber doch irgendwo.
Aber so war es eben nicht. Die Einsamkeit drohte sie oft aufzufressen, Stück für Stück, Zelle für Zelle. Sie drang in ihr Innerstes vor, zersetzte sie schleichend. Vor allem an einem Tag wie dem heutigen. Da hätte sie Paul gebraucht, da hätte sie ihn verdammt nochmal gebraucht. Gebraucht, damit er sie in seine Arme schloss, ihr über den Kopf strich und ihr ins Ohr raunte, dass sie Dummerchen sich keine Sorgen machen müsse über die zwei Verrückten da draußen im Mercedes und dass das Datum nichts weiter als ein Zufall sei. Dass die Leute vermutlich wirklich nur Interessenten für den Neubau waren oder auch zwei unterbezahlte Boulevardjournalisten, die hier herumlungerten in der Hoffnung, irgendeinen Promi bei der Wohnungssuche vor die Linse zu bekommen.
»Die Preise, die der Marquardt aufruft, sind ja horrend genug«, hätte Paul zu ihr gesagt und dabei gelacht. »Schon möglich, dass da irgendwelche C- und D-Sternchen aufkreuzen, die sich zu Höherem berufen fühlen und meinen, nach ihrem Rumgehüpfe bei Let’s Dance oder dem Seelenstrip beim Dschungelcamp müsse es jetzt mindestens ein Luxusloft sein.«
Stella hätte ihm zugestimmt und ebenfalls gekichert. Vielleicht hätte sie sogar im Spaß eine weitere Möglichkeit vorgeschlagen: »Vielleicht sind es ja auch die Zeugen Jehovas, die hier mit allen Anwohnern über Gott sprechen möchten.«
»Wird schwierig, wenn sie dafür nicht mal aussteigen. Es sei denn, die wollen einen Drive-In betreiben und warten darauf, dass die Leute zum Bekehrungsgespräch an ihre Autoscheibe klopfen.«
Sie hätte richtig laut gelacht und gleich noch einen draufgesetzt: »Oder es sind verdeckte Ermittler, die den Scharff beschatten. Bei dem will man ja gar nicht wissen, wer oder was da seit Jahren in seinem Keller hockt.«
»Das wären dann aber ganz schön ›unverdeckte‹ Ermittler, wenn sie am helllichten Tag gut sichtbar in der Straße parken«, hätte Paul entgegnet. »Für wahrscheinlicher halte ich noch zwei Bewährungshelfer, die Leon Sanders im Auge behalten.«
»Warum das?«
»Na, so wie der sich immer rumdrückt, würde es mich nicht wundern, wenn der was ausgefressen hätte. Wer weiß, ob der seine Ausbildung wirklich abgebrochen hat oder nicht vielmehr gefeuert worden ist. Der Junge braucht mal einen ordentlichen Tritt in den Hintern, aber Michael und Nina lassen den ja machen, was er will.«
»Jetzt klingst du selbst wie Egon Scharff.«
»Du!«, hätte er empört erwidert und ihr im Spaß mit erhobenem Zeigefinger gedroht. Dann hätten sie beide noch einmal gelacht, hätten sich geküsst und sich am Abend eine gute Flasche Rotwein und das bestellte Essen von Sushi for Friends schmecken lassen. Und ansonsten keinen weiteren Gedanken mehr an die Insassen des Mercedes verschwendet. Ja, so wäre es gewesen, genau so.
Stattdessen aber war Stella allein mit ihrer Angst. Vollkommen allein. Nicht einmal anrufen konnte sie Paul. Es gab zwar an Bord seiner Maschine ein Satellitentelefon, aber das war natürlich nicht für Privatgespräche gedacht. Erst recht nicht für Telefonate mit überspannten Ehefrauen. Pauls aktueller Einsatzplan, der wie immer an der Tür des Kühlschranks pinnte, hatte ihr verraten, dass er gerade irgendwo über dem Indischen Ozean war und erst um 0.30 Uhr UTC – Universal Time Coordinated, die Zeitzone, in der er ständig lebte –, den Flughafen von Auckland erreichen würde; da wäre es hier bereits halb zwei in der Nacht, in Neuseeland schon zwölf Stunden weiter am Nachmittag.
Trotzdem hatte sie vorhin, nachdem Renata gegangen und auch der Kater nicht aufzufinden gewesen war, die Handynummer ihres Mannes gewählt. Und sich mit seiner Mailbox unterhalten, die ohne ein einziges Klingeln angesprungen war, wie in fünfundneunzig Prozent der Fälle, wenn Paul Dienst hatte.
Frustriert hatte sie das Telefon aufs Sofa gepfeffert, sich allein eine Flasche vom guten Roten geöffnet, um sich mit einem Glas ins Schlafzimmer zu verziehen. Trotzig war sie die Treppe nach oben gestapft, innerlich skandierend, dass sie damals »nein« hätte sagen sollen. Dass diese Heirat ein Fehler gewesen war und dass sie lieber einen wollte, der ganz langweilig auf dem Boden blieb. Montag bis Freitag, Nine-to-Five, mit Spiele- und Kochabenden bei Freunden und Wochenendausflügen. Mit dreißig Tagen Urlaub im Jahr, dann ab in einen Robinson Club oder in ein Wellness-Hotel an der Ostsee. Mit Ostern, Weihnachten und Silvester in trauter Zweisamkeit. Sie schiss auf Neujahrsgrüße per WhatsApp aus Singapur!
Dazu machte sie das permanente Jonglieren mit den Zeitzonen verrückt, verrückt. Dass sie nie genau wusste, ob sie Paul in den seltenen Fällen, in denen sie ihn an die Strippe bekam, mit »Guten Morgen« oder »Guten Abend« oder »Sorry, hab ich dich geweckt?« begrüßen sollte; dass er so oft auf einem anderen Planeten zu Hause war als sie, unter einer anderen Sonne und einem anderen Mond lebte, dass Stella sich – im wahrsten Sinne des Wortes – meist fühlte wie Die Frau des Zeitreisenden.
Andere beneideten sie tatsächlich darum. Die Frauen aus Nachbarschaft und Bekanntenkreis. Sie sah es an ihren begehrlichen Blicken. Oh, wie toll, Stella Johannsens Mann ist Pilot! Sogar Kapitän! Vier Streifen auf der Schulterklappe, der hat es zu was gebracht!
Dass er »nur« Cargo flog, also Frachtgut anstelle von Passagieren von A nach B beförderte, minderte ihre Wertschätzung nicht. Im Gegenteil. »Seien Sie doch froh«, hatte Chloé Marquardt irgendwann einmal zu ihr bei einem kurzen Gespräch im Supermarkt gesagt, als Stella angesichts der klebrigen Bewunderung der Architektenfrau bissig erwidert hatte, Paul sei genau genommen auch nichts Besseres als ein Postbote, nur eben in der Luft. »Seien Sie doch froh«, hatte Chloé Marquardt da gesagt, »keine hübschen Stewardessen oder Fluggäste, das kann doch nur von Vorteil sein, so rasend gut, wie er aussieht.« Keine Stewardessen. Das konnte Stella tatsächlich als Vorteil gelten lassen beim rasend gutaussehenden Paul Johannsen.
Und sie selbst? Sie sah nicht gut aus. Schon gar nicht rasend. Nicht mehr. Sie ging vom Schlafzimmer hinüber ins angrenzende Bad, und schon bevor sie in den Spiegel sah, wusste sie, dass der Anblick sie auch heute noch, nach so vielen Jahren, schmerzen würde. Und dass der Rotwein, den sie vorhin getrunken und von dem sie so schläfrig geworden war, ein Übriges getan hatte, die letzte verbliebene Vitalität aus ihren Zügen zu vertreiben.
Sie hatte recht. Ihr zerschlagenes Gesicht war für niemanden attraktiv. Die große wulstige Narbe, die sich von der linken Schläfe bis zur Mitte ihrer Stirn zog. Es gab kein Make-up, das einen solchen Makel verschwinden lassen konnte. Das hängende linke Auge. Die schiefgedrückte Nase. In drei Operationen irgendwie wieder zusammengeschustert, damit sie wenigstens ohne allzu große Schwierigkeiten atmen konnte. Schön sah es nicht aus. Aber darum war es den Ärzten auch nicht gegangen. Sondern darum, die Funktion zu retten. Sie zu erhalten. Mehr hatte man, hatte sie nicht erwarten dürfen.
Sie drehte den Wasserhahn auf, hielt beide Hände darunter und fing das Nass auf wie mit einer Kelle, bevor sie es sich ins Gesicht warf. In dieses krumme Gesicht. Wie hübsch sie einmal gewesen war. Wie hübsch! Seidig blonde Haare, die ihr bis über die Schultern reichten. Gut, die waren geblieben. Ebenso die hellblauen Augen, so hell, dass sie strahlten wie unter Scheinwerferlicht. Doch darauf achtete niemand. Zu verstörend waren die Narben. Die roten Mahnmale lenkten ab von allem, was früher so viele als anziehend empfunden hatten. Sie hob eine Hand, bedeckte ihre linke Gesichtshälfte, betrachtete nur die rechte und versuchte, sich daran zu erinnern, dass beide einmal so ebenmäßig gewesen waren. Hübsch ist das falsche Wort. Sie war eine schöne Frau gewesen.
Lehrerin? Ihre Mutter hatte es nicht geschrien, sie hatte es gekreischt. Du willst Lehrerin werden? Und dann noch an der Grundschule? Bei deinen Möglichkeiten? Kind, bist du verrückt geworden?
Nein, sie war nicht verrückt geworden. Sie war es schon immer. Und jetzt – jetzt war sie einfach nur noch ein bisschen ver-rückter. Ver-rückt darüber, dass sie nicht einmal mehr mit Kindern arbeiten konnte. Weil sie ihnen Angst machte, weil sie sich vor Stella fürchteten. Anders als vor Egon Scharff, der Disziplin und Respekt einforderte, den die Schüler aber wenigstens ansehen konnten, ohne sich vor ihm zu gruseln. Da konnte Stella noch so viel Liebe und Aufmerksamkeit geben, vor ihr wichen die Kinder zurück. Oder sie gaben Gemeinheiten von sich, weil sie noch nicht gelernt hatten, Impulse höflich zu unterdrücken, sondern direkt sagten, was sie dachten.
Du, Frau Johannsen, warum siehst du so gruselig aus?
Steigt ein Zombie aus der Geisterbahn. Und der Zombie heißt Frau Johannsen.
Narbenfresse, meck, meck, meck, schon ist die Johannsen weg!
Sie kannte auch einen Kinderreim. Und der ging so:
Ene, mene, miste
Es rappelt in der Kiste
Ene, mene, muh
Und raus bist du
Raus bist du noch lange nicht
Sag mir erst, wie alt du bist.
Zweiunddreißig.
Eins … zwei … drei … vier …
Sie waren beide zweiunddreißig Jahre alt. Mit zweiunddreißig hörte das Leben der anderen auf. Und Stellas begann. Hatte sie jedenfalls gedacht. Damals.
Paul also. Mit vier Streifen auf der Schulterklappe. Flog um die Welt, flog und flog; schwebte hinaus ins Universum und zurück. Kapstadt. Rio. Shanghai. New York. Sydney. Honolulu.
Zu Hause: Stella. Sein demütiges Weib. Das wartete. Egal, wie lange es dauerte. Manchmal zehn Tage am Stück. »Kette fliegen« nannten sie das. Ein passender Begriff. Denn so lange lag sie an der Kette, konnte sich nicht rühren und nicht bewegen, fühlte sich wie abgestorben. Auch die Mitbringsel von fünf Kontinenten trösteten sie nach Pauls Heimkehr nicht darüber hinweg. Was hatte sie von einer winkenden Glückskatze aus Hongkong oder Erdnussbutterbrezeln aus Los Angeles? Sie vermisste ihn, ihren Mann. Seine Nähe, seine Wärme, seinen Geruch, seine Haut an ihrer. Natürlich, sicher, dafür war er dann mehrere Tage am Stück zu Hause, dann hatte sie ihn 24/7. Aber dieses »ganz oder gar nicht«, das schlauchte sie fast noch mehr. Das Leben mit Paul war ein einziger Entzug in Intervallen; nach jedem Schuss sofort die gewaltsame Entgiftung, ständig litt sie unter einer Art von Liebeskummer.
Aber nein. Stella drehte erst ihren Verlobungs-, dann ihren Ehering am Finger hin und her, warf ihrem Spiegelbild ein zaghaftes Lächeln zu, schloss die Augen und erinnerte sich an damals. Paul und sie beim Standesamt, nur sie beide, ohne Trauzeugen, ohne Gäste, denn sie hatten das nur für sich getan, für niemanden sonst. Sie hatten weder eine rührselige Tante Gertrud gebraucht noch einen launigen Onkel Manfred, der beim anschließenden Fest erst dröhnend Anekdoten zum Besten und sich danach die Kante gegeben hätte. Keine Freunde mit peinlichen Ideen für noch peinlichere Spiele oder gar Gesangeinlagen. Und keine Eltern. Stellas Mutter war schon seit einigen Jahren tot, und ihren Vater hatte sie zuletzt mit vier gesehen, seitdem war er abgängig, dorthin, wo – laut ihrer Mutter – der Pfeffer wächst. Pauls Eltern hingegen wären ohnehin nicht gekommen. Sie waren von ihrer Verbindung so wenig begeistert, dass Paul ihnen erst zwei Jahre später erzählt hatte, dass sie inzwischen verheiratet waren.
Trotzdem oder gerade deshalb: Es war der schönste Tag ins Stellas Leben, schöner, als sie es sich je hätte träumen lassen. Die Heirat, sie war kein Fehler gewesen. Sie liebte Paul, wie sie noch nie zuvor jemanden geliebt hatte. Vom ersten Moment an hatte sie das getan, seit sie ihn damals gesehen hatte.
An einem Sonntag waren sie sich begegnet, im Supermarkt des Flughafens, der als einziger der Stadt geöffnet hatte. Sie hatte eine Kollegin zu ihrem Flieger gebracht, eine Woche Mallorca zu Pfingsten. Nie hätte sie damit gerechnet, an diesem Tag den Mann ihres Lebens zu treffen. Aber genau so war es passiert. Gegen vier Uhr am Nachmittag waren ihre Leben ineinandergestolpert. Er, Paul, dieser rasend gutaussehende Mann in seiner schneidigen Pilotenuniform, über einen Meter neunzig groß, mit schwarzen Haaren, bronzenem Teint und bernsteinfarbenen Augen, gerade erst von sonst woher eingeflogen, wie ein schöner Prinz aus einem fernen Land; und sie, Stella, nicht einmal einen Meter siebzig, zierlich und im sommerlichen Blümchenkleid, ein wenig zerstreut wie immer, im Kopf noch die Korrekturen der Deutscharbeit, an denen sie bis mittags gesessen hatte. Sie hatten ihre Einkaufswagen miteinander vertauscht, und Paul war hinter Stella hergerannt, um den Irrtum aufzuklären.
Noch am selben Abend hatte Stella in Pauls Haus für ihn gekocht, hatte aus ihren gemeinsamen Einkäufen ein dreigängiges Menü gezaubert und dafür staunende Begeisterung geerntet. Eine leidenschaftliche Liebesnacht war gefolgt. Erst am nächsten Morgen, als Paul sie mit zärtlichen Küssen geweckt hatte, hatte Stella ihm gestanden, dass die Sache mit den Einkäufen gar keine Verwechslung gewesen war. Dass sie seinen Wagen absichtlich genommen hatte. Absichtlich, weil sie ihn unbedingt hatte kennenlernen wollen, da schon ein einziger Blick für sie gereicht hatte, um dieses Gefühl in ihr heraufzubeschwören – dieses Gefühl, dass sie zu ihm gehörte und er zu ihr. Und so war es dann auch gewesen, von diesem Morgen an hatten sie zusammengehört, unzertrennlich füreinander bestimmt.
Deshalb war Stella bereit, den Preis des Alleinseins zu zahlen. Und das Paar im Auto würde sie nicht dazu bringen, alles in Frage zu stellen, was sie hatte. Das wäre lächerlich, wirklich lächerlich!
Sie ging zurück ins Schlafzimmer, schnappte sich das leere Weinglas und brachte es hinunter in die Küche. Und als wollte sie sich von der Lächerlichkeit ihrer Angst überzeugen, zog sie mit einem Ruck das Rollo des Küchenfensters hoch und sah hinaus auf die Straße.
Der Mercedes stand noch immer an derselben Stelle. Nur hatte das Paar die Plätze gewechselt.
Jetzt saß der Mann am Steuer.
3
Freitag, 22. Juni
In der Nacht riss sie das Klingeln ihres Handys erneut aus einem tiefen Schlaf. Benommen tastete sie danach und stieß dabei die leere Rotweinflasche auf dem Couchtisch um. Sie hatte sich mit einem Film auf andere Gedanken bringen wollen und war dabei offenbar eingenickt. Der Fernseher zeigte das stumme Hauptmenü von Netflix.
»Hallo?« Stellas Stimme kratzte, als sie noch im Liegen das Gespräch entgegennahm.
»Hallo, Schatz! Du hattest angerufen?«
»Paul!«
»Ist irgendwas los?«
»Nein, was soll denn los sein?«
»Du klingst so aufgebracht.«
»Tut mir leid, du hast mich geweckt, das ist alles.«
»Na ja«, sie hörte ihn schmunzeln, »bei dir ist es jetzt kurz nach zwei, kein Wunder, dass du schon geschlafen hast. Du hättest dein Handy ausschalten sollen.«
Stella setzte sich auf und hangelte mit einer Hand nach der leeren Weinflasche, die sie ein wenig beschämt über sich selbst zurück auf den Couchtisch stellte. »Ich bin froh, deine Stimme zu hören, das Wecken macht mir nichts.«
»Was wolltest du denn?«
»Ach, ich weiß auch nicht«, erwiderte sie, während sie aufstand, zur Fensterfront ging und nach draußen sah. Der Mercedes parkte noch immer an Ort und Stelle, jetzt allerdings mit eingeschalteter Innenbeleuchtung. Verstecken wollten sich die Insassen offensichtlich nicht. Der Mann am Steuer, neben ihm die Frau. Sofort kam die Angst zurück, die Stella mit dem Rotwein hatte verscheuchen wollen.
»Was weißt du nicht?«
»Es ist vielleicht albern. Aber hier steht seit heute früh ein schwarzes Mercedes Cabriolet in der Straße mit zwei Leuten, die einfach nicht aussteigen.«
»Was denn für Leute?«
»Ein Mann und eine Frau.«
»Seit heute früh?«
»Genau genommen seit gestern, ist ja schon nach Mitternacht.«
»Und was machen die beiden?«
»Das ist es ja gerade, die machen nichts. Das heißt, doch, zwischendurch haben sie einmal die Plätze getauscht. Zuerst saß die Frau am Steuer, jetzt der Mann.«
»Dann warten die wohl auf etwas oder jemanden.«
»Einen Tag lang und die halbe Nacht?«
Kurze Pause. Dann: »Na ja, vielleicht springt ihr Auto nicht an.«
»Paul!«, fuhr sie ihn an. »Dann bleibt man doch nicht stundenlang einfach da hocken!«
»Wenn der ADAC mal wieder etwas länger braucht, dann schon«, sagte er und lachte.
»Mir ist gerade nicht nach Witzen zumute.«
»Tut mir leid, Schatz. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass die einfach nur ein Problem mit dem Wagen haben.«
»Dann würde man doch in ein Hotel gehen.«
»Was weiß ich?« Stella hörte ein klatschendes Geräusch, als würde er sich mit einer Hand auf den Oberschenkel schlagen. »Vielleicht haben sie kein Geld, sind zu geizig dafür, warten auf einen befreundeten Schrauber, der sich Zeit lässt, sind geistig umnachtet …« Ein Seufzer erklang. »Dafür kann es alle möglichen Erklärungen geben.«
»Ja«, stimmte sie ihm zu. »Aber ich hab so ein seltsames Gefühl.«
»Geh doch einfach mal hin und frag, was los ist.«
»Auf keinen Fall!«, stieß sie aus. Allein der Gedanke löste bei ihr Panik aus.
»Tja …« Ein Dann kann ich dir auch nicht helfen in einer einzigen Silbe. »Am besten legst du dich schlafen. Morgen früh sind die mit Sicherheit verschwunden. Ich glaube wirklich nicht, dass du dir darüber Sorgen machen musst.«
»Glaubst du nicht?«, wiederholte sie Pauls Worte und bemerkte die fast kindlich klingende Hoffnung, die in ihrer Stimme mitschwang.
»Nein«, bekräftigte er. »Wie gesagt, leg dich hin und vergiss die Sache.«
»Paul …« Sie zögerte, wollte nicht, dass er sie für hysterisch hielt. Aber sich verabschieden und auflegen – das wollte sie noch viel weniger. Denn die Angst war trotz der durchaus logischen Gründe, die er aufgeführt hatte, immer noch da. Auch wenn Stella sich mittlerweile selbst fragte, weshalb. Erst da fiel ihr wieder ein, welchen Tag sie hatten, das war ihr komplett entfallen. »Da ist aber noch die Sache mit dem Datum!«, sagte sie hektisch.
»Was ist denn damit?«
»Gestern war der einundzwanzigste Juni.«
Paul sog scharf die Luft ein, hustete. »Du meinst …« Er sprach nicht weiter.
»Ich weiß nicht, was ich meine. Aber es ist schon sehr eigenartig.«
»Ach, Quatsch!« Es kam gepresst und so energisch, als wolle er sich selbst davon überzeugen. »Das ist doch reiner Zufall. Die Sache ist schon sechs Jahre her, niemand weiß davon, da müsste ja …«
»Niemand?«, unterbrach sie ihn. »Hast du da nicht eine Kleinigkeit vergessen?« Sie wollte ihn nicht so anherrschen, aber es war ihr herausgerutscht.
»Nein, hab ich nicht.« Er klang angespannt. »Auf das Video ist allerdings nie wieder etwas gefolgt. Warum sollte also ausgerechnet jetzt etwas passieren?«
»Keine Ahnung.« Sie zuckte mit den Schultern, so als könnte er es sehen. »Ich kann nur sagen, dass ich ein mulmiges Gefühl habe.« Noch immer hatte sie den Blick auf das Paar in dem Wagen geheftet. Am liebsten wäre sie jetzt doch nach draußen auf die Straße gerannt und hätte die Leute angeschrien, dass sie verschwinden sollten.
»Was genau für ein Auto ist es denn?«
»Keine Ahnung«, sagte sie noch einmal. »Halt ein schwarzes Mercedes Cabriolet.«
»Ich meine, was für ein Modell?«
»Woher soll ich das wissen?« Erneut geriet ihr der Tonfall aggressiver als gewollt.
»Schatz, ich meine, ob es ein …«
»Ob es ein Oldtimer ist?«, beendete sie seine Frage.
»Genau.«
»Nein, das Auto ist neu.«
Sie hörte ihn aufseufzen. »Na, siehst du!« Nun hatte er sich wieder im Griff, war ganz der souveräne und umsichtige Paul. »Du kannst mir glauben, das alles bedeutet rein gar nichts.«
»Aber ausgerechnet ein Mercedes Cabrio?«
»Davon gibt’s ja nun wirklich so viele, dass das nichts zu bedeuten hat. Es ist ja kein Oldtimer, also mach dich nicht verrückt.«
»Ich weiß nicht …«
»Liebling, du siehst Gespenster.« Er lachte auf. »Ich meine, selbst, wenn es so wäre: Was sollte so eine Aktion denn bringen? Wenn die was von uns wollen würden, dann würden sie … Na ja, sie würden doch wohl eher klingeln oder anrufen oder irgendwas tun. Einfach nur im Auto sitzen? Das ergibt nicht den geringsten Sinn! Ich finde, du solltest die ganze Sache wirklich einfach vergessen.«
»Okay«, antwortete sie, ging vom Fenster zurück zum Sofa und ließ sich darauf plumpsen. »Ich sehe wohl tatsächlich nur Gespenster. Trotzdem wünschte ich, du wärst jetzt hier und nicht am anderen Ende der Welt.«
»Das kann ich ja nicht ändern.«
»Ich weiß.«
»Wo ist denn das Tier?«
»Treibt sich irgendwo rum, ich hab ihn seit vorgestern nicht mehr zu Gesicht bekommen.«
»Taucht sicher bald wieder auf, länger als zwei Tage ist es doch nie weg.«
»Ich guck gleich mal nach, ob Paulchen in seinem Korb liegt.«
»Mach das. Und knuddel ihn von mir.«
»Echt?«
»Ausnahmsweise«, erwiderte er, und Stella dachte daran, wie Paul vor drei Jahren, als sie ungefragt mit dem Kater aufgetaucht war, gesagt hatte, er selbst würde sich um »das Vieh« mit Sicherheit nicht kümmern. Und auch Renata sei nicht dafür da, Katzenscheiße und Tierhaare wegzuputzen. Das hatte Stella nicht gestört, im Gegenteil, sie kümmerte sich am liebsten allein um ihren kleinen Mitbewohner, der von Paul immer nur »das Tier« genannt wurde. Vermutlich, weil er die Tatsache, dass Stella den Kater nach ihm benannt hatte, im Gegensatz zu ihr weder lustig noch originell fand, sondern »einfach nur bescheuert«. Allerdings hatte er durchaus verstehen können, dass sie nicht immer so allein sein wollte, und sich mittlerweile einigermaßen mit Paulchen arrangiert. Vor ein paar Wochen hatte Stella ihren Mann sogar dabei ertappt, wie er ihm heimlich die Öhrchen kraulte, so hingebungsvoll, dass er nicht einmal seine Frau im Türrahmen bemerkte. Sie hatte sich in dem Moment nicht zu erkennen gegeben, sondern war ganz leise wieder davongeschlichen.
»Okay, das mache ich«, sagte Stella nun. Dann zögerte sie einen Moment und überlegte, ob sie Paul bitten sollte, wenigstens mal pro forma bei der Crewplanung seiner Airline anzufragen, ob die Möglichkeit bestünde, seinen Dienst so zu ändern, dass er früher nach Hause käme. Aber sie ließ es. Er hatte ja recht, es gab keinen Grund, panisch zu sein. »Ich liebe dich«, sagte sie stattdessen.
»Ich liebe dich auch. Versuch, wieder einzuschlafen. Morgen früh ist das Auto ganz bestimmt weg. Wenn nicht, ruf mich an, mein nächster Flug geht erst in fünfzehn Stunden.«
»Ist gut.« Sie schickten sich gegenseitig zwei Küsschen durch die Leitung, dann legten sie auf.
Einen Moment blieb Stella noch auf dem Sofa sitzen, dann nahm sie die leere Weinflasche, stellte sie in der Küche in den Kasten fürs Altglas und schloss ihr Handy ans Ladekabel neben der Arbeitsplatte an. Ihr Blick fiel auf den Poststapel, den sie gestern Nachmittag hier abgelegt hatte. Sie blätterte ihn durch, beförderte drei Umschläge mit Werbung direkt in den Mülleimer und legte zwei Rechnungen für Paul beiseite. Das letzte Kuvert war aus dickem cremefarbenem Büttenpapier und an ihn adressiert. Nur an ihren Mann. »Paul Johannsen« stand dort, schwungvoll mit blauem Füller geschrieben. Kein Absender. Stella sah sich nach allen Seiten um, als könnte sie hinter zugezogenen Fenstern jemand beobachten, dann öffnete sie den Brief, entnahm ihm eine ebenfalls cremefarbene Klappkarte und begann, den gedruckten Text zu lesen.
Danksagung
Meine Konfirmation am 14. April war für mich ein wunderschöner Tag, und ich möchte mich von Herzen bei Dir bedanken, dass Du mit Deinem Dabeisein, mit Deinen Glückwünschen und Geschenken dazu beigetragen hast.
Unterschrieben war die Karte ebenfalls mit blauer Tinte. »Alles Liebe, Deine Laura.«
Alles Liebe, Deine Laura.
Stella legte sich eine Hand auf den Brustkorb, als würde sie dort ein körperliches Stechen verspüren. Und tatsächlich schmerzte ihr Herz für einen kurzen Moment, ihre Augen füllten sich mit Tränen. Laura. Laura Sievers, Pauls Patenkind, die Tochter seines früheren Schwagers. Die er seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Nicht, seit er – natürlich wegen Stella – von Lauras Eltern Lukas und Saskia zur persona non grata erklärt worden war. Umso überraschender die Einladung zu Lauras Konfirmation, die ihnen Anfang März ins Haus geflattert und die ebenfalls ausschließlich an Paul gerichtet gewesen war.
Es hatte darüber Streit gegeben. Heftigen Streit.
»Wie kommen diese Leute dazu, dich ohne mich einzuladen?«, hatte sie ihn angefaucht. »Das ist eine absolute Unverschämtheit, immerhin bin ich deine Frau!«
»Stella«, hatte er erwidert, »du weißt doch, warum!«
»Natürlich weiß ich das!« Vor Wut hatte sie ihn kaum ansehen können. »Und ich weiß auch, wie unfair das ist.«
»Unfair ist wohl kaum das richtige Wort.«
»Ist mir egal, welche Bezeichnung du passend findest! Was soll das überhaupt? Du hast doch seit Jahren nichts mehr von denen gehört!«
»Wundert mich auch, aber vielleicht ist es ein Zeichen der Versöhnung. Immerhin ist Laura meine Patentochter.«
»Du bist gar nicht mehr ihr Onkel! Natalie ist tot, und wir sind jetzt verheiratet. Es hat sich also ausgeonkelt.«
»Pate bleibt man ein Leben lang.«
»Laura hat sich doch nie für dich interessiert.«
»Sie ist ein Kind, Stella!«, hatte er zurückgegeben. »Außerdem ist es als Pate meine Aufgabe, für sie da zu sein, ganz egal, wie sie sich verhält.«
»Was aber offensichtlich nie gewünscht war, sonst wären deine Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke ja nicht immer ungeöffnet zurückgekommen.«
»Wer weiß, ob Laura die Annahme selbst verweigert hat oder ob das nicht vielmehr ihre Eltern waren. In jedem Fall freue ich mich umso mehr, dass sie ihre Meinung geändert hat und mich nun einlädt. Und dass das auch für Lukas und Saskia in Ordnung zu sein scheint.«
Stella hatte ihren Mann entsetzt angestarrt. »Du willst da doch wohl nicht hingehen?«
»Natürlich will ich das.« Er hatte sie in den Arm nehmen wollen, war aber von ihr zurückgestoßen worden.
»Lass das!«, hatte sie ihn angeherrscht und dabei angefangen zu weinen.
»Stella, bitte.« Nun hatte sie doch zugelassen, dass er sie an sich zog und ihr beruhigend über den Kopf strich. »Das ist doch eine Hand zur Versöhnung, und ich möchte sie gern ergreifen. Kannst du das nicht verstehen?«
Dem hatte sie nichts mehr entgegenzusetzen gehabt. Und so hatte sie unglücklich mit angesehen, wie Paul zuerst seine Patentochter angerufen, sich bei ihr bedankt und zugesagt hatte. Und wie er im Anschluss seinen für April bereits festgelegten Dienstplan ändern ließ, um am Tag der Feier und dem danach frei zu haben. Sie hatte geschwiegen, hatte nichts gesagt. Nicht, dass er das für sie, Stella, noch nie getan hatte. Und sie hatte es auch nicht weiter kommentiert, als er nach der Konfirmation erst am frühen Morgen nach Hause gekommen war, so betrunken, dass er es nicht einmal bis zu ihr ins Schlafzimmer geschafft hatte, sondern mitsamt Anzug und Schuhen auf dem Sofa im Wohnzimmer eingeschlafen war. Anstatt ihm irgendwelche Vorhaltungen zu machen, hatte sie ihn gegen Mittag mit einem starken Kaffee und einem ordentlichen Katerfrühstück geweckt, das er zwar dankbar, aber schweigend und recht abwesend zu sich genommen hatte.
Danach hatten weder Paul noch Stella ein Wort über die Konfirmation verloren. Er hatte nichts erzählt, und sie hatte nicht gefragt, weil sie nichts hatte wissen wollen. Im Gegenteil, sie hatte gehofft, dass das Thema damit erledigt war und Natalies Familie wie in all den Jahren zuvor keine Rolle mehr in ihrem Leben spielen würde.
Und nun also Lauras Danksagung an Paul, die in ihr alles wieder hochkommen ließ. Immerhin nur eine unpersönliche Drucksache, ein Massenbrief an alle. Kein »Lieber Onkel Paul, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder!«. Nein. Von daher wohl kein Grund, darüber so aus dem Häuschen zu geraten.
Stella zögerte einen Moment, dann steckte sie die Karte zurück in den Umschlag – und zerriss beides so gründlich, dass davon nur noch kleine Schnipsel übrig blieben, die sie zu den Werbebriefen in den Müll beförderte. Die Post war unzuverlässig, das wusste schließlich jeder. Einen Moment stand Stella noch unschlüssig in der Küche herum, dann ging sie nach oben, um die restliche Nacht in ihrem und Pauls Bett zu verbringen.
Als sie die letzte Treppenstufe erreicht hatte, entdeckte sie den Kater, der im Flur in seinem Körbchen lag und schlief. Vor Freude lachte sie auf, einen Augenblick später hatte sie Paulchen auf dem Arm und drückte ihre Nase in sein warmes weiches Fell. Nur, um den Kater sofort wieder mit einem Aufschrei fallen zu lassen. Nach einer unsanften Landung flitzte das Tier fauchend davon, aber sie sah ihm nicht nach, sondern starrte angewidert auf ihre nackten Unterarme. Blut, sie waren vollgeschmiert mit Blut. Zu Stellas Füßen lag die zerbissene Maus, die Paulchen in seinem Korb unter sich begraben haben musste. Der Kopf des Kadavers fehlte zur Hälfte, aus dem aufgeschlitzten kleinen Bauch blitzten Teile des Gerippes hervor, und das eine noch verbliebene Auge schien Stella in Todesangst anzustarren.
Sie musste würgen, presste sich eine Hand vor den Mund, was die Übelkeit aber noch verstärkte, denn jetzt stieg ihr der Geruch des Bluts direkt in die Nase. Kopflos stolperte sie Richtung Schlafzimmer und Bad, riss den Deckel der Toilette hoch und beugte sich über die Schüssel. Eine Minute lang verharrte sie so, aber es blieb bei einem leeren Würgen, auf das nichts folgte.
Als sie sicher sein konnte, den Brechreiz überwunden zu haben, ging sie zum Waschtisch, drehte den Hahn auf und hielt beide Arme unter den warmen Wasserstrahl. Hellrot floss das Blut ins Becken, verschwand im Ausguss und in der Kanalisation. Stella nahm die Nagelbürste aus dem kleinen Schälchen neben der Mischbatterie, hielt ihre Arme nacheinander unter den Seifenspender und pumpte sich mehrere Hübe der sämigen Flüssigkeit auf die oberflächlich zwar nun sauberen, aber vom Gefühl her noch immer besudelten Stellen. Mit der Bürste schrubbte sie, schrubbte und schrubbte, bis ihre Unterarme ganz rot und wund waren, aber trotzdem noch immer nicht vom Blut befreit.
Erst, als ihr vor Schmerz schon fast die Tränen kamen, wurde ihr bewusst, was sie da tat. Abrupt hielt sie in der Bewegung inne, stellte das Wasser aus und beförderte die Bürste in den kleinen Treteimer unterm Waschtisch.
Es war Unsinn, sich wegen ein bisschen Tierblut so aufzuregen. Paulchen brachte immer mal wieder solche »Geschenke« mit nach Hause, das war keine Seltenheit. Normalerweise legte er sie draußen vor der Haustür ab, dass er seine Beute dieses Mal mit hineingetragen hatte, war dennoch alles andere als ein Drama.
Stella wickelte ein langes Stück Toilettenpapier ab und ging damit zurück in den Flur. Sie bückte sich zu der toten Maus, spürte kurz wieder ein flaues Gefühl im Magen, doch dann stülpte sie das Papier über den Kadaver und nahm ihn mit spitzen Fingern auf. Ihr Blick fiel auf Pauls Schlafplatz, und auch, wenn sie auf der weichen Polsterung weder Blut noch irgendwelche Tierreste entdecken konnte, beschloss sie, den Bezug ebenfalls zu entsorgen, und legte die tote Maus darauf.
Dann lief sie noch einmal zurück ins Bad, holte mehr Toilettenpapier und Desinfektionsspray, um die Stelle auf dem Fußboden, wo das Tier gelegen hatte, gründlich zu reinigen. Nachdem sie das erledigt hatte, löste sie das Polster vom Katzenkorb, faltete es mitsamt gruseligem Inhalt zusammen und ging nach unten zur Haustür.