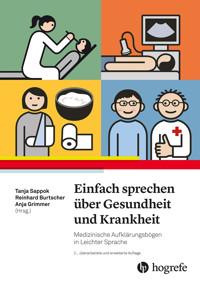
Einfach sprechen über Gesundheit und Krankheit E-Book
47,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Was passiert beim Arzt und im Krankenhaus? Medizinische Aufklärung in Leichter Sprache und mit intuitiven Bildsymbolen von METACOM. Menschen mit intellektuellen Behinderungen erkranken im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung häufiger an psychischen oder körperlichen Störungen. Eine gute medizinische Versorgung ist daher besonders wichtig. Je ausgeprägter eine kognitive Beeinträchtigung erscheint, desto heraus-fordernder sind die diagnostischen und therapeutischen Zugänge in der Behandlung. Verständigungsschwierigkeiten bei Patientinnen und Patienten und beim Fachpersonal erschweren notwendige Untersuchungen und Behandlungen. Wenn Patientinnen und Patienten aber entsprechend ihrem Entwicklungsstand aufgeklärt werden können, dann reduziert sich das Angst- und Stressniveau bei allen Beteiligten. Die Erfolgsquote einer Behandlung steigt. Das Buch beinhaltet unterschiedliche Materialien zur Aufklärung über Krankheiten, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in leicht verständlicher Sprache: - Welche Besonderheiten ergeben sich in der Diagnostik und Behandlung von Menschen mit intellektuellen Entwicklungsstörungen? - Optimale Vorbereitung. Das ICH-Buch: Meine persönlichen Daten, wie verstehe ich Erklärungen am besten? Was gefällt mir nicht, wobei brauche ich Hilfe? (auch als Download zum Ausdrucken und Ausfüllen). - Erklären und Verstehen: Das großformatige Buch beinhaltet mehr als 100 farbige Aufklärungsbögen mit wesentlichen Informationen zu Krankheiten, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in Leichter Sprache, ergänzt mit anschaulichen Piktogrammen.Das Buch hat sich als wertvolle Unterstützung für medizinisches, therapeutisches und pädagogisches Personal in ihrer täglichen Arbeit bewährt. Die Aufklärungsbögen fördern den Dialog mit Angehörigen und Menschen mit Lernschwierigkeiten, tragen so zu einer informierten Entscheidung bei und stärken die Patientenrechte. Leichte Sprache ist nicht nur ein Thema für Menschen mit Lernschwierigkeiten, sondern immer dann hilfreich, wenn unterschiedliche Gruppen, Milieus und Kulturen aufeinandertreffen. Das Buch kann daher auch bei Personen mit nichtdeutscher Muttersprache, älteren Menschen, Kindern oder krankheitsbedingt eingeschränkten Personen eingesetzt werden. Neu in der 2. Auflage: Aktualisierung der Aufklärungsbögen und Ergänzung weiterer Themen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tanja Sappok
Reinhard Burtscher
Anja Grimmer
(Hrsg.)
Einfach sprechen über Gesundheit und Krankheit
Medizinische Aufklärungsbögen in Leichter Sprache
2., überarbeitete und erweiterte Auflage
Mit Symbolen von Annette Kitzinger
Einfach sprechen über Gesundheit und Krankheit
Tanja Sappok, Reinhard Burtscher, Anja Grimmer (Hrsg.)
Programmbereich Medizin
Univ.-Prof. Dr. med. Tanja Sappok (Hrsg.)
Universitätsklinikum OWL der Universität Bielefeld
Campus Bielefeld-Bethel
Maraweg 21
33617 Bielefeld
Prof. Dr. Reinhard Burtscher (Hrsg.)
Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin
Köpenicker Allee 39–57
10318 Berlin
Dr. med. Anja Grimmer (Hrsg.)
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge GmbH
Herzbergstraße 79
10365 Berlin
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten.
Verantwortliche Person in der EU: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Merkelstraße 3, 37085 Göttingen, [email protected]
Anregungen und Zuschriften bitte an den Hersteller:
Hogrefe AG
Lektorat Medizin
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Susanne Ristea, Sibylle Khoumeri
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung: Annette Kitzinger, Oeversee, METACOM
Umschlaggestaltung: Hogrefe Verlag AG, Bern
Illustrationen (Innenteil): Annette Kitzinger, Oeversee, METACOM
Satz: punktgenau GmbH, Bühl
Format: EPUB
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2025
© 2021, 2025 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96398-3)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76398-9)
ISBN 978-3-456-86398-6
https://doi.org/10.1024/86398-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Vorwort zur 2. Auflage
Teil 1
1 Besonderheiten in der Diagnostik und Behandlung von Menschen mit Störungen der IntelligenzentwicklungTanja Sappok, Reinhard Burtscher und Anja Grimmer
1.1 Besondere Bedingungen
1.2 Untersuchungsinstrumente und Leitlinien
1.3 Ziele der Materialsammlung
2 Herausforderungen einer medizinischen Behandlung aus Sicht der Nutzer*innen und Anbieter*innen
2.1 Die Perspektive der Nutzer*innen: Erfahrungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten in der GesundheitsversorgungGermaine Köchling und Anna-Maria Biendarra
2.2 Die Perspektive der Nutzer*innen: „Ich bin selbst für meine Gesundheit verantwortlich.“ Menschen mit Down-Syndrom äußern sich zum Thema GesundheitKatja Weiske, Katja de Bragança und Anne Leichtfuß
2.3 Die Perspektive der Nutzer*innen: Gestaltung der medizinischen Versorgung von Menschen im AutismusspektrumSilke Lipinski und Rainer Döhle
2.4 Die Perspektive der Angehörigen: Menschen im Autismusspektrum im GesundheitssystemMaria Kaminski und Fabian Diekmann
2.5 Die Perspektive der Eingliederungshilfe: Stärkung und Befähigung aller BeteiligtenGeorg Poppele und Birgit Pohler
2.6 Die Perspektive der Eingliederungshilfe: Wünsche und Erwartungen an Kliniken aus Sicht besonderer Wohnformen (bisher: stationärer Wohnangebote)Heiner Bartelt
2.7 Die Perspektive der Eingliederungshilfe: Ambulante medizinische Versorgung von Menschen mit einer kognitiven BeeinträchtigungMaike Bohner
2.8 Die Perspektive der Eingliederungshilfe: Menschen mit schwermehrfacher Behinderung im Krankenhaus – Herausforderungen und Lösungsansätze Martin Rothaug
2.9 Die Perspektive der Klinik: Medizinische Versorgung von Menschen mit intellektueller BeeinträchtigungAnja Grimmer und Sabine Zepperitz
2.10 Die Perspektive der Wissenschaft: Die Versorgungssituation von Menschen mit LernschwierigkeitenMatthias Schützwohl
Teil 2
3 Medizinische Aufklärungsbögen
Die Arbeitsweise der PrüfgruppenGermaine Köchling und Reinhard Burtscher
4 Medizinische Aufklärungsbögen
4.1 Der Arzt-Besuch und das Kranken-Haus
4.1.1 Gesundheit und Krankheit
4.1.2 Gute Gründe für einen Besuch bei der Haus-Ärztin
4.1.3 Der Arzt-Besuch
4.1.4 Vorsorge-Untersuchungen
4.1.5 Ärztliche Behandlung
4.1.6 UK: Unterstützte Kommunikation
4.1.7 Die Tasche für das Kranken-Haus
4.1.8 Das Kranken-Haus
4.1.9 Die Entlassung aus dem Kranken-Haus
4.2 Untersuchungen
4.2.1 Untersuchung des Körpers
4.2.2 Schmerz: Patienten-Befragung
4.2.3 Blut-Druck messen
4.2.4 Blut-Abnahme
4.2.5 Blut-Zucker messen
4.2.6 EKG: Elektro-Kardio-Gramm
4.2.7 Ultraschall
4.2.8 Röntgen
4.2.9 CT: Computer-Tomogramm
4.2.10 MRT: Magnet-Resonanz-Tomogramm
4.2.11 EEG: Elektro-Enzephalo-Graphie
4.2.12 Psychologische Diagnostik
4.2.13 Gastroskopie: Magen-Spiegelung
4.2.14 Koloskopie: Darm-Spiegelung
4.2.15 LP: Lumbal-Punktion
4.2.16 Intensiv-Station
4.2.17 Abstrich
4.3 Erkrankungen
4.3.1 Autismus
4.3.2 FAS: Fetale Alkohol-Spektrum-Störungen
4.3.3 Gefühls-Regulation
4.3.4 Schizophrenie
4.3.5 Depression
4.3.6 Persönlichkeits-Störungen
4.3.7 Angst-Störungen
4.3.8 Störung der Impuls-Kontrolle
4.3.9 Psychogene Anfälle
4.3.10 Schlag-Anfall
4.3.11 Epilepsie
4.3.12 Spastik
4.3.13 Band-Scheiben-Vorfall
4.3.14 Fraktur: Knochen-Bruch
4.3.15 Skoliose
4.3.16 Blind-Darm-Entzündung
4.3.17 Krebs-Erkrankungen
4.3.18 Schild-Drüsen-Erkrankungen
4.3.19 Blut-Hoch-Druck
4.3.20 Schwindel – Gleichgewichts-Störungen
4.3.21 Übergewicht
4.3.22 Diabetes: Zucker-Krankheit
4.3.23 Gastritis: Magen-Schleimhaut-Entzündung
4.3.24 Demenzen
4.3.25 Kopf-Schmerzen
4.3.26 Herz-Infarkt
4.3.27 Pneumonie: Lungen-Entzündung
4.3.28 HWI: Harnwegs-Infekt
4.3.29 Karies
4.3.30 Verstopfung
4.4 Therapien und Medikamente
4.4.1 Psycho-Therapie
4.4.2 Gruppen-Psycho-Therapie
4.4.3 DBT: Skills-Training
4.4.4 Ergo-Therapie
4.4.5 Musik-Therapie
4.4.6 Kunst-Therapie
4.4.7 Therapie mit Hunden
4.4.8 Physio-Therapie
4.4.9 Logopädie: Sprach-Therapie
4.4.10 Logopädie: Schluck-Therapie
4.4.11 Medikamente
4.4.12 Anti-Psychotika
4.4.13 Anti-Depressiva
4.4.14 Epilepsie-Medikamente
4.4.15 Benzodiazepine
4.4.16 Diabetes: Insulin-Therapie
4.4.17 Magen-Tabletten
4.4.18 Schild-Drüsen-Medikamente
4.4.19 Schmerz-Medikamente
4.4.20 Schlaf-Störungen: Was können Sie tun?
4.4.21 Blut-Druck-Medikamente
4.4.22 Sedierung
4.4.23 Narkose
4.4.24 Operation
4.4.25 Dialyse
4.4.26 Masken-Beatmung
4.4.27 Atem-Insuffizienz: Behandlung mit einer Nasen-Brille
4.4.28 Intubation
4.4.29 Tracheotomie
4.5 Medizinische Fachrichtungen
4.5.1 Der Augen-Arzt
4.5.2 Die Chirurgin
4.5.3 Der Frauen-Arzt – Gynäkologe
4.5.4 Die Hals-Nasen-Ohren-Ärztin
4.5.5 Der Haut-Arzt – Dermatologe
4.5.6 Die Haus-Ärztin – Allgemein-Medizinerin
4.5.7 Der Internist – Innere Medizin
4.5.8 Die Neurologin – Fachärztin des Nerven-Systems
4.5.9 Der Psychiater – Facharzt für psychische Erkrankungen
4.5.10 Die Psycho-Therapeutin
4.5.11 Der Urologe
4.5.12 Die Zahn-Ärztin
4.6 Gesundheits-Förderung
4.6.1 Gesundheits-Förderung
4.6.2 Bewegung
4.6.3 Gesunde Ernährung
4.6.4 Stress und Entspannung
Teil 3
Das Ich-Buch: Was man über Sie wissen sollte, um Ihnen die Behandlung zu erleichtern
Anhang
Glossar
Kurzvita des Herausgeberteams
Mitwirkende
Die Prüfer*innen
Die Symbole
Aufklärungsbögen A–Z
|9|Danksagung
Das vorliegende Buchprojekt wäre ohne die Beteiligung vieler Mitwirkender nicht möglich gewesen. Vor allem die Bereitstellung und Neuerstellung der zahlreichen Piktogramme auf der zweiten Seite der Aufklärungsbögen war eine Mammutaufgabe. Annette Kitzinger hat mit METACOM eine beeindruckende Symbolsammlung für die Unterstützte Kommunikation entwickelt, von der wir hier profitieren konnten. Frau Prof. Andrea Erdélyi von der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg stand uns mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich der Unterstützen Kommunikation mit ihrem hilfreichen Rat zur Seite. In monatelanger Arbeit hat Niklas Tibbe aus dem Methodenzentrum Unterstützte Kommunikation (MEZUK) schließlich die Zuordnungen der Piktogramme auf den Bögen vorgenommen. Mareik Müller-Cleve hat die Piktogramme in der 2. Auflage ergänz. Wir bedanken uns aufs Herzlichste bei allen Beteiligten für dieses großartige Ergebnis, das Sie als Nutzerin und Nutzer nun in den Händen halten.
Bedanken möchten wir uns auch beim Hogrefe-Verlag. Unsere direkten Ansprechpartnerinnen, Frau Susanne Ristea und Frau Sybille Khoumeri, waren vom ersten Tag an begeistert und haben uns intensiv durch die Zeit begleitet. Wir sind sehr glücklich, dass dieses Projekt durch die Unterstützung des Verlages verwirklicht werden konnte. Des Weiteren wurden wir großzügig von der Stiftung Bethel unterstützt, wofür wir ebenfalls sehr dankbar sind.
Ein großer Dank gilt allen Beteiligten, die aktiv mitgestaltet haben. Hier möchten wir die Prüfgruppen mit ihren Prüferinnen und Prüfern, die Verfasserinnen und Verfasser der Beiträge und natürlich alle, die Bögen entworfen, entwickelt, erstellt und korrigiert haben, nennen. Dieses Projekt hat uns viele Monate begleitet. Nun freuen wir uns über das Ergebnis und hoffen, dass Sie als Leserinnen und Leser davon profitieren können.
Tanja Sappok
Reinhard Burtscher
Anja Grimmer
|11|Vorwort zur 2. Auflage
Liebe Leserinnen und Leser,
als Herausgeberinnen und Herausgeber freuen wir uns über die Resonanz, die wir zur ersten Ausgabe erhalten haben. Inzwischen sind vier Jahre vergangen. Wir stellen fest, dass das Bewusstsein um verständliche Kommunikation im Gesundheitssystem steigt. Einfach sprechen über Gesundheit und Krankheit wird zunehmend als eine wichtige Dienstleistung anerkannt. Die vorliegenden medizinischen Aufklärungsbögen in Leichter Sprache helfen dabei, die passenden Worte zu finden. Sie dienen als ein Werkzeug, das variabel eingesetzt werden kann. Verständliche Sprache vollzieht sich nicht im Einhalten vorgegebener Regelwerke, Sätze oder Textbausteine, sondern passt sich individuell an den Bedürfnissen des Menschen an. Insofern ermutigen wir zu einem erfindungsreichen Gebrauch der Vorlagen. Das aktive Feedback ist eine einfache Methode, um sicherzustellen, dass man richtig verstanden wurde. Dies kann durch direkte Fragen oder durch Beobachtung der Reaktionen und Körpersprache der Gesprächsperson erfolgen.
Die vorliegenden Aufklärungsbögen sind überarbeitet und mit einigen Ergänzungen erweitert worden. Rückmeldungen von Leserinnen und Leser waren ein nützliches Korrektiv. Wenn es um verständliche Sprache geht, dann sehen wir, dass zunehmend KI-Tools eingesetzt werden. Eine aktuelle Bewertung von 12 Sprachprofis ergibt, dass sie „den Nutzen und das Potenzial von KI-Tools für Einfache Sprache [erkennen].“ Gleichzeitig betonen Sie die „Notwendigkeit menschlicher Expertise“1.
Eine Orientierungshilfe für die Praxis liefern zwei DIN Normen, die im Jahr 2023 und 2024 veröffentlicht wurden. Es handelt sich um
DIN ISO 24495-1. Einfache Sprache - Teil 1: Grundsätze und Leitlinien (ISO 24495-1:2023)
DIN 8581-1. Einfache Sprache - Anwendung für das Deutsche - Teil 1: Sprachspezifische Festlegungen.
Beide Normen setzten Standards, die helfen, verständliche Texte für verschiedenste Zielgruppen zu verfassen. Aus der Perspektive der Behindertenpädagogik ist längst klar: Einfache Sprache ist nicht nur ein Thema für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Einfache Sprache ist überall dort sinnvoll, wo unterschiedliche Gruppen, Milieus und Kulturen aufeinandertreffen. Unser Buch kann daher auch bei weiteren Zielgruppen eingesetzt werden, z. B. Personen mit nichtdeutscher Muttersprache, älteren Menschen, Kindern oder krankheitsbedingt eingeschränkten Personen.
Als Herausgeberinnen und Herausgeber hoffen wir, dass dieses Buch Ihnen neue Impulse liefert und Sie dazu inspiriert, sich aktiv um verständliche Sprache zu bemühen. Sprache lebt davon, dass sie aktiv genutzt, weiterentwickelt und angepasst wird. Wie bei der ersten Ausgabe nehmen wir gerne Ihre neuen Anregungen zu dieser 2. Auflage entgegen.
Tanja Sappok, Reinhard Burtscher, Anja Grimmer
Berlin im Oktober 2024
KI-Tools für Einfache Sprache. Ein Fazit von 12 Sprachprofis. Online unter: https://multisprech.org/2024/06/20/ki-tools-fuer-einfache-sprache-ein-fazit-von-12-sprachprofis/ Abrufdatum: 13. Okt. 2024.
|13|Teil 1
|15|1 Besonderheiten in der Diagnostik und Behandlung von Menschen mit Störungen der Intelligenzentwicklung
Tanja Sappok, Reinhard Burtscher und Anja Grimmer
Menschen mit Störungen der Intelligenzentwicklung werden häufiger krank als die Allgemeinbevölkerung. Neben psychischen Erkrankungen treten körperliche Erkrankungen vermehrt auf, z. B. Epilepsien, Skoliosen, Zerebralparesen, gastrointestinale und metabolische Störungen wie Obstipation, Übergewicht oder Hyperlipidämie (Cooper, Smiley, Morrison, Williamson & Allan, 2007; Robertson, Hatton, Emerson & Baines, 2015; Tyler, Schramm, Karafa, Tang & Jain, 2010; Traci, Seekins, Szali-Petree & Ravesloot, 2002; Franke, Heinrich, Adam, Sünkel, Diefenbacher & Sappok, 2018). Mit den körperlichen Krankheiten sind häufig chronische Schmerzen verbunden, die oft nur unzureichend erkannt und behandelt werden (Walsh, Morrison & McGuire, 2011; Engel & Kartin, 2006; Martin, 2017). Aufgrund der damit verbundenen Beeinträchtigung der Lebensqualität ist eine umfassende Schmerzdiagnostik unabdingbar (Carr & Owen-Deschryver, 2007; Walsh et al., 2011; Walter-Fränkel, 2018). Der Gesundheitszustand ist also insgesamt schlechter und der Zugang zur medizinischen Grundversorgung erschwert (Havercamp, Scandline & Roth, 2004; Cooper, Melville & Morrison, 2004).
1.1 Besondere Bedingungen
Entsprechend der UN-Behindertenkonvention haben Menschen mit Behinderungen ein Recht auf ein Höchstmaß an Gesundheit und sollten aktiv in den Behandlungsprozess mit einbezogen werden (United Nations, 2006). Dies ist jedoch aufgrund ungünstiger Ausgangs- und Rahmenbedingungen häufig erschwert:
Die Anamnese- und Befunderhebung ist durch die reduzierten kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten häufig beeinträchtigt. Das betrifft nicht nur den eigentlichen Bericht über die Beschwerden und den Verlauf an sich. Häufig werden auch Fehlinformationen durch die hohe Suggestibilität oder aus dem Bedürfnis heraus, dem Fragenden eine erwünschte Antwort zu liefern, gegeben.
Die medizinische Krankengeschichte ist oft unvollständig.
Standardisierte Untersuchungsinstrumente z. B. zur Demenz- oder Autismusdiagnostik können häufig nicht eingesetzt und müssen spezifisch angepasst werden.
Krankheitsbilder und mit der Behinderung verbundene Einschränkungen können sich überlagern und sind zum Teil nur schwer zu differenzieren.
Krankheitsbilder und -verläufe weichen oftmals von denen der Menschen ohne Behinderung ab.
Beschwerden können aufgrund der reduzierten Ausdrucksmöglichkeit nicht mitgeteilt werden, was zum sogenannten „underreporting“ führt.
Alle denkbaren körperlichen Erkrankungen können sich im Gewand einer psychischen Störung oder Verhaltensauffälligkeit präsentieren.
Auffällige Verhaltensmuster werden unter Umständen als zur intellektuellen Behinderung gehörend erachtet. Dieses von Reiss 1983 beschriebene Phänomen heißt „diagnostic overshadowing“ (Reiss & Szyszko, 1983).
Durch die oft eingeschränkten sozialen Fähigkeiten präsentieren sich psychiatrische Symptome ggf. anders als üblich. Das wird auch als „psychosocial masking“ bezeichnet.
Einströmende Reize können unter Umständen nicht in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden: „cognitive disintegration“.
Die Introspektions- und Reflexionsfähigkeiten sind reduziert.
|16|Körperliche Erkrankungen wie z. B. Spastiken, Skoliosen, Osteoporose oder Epilepsie beeinträchtigen den Einsatz gängiger Coping-Strategien.
Verschiedene häufige Krankheitsbilder wie z. B. Autismus oder Syndrom-assoziierte psychische und körperliche Besonderheiten sind nicht regelhafter Bestandteil in der ärztlichen, pflegerischen oder therapeutischen Ausbildung und werden unter Umständen nicht erkannt.
Erschwerend kommt hinzu, dass die sozialen Ressourcen und Belastungen vielfach anders sind, da die Beziehungen meist geprägt sind von professionellem Personal und fremdbestimmten Strukturen sowie Institutionen. Auch sozioökonomische Faktoren spielen eine wichtige Rolle (Richter & Hurrelmann, 2016). Diese besonderen Bedingungen erfordern eine komplexe, spezialisierte, fachkompetente Beurteilung und Behandlung. Diagnostische Wege und therapeutisches Handeln in der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen müssen in vielen Punkten auf die besonderen Bedarfslagen angepasst werden:
Die Zugangswege sollten barrierefrei gestaltet sein.
Die im Gesundheitssystem Tätigen brauchen eine besondere Ausbildung, z. B. in Hinblick auf genetische Syndrome oder seltene Krankheitsbilder.
Der Behandlungsprozess muss interdisziplinär gestaltet werden.
Die sorgfältige Anamnese sowie die psychische wie körperliche Befunderhebung sind zentral.
Der Umgang und die Kommunikation müssen dem Grad der intellektuellen und sozioemotionalen Entwicklung angepasst werden.
Dabei sollten die zentralen Bezugspersonen aus den verschiedenen Lebensbereichen Wohnen, Arbeit, Freizeit und Familie einbezogen werden. Sie können nicht nur wichtige Informationen liefern, sondern auch quasi als „Übersetzer*innen“ dienen und die besonderen Ausdrucksweisen der Patient*innen erklären.
1.2 Untersuchungsinstrumente und Leitlinien
Körperliche und psychische Erkrankungen werden nach denselben Grundsätzen behandelt wie bei Menschen ohne Behinderung. Bei der ärztlichen Vorstellung ist das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell die Grundlage. Basierend auf dem emotionalen und kognitiven Entwicklungsstand werden gezeigte Verhaltensweisen versteh- und international gebräuchliche Diagnosesysteme anwendbar (Gardner, Dosen & Griffiths, 2006; NICE Guideline, 2015 und 2016; Häßler, 2014; Canadian Consensus Guidelines, 2018; Sappok & Diefenbacher, 2017; Sappok, Diefenbach & Winterholler, 2019). Die emotionale Entwicklungsdiagnostik gibt Einblicke in das innere Erleben und die Mentalisierungsfähigkeiten der Patient*innen (Sappok & Zepperitz, 2018). Mit Hilfe einer Verhaltensanalyse können gezeigte Verhaltensweisen systematisch erfasst und ausgewertet werden (Bienstein & Werner, 2018; Sappok & Feuerherd, 2018). Standardisierte, spezifisch für Menschen mit Störungen der Intelligenzentwicklung entwickelte oder angepasste Untersuchungsinstrumente ermöglichen eine fachgerechte Abklärung einzelner Krankheitsbilder, z. B. mit Hilfe des Diagnostischen Beobachtungsbogens für Autismus-Spektrum-Störungen – Revidiert (DIBAS-R) (Sappok et al., 2015) für Autismus oder mit Hilfe der Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostik (SEED) (Sappok, Zepperitz, Barrett & Došen, 2018) für die emotionale Entwicklungsdiagnostik. Komplexe Störungsbilder, z. B. Schmerzen, Autismus oder Demenzen sollten interdisziplinär im Rahmen von Fallkonferenzen abgeklärt und die medizinische und psychosoziale Behandlung koordiniert werden (Bergmann, Diefenbacher, Heinrich, Riedel & Sappok, 2016; Walter-Fränkel, 2018; Kruse, Müller & Sappok, 2019).
Spezifische Aspekte für die Behandlung psychischer Erkrankungen sind in verschiedenen Leitlinien beschrieben, z. B. in den NICE Guidelines 54 und 11 (NICE Guideline, 2015 und 2016), den S2k-AWMF-Leitlinien (Häßler, 2014), den kanadischen Leitlinien (Canadian Consensus Guidelines, 2018) oder den Praxisleitlinien der Sektion “Psychiatry of Intellectual Disability” der World Psychiatry Association (WPA; Gardner et al. 2006; deutsche Version vgl. Seidel, 2012). Im deutschen Sprachraum gibt es für psychische Krankheitsbilder und den emotionalen Entwicklungsansatz spezifische Fachliteratur (Sappok, 2023; Schanze, 2013; Sappok & Zepperitz, 2019).
Gemeinsam mit den Patient*innen und dem Helfersystem wird ein bedarfsgerechter, zielorientierter Gesamtbehandlungsplan erarbeitet, der die unterschiedlichen Störungsebenen (bio-psycho-sozial) einbezieht und sich am kognitiven und emotionalen Entwicklungsstand der Patient*innen orientiert. Dabei werden die Patient*innen als kompetente, in ihre Umgebung eng verflochtene Personen betrachtet. Das medizinische Konzept ist geprägt von einem ganzheitlichen und individuellen Ansatz, der die Menschen in ihren jeweiligen Lebensbezügen sieht. Besonderheiten bei der Pharmakotherapie wie die erhöhte Nebenwirkungsrate sind zu beachten. Bei den Entscheidungen zu Fragen |17|der Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Ausstattung mit orthopädischen und Reha-Hilfsmitteln sind die Lebensbedingungen und individuellen Bedarfe zu berücksichtigen. Nicht-medikamentöse Therapiemöglichkeiten sollten ausgeschöpft bzw. ergänzend zur psychopharmakologischen Behandlung angewandt werden. Psychotherapeutische Ansätze wie z. B. die Dialektisch Behaviorale Therapie (DBToP) oder Tokenkonzepte können – an die Lerngeschwindigkeit angepasst – angewandt werden (Barrett, 2018; Sappok & Feuerherd, 2018). Bei Menschen mit schwerer intellektueller Beeinträchtigung sind pädagogische und entwicklungsbasierte Methoden vielversprechend (Sappok & Zepperitz, 2018; Sappok, 2018).
1.3 Ziele der Materialsammlung
Diese Materialsammlung verfolgt das Ziel, die medizinische Behandlung und Beratung von Menschen mit Lernschwierigkeiten zu verbessern, indem die Betroffenen in einer Form aufgeklärt und begleitet werden, die ihren individuellen Bedürfnissen und Ressourcen entspricht. Je schwerer der Grad der kognitiven Beeinträchtigung, desto schwieriger gestaltet sich die Planung und Durchführung von notwendigen ärztlichen (Routine-)Maßnahmen, wie z. B. einer Blutabnahme oder einer Röntgenuntersuchung. Aufklärungen über Medikamente sind meist sehr unübersichtlich gestaltet und entsprechen nicht den Bedürfnissen der Nutzer*innen, sodass die Informationen nur schwer vermittelbar sind und damit die Entscheidungsgrundlage für oder gegen eine bestimmte Behandlung fehlt. Diesem Bedarf möchten wir mit der hier vorliegenden Sammlung von Aufklärungsbögen in Leichter Sprache entsprechen. Die Materialien können als Informationsquelle schon vor dem Besuch bei der Ärzt*in oder Therapeut*in genutzt werden, aber auch in ärztlichen Visiten und Therapieeinheiten als gemeinsame Gesprächsgrundlage zum Einsatz kommen. Sie sollten NICHT einfach der Nutzer*in oder der Betreuer*in in die Hand gedrückt werden. Sie ersetzen NICHT rechtlich bindende Aufklärungs- oder Einverständnisbögen für bestimmte Behandlungen. Diese Sammlung kann die Kommunikation über bestimmte Themen erleichtern, die häufig angstbesetzt sind. Sie können eine Inspirationsquelle für medizinisches, therapeutisches und pädagogisches Fachpersonal sein, um besser und professioneller mit Menschen mit Lernschwierigkeiten über Ihre gesundheitlichen Belange ins Gespräch zu kommen. Umgekehrt können sich Personen mit Behinderungen mit Hilfe der Materialien auch über verschiedene Gesundheitsthemen selbst informieren. Die folgenden Kapitel über die Herausforderungen einer gelungenen medizinischen Behandlung aus der Perspektive der unterschiedlichen Akteure im Gesundheitswesen, insbesondere aber auch der Nutzer*innen selbst, sollen Einblicke in die verschiedenen Sichtweisen und Bedarfe geben.
Praxishinweise für die gelungene Arzt-Patienten-Kommunikation (Sappok, Diefenbacher & Winterholler, 2019)
Verwenden Sie kurze Sätze ohne Nebensätze.
Verwenden Sie von der Patient*in gebrauchte Worte bzw. Formulierungen.
Beziehen Sie die Bezugspersonen als „Übersetzer*in“ ein.
Vermeiden Sie Fremdworte, Metaphern, Ironie und Verneinungen (sagen Sie z. B. „leise sprechen“ anstelle von „nicht schreien“).
Prüfen Sie nach, ob Sie verstanden wurden, indem Sie die Patient*in bitten, das Gesagte in eigenen Worten zu wiederholen.
Arbeiten Sie mit Bildern oder Gegenständen zur Veranschaulichung.
Machen Sie vor, wie Sie die Patient*in untersuchen.
Beziehen Sie die Patient*in mit ein (z. B. Kuscheltier verarzten, selbst abhören).
Lassen Sie Untersuchungen vorab durch Bezugspersonen vorbereiten und einüben, z. B. Blutentnahmen, Blutdruckmessungen oder EKG- bzw. EEG-Ableitungen, indem sie im gewohnten Lebensumfeld die Patient*in mit den dafür nötigen Materialien oder Abläufen vertraut machen.
Literatur
Barrett, B. (2018). Dialektisch behaviorale Therapie. In T.Sappok (Hrsg.), Co-Production: Ein Lehrbuch zur psychischen Gesundheit bei intellektueller Entwicklungsstörung. Stuttgart: Kohlhammer.
Bergmann, T., Diefenbacher, A., Heinrich, M., Riedel, A. & Sappok, T. (2016). Perspektivenverschränkung: Multiprofessionelle Autismusdiagnostik bei erwachsenen Menschen mit Intelligenzminderung. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 64(4), 257–267. Crossref
Bienstein, P. & Werner, N. (2018). Verhaltensanalyse. In T.Sappok (Hrsg.), Co-Production: Ein Lehrbuch zur psychischen Gesundheit bei intellektueller Entwicklungsstörung.Stuttgart: Kohlhammer.
Carr, E. G. & Owen-Deschryver, J. S. (2007). Physical illness, pain, and problem behavior in minimally verbal people with developmental disabilities. J Autism Dev Disord, 37(3), 413–24. Crossref
|18|Cooper, S. A., Melville, C. & Morrison, J. (2004). People with intellectual disabilities. BMJ, 329, 414–415. Crossref
Cooper, S. A., Smiley, E., Morrison, J., Williamson, A. & Allan, L. (2007). Mental ill-health in adults with intellectual disabilities: prevalence and associated factors. Br J Psychiatry, 190, 27–35. Crossref
Canadian Consensus Guidelines. (2018). Primary care of adults with developmental disabilities. Can Fam Physician, 64(4), 254–279.
Engel, J. M. & Kartin, D. (2006). Pain in individuals with cerebral palsy. In T. F.Oberlander &F. J.Symons (Eds.), Pain in children & adults with developmental disabilities (pp. 109–119). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing.
Franke, M. L., Heinrich, M., Adam, M., Sünkel, U., Diefenbacher, A. & Sappok, T. (2018). Körpergewicht und psychische Erkrankungen – Ergebnisse einer klinisch- psychiatrischen Querschnittsanalyse bei Menschen mit Intelligenzminderung. Der Nervenarzt, 89(5), 552–558. Crossref
Gardner, W. I., Dosen, A. & Griffiths, D. M. (2006). Practice guidelines for diagnostic, treatment and related support services for people with developmental disabilities and serious behavioral problems. New York: NADD Press.
Häßler, F. (2014). S2k Praxisleitlinie Intelligenzminderung (AWMF-Register Nr. 028–042). Zugriff am 6.7.2020 unter https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-042l_S2k_Intelligenzminderung_2021-09.pdf
Havercamp, S. M., Scandline, D. & Roth, M. (2004). Health disparities among adults with developmental disabilities, adults with other disabilities, and adults not reporting disability in North Carolina. Public Health Rep, 119, 418–426. Crossref
Kruse, B., Müller, S. V. & Sappok, T. (2019). Demenz bei Menschen mit geistiger Behinderung. NeuroTransmitter, 30(3), 37–43. Crossref
Martin, P. (2017). Pain in Rett syndrome: peculiarities in pain processing and expression, liability to pain causing disorders and diseases, and specific aspects of pain assessment. Adv in Autism, 3(3), 163–182. Crossref
NICE Guideline. (2015). Challenging behavior and learning disabilities: prevention and interventions for people with learning disabilities whose behavior challenges. Zugriff am 8.2.2020 unter https://www.nice.org.uk/guidance/ng11
NICE Guideline. (2016). Mental health problems in people with learning disabilities: prevention, assessment and management. Zugriff am 8.2.2020 unter https://www.nice.org.uk/guidance/ng54
Reiss, S. & Szyszko, J. (1983). Diagnostic overshadowing and professional experience with mentally retarded persons. Am J Ment Defic, 87, 396–402.
Richter, M. & Hurrelmann, K. (Hrsg.). (2016). Soziologie von Gesundheit und Krankheit. Wiesbaden: Springer VS. Crossref
Robertson, J., Hatton, C., Emerson, E. & Baines, S. (2015). Prevalence of epilepsy among people with intellectual disabilities: A systematic review. Seizure, 29, 46–62. Crossref
Sappok, T. (Hrsg.). (2023). Co-Production: Ein Lehrbuch zur psychischen Gesundheit bei Störungen der Intelligenzentwicklung (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
Sappok, T. & Diefenbacher, A. (Hrsg.). (2017). Die 4. Dimension: Erweiterung des bio-psycho-sozialen Krankheitsmodells um die emotionale Entwicklungskomponente bei Menschen mit geistiger Behinderung. Bielefeld: Bethel Verlag.
Sappok, T., Diefenbacher, A. & Winterholler, M. (2019). Medizinische Versorgung von Menschen mit Intelligenzminderung. Deutsches Ärzteblatt, 116, 809–816.
Sappok, T. & Feuerherd, C. (2018). Red flags für die psychiatrische Vorstellung. In H.Schäfer &L.Mohr (Hrsg.), Psychische Störungen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (S. 185–196). Weinheim: Beltz Verlag.
Sappok, T., Gaul, I., Bergmann, T., Dziobek, I., Bölte, S., Diefenbacher, A. & Heinrich, M. (2015). DiBAS-R Der Diagnostische Beobachtungsbogen für Autismus-Spektrum-Störungen – Revidiert. Ein Screening-Instrument für Erwachsene mit Intelligenzminderung. Bern: Hogrefe.
Sappok, T. & Zepperitz, S. (2018). Emotionale Entwicklung als Schlüssel zum Verständnis von Verhalten bei Personen mit geistiger Behinderung. Behinderte Menschen, 1, 47–52.
Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). Das Alter der Gefühle − über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.
Sappok, T., Zepperitz, S., Barrett, B. F. & Došen, A. (2018). Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostik (SEED). Bern: Hogrefe.
Schanze, C. (Hrsg.). (2013). Psychiatrische Diagnostik und Therapie bei Menschen mit Intelligenzminderung (2. Aufl.). Stuttgart: Schattauer Verlag.
Seidel, M. (2012). Problemverhalten bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung. Eine internationale Leitlinie zum Einsatz von Psychopharmaka. Materialien der DGBSB Band 26. Zugriff am 8.2.2020 unter https://dgsgb.de/downloads/materialien/Band26.pdf
Traci, M. A., Seekins, T., Szali-Petree, A. & Ravesloot, C. (2002). Assessing secondary conditions among adults with developmental disabilities: A preliminary study. Mental Retardation, 40, 119–131. Crossref
Tyler, C. V., Schramm, S., Karafa, M., Tang, A. S., Jain, A. (2010). Electronic Health Record analysis of the primary care of adults with intellectual and other developmental disabilities. J Policy Pract Intellect Disabil, 3, 204–210. Crossref
United Nations. (2006). UN-Behindertenrechtskonvention. Zugriff am 8.2.2020 unter http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcfinalrepe.htm
Walsh, M., Morrison, T. G. & McGuire, B. E. (2011). Chronic pain in adults with an intellectual disability: Prevalence, impact, and health service use based on caregiver report. Pain, 152(9), 1951–1957. Crossref
Walter-Fränkel. (2018). Schmerzdiagnostik. In T.Sappok (Hrsg.), Co-Production: Ein Lehrbuch zur psychischen Gesundheit bei intellektueller Entwicklungsstörung. Stuttgart: Kohlhammer.
|19|2 Herausforderungen einer medizinischen Behandlung aus Sicht der Nutzer*innen und Anbieter*innen
In den folgenden Kapiteln werden die Herausforderungen, aber auch die Lösungsansätze für eine gute Gesundheitsversorgung von Menschen mit Lernschwierigkeiten aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Als Herausgeberteam beziehen wir viele verschiedene Akteur*innen ein und entwerfen ein vielschichtiges Bild der Gesundheitsversorgung. Wir freuten uns über die insgesamt große Bereitschaft der angesprochenen Autor*innen, deren Beiträge im Folgenden zu lesen sind. Die Kapitel stellen dabei die subjektive Perspektive der jeweiligen Autor*innen dar. Als Herausgeberteam hielten wir uns beim Lektorieren zurück, um die Vielstimmigkeit und den unterschiedlichen Duktus der einzelnen Beiträge beizubehalten. Wir hoffen, damit ein möglichst authentisches Bild eines komplexen Gefüges darstellen zu können.
2.1 Die Perspektive der Nutzer*innen: Erfahrungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten in der Gesundheitsversorgung
Germaine Köchling und Anna-Maria Biendarra
Menschen mit Lernschwierigkeiten sind in Relation zu Menschen ohne Lernschwierigkeiten in einem höheren Maße gesundheitlich belastet (BMAS, 2016): ,,In wie vielen Praxen, Krankenhäusern und anderen stationären Einrichtungen der gesundheitlichen Versorgung Informationen in leichter Sprache vorliegen oder mündlich kommuniziert werden […], ist nicht bekannt.‘‘ Und obwohl ein erhöhter Versorgungsbedarf bei Menschen mit Lernschwierigkeiten signifikant vorhanden ist, ist die gesundheitliche Versorgung dieses Personenkreises erheblich schlechter als die der Durchschnittsbevölkerung (Bössing, Schrooten & Tiesmeyer, 2019). In einer Studie der Universität Witten/Herdecke wurden 181 Menschen mit Lernschwierigkeiten in Werkstätten verschiedener Städte in Nordrhein-Westfalen sowie deren Angehörige und Betreuer*innen zu der medizinischen Versorgung befragt (Schwalen & Geraedts, 2017). Hierbei werden als Versorgungsbarrieren von den Befragten häufig Kommunikationsschwierigkeiten und Ängste benannt, welche die Versorgung hemmen. Solche Erhebungen zeigen umso mehr, wie wichtig es ist, Informationen für Menschen mit Lernschwierigkeiten in Leichter Sprache zugänglich zu machen.
Im Rahmen des Projektes „Prüfgruppe für medizinische Aufklärungsbögen‘‘ wurden fünf Prüfer des Trägers Bastille – Gemeinsam sind wir stark e. V. von Studierenden der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin zu ihren Erfahrungen in der Gesundheitsversorgung befragt (vgl. Kap. 3). Bastille – Gemeinsam sind wir stark e. V. ist ein Träger der Behindertenhilfe in Berlin Friedrichshain und betreut Menschen mit Lernschwierigkeiten in drei Wohngemeinschaften und im Betreuten Einzelwohnen. Das Betreuungsangebot richtet sich an junge erwachsene Menschen mit intellektueller, körperlicher, seelischer oder mehrfacher Behinderung. Den Schwerpunkt der Betreuungsarbeit bildet die individuelle Beratung und Begleitung von Menschen mit Lernschwierigkeiten in psychosozialen sowie alltagspraktischen Bereichen.
Die Prüfer benennen unterschiedliche Herausforderungen und positive sowie negative Erfahrungen, welche sie bisher in der Gesundheitsversorgung erfahren haben.
Tim Schimpf berichtet von einem Besuch mit seinem Betreuer bei einem Dermatologen:
„Der Arzt hat gar nicht mit mir gesprochen, sondern nur mit meinem Betreuer.“
|20|Trotz wiederholter Aufforderung seitens des Betreuers, den Klienten in das Gespräch einzubeziehen, wende sich der Arzt ausschließlich dem Betreuer zu. Tim Schimpf:
„Sechsmal hat mein Betreuer gesagt, er soll mit mir reden.“
Tim äußert sich zudem zu seinen Erfahrungen bei der Suche nach einem Therapieplatz:
„Die Suche ist voll schwierig und frustrierend, weil es schwer ist, jemanden zu finden.“
Die Besuche bei seinem Hausarzt bewertet er hingegen als positiv:
„Da fühle ich mich ernst genommen.“
Vincent Martinez ist in psychotherapeutischer Behandlung und benennt Folgendes:
„Meine Therapie ist mir wichtig. Mein Therapeut hört mir zu.“
Alexander Moritz erzählt von einem Besuch bei einem Neurologen:
„Der Arzt hat mir gar nicht zugehört und mir nichts erklärt. Da kann man sich doch nicht ernst genommen fühlen. Jetzt habe ich gewechselt und bin zufrieden.“





























