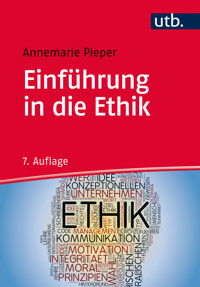
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Annemarie Piepers bewährte Einführung stellt die verschiedenen Disziplinen der Ethik, ihre Bezüge zu anderen Wissenschaften sowie die Grundfragen und argumentativen Grundformen der Ethik vor, erläutert und kommentiert sie. Bereits in der 6. Auflage dieses Standardwerks kamen Kapitel zur Biologie sowie zum körperbewussten und zum lebensweltlichen Ansatz hinzu. Das Kapitel zur Wertethik wurde um eine kommentierte Wertetafel ergänzt. Für die 7. Auflage wurden die Ausführungen zur Bioethik, zur Medienethik und zum Moralischen Realismus ergänzt sowie das Literaturverzeichnis auf den neuesten Stand gebracht. "Piepers Einführung in die Ethik ist außerordentlich klar und verständlich, umfassend und aktuell. Nach meiner Einschätzung handelt es sich um die derzeit beste einführende Darstellung der Moralphilosophie." E. Hilgendorf Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Annemarie Pieper
Einführung in die Ethik
7., aktualisierte Auflage
A. Francke Verlag Tübingen
© 2017 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-8463-4696-9
Inhalt
Vorwort
Die erste Auflage dieses Buches erschien 1985 unter dem Titel »Ethik und Moral. Eine Einführung in die praktische Philosophie« im BeckBeck, L.W. Verlag (München). Der Text basiert auf dem dreiteiligen Kurs »Einführung in die philosophische Ethik«, den ich 1979/80 im Auftrag der Fernuniversität Hagen für Studierende der Erziehungswissenschaften erarbeitet hatte. Die zweite, gründlich überarbeitete und erweiterte Auflage, die der Entwicklung der Ethik seit 1985 Rechnung trug, erschien 1991 im Francke Verlag (Tübingen und Basel) unter dem Titel »Einführung in die Ethik«. Die dritte Auflage, in welcher das Literaturverzeichnis auf den neuesten Stand gebracht wurde, kam 1994 heraus. Die vierte Auflage (1999) wurde wiederum durchgehend aktualisiert und vor allem in den Kapiteln 2.5, 3.2.1, 3.3.2 und 8. ergänzt. Für die 5. Auflage (2003) wurde Kapitel 7 ergänzt und das Literaturverzeichnis aktualisiert. Die 6. Auflage trug neueren Diskussionsschwerpunkten in der Ethik Rechnung. Entsprechend kamen die Kapitel 3.1.3 (Biologie), 7.2.4 (Der körperbewusste Ansatz) und 7.3.7 (Der lebensweltliche Ansatz) neu hinzu. Ergänzt wurde Kapitel 7.2.1 um eine kommentierte Wertetafel. Schließlich wurde das Literaturverzeichnis auf den neuesten Stand gebracht. Für die siebte Auflage wurden die Ausführungen zur Bioethik, zur Medienethik und zum Moralischen Realismus ergänzt sowie das Literaturverzeichnis aktualisiert.
Basel, im März 2017 Annemarie Pieper
Einleitung
Im Mittelpunkt unserer Überlegungen stehen drei Fragenbereiche:
Womit hat es die Ethik als philosophische Disziplin zu tun? Was ist ihr Gegenstand?
In welcher Weise beschäftigt sie sich mit diesem Gegenstand? Bildet sie methodische Verfahren aus, die dazu berechtigen, von der Ethik als einer Wissenschaft zu sprechen? Oder steht sie auf einer Stufe mit Weltanschauungen und Ideologien, die keine allgemeine VerbindlichkeitVerbindlichkeit beanspruchen können?
Worum geht es der Ethik letztendlich? Was ist ihr Ziel?
Vorab lassen sich noch ohne nähere Begründung folgende Antworten auf diese Fragen skizzieren:
Die Ethik hat es mit menschlichen HandlungenHandeln/Handlung zu tun. Dennoch ist sie keine Handlungstheorie schlechthin, denn ihr geht es vorrangig um solche Handlungen, die Anspruch auf Moralität erheben, um moralische Handlungen also. Sie fragt nach diesem qualitativen Moment, das eine Handlung zu einer moralisch guten Handlung macht, und befasst sich in diesem Zusammenhang mit Begriffen wie Moral, das GuteGute, das, PflichtPflicht, SollenSollen, Erlaubnis, Glück u.a.
Zu 2.Die Ethik beschäftigt sich auf methodische Weise mit ihrem Gegenstand – mit moralischen HandlungenHandeln/Handlungenmoralische(s) –, da sie zu argumentativ begründeten Ergebnissen gelangen will und somit weder moralisieren noch ideologisieren oder weltanschauliche Überzeugungen als allgemein verbindliche Handlungsgrundlage verkünden darf. Ihr ist es demnach um Aussagen zu tun, die nicht bloß subjektiv gültig, sondern als intersubjektiv verbindlich ausweisbar sind.
Man unterscheidet in der Ethik grob zwei Kategorien von ethischen MethodenMethodeBegriff der: deskriptive und normative Methode. Die deskriptive Methode ist ein beschreibendes Vorgehen: Es werden die faktischen Handlungs- und Verhaltensweisen in einer bestimmten Gesellschaft oder Gemeinschaft daraufhin untersucht, welche Wertvorstellungen und Geltungsansprüche in ihnen wirksam sind. Diese bilden den in der untersuchten Handlungsgemeinschaft geltenden, d.h. die dort übliche PraxisPraxis ebenso wie die Urteile über diese PraxisPraxis leitenden MoralkodexMoralkodex, dessen Verbindlichkeit von den meisten Mitgliedern dieser Gemeinschaft anerkannt ist. Die normative Methode hingegen ist ein präskriptives, ein vorschreibendes Verfahren. Bei dieser Methode ist die Gefahr der Ideologisierung von einem dogmatischen Standpunkt aus naturgemäß viel größer als beim deskriptiven Verfahren, das lediglich konstatiert, was gilt, ohne sich dazu zu äußern, was gelten soll. Aber bekanntlich kann man auch reines Faktenmaterial durch die Art der Auswahl oder die Form der Zusammenstellung so manipulieren, dass bestimmte Werturteile suggeriert werden. Normative Methoden in der Ethik sind nur als kritische Methoden zulässig, d.h. als Methoden, die keine direkten Handlungsanweisungen geben von der Art ›In der Situation Z musst du y tun‹. Vielmehr hat eine normativ verfahrende Ethik Kriterien zu entwickeln, die eine moralische Beurteilung von Handlungen ermöglichen, ohne sie bereits vorwegzunehmen. Diese Beurteilungskriterien müssen ständig hinterfragbar, überprüfbar – eben kritisierbar sein.
Zu 3.Was das Ziel der EthikEthikZiele der anbelangt, so artikuliert sich ihr Interesse in einer Reihe von Teilzielen:
Aufklärung menschlicher PraxisPraxis hinsichtlich ihrer moralischen Qualität;
Einübung in ethische Argumentationsweisen und Begründungsgänge, durch die ein kritisches, von der Moral bestimmtes Selbstbewusstsein entwickelt werden kann;
Hinführung zu der Einsicht, dass moralisches Handeln nicht etwas Beliebiges, Willkürliches ist, das man nach Gutdünken tun oder lassen kann, sondern Ausdruck einer für das Sein als Mensch unverzichtbaren Qualität: der HumanitätHumanität.
Diese Ziele enthalten sowohl ein kognitives Moment als auch ein nicht mehr allein durch kognitive Prozesse zu vermittelndes Moment: das, was man als VerantwortungsbewusstseinVerantwortung oder moralisches EngagementEngagement bezeichnen kann.
Die Grundvoraussetzung jedoch, auf der jede EthikEthik aufbaut, ja aufbauen muss, ist der ›gute WilleWilleguter‹. Guter Wille meint hier die grundsätzliche Bereitschaft, sich nicht nur auf Argumente einzulassen, sondern das als gut Erkannte auch tatsächlich zum Prinzip des eigenen Handelns zu machen und in jeder Einzelhandlung umzusetzen. Wer von vornherein nicht gewillt ist, seinen eigenen Standpunkt in moralischen Angelegenheiten zu problematisieren
sei es, weil er prinzipiell keine anderen Überzeugungen als die eigenen gelten lässt;
sei es, weil er in Vorurteilen verhaftet ist;
sei es, weil er überzeugter Amoralist oder radikaler Skeptiker ist;
sei es, weil er die Verbindlichkeit von moralischen Normen nur für andere, nicht aber für sich selbst anerkennt,
lässt es aus verschiedenen Gründen an gutem Willen fehlen. Mangelnde Offenheit und Aufgeschlossenheit für das Moralische entziehen jeglicher ethischer Verständigung das Fundament. Ethische Überlegungen hätten hier keinen Sinn mehr, so wie z.B. theologische Überlegungen zwar durchaus intellektuell relevant sein mögen, ohne jedoch an ihr eigentliches Ziel zu gelangen, wenn sie nicht zugleich in irgendeiner Form das religiöse Handeln betreffen. Wie niemand durch TheologieTheologie religiös wird, so wird auch niemand durch Ethik moralisch. Gleichwohl vermag die Ethik durch kritische Infragestellung von Handlungsgewohnheiten zur Klärung des moralischen Selbstverständnisses beizutragen. Der Gegenstand der Ethik ist also: moralisches Handeln und Urteilen. Er geht jeden einzelnen, sofern er Mitglied einer Sozietät ist, deren Kommunikations- und Handlungsgemeinschaft er als verantwortungsbewusstes Individuum auf humane Weise mitzugestalten und zu verbessern verpflichtet ist, wesentlich an. Das Leben in einer Gemeinschaft ist regelgeleitet. Die Notwendigkeit von RegelnRegel bedeutet nicht Zwang oder Reglementierung, vielmehr signalisiert sie eine OrdnungOrdnung und Strukturierung von Praxis um der größtmöglichen FreiheitFreiheit aller willen. Ein regelloses Leben ist nicht menschlich. Selbst Robinson auf seiner Insel folgt gewissen, selbst gesetzten RegelnRegel, während der Wolfsmensch RegelnRegel der NaturNatur und damit tierischen Verhaltensmustern folgt.
Moderne Gesellschaften sind gekennzeichnet durch eine Pluralität von weltanschaulichen Standpunkten, privaten Überzeugungen und religiösen Bekenntnissen; hinzu kommt eine rasch fortschreitende soziokulturelle Entwicklung und damit verbunden eine fortgesetzte Veränderung kultureller, ökonomischer, politischer und gesellschaftlicher Zielvorstellungen. Bei dieser zum Teil in sich heterogenen Mannigfaltigkeit ist ein KonsensKonsens über Angelegenheiten der MoralMoral keineswegs mehr selbstverständlich, ja bleibt aufgrund gegensätzlicher InteressenInteresse und BedürfnisseBedürfnis oft sogar aus. Insofern ist eine Verständigung über die Grundsätze der MoralMoral, deren AnerkennungAnerkennung jedermann rational einsichtig gemacht und daher zugemutet werden kann, ebenso unerlässlich wie eine kritische Hinterfragung von faktisch erhobenen moralischen Geltungsansprüchen hinsichtlich ihrer Legitimität.
Eine solche Verständigung über Geltungsansprüche setzt die Einsicht voraus, dass der KonfliktKonflikt zwischen konkurrierenden Forderungen nicht mit GewaltGewalt ausgetragen werden soll, sondern auf der Basis von Vernunft. Keiner soll seine Wünsche uneingeschränkt durchsetzen, was zum KriegKrieg, H. aller gegen alle führt und zu einer Favorisierung der Prinzipien Macht, GewaltGewalt, Tücke, List. Es gilt vielmehr, das moralische Prinzip der AnerkennungAnerkennung von Rechten der anderen, die durch mein Handeln betroffen sind, zu befolgen.
Die doppelte Aufgabe – Analyse und Kritik von Sollensforderungen, die Anspruch auf Moralität erheben – muss jeder einzelne nach Maßgabe seiner Selbstbestimmung in seiner Praxis ständig erneut bewältigen; sie ist gewissermaßen das moralische Rückgrat seiner Geschichte, seiner Biographie. Von jedem einzelnen als Mitglied einer mündigen, aufgeklärten Gemeinschaft wird ein gewisses Maß an moralischer KompetenzKompetenz, moralische und an Verantwortungsbewusstsein erwartet, darüber hinaus die Fähigkeit, diese beiden grundlegenden Aspekte moralischen EngagementsEngagement im Konfliktfall anderen gegenüber kommunikativ bzw. argumentativ zu vermitteln, d.h. sich zu rechtfertigen und sein moralisches EngagementEngagement als unverzichtbare Basis eines kritischen, emanzipativen, für Freiheit und Humanität eintretenden Selbstverständnisses sichtbar zu machen. Dabei handelt es sich nicht um etwas Außergewöhnliches, sondern um ganz alltägliche, selbstverständliche Dinge, so wenn wir für unser Tun zur Rechenschaft gezogen werden, für etwas ein- oder geradestehen müssen, anderen Vorwürfe wegen ihres Verhaltens machen, sie der Verantwortungslosigkeit bezichtigen usf. Die methodisch-systematische Vermittlung der Einsicht in den Sinn moralischen HandelnsHandeln/Handlungmoralische(s) geschieht durch die Ethik. Die Ethik ist jedoch kein Ersatz für moralisches Handeln, sondern erschließt die kognitive Struktur solchen Handelns. Das heißt, indem sie einerseits durch Beschreibung und Analyse moralischer Verhaltensmuster und Grundeinstellungen, andererseits durch methodische Begründung der Gesolltheit moralischer Praxis kritische Maßstäbe zur Beurteilung von Handlungen überhaupt liefert, löst die Ethik den komplexen Bereich moralischen HandelnsHandeln/Handlungmoralische(s) begrifflich auf und macht dessen Strukturen transparent.
Damit werden demjenigen, der sich aus einem Interesse am HandelnHandeln/Handlung und um des Handelns willen mit Ethik beschäftigt, Argumentationsstrategien an die Hand gegeben, vermittels deren er in der Lage ist, moralische Probleme und Konflikte menschlichen Handelns als solche klar zu erfassen, mögliche Lösungsvorschläge zu entwickeln und auf ihre moralischen Konsequenzen hin zu durchdenken sowie sich nach reiflicher Überlegung selbständig »mit guten Gründen« für eine bestimmte Lösung zu entscheiden.
Letzteres ist das eigentliche Ziel der EthikEthikZiele der: die gut begründete moralische Entscheidung als das einsichtig zu machen, was jeder selbst zu erbringen hat und sich von niemandem abnehmen lassen darf – weder von irgendwelchen Autoritäten noch von angeblich kompetenteren Personen (Eltern, Lehrern, Klerikern u.a.). In Sachen Moral ist niemand von Natur aus kompetenter als andere, sondern allenfalls graduell aufgeklärter und daher besser in der Lage, seinen Standort zu finden und kritisch zu bestimmen. Bei diesem Aufklärungsprozess hat die Ethik eine sehr wichtige Funktion: Sie soll nicht bevormunden, vielmehr Wege weisen, wie der einzelne unter anderen Individuen und in Gemeinschaft mit ihnen er selbst werden bzw. sein kann.
1Die Aufgabe der EthikEthikAufgabe der
Die Ethik als eine Disziplin der Philosophie versteht sich als Wissenschaft vom moralischen HandelnHandeln/Handlungmoralische(s). Sie untersucht die menschliche Praxis im Hinblick auf die Bedingungen ihrer MoralitätMoralität/Sittlichkeit und versucht, den Begriff der MoralitätMoralität/Sittlichkeit als sinnvoll auszuweisen. Dabei ist mit Moralität vorerst jene Qualität gemeint, die es erlaubt, eine Handlung als eine moralische, als eine sittlich gute Handlung zu bezeichnen. Heißt dies nun aber, dass Ethik etwas so Elitäres, der Alltagspraxis Enthobenes ist, dass niemand von sich aus, quasi naturwüchsig darauf käme, Ethik zu betreiben? Keineswegs. Ethische Überlegungen sind nicht bloß dem Moralphilosophen oder Ethiker vorbehalten. Vielmehr hat sich jeder in seinem Leben gelegentlich schon mehr oder weniger ausdrücklich ethische Gedanken gemacht, in der Regel jedoch, ohne sie systematisch als eine zusammenhängende Theorie zu entfalten, weil diese Gedanken meist im Zusammenhang mit einer gegebenen Situation, einem bestimmten KonfliktKonflikt sich einstellen, mit dessen Lösung auch das darin steckende ethische Problem erledigt ist. Manchmal ergeben sich Diskussionen allgemeiner Art: Dürfen Politiker sich in Krisensituationen über Moral und Recht hinwegsetzen? Wem nützt es, dass es moralische Normen gibt, wenn keiner sie befolgt? Aber auch in solchen Grundsatzdiskussionen bleiben ethische Fragen oft im Ansatz stecken.
Soviel ist fürs erste deutlich: Ohne moralische Fragen, KonflikteKonflikt, Überzeugungen etc. keine Ethik. Aber wie kommt man zur Moral?
Sobald ein KindKind anfängt, sich seiner Umwelt zu vergewissern, indem es nicht nur rezeptiv wahrnimmt, was um es herum geschieht, sondern zugleich seiner Umgebung seinen Willen aufzuzwingen versucht, macht es die Erfahrung, dass es nicht alles, was es will, auch ungehindert erreicht. Es lernt, dass es Ziele gibt, die unerreichbar sind (z.B. Siebenmeilenstiefel zu haben) oder die zu erreichen nicht wünschenswert ist, weil sie entweder schlimme Folgen haben (z.B. die heiße Kochplatte anzufassen) oder von den Erwachsenen unter Androhung von Strafe verboten werden (z.B. die kleineren Geschwister zu verprügeln). Andere Ziele wiederum (z.B. der Mutter zu helfen) werden durch Lob und Belohnungen ausgezeichnet.
Mit der Zeit lernt das KindKind, zwischen gebotenen (du sollst …), erlaubten (du darfst …) und verbotenen (du sollst nicht …; du darfst nicht …) Zielen zu unterscheiden und diesen Unterschied nicht nur in Bezug auf das, was es selbst unmittelbar will, zu berücksichtigen, sondern auch in seine Beurteilung der Handlungen anderer einzubringen. Es lernt mithin, nicht nur RegelnRegel zu befolgen und nach RegelnRegel zu handeln, sondern auch Handlungen (seine eigenen wie die anderer Menschen) nach RegelnRegel zu beurteilen.
Dieses zentralen Begriffs der RegelRegel bedient sich auch der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean PIAGETPiaget, J., um ›Das moralische Urteil beim Kinde‹ genetisch aufzuklären.
Jede Moral ist ein System von Regeln, und das Wesen jeder Sittlichkeit besteht in der Achtung, welche das Individuum für diese Regeln empfindet. …
Das KindKind empfängt die moralischen Regeln, die es zu beachten lernt, zum größten Teil von den Erwachsenen, d.h. in fertiger Form. (S. 7)
PIAGETPiaget, J. trifft nun eine wichtige Unterscheidung zwischen dem, was er die PraxisPraxis der RegelnRegel einerseits und das Bewusstsein der Regeln andererseits nennt. Das KindKind lernt zunächst die PraxisPraxis der RegelnRegel, indem es den Geboten und Vorschriften, die an es ergehen, gehorcht – so wie es beim Spielen die Spielregeln fraglos befolgt. Die ersten Formen des Pflichtbewusstseins sind demnach gemäß PIAGET im Wesentlichen heteronom (fremdbestimmend, fremdgesetzlich, von griech. heteros – fremd, nomos – Gesetz), weil das KindKind die RegelnRegel als von außen kommende, nicht von ihm selbst gewählte ImperativeImperativ verinnerlicht.
Wir werden als moralischen RealismusRealismus, moralischer die Neigung des Kindes bezeichnen, die Pflichten und die sich auf sie beziehenden Werte als für sich, unabhängig vom Bewusstsein existierend und sich gleichsam obligatorisch aufzwingend, zu betrachten. …
Pflichtmoral ist in ihrer ursprünglichen Form heteronom. Gut sein heißt dem Willen des Erwachsenen gehorchen. Schlecht sein nach seinem eigenen Kopf handeln. (S. 121, 221)
Auf diese Phase frühkindlicher heteronomer Moral folgt nach PIAGETPiaget, J. eine Übergangsphase oder ein Zwischenstadium auf dem Wege zur autonomen Phase der Selbstbestimmung. In dieser Übergangsphase gehorcht das KindKind, wenn es eine Regel befolgt, nicht mehr aus dem Grund, weil die Eltern oder andere Autoritätspersonen es befehlen, sondern weil die RegelRegel es gebietet. Die RegelRegel wird bis zu einem bestimmten Grad verallgemeinert und selbstständig angewendet. Das KindKind gehorcht also jetzt primär der RegelRegel, weil es durch Erfahrung gelernt hat, dass die RegelRegel nicht etwas ist, das nur einseitig dem Machtbereich der Erwachsenen zugehört, sondern Produkt einer gemeinsamen Praxis ist. »Das Gute ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit« (ebd.). Das KindKind betrachtet mithin die RegelRegel nicht mehr als etwas ihm bloß von außen Gegebenes, das mit ihm selbst eigentlich nichts zu tun hat, sondern erkennt sie als für sein Verhalten maßgebliches Orientierungsmuster an.
Auf diese Übergangsphase folgt dann die eigentliche Moral, die mit einem Bewusstsein der RegelnRegel verbunden ist. Dies ist die Stufe der autonomen Moral, auf der das KindKindRegelnRegel kritisch auf ihre Moralität hin zu überprüfen imstande ist.
Damit ein Verhalten als moralisch bezeichnet werden kann, bedarf es mehr als einer äußeren Übereinstimmung seines Inhalts mit dem der allgemein anerkannten Regeln: es gehört auch noch dazu, dass das Bewusstsein nach der Moralität als nach einem autonomen Gut strebt und selbst imstande ist, den Wert der Regeln, die man ihm vorschlägt, zu beurteilen. […]
So folgt eine neue Moral auf die der reinen Pflicht. Die Heteronomie weicht einem Bewusstsein des Guten, dessen AutonomieAutonomie sich aus der Annahme der Normen der Gegenseitigkeit ergibt. (S. 458, 460)
PIAGETPiaget, J. verdeutlicht seine These sehr instruktiv an der GerechtigkeitsvorstellungGerechtigkeit beim KindKind, die anhebt mit einem Verhalten, das auf Vergeltung für angetanes oder vermeintliches Unrecht aus ist, wobei Vergeltung verbunden ist mit dem Wunsch nach Rache und Bestrafung. In der Übergangsphase wird auch noch an der Vorstellung vergeltender GerechtigkeitGerechtigkeit festgehalten, aber ohne den Rache- und Sühnewunsch. Die Vergeltung soll in einer einfachen Wiedergutmachung bestehen. Von dort ist es dann nicht mehr allzu weit bis zur verzeihenden GerechtigkeitGerechtigkeit, die mit Großmut und Nächstenliebe einhergeht.
Was PIAGETPiaget, J. als Psychologe entwicklungsgeschichtlich (genetisch) entfaltet – und zwar auf der Basis von Beobachtungen und BefragungenMethodeBegriff der von KindernKind verschiedener Altersstufen –, bietet reichhaltiges Material für die philosophische Ethik, die, um den Begriff der MoralMoral zureichend reflektieren zu können, erst einmal etwas über den Ursprung der Moral in Erfahrung bringen muss, um den Sinn der Moral bestimmen zu können. Der Mensch lernt also von früh an, dass es in einer Gemeinschaft von Menschen nicht regellos zugeht, sondern dass es RegelnRegel in Form von Geboten, Verboten, Normen, Vorschriften etc. gibt. Die eigentlich moralischeMoral Einsicht besteht jedoch darin, dass solche Regeln nicht als ein von außen auferlegter Zwang aufgefasst werden, sondern als Garanten der größtmöglichen FreiheitFreiheit aller Mitglieder der Handlungsgemeinschaft. Nur eine RegelRegel, die dies gewährleistet, ist eine moralische Regel.
Hand in Hand mit der Erfahrung, dass der Mensch seine Umwelt nicht in jeder Hinsicht so hinnehmen muss, wie sie ist, sondern mit seinem WillenWille in sie eingreifen und sie handelnd verändern kann, geht die Einsicht, dass seinem Wollen und Handeln – und damit seiner FreiheitFreiheit – Grenzen gesetzt sind. Niemand ist in dem Sinne frei, dass er beliebig, d.h. völlig willkürlich tun und lassen kann, was ihm gefällt. Jeder muss vielmehr sein Wollen und Handeln bis zu einem gewissen Grad einschränken, und zwar einmal im Hinblick auf Ziele, deren Realisierung ihm nicht möglich ist (z.B. ist für einen Querschnittsgelähmten das Gehenwollen ein zwar verständliches, aber letztlich unerreichbares Ziel, das zu verfolgen sinnlos wäre). Hierzu bemerkt bereits EPIKTETEpiktet zu Beginn des 1. Kapitels seines »Handbüchleins der Ethik« (um 100 n. Chr.):
Von den vorhandenen Dingen sind die einen in unserer Gewalt, die anderen nicht. In unserer Gewalt sind Meinung, Trieb, Begierde und Abneigung, kurz: alles, was unser eigenes Werk ist. Nicht in unserer Gewalt sind Leib, Besitztum, Ansehen und Stellung, kurz: alles, was nicht unser eigenes Werk ist. Was in unserer Macht steht, das ist von Natur frei und kann nicht verhindert oder verwehrt werden; was aber nicht in unserer Macht steht, das ist schwach, unfrei, behindert und fremdartig.
Was der Verfügbarkeit des Menschen prinzipiell entzogen ist, kann somit sinnvollerweise nicht Gegenstand seines WollensWollen und Handelns sein, da hier durch FreiheitFreiheit nichts veränderbar ist, d.h. die FreiheitFreiheit hat eine natürliche Grenze an der Unaufhebbarkeit einer nicht durch sie hervorgebrachten Faktizität. Zum anderen hat sie eine normative Grenze im Hinblick auf Ziele, durch die das WollenWollen und Handeln anderer Menschen in unzulässiger Weise beeinträchtigt würde (z.B. durch krassen Egoismus in Form von Unterdrückung schwächer Gestellter bis hin zu Verbrechen an Leib und Leben). Hier handelt es sich um Ziele, die ein Mensch mit Hilfe seiner natürlichen Kräfte durchaus verfolgen kann, die er aber nicht verfolgen soll. Der FreiheitFreiheit ist hier nicht eine Grenze an der Faktizität gesetzt, sondern an der FreiheitFreiheit anderer Menschen.
Diese Grunderfahrung, dass menschliche WillensWille- und Handlungsfreiheit nicht unbegrenzt sind, sondern an den berechtigten Ansprüchen der Mitmenschen ihr Maß haben, ist die Basis, auf der moralisches Verhalten entsteht. Solange jemand sein naturwüchsiges WollenWollen nur deshalb einschränkt, weil es ihm befohlen wurde oder weil es bequemer ist oder weil ihm Belohnungen versprochen wurden, so lange handelt er noch nicht moralisch im eigentlichen Sinn. Er tut zwar, was er soll, aber er tut es nicht aus eigener Überzeugung, aus der Einsicht heraus, dass es vernünftig und gut ist, so zu handeln, sondern weil er dazu »abgerichtet« wurde, das, was andere für gut und vernünftig halten, kritiklos zu übernehmen. Er urteilt nicht selbständig, sondern die Urteile anderer haben sich in ihm zum Vorurteil verfestigt. Immanuel KANTKant, I. nennt diese Haltung eine »selbstverschuldete Unmündigkeit«:
AufklärungAufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der AufklärungAufklärung. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen …, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, usw.: so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: Werke, Bd. 9, 53)
Man könnte dieses Zitat zunächst so verstehen, als habe sich die von PIAGETPiaget, J. sogenannte heteronome Phase des Kindes in die Erwachsenenwelt hinein verlängert. Der gravierende Unterschied besteht jedoch darin, dass die Unmündigkeit des Kindes eine natürliche und keine selbstverschuldete ist. Der Erwachsene dagegen, der aus Faulheit, Feigheit oder Bequemlichkeit an seiner Unmündigkeit festhält, ist selber schuld daran, dass er sich seiner FreiheitFreiheitdes Handelns nicht bedient. Es ist ihm lästig, selbst zu handeln, und so lässt er andere für sich handeln. Es ist jedoch unmoralisch, sich bevormunden zu lassen und damit seine eigene Unfreiheit zu wollen. Genau darüber soll der Unmündige aufgeklärt werfen, dass er zur FreiheitFreiheitdes Willens aufgerufen ist und es an ihm selber liegt, wie frei er ist; und dass es zur FreiheitFreiheit des Mutes, der Risikobereitschaft, der Entschlusskraft bedarf.
Erst wenn ein Mensch sich nicht mehr dogmatisch vorschreiben lässt, was als gut zu gelten hat, sondern nach reiflicher Überlegung, d.h. in kritischer Distanz sowohl zu seinen eigenen Interessen als auch zu den Urteilen anderer, selbst bestimmt, welche Ziele für ihn, für eine Gruppe von Menschen oder auch für alle Menschen insgesamt gute, d.h. erstrebenswerte Ziele sind, hat er die Dimension des Moralischen erreicht.
Damit haben wir über den Gegenstand der EthikEthik, das moralische HandelnHandeln/Handlungmoralische(s), bereits einiges in Erfahrung gebracht.
Wir fällen ja tagtäglich fortwährend moralische Urteile, und dies so selbstverständlich, dass es uns kaum noch auffällt. Ob wir z.B.
uns selber anklagen, schlampig gearbeitet zu haben,
beim Einkaufen jemandem, der sich an der Kasse vordrängelt, Rücksichtslosigkeit vorwerfen,
über die Reklame im Fernsehen schimpfen und dabei von Verdummungseffekten reden,
uns über politische Ereignisse entrüsten oder
dem Nachbarn für seine angebotene Hilfe danken,
uns über ein besonders gut gelungenes Werk freuen,
einen kritischen Kommentar in der Tageszeitung mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen,
so drückt sich in allen diesen ablehnenden bzw. zustimmenden Äußerungen ein Werturteil aus über das, was wir für gut halten.
Wer es nun nicht dabei belässt, einfach moralisch zu urteilen, sondern sich dafür interessiert, was das MoralischeMoral eigentlich ist, und ob es überhaupt einen Sinn hat, moralisch zu handeln, wie man solches Handeln begründen und rechtfertigen kann – wer solche Fragen stellt, fängt an, EthikEthik zu betreiben.
Die EthikEthik erörtert alle mit dem Moralischen zusammenhängenden Probleme auf einer allgemeineren, grundsätzlicheren und insofern abstrakteren Ebene, indem sie rein formal die Bedingungen rekonstruiert, die erfüllt sein müssen, damit eine Handlung, ganz gleich welchen Inhalt sie im Einzelnen haben mag, zu Recht als eine moralischeHandlungHandeln/Handlungmoralische(s) bezeichnet werden kann. Die EthikEthik setzt somit nicht fest, welche konkreten Einzelziele moralisch gute, für jedermann erstrebenswerte Ziele sind; vielmehr bestimmt sie die Kriterien, denen gemäß allererst verbindlich festgesetzt werden kann, welches Ziel als gutes Ziel anzuerkennen ist. Die EthikEthik sagt nicht, was das Gute in concreto ist, sondern wie man dazu kommt, etwas als gut zu beurteilen. Diese die Aufgabe der EthikEthikAufgabe der betreffende These wird noch weiter präzisiert werden. Soviel kann jedoch schon festgehalten werden: Die Ethik ist nicht selber eine MoralMoral, sondern redet überMoralMoral.
Moralische Urteile und Aussagen über moralische Urteile sind zweierlei Dinge, die verschiedenen Sprach- und Objektebenen zugehören – so wie es auch etwas anderes ist, ob ich etwas erkenne und diese Erkenntnis formuliere oder ob ich über mein Erkennen überhaupt rede. Im einen Fall gilt meine Rede dem Etwas meiner Erkenntnis, im anderen Fall der Art und Weise, wie ich überhaupt etwas erkenne, d.h. hier liegt der Schwerpunkt nicht mehr auf dem einzelnen Etwas, sondern auf dem Wie. Die EthikEthik fällt entsprechend nicht moralische Urteile über einzelne HandlungenHandeln/Handlung, sondern analysiert auf einer Metaebene die Besonderheiten moralischer Urteile über HandlungenHandeln/Handlung.
1.1Herkunft und Bedeutung des Wortes »EthikEthik«
ARISTOTELESAristoteles war der Erste, der die EthikEthik als eine eigenständige philosophische Disziplin behandelt und von den Disziplinen der theoretischen Philosophie (LogikLogik, PhysikPhysik, MathematikMathematik, MetaphysikMetaphysik) unterschieden hat. Die praktische Philosophie untergliederte er in EthikEthik, ÖkonomikÖkonomik und PolitikPolitik. Während es die theoretische Philosophie mit dem veränderlichen und unveränderlichen Seienden zu tun hat, geht es in der praktischen Philosophie um menschliche HandlungenHandeln/Handlung und ihre Produkte.
Doch schon nahezu alle Dialoge PLATONPlatons enthalten ethische Überlegungen – insbesondere gilt dies für die zwischen SOKRATESSokrates und den Sophisten ausgetragene Auseinandersetzung über das Ziel der ErziehungErziehung:
ErziehungErziehung wurde von den Sophisten (insbesondere von PROTAGORASProtagoras und GORGIASGorgias) als Einübung in die von den Vätern überkommenen SittenSitte und Satzungen, deren Geltung fraglos und unbestritten anerkannt war, verstanden. SOKRATESSokrates dagegen sah Erziehung als einen an der Idee des GutenGuteIdee des orientierten Lernprozess an, dessen Ziel der Erwerb von Mündigkeit im Sinne kritischer Urteilsfähigkeit war.
Während ErziehungErziehung also für SOKRATESSokrates ein ethisch begründeter Lernprozess ist, betonen die Sophisten den Wert der Rhetorik als Mittel zur Gewinnung und Aufrechterhaltung von politischer MachtMacht. Entsprechend verstanden sie ErziehungErziehung primär als Anleitung zu Rhetorik.
PLATONPlaton hat also zweifellos Untersuchungen zum Ethischen durchgeführt, jedoch sind derartige Überlegungen von ihm nicht systematisch zu einer EthikEthik zusammengefasst worden. Vielmehr durchziehen sie die einzelnen Dialoge in unterschiedlicher Gewichtung und sind von PLATONs metaphysischem Denkansatz nicht abtrennbar. Die menschliche PraxisPraxis wird von PLATON immer im Zusammenhang mit der Ideenlehre und damit verbunden der Frage nach den unveränderlichen, ewigen Prinzipien des SeiendenSein insgesamt erörtert.
Ausgehend von sophistischen und sokratisch-platonischen Thesen über die menschliche PraxisPraxis und das GuteGute, das hat dann ARISTOTELESAristoteles die praktische Philosophie von der theoretischen abgegrenzt und die EthikEthik als eine eigenständige Disziplin begründet. Dies dokumentieren verschiedene Werke, vor allem seine Vorlesungen über das Thema EthikEthik: die ›Eudemische Ethik‹ und die sog. ›Große Ethik‹. Am berühmtesten aber ist seine ›Nikomachische Ethik‹ geworden, die ihren Titel vermutlich vom Namen des Sohnes Nikomachos her erhalten hat. Die Nikomachische EthikEthik enthält eine umfassende Theorie des Handelns, die sowohl eine Glücks- als auch eine TugendlehreTugend ist, und erhebt den Anspruch, den Schüler der EthikEthik so über sein Tun aufzuklären, dass er lernt, das GuteGute, das immer besser zu tun und sich dadurch immer mehr als ein guter Mensch zu erweisen.
Der seit ARISTOTELESAristoteles verwendete Disziplintitel EthikEthik leitet sich ursprünglich von dem griechischen Wort ethosEthos her, das in zwei Varianten vorkommt, nämlich einmal als ἔθοςEthos – Gewohnheit, SitteSitte, Brauch: Wer durch ErziehungErziehung daran gewöhnt worden ist, sein Handeln an dem, was SitteSitte ist, was im antiken Stadtstaat, in der Polis Geltung hat und sich daher ziemt, auszurichten, der handelt »ethisch«, insofern er die Normen des allgemein anerkannten ›MoralkodexMoral‹ befolgt. Im engeren und eigentlichen Sinn ethisch handelt jedoch derjenige, der überlieferten Handlungsregeln und Wertmaßstäben nicht fraglos folgt, sondern es sich zur Gewohnheit macht, aus Einsicht und Überlegung das jeweils erforderliche GuteGute, das zu tun: Das ἔθοςEthos wird dann zum ἦθοςEthos im Sinne von Charakter; es verfestigt sich zur Grundhaltung der Tugend.
Also entstehen die sittlichen Vorzüge in uns weder mit Naturzwang noch gegen die NaturNatur, sondern es ist unsere NaturNatur, fähig zu sein sie aufzunehmen, und dem vollkommenen Zustande nähern wir uns dann durch Gewöhnung. … Mit einem Wort: aus gleichen Einzelhandlungen erwächst schließlich die gefestigte Haltung. Wir philosophieren nämlich nicht, um zu erfahren, was TugendTugend sei, sondern um tugendhafte Menschen zu werden. (Eth. Nic. 11, 1–2; 1103a 23–b28)
Das lateinische Wort mos (Plural: mores) ist eine Übersetzung der beiden griechischen ethosEthos-Begriffe und bedeutet daher sowohl SitteSitte als auch Charakter. Von mos wiederum leitet sich das deutsche Wort MoralMoral her, das ein Synonym für SitteSitte ist. Zur MoralMoral oder SitteSitte werden jene – aus wechselseitigen Anerkennungsprozessen in einer Gemeinschaft von Menschen hervorgegangenen und als allgemein verbindlich ausgezeichneten Handlungsmuster zusammengefasst, denen normative Geltung zugesprochen wird. Die Ausdrücke MoralMoral und SitteSitte bezeichnen mithin Ordnungsgebilde, die gewachsene Lebensformen repräsentieren, Lebensformen, die die Wert- und Sinnvorstellungen einer Handlungsgemeinschaft widerspiegeln. Während der Bedeutungsgehalt von MoralMoral/SitteSitte mehr dem entspricht, was mit ἔθοςEthos gemeint ist, stehen die Abstrakta Moralität/Sittlichkeit in ihrer Bedeutung dem näher, was unter ἦθοςEthos verstanden wird: der Qualität eines Handelns, das sich einem unbedingten Anspruch (dem GutenGute, das) verpflichtet weiß.
Die Adjektive moralisch/sittlich dagegen sind doppeldeutig und können sowohl im Sinne von ἔθος wie von ἦθος verwendet werden. Wenn eine HandlungHandeln/Handlung als moralisch/sittlich beurteilt wird, so kann dies sowohl heißen: sie folgt einer Regel der geltenden MoralMoral/SitteSitte, als auch: sie hat ihren Grund in der Moralität/Sittlichkeit des Handelnden. Wenn ich von jemandem sage, er sei ein unmoralischer Mensch, so meine ich entweder, sein Verhalten entspreche nicht dem von den meisten anerkannten MoralkodexMoralkodex, oder aber, er habe einen verdorbenen Charakter.
Hinsichtlich der Verwendung der Wörter EthikEthik und ethisch ist folgendes festzustellen: Sowohl in der traditionellen EthikEthik als auch in der Umgangssprache wird das Adjektiv ethisch häufig synonym mit moralisch bzw. sittlich gebraucht: es ist die Rede von ethischen HandlungenHandeln/Handlung, ethischen Ansprüchen, ethischen Normen usf. Dieser Sprachgebrauch ist keineswegs unberechtigt, wenn man an die Herkunft des Wortes EthikEthik aus ἔθοςEthos denkt. Um jedoch die verschiedenen Reflexionsniveaus von vornherein bereits sprachlich scharf gegeneinander abzugrenzen, ist man in der EthikdiskussionEthik weitgehend dazu übergegangen, den Titel EthikEthik wie auch das Adjektiv ethisch ausschließlich der philosophischen Wissenschaft vom moralischen/sittlichen HandelnHandeln/Handlung des Menschen vorzubehalten.
Nach einem sich einbürgernden Sprachgebrauch bezeichnen wir als ›Moral‹ den Inbegriff moralischer Normen, Werturteile, Institutionen, während wir den Ausdruck ›Ethik‹ (sprachgeschichtlich mit ›MoralMoral‹ bedeutungsäquivalent) für die philosophische Untersuchung des Problembereichs der Moral reservieren. (G. PATZIGPatzig, G., Ethik ohne Metaphysik, 3)
Nicht immer wird zwischen ›Ethik‹ und ›MoralMoral‹ unterschieden. Trotzdem ist es nicht unzweckmäßig, eine solche Unterscheidung zu treffen – selbst wenn sich herausstellen sollte, dass die beiden entsprechenden Bereiche aneinander grenzen und dass eine exakte Grenzziehung kaum möglich ist. Deshalb wollen wir in Übereinstimmung mit einem in der Philosophie nicht ganz ungewöhnlichen Sprachgebrauch im Folgenden ›Ethik‹ als gleichbedeutend mit ›Moralphilosophie‹ verstehen. (N. HOERSTERHoerster, N., Texte zur Ethik, 9)
Die Sprache der MoralMoralSprache der oder die moralische Sprache umfasst das umgangssprachliche Reden über Handlungen, sofern sie einer kritischen Beurteilung unterzogen werden. Die Sprache der Ethik oder Moralphilosophie dagegen ist ein reflektierendes Sprechen über die moralische Sprache.
Die Ethik hat somit MoralMoral (SitteSitte) und Moralität (Sittlichkeit)1 zu ihrem Gegenstand. Ihre Fragen unterscheiden sich von denen der MoralMoral dadurch, dass sie sich nicht unmittelbar auf singuläre Handlungen bezieht, also auf das, was hier und jetzt in einem bestimmten Einzelfall zu tun ist, sondern auf einer Metaebene moralisches Handeln grundsätzlich thematisiert, indem sie z.B. nach dem MoralprinzipMoralprinzip oder nach einem Kriterium zur Beurteilung von Handlungen fragt, die Anspruch auf Moralität erheben; oder indem sie die Bedingungen untersucht, unter denen moralische Normen und WerteWert allgemein verbindlich sind.
Aus dieser begrifflichen Differenzierung zwischen MoralMoral und Ethik folgt, dass ethische Überlegungen nicht eo ipso moralisch sind, aber durchaus aus einem Interesse an einer bestimmten Problematik der MoralMoral hervorgehen können, so wie umgekehrt moralische Überlegungen nicht eo ipso ethisch sind, aber durchaus zu ethischen Fragestellungen radikalisiert werden können.
Zusammenhang und Unterschied zwischen Ethik und MoralMoral lassen sich durch folgende Analogien verdeutlichen:
Gegenstand der Literaturwissenschaft ist die sog. »schöne Literatur«, die unter verschiedenen (z.B. linguistischen, formaltechnischen, inhaltlichen) Aspekten untersucht und klassifiziert wird. Wer Literaturwissenschaft betreibt, schreibt – indem er dies tut – keinen Roman, kein Gedicht etc., obwohl er dazu durchaus in der Lage sein mag; vielmehr analysiert er literarische Texte im Hinblick auf bestimmte regelmäßige Strukturelemente und -formen, um zu allgemeinen Aussagen über »den« Roman, »das« Drama, »die« Ode etc. zu gelangen, und versucht, vermittels dieser Regeln wiederum einzelne Romane, Dramen, Oden kritisch zu beurteilen. Wer dagegen einen Roman schreibt, betreibt nicht – indem er dies tut – Literaturwissenschaft, obwohl ihm literaturwissenschaftliche Kenntnisse bei der Abfassung durchaus von Nutzen sein können.
Eine andere Analogie:
Ein guter Theaterkritiker muss nicht notwendig auch ein guter Schauspieler sein (in der Regel wird er dies gerade nicht sein). Ihn zeichnet ja eben die Distanz zum Stück, zum Spiel aus, und nur aus dieser Distanz heraus gelingt es ihm, etwas Treffendes über das Stück, über den Schauspieler zu sagen. Wenn er selber ein unmittelbar Beteiligter wäre, könnte er nicht zugleich und in derselben Hinsicht als Kritiker fungieren, weil ihm die nötige Distanz fehlte.
Analog zum Literaturwissenschaftler und Theaterkritiker urteilt auch der Ethiker aus einer gewissen Distanz zu seinem Gegenstand über diesen Gegenstand, die MoralMoral nämlich. Indem der Ethiker Ethik betreibt, handelt er nicht moralisch, sondern reflektiert aus theoretischer Perspektive über das Moralische und damit aus der kritischen Distanz des Wissenschaftlers.
Diese Distanz kann im Extremfall so weit gehen wie in der folgenden Anekdote: Max SCHELERScheler, M., einer der führenden Wertethiker um die Jahrhundertwende, hat sich angeblich nicht immer moralisch einwandfrei verhalten und gelegentlich gegen die sogenannten guten Sitten verstoßen. Darauf angesprochen, ob dies denn nicht im Widerspruch zu dem stehe, was er in seinen ethischen Arbeiten vertrete, soll er sinngemäß gesagt haben: Kennen Sie einen Wegweiser, der selber in die Richtung geht, die er anzeigt?
Das mag zunächst frivol klingen, ist aber durchaus nicht absurd, denn die Ethik als Theorie der moralischen PraxisPraxis ist nicht selber schon die PraxisPraxis der MoralMoral, und man kann sich sehr wohl eine richtige Theorie der PraxisPraxis vorstellen, die unabhängig davon richtig ist, ob derjenige, der diese Theorie entwickelt hat, sie auch praktiziert oder nicht. AndersAnders, G. gesagt: Über die Richtigkeit der Theorie entscheidet nicht die Tatsache, dass ihr Urheber sie praktiziert. Aber wenn die Theorie richtig ist, kann man sagen, dass es praktisch inkonsequent ist, wenn sie für die PraxisPraxis ihres Urhebers folgenlos bleibt. Das Bild des Wegweisers ist somit insofern zutreffend, als man den Wegweiser und den zu gehenden Weg voneinander trennen muss. Man kann also nicht sagen, im Idealfall müsste der Wegweiser tatsächlich den von ihm gewiesenen Weg gehen, d.h. Ethik und MoralMoral müssten zusammenfallen. Der Wegweiser steht für eine richtige Theorie der Ethik, und jeder, der sie verstanden hat, hat damit zugleich eine bestimmte Form von PraxisPraxis als verbindlich anerkannt, die er handelnd verwirklichen soll.
1.2Die Rolle der MoralMoral in der Alltagserfahrung
Die MoralMoral spielt im alltäglichen Erfahrungsbereich eine große Rolle: In allen menschlichen Verhaltensweisen und Sprachgewohnheiten stellt sich mehr oder weniger ausdrücklich ein bestimmtes EngagementEngagement dar, das wiederum auf bestimmten Wertvorstellungen basiert.
Es macht gerade die HumanitätHumanität des Menschen als Mitgliedes einer Sozietät aus, dass er sich nicht schlechthin gleichgültig gegen alles das verhält, was seine Mitmenschen sagen und tun, sondern Partei ergreift, indem er durch die Äußerung von Lob und Tadel, von Billigung und Missbilligung, von Zustimmung und Ablehnung erkennen lässt, was er für gut oder böse, richtig oder falsch hält. Diese grundsätzliche Möglichkeit, nicht alles, was geschieht, kritiklos hinzunehmen, sondern – sei es aus eigenem Interesse, sei es aus innerer Überzeugung oder sei es um eines allgemein für erstrebenswert gehaltenen Ziels willen – seine persönliche Stellungnahme in die Gemeinschaft der miteinander Redenden und Handelnden einzubringen, ist ein Indiz für die FreiheitFreiheit als Fundament aller menschlichen Praxis.
Doch birgt diese Möglichkeit die Gefahr der Verkehrung von FreiheitFreiheit in Unfreiheit. Nirgends sind die Meinungsverschiedenheiten und die Widersprüche zwischen miteinander unverträglichen Standpunkten größer als in der Beurteilung von Handlungen bezüglich ihrer Richtigkeit und Moralität. Was der eine für gut hält, lehnt der andere rigoros ab und ist oft nicht einmal dazu bereit, seinen Standpunkt zu problematisieren, d.h. der Kritik auszusetzen und Gegenargumenten zu begegnen. Solche dogmatisch als unangreifbar behaupteten, zu bloßen Vorurteilen erstarrten Haltungen sind Formen eines »Moralisten-« oder »Pharisäertums«, das FreiheitFreiheit nicht als FreiheitFreiheit aller begreift, sondern als FreiheitFreiheit von Auserwählten missversteht. Die Folgen eines solchen unkritisch verallgemeinerten Ethos sind bekannt: religiöse Verfolgung, Diffamierung von Minderheiten, Rassen- und Geschlechterdiskriminierung, Ächtung politisch oder ideologisch Andersdenkender, Verfemung moralisch Andershandelnder usf. Hier werden die Menschen in Klassen, in Über- und Untermenschen eingeteilt, und zwar nach Maßgabe desjenigen, der sich einen absoluten Standpunkt angemaßt hat und nicht mehr bereit ist, diesen zu problematisieren.
FreiheitFreiheit als Fundament menschlicher Praxis ist keine regellose Willkürfreiheit, der gemäß jeder tun und lassen kann, was ihm beliebt. Der Mensch ist auch nicht wie das Tier schon von Natur aus durch Instinkt und Triebe so optimal eingerichtet, dass FreiheitFreiheit überflüssig würde. Vielmehr besteht die menschliche FreiheitFreiheit als moralische FreiheitFreiheit darin, sich selber RegelnRegel im Hinblick auf das, was man als von Bedürfnissen und Trieben abhängiges, durch diese aber nicht schlechthin determiniertes Sinnenwesen ist, zu geben und diese RegelnRegel aus FreiheitFreiheit und zur Erhaltung der FreiheitFreiheit zu befolgen. Erst durch die Selbstbindung an solche RegelnRegel der FreiheitFreiheit entsteht VerbindlichkeitVerbindlichkeit und damit eine MoralMoral.
Regellose FreiheitFreiheit ist keine menschliche, sondern unmenschliche FreiheitFreiheit. Das andere Extrem, eine total von RegelnRegel bestimmte, in Zwangsmechanismen erstarrte Freiheit – z.B. in totalitären Staaten oder Gesellschaftsformen, wo kein Spielraum mehr bleibt für die Freiheit des einzelnen – ist ebenso unmenschlich. Moralische FreiheitFreiheitmoralische dagegen setzt sich selbst um der Freiheit aller willen RegelnRegel, an die sie sich bindet, so wie man beim SpielSpielRegelnRegel gehorcht, die das Spielen nicht aufheben, sondern als SpielSpiel gerade ermöglichen sollen.
Was genau beinhaltet nun das Wort MoralMoral?
Eine Moral ist der Inbegriff jener NormenNorm und WerteWert, die durch gemeinsame AnerkennungAnerkennung als verbindlich gesetzt worden sind und in der Form von
Geboten (Du sollst …; es ist deine Pflicht …) oder
Verboten (Du sollst nicht …)
an die Gemeinschaft der Handelnden appellieren. Jede MoralMoral ist somit als geschichtlich entstandener und geschichtlich sich mit dem Freiheitsverständnis von Menschen verändernder Regelkanon immer eine GruppenmoralGruppenmoral, deren Geltung nicht ohne weiteres über die Mitglieder der Gruppe hinaus ausgedehnt werden kann.
Der Versuch, eine umfassende Menschheitsmoral aus der Vielzahl vorhandener Moralen herauszudestillieren, würde letztlich weniger daran scheitern, dass über universale BasisnormenBasisnorm bzw. Grundwerte keine Einigung zustande käme: Es lässt sich wohl bis zu einem gewissen Grad einsichtig machen, dass keine MoralMoral ohne die Ideen FreiheitFreiheit, GleichheitGleichheit, MenschenwürdeMenschenwürde, GerechtigkeitGerechtigkeit u.a. auskommen kann. Die eigentliche Schwierigkeit besteht vielmehr darin, die RegelnRegel einer solchen UniversalmoralMoral im Kontext unterschiedlicher, geschichtlich gewachsener Lebensformen und Kulturkreise »anzuwenden«, d.h. mit den jeweiligen Lebensbedingungen (Klima, geographische Lage, religiöse Überzeugungen, wirtschaftlicher Status, Stand der Zivilisation etc.) zu vermitteln. Auch TraditionTradition und KonventionKonvention bestimmen den durch den jeweiligen MoralkodexMoralkodex repräsentierten, kulturell geprägten Sinnhorizont einer Sozietät wesentlich mit und führen zu unterschiedlichen, ja manchmal sogar entgegengesetzten Ausprägungen einer und derselben BasisnormBasisnorm.
Die inzwischen vorliegenden Berichte über die moralischen Verhaltensregeln und ihren Zusammenhang in bestimmten ethnischen Gruppen sind für die Ethik deshalb bedeutsam, weil wir aus solchen Untersuchungen lernen, dass bei gleichen zugrunde liegenden moralischen Grundsätzen doch vollkommen verschiedene ›moralische Landschaften‹ entstehen können, je nach den aktuellen geographischen, ökonomischen und historischen Bedingungen, unter denen die Angehörigen solcher Gruppen leben. (G. PATZIGPatzig, G.: Relativismus und Objektivität moralischer NormenNorm, in: Ethik ohne Metaphysik, 79)
Was genau heißt es, dass bei gleichen zugrundeliegenden moralischen Grundsätzen dennoch ganz verschiedene »moralische Landschaften« entstehen können? Ein extremes Beispiel mag dies veranschaulichen:
Bei manchen ›primitiven‹ Gruppen, z.B. bei den Eskimos, soll es Brauch gewesen sein, alte und schwache Leute zu töten. Diese Regel steht in krassem Widerspruch zu unserem Verständnis von Menschenwürde und wird nur nachvollziehbar vor dem Hintergrund extremer Lebensverhältnisse, die durch große Unwirtlichkeit des Lebensraums und knappe Lebensmittel gekennzeichnet sind. Nur so ist es verstehbar, dass die moralische NormNorm, seinen Eltern Gutes zu tun und ihnen Leid zu ersparen, dadurch erfüllt wird, dass man ihnen einen qualvollen Tod erspart, indem man sie auf schmerzlose Weise tötet und somit die Überlebenschance der Jungen vergrößert.
Hier wird also der moralische Grundsatz: ›Du sollst deinen alten Eltern Gutes tun‹ durchaus anerkannt, allerdings auf eine Weise, die uns als das genaue Gegenteil einer moralischen Praxis erscheint.
Wenn man jedoch bedenkt, wie lieblos bei uns alte Menschen oft ohne Not in Alten- oder Seniorenheime abgeschoben werden, so kann man sich mit Recht fragen, ob diese Form der »Aussetzung« in der Tat sehr viel menschenwürdiger ist als die Praxis sogenannter »primitiver« Stämme.
Wohlgemerkt: Die Tötung alter Menschen geschah bei den Eskimos nicht gegen den Willen der Alten, sondern mit ihrem Einverständnis. Sie waren ja mit dieser RegelRegel bereits aufgewachsen und wußten um ihre Bedeutung. Ihnen wurde also keineswegs Zwang oder GewaltGewalt im eigentlichen Sinn angetan.
Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist die, wie solche unterschiedlichen Praktiken ethisch zu beurteilen sind. Hier ist es sicher nicht mit ToleranzToleranz getan, wie der Ethnologe Melville J. HERSKOVITSHerskovits, J. meint, der folgende drei Thesen aufstellt:
Das Individuum verwirklicht seine Persönlichkeit im Rahmen seiner KulturKultur; daher bedingt die Achtung individueller auch die Achtung kultureller Verschiedenheiten. …
Die Achtung kultureller Unterschiede folgt aus der wissenschaftlichen Tatsache, dass noch keine Methode zur qualitativen Bewertung von Kulturen entdeckt worden ist. …
Maßstäbe und Werte sind relativ auf die KulturKultur, aus der sie sich herleiten. Daher würde jeder Versuch, Postulate zu formulieren, die den Überzeugungen oder dem Moralkodex nur einer KulturKultur entstammen, die Anwendbarkeit einer MenschenrechtserklärungMenschenrechte auf die Menschheit als ganze beeinträchtigen. (Ethnologischer RelativismusRelativismus und MenschenrechteMenschenrechte, in: Texte zur Ethik, 39f.).1
Die ethischeEthik Schlussfolgerung in Bezug auf den oben beschriebenen Fall müsste vielmehr die sein, dass alles darangesetzt wird, die Lebensverhältnisse und die wirtschaftlichen Bedingungen dieser Menschen so zu verbessern, dass die geschilderten Praktiken von selbst obsolet werden.
Bisher war die Rede von der Gruppenmoral im Rahmen unterschiedlicher KulturkreiseKultur. Im alltäglichen Erfahrungsbereich begegnet einem die MoralMoral jedoch nicht nur als ein kulturspezifisches Phänomen, das im Unterschied zu Sinndeutungen anderer gesellschaftlicher oder nationaler Handlungsgemeinschaften den Sinnhorizont der Handlungsgemeinschaft darstellt, in der der einzelne aufgewachsen ist und an der aktiv mitzuwirken er aufgerufen ist, sondern innerhalb der Gesamtmoral haben sich auch besondere MoralenMoral herausgebildet, deren RegelnRegel nur für einen Teil der gesamten Gruppe gelten.
So tritt die christliche MoralMoralchristliche mit dem Anspruch religiös fundierter moralischer RegelnRegel an die Christen heran, wobei diese RegelnRegel nach katholischer Überzeugung sowohl ihrer Form als auch ihrem Inhalt nach anders ausfallen als nach evangelischer Auffassung – von den zahlreichen Sekten und Weltanschauungslehren ganz zu schweigen.
So hat jeder Beruf mehr oder weniger ausdrücklich sein eigenes Berufs- oder Standesethos entwickelt, dessen Normen für den verbindlich sind, der diesen Beruf gewählt hat und ausübt.
Der »Eid des HippokratesHippokrates« verpflichtet den Arzt in Anwendung der allgemeinen moralischen Forderung, seinen Mitmenschen in der Not zu helfen, auf die ärztliche Tätigkeit dazu, nach bestem Wissen und Gewissen für das körperliche Wohlergehen und die Gesundheit der ihm anvertrauten Patienten zu sorgen.
Das EthosEthos des Lehrers besteht in der Forderung, die Schüler über die angemessene Vermittlung bestimmter Wissensinhalte zu aufgeklärten, mündigen Menschen zu erziehen.
Das EthosEthos des Busfahrers liegt in der Verantwortung für seine Passagiere, die er ungefährdet an ihr Ziel zu bringen hat.
Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen über die »Arbeiter-«, »Angestellten-« und »Beamtenmoral« bis hin zur »Hausfrauenmoral«. Alle diese BerufsgruppenmoralenGruppenmoral basieren auf dem allgemeinen moralischen Grundsatz, das Seine im Beruf so gut wie möglich zu tun. Hier wird also der Arbeit an sich selber ein Wert zuerkannt, oder anders gesagt: Arbeit ist nicht allein definiert durch die technischen RegelnRegel, die einen reibungslosen Arbeitsprozess ermöglichen, sondern Arbeit ist zugleich eine Tätigkeit, die auf der Basis von moralischen RegelnRegel ausgeübt wird – besonders dort, wo andere Menschen mittelbar oder unmittelbar mitbetroffen sind.
Einen Sonderfall stellt die MoralMoral einer Räuberbande dar. Auch sie ist eine GruppenmoralGruppenmoral, ohne die die Gemeinschaft der Räuber nicht funktionieren würde. Es muss also z.B. geregelt sein, nach welchem Schlüssel die Beute verteilt wird, damit es gerecht zugeht; wie der einzelne sich zu verhalten hat, wenn er geschnappt wird: er darf nicht ›singen‹, um die anderen nicht zu gefährden etc. Hier geht es um die sog. Ganovenehre, um das Ethos des Berufsverbrechers, das ebenfalls eine GruppenmoralGruppenmoral ist.
Weitere Spezialisierungen der allgemeinen GruppenmoralGruppenmoralMoral einer Gemeinschaft oder Gesellschaft artikulieren sich einerseits in EhrenkodizesEhrenkodex, andererseits in oft stillschweigend respektierten Tabuzonen. Hier werden bestimmte Selbstwertvorstellungen, die durch AnerkennungsprozesseAnerkennung vermittelt sind, manifest.
Die Berufs- oder Standesehre z.B. ist eng mit den im Berufsethos zusammengefassten Regeln verknüpft, und wer gegen diese Regeln verstößt, schadet nicht nur dem eigenen Ansehen, sondern dem ganzen Berufsstand.
Ein KaufmannKaufmann, A., der minderwertige Ware zu überhöhten Preisen verkauft, verletzt seine Berufsehre ebenso wie ein Politiker, der nur seine Machtinteressen verfolgt, anstatt sich für die von ihm zu vertretenden Belange einzusetzen, oder wie ein Handwerker, der mangelhaft arbeitet. In derartigen Fällen wird dem Betreffenden die AnerkennungAnerkennung sowohl vonseiten der Betroffenen versagt (man kauft bei ihm nicht mehr ein, wählt ihn nicht mehr, ruft ihn nicht mehr zu Reparaturen) als auch vonseiten der Berufsgruppe, was den Ausschluss aus dieser Gruppe zur Folge haben kann.
Umgekehrt wird besonders vorbildliches Verhalten im Dienst am Mitmenschen durch öffentliches Lob oder die Verleihung von Preisen und Orden ausgezeichnet.
Eine besondere Art von EhrenkodexEhrenkodex stellt die Stammes- und Familienehre dar. Auch hier wird ein Verstoß gegen die Regeln (z.B. eine unstandesgemäße Heirat oder ein Eingriff von außen, wie etwa eine unbefugte Grenzüberschreitung) zumeist mit dem Ausstoß aus dem Familienclan, ja gelegentlich auch heute noch mit Blutrache geahndet.
Als besonders schwerer moralischer Verstoß gegen Anstand und SitteSitte gilt im alltäglichen Erfahrungsbereich die Verletzung eines TabusTabu. Waren es früher hauptsächlich der religiöse und der sexuelle Bereich, in dem durch Verbote unter Androhung schlimmer Strafen gewisse Bezirke (des Heiligen, Numinosen, bzw. bestimmte erotische Spielarten) ausgegrenzt, als unzugänglich (»unberührbar«) deklariert und der menschlichen Praxis untersagt wurden, so gilt heute die individuelle Privat- und Intimsphäre eines jeden als tabu. Sowohl die zu weit gehende Zurschaustellung dieses persönlichen Bereichs vonseiten bekannter Persönlichkeiten als auch unverschämte Übergriffe vonseiten der Massenmedien werden trotz der Neugier des Publikums in der Regel von den meisten als schamloser, unanständiger Eingriff in Dinge, die die Öffentlichkeit nichts angehen, empfunden.
Bei allen TabusTabu muss grundsätzlich immer wieder gefragt werden, inwieweit sie in der Tat noch dem Schutz wirklicher WerteWert wie MenschenwürdeMenschenwürde und persönliche FreiheitFreiheit dienen, oder ob sie nicht zu bloßen Druckmitteln entartet sind, um missliebiges Verhalten einzuschränken und Kontrollfunktionen über das erlaubte Maß hinaus auszudehnen. Tabus können veralten und aufgehoben werden, wenn sich herausstellt, dass die Menschen inzwischen einen natürlicheren oder aufgeklärteren Zugang zu dem ursprünglich tabuisierten Bereich gefunden haben, sodass die alten Verbote hinfällig werden oder einer Modifikation bedürfen. Als Beispiele wären hier die veränderte Beurteilung des Inzests und der Homosexualität zu nennen.
Die bisher skizzierten MoralsystemeMoral spielen in der Alltagspraxis, im Umgang mit den Mitmenschen, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, eine große Rolle, ohne dass sich die meisten ausdrücklich darüber klar sind, wie weit ihre kommunikativen Verhaltensweisen von solchen MoralenMoral bestimmt, ja reglementiert sind. Erst wenn im Privatbereich persönliche (GewissenGewissens-) KonflikteKonflikt entstehen oder in der öffentlichen Diskussion Probleme erörtert werden, die sich aus einer Normen- resp. WertekollisionWert ergeben, wird sich der einzelne zum einen der Selbstverständlichkeit bewusst, mit der er bestimmten internalisierten moralischen Regeln fraglos folgt, zum andern aber auch seiner persönlichen Verantwortung, derer er durch die Befolgung von Vorschriften der geltenden MoralMoral keineswegs enthoben ist.
Es lassen sich drei Hauptklassen solcher NormenNorm- oder WertekollisionenWert, die zu einem GewissenGewissenskonfliktKonflikt führen können, unterscheiden:
Es kann erstens passieren, dass NormenNorm, die zu ein und demselben MoralsystemMoral gehören, miteinander kollidieren.
Dies ist z.B. der Fall, wenn sich die Regel, immer wahrhaftig zu sein, in einer bestimmten Situation mit der Regel, niemandem Leid zuzufügen, nicht in Einklang bringen lässt, sodass das Sagen der WahrheitWahrheit mit der Zufügung großen Leids verbunden ist, das Verschweigen der WahrheitWahrheit aber zu ständigem Lügen zwingt.
Ein anderer Fall liegt vor, wenn das Leben eines Menschen nur durch den Bruch eines Versprechens oder durch Verrat gerettet werden kann.
Es kann zweitens der Fall eintreten, dass NormenNorm, die zu verschiedenen MoralsystemenMoral gehören, miteinander kollidieren.
Für den Pazifisten ist z.B. die Forderung, keine Waffen zu tragen und sich aus Kriegshandlungen herauszuhalten, mit der Forderung des Staates, sein Vaterland notfalls mit Waffen zu verteidigen, unvereinbar.
Das katholische Verbot einer Schwangerschaftsverhütung durch »die Pille« kann mit einer ärztlichen oder sozialen Indikation zusammenstoßen, der gemäß eine Schwangerschaft schwerste leibliche und seelische Schäden zur Folge haben würde.
Es kann schließlich drittens eine bestimmte, allgemein anerkannte NormNorm oder WertvorstellungWert das Selbstverständnis eines einzelnen so tiefgreifend beeinträchtigen, dass ihre Befolgung seine freie Selbstverwirklichung, auf die er einen moralischen Anspruch hat, in unzulässiger Weise behindern würde. Hier entsteht der KonfliktKonflikt nicht durch die Unvereinbarkeit von allgemeinen NormenNorm oder NormensystemenNorm, sondern durch den Zusammenstoß einer allgemein anerkannten mit einer in bestimmter Weise ausgelegten Individualnorm.
Dies ist z.B. der Fall, wenn jemand homosexuell veranlagt ist und mit einem gleichgeschlechtlichen Partner zusammenlebt, was gegen die Institution der Ehe verstößt.
Das Gemeinsame der oben geschilderten KonfliktsituationenKonflikt liegt darin, dass sie nicht durch irgendeine öffentliche Autorität oder Instanz allgemein verbindlich für jeden Einzelfall a priori gelöst werden können, sondern von dem betroffenen Individuum selbstverantwortlich entschieden werden müssen. Zwar können öffentliche oder private Diskussionen dazu beitragen, in Pro- und Contra-Argumenten gute Gründe für die eine oder die andere Lösung zu formulieren und auf die möglichen Folgen der jeweiligen Entscheidung aufmerksam zu machen; außerdem können gesetzliche Regelungen den Entscheidungsraum einschränken, aber treffen muss die Entscheidung der einzelne, der sich in der KonfliktsituationKonflikt befindet, und er muss sie im Bewusstsein seiner moralischen Verantwortung treffen, d.h. nicht nach Gutdünken und ausschließlich persönlichem Wunsch und Willen, sondern unter Berücksichtigung dessen, was in der Gemeinschaft gilt, zu der er gehört. Er muss somit bereit sein, sich vor dieser Gemeinschaft bezüglich seiner Entscheidung zu rechtfertigen, mithin die Gründe offenzulegen, die ihn bewogen haben, so zu handeln, wie er gehandelt hat bzw. handeln möchte. Ganz gleich wie seine Entscheidung de facto ausfällt, sie wird in den exemplarisch geschilderten Fällen immer gegen die eine oder die andere NormNorm verstoßen und insofern mit einem gewissen Maß an moralischer SchuldSchuld verbunden sein. Doch ist die grundsätzliche Bereitschaft, eine solche Entscheidung zu rechtfertigen, vor anderen zu verantworten, ein Indiz dafür, dass die betreffende Person nicht unmoralisch ist, sondern dass es vielmehr in Ausnahmefällen und Extremsituationen rechtens sein kann, den Anspruch einer bestimmten moralischen NormNorm zugunsten einer höher geschätzten NormNorm nicht zu erfüllen.
Eine geltende MoralMoral bzw. eine moralische Regel kann aus Moralität in Frage gestellt oder negiert werden.
In den verschiedenen historisch entstandenen Moralsystemen kommt ein NormenpluralismusNorm zum Ausdruck, durch den die Alltagspraxis und damit zugleich das Freiheitsverständnis von Menschen bestimmt wird. Das spiegelt sich in einer Vielzahl von inhaltlich differierenden Geboten, Verboten, Handlungsanweisungen, Regeln, Vorschriften und dergleichen mehr. Es fragt sich nun, ob es sich bei der Mannigfaltigkeit dieser NormenNorm um eine heterogene Vielfalt handelt, oder ob sie sich nicht trotz aller inhaltlichen Differenz doch allesamt auf einen als Moralkriterium fungierenden formalen Grundsatz zurückführen lassen. Ein solcher Grundsatz, der auf die Bibel zurückgeht, ist z.B. als »Goldene RegelRegelGoldene« allgemein bekannt:
Was du nicht willst, das man dir tu, das füg’ auch keinem andern zu;
oder positiv formuliert:
Behandle deine Mitmenschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst. (Vgl. AT: Tobias 4, 16; NT: Matth. 7, 12; Luk. 6,31)
Diese Regel verlangt somit vor jeder konkreten Einzelentscheidung, dass man sich in die Lage des oder der von ihr Betroffenen versetzen soll, um zu prüfen, ob man die Entscheidung auch dann gutheißen würde, wenn ein anderer sie fällen würde und ich dadurch unmittelbar oder mittelbar betroffen wäre.
Die Goldene RegelRegelGoldene ist nicht selber eine moralische NormNorm, sondern soll als Maßstab von moralischen NormenNorm fungieren, d.h. sie schreibt nicht inhaltlich vor, was im Einzelnen getan werden soll; sie gebietet vielmehr rein formal, wie generell gehandelt werden muss, damit die Handlung als moralischHandeln/Handlungmoralische(s) anerkannt werden kann. Die HandlungHandeln/Handlungmoralische(s) gilt dann als moralisch, wenn sie nicht Folge eines bloß subjektiven, unmittelbaren WollensWollen (BedürfnissesBedürfnis oder Interesses) ist, sondern Ausdruck eines sich von seinem unmittelbaren Begehren distanzierenden und auf den WillenWille anderer Subjekte beziehenden, intersubjektiv vermittelten WillensWille.
Allerdings gibt es ein Problem, das auch die Goldene RegelRegelGoldene nicht zu lösen vermag, nämlich das Problem des Fanatikers, der dem Grundsatz huldigt: fiat iustitia, pereat mundus – Gerechtigkeit muss sein, auch wenn die Welt daran zugrunde geht. Der Fanatiker wäre also grundsätzlich bereit, Gewalt und Tod zu erleiden, wenn er selber in der Rolle des Betroffenen wäre. Die Goldene RegelRegelGoldene versagt in diesem Fall; sie funktioniert nur, solange es um ›normales‹ moralisches Verhalten geht. Sobald jemand die katastrophalen FolgenFolgen einer unmenschlichen Tat für sich selbst akzeptiert und zu tragen bereit ist, endet nicht nur die Plausibilität der Goldenen RegelRegelGoldene, sondern die Wirksamkeit jedes noch so vernünftigen Arguments, da moralische Eiferer und Fanatiker sich auf keinen echten Dialog einlassen.
Lenkt die Goldene RegelRegelGoldene den Blick auf die Qualität des Willens, durch den eine Tat zu einer moralischen HandlungHandeln/Handlung wird, so bezieht sich eine andere Formulierung des Maßstabs der Moral, der in der Alltagspraxis ebenfalls häufig Verwendung findet, auf die möglichen FolgenFolgen einer HandlungHandeln/Handlung: Nach dem Prinzip der VerallgemeinerungPrinzip der Verallgemeinerung (umgangssprachlich in dem Argument enthalten: »Stell’ dir vor, was passieren würde, wenn alle so handelten wie du.«) gilt eine HandlungHandeln/Handlungmoralische(s)dann als unmoralisch, wenn ihre generelle Ausführung unzumutbare Konsequenzen nach sich zöge.
In einem sehr trockenen Sommer herrscht Wasserknappheit, und jeder ist gehalten, seinen Wasserverbrauch einzuschränken. Herr X füllt seinen Swimmingpool neu auf. Frau Y lässt den ganzen Tag den Rasensprenger laufen. Nachbar Z weist beide auf die katastrophalen FolgenFolgen hin, die sich ergäben, wenn jeder die gleichen Wassermengen verbrauchte.
Das Prinzip der Verallgemeinerung appelliert somit an das VerantwortungsbewusstseinVerantwortung des Handelnden, indem es ihn dazu verpflichtet, die Zukunft mitzuberücksichtigen und nicht um der Befriedigung eines aktuellen Bedürfnisses willen die eventuellen FolgenFolgen einer HandlungHandeln/Handlung außer Acht zu lassen. Dieses Problem stellt sich heute in besonderem Maß im Zusammenhang mit Umweltfragen. Können wir es moralisch verantworten, unseren Nachkommen eine durch Abgase, Müll und atomare Verseuchung zerstörte Welt zu hinterlassen, nur um uns einen möglichst hohen Lebensstandard zu ermöglichen?
1.3Der Ansatz ethischen Fragens
Im Anschluss an die Beschreibung der verschiedenen Erscheinungsformen der MoralMoral, wie sie uns im Alltag begegnet, lässt sich nun der Begriff der MoralMoralBegriff der bestimmen und gegen den Begriff der MoralitätMoralität/Sittlichkeit abgrenzen. Zugleich kann in einem ersten Anlauf die Aufgabe der EthikEthikAufgabe der umrissen werden, die sich weniger mit Einzelphänomenen und Spezialproblemen der MoralMoral als mit der begrifflichen Struktur des Verhältnisses von MoralMoral und MoralitätMoralität/Sittlichkeit befasst.
Im Wesentlichen sind es drei Momente, die den Begriff der MoralMoralBegriff der (im Sinne von ἔθοςEthos) charakterisieren:
Der Begriff der MoralMoralBegriff der umfasst alle teils naturwüchsig entstandenen, teils durch Konvention vereinbarten, teils durch TraditionTradition überlieferten, aus wechselseitigen AnerkennungsprozessenAnerkennung hervorgegangenen OrdnungOrdnungs- und Sinngebilde (RegelRegel





























