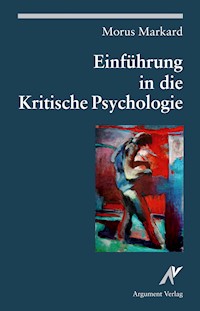
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argument Verlag mit Ariadne
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die von Klaus Holzkamp begründete Kritische Psychologie begann mit einer Kritik der Funktion der Psychologie als Herrschaftswissenschaft und einer Methodik, die 'Verhalten' nur als Arrangement unter fremdgesetzten Bedingungen erfasst. Die Einführung zeichnet nach, wie diese Kritik zur marxistischen Subjektwissenschaft entwickelt wurde. Als solche will sie Möglichkeiten auf den Begriff bringen, die in der traditionellen Psychologie nach wie vor theoretisch verkannt und in der kapitalistischen Gesellschaft praktisch behindert werden. Wie mit den Kategorien der Kritischen Psychologie und mit ihren theoretischen, methodischen und praxisbezogenen Konzepten diese emanzipatorische Perspektive zu gewinnen ist, wird ebenso dargestellt wie konkrete Probleme, die sich dabei ergeben. Überlegungen, welche Aufgaben sich für eine Weiterentwicklung der Kritischen Psychologie stellen, runden den Band ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morus Markard
Einführung in die Kritische Psychologie
Argument
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Deutsche Originalausgabe
© Argument Verlag 2009/2022
Glashüttenstraße 28, 20357 Hamburg
Telefon 040 / 4018000 – Fax 040 / 40180020
www.argument.de
Umschlagbild: Christoph Krämer, Tänzer
ISBN 978-3-86754-829-8 (E-Book)
ISBN 978-3-88619-335-6 (Buch)
Für Christiane (conditio sine qua non) und Nora
und all die Studierenden, von denen ich in der Lehre gelernt habe
Dank für Lektorat und Kritik an Dagmar Hübner, Christina Kaindl, Arn Thorben Sauer und Gisela Ulmann
Es ist mir egal, was die Leute von mir denken.
Mir ist aber nicht egal, was ich selbst von mir denke.
Clint Eastwood
1. Einleitung
1.1 Was meint »kritische Wissenschaft«?
Die kritische Psychologie gibt es eigentlich nicht. Vielmehr gibt es eine Vielzahl von Arbeitsrichtungen, Schulen, Ansätzen in der Psychologie, die sich »kritisch« nennen bzw. so bezeichnet werden (vgl. auch Billig 2006); sie reichen, um einige Beispiele anzuführen, von gemeindepsychologischen über psychoanalytische, kulturpsychologische, feministische bis zu ›poststrukturalistischen‹ Richtungen. Ihr kleinster gemeinsamer Nenner besteht darin, sich nicht dem experimentell-statistisch orientierten Mainstream der Psychologie zuzurechnen oder ihm zugeschlagen zu werden und sich mit irgendeinem Aspekt des gesellschaftlichen Status quo auseinanderzusetzen.
Der kritisierte Mainstream der Psychologie hat allerdings einen methodologischen Paten, der ebenfalls das Beiwort, »kritisch« im Namen führt, den Kritischen Rationalismus nämlich, der, salopp formuliert, grundsätzlich alle Aussagen kritisiert, die nicht nach einem bestimmten methodischen Regelwerk einer empirischen Prüfung zu unterziehen und damit nicht experimentell widerlegbar sind. Außerdem kann sich auch der psychologische Mainstream durchaus kritisch mit gesellschaftlich vorfindlichen Problemen befassen, wie klassische Experimente zum Autoritätsgehorsam (Milgram 1973), zur Konformität (Asch 1951) oder zur Verantwortungsdiffusion (Latané & Darley 1970) zeigen: Milgrams weltberühmte Studien waren inspiriert durch den deutschen Faschismus und die Kritik an US-Brutalitäten in Vietnam, Asch wollte die Mechanismen der Anpassung durch psychischen Gruppendruck aufzeigen, und die Forschung zur Verantwortungsdiffusion nahm ihren Ausgang von dem spektakulären Fall, dass 1964 in New York vor den Augen von 38 aus dem Fenster schauenden Menschen eine junge Frau ermordet wurde, ohne dass jemand ein- oder zumindest zum Telefon gegriffen hätte (Aronson 1972, 65; Aronson et al. 2004, XIV, 29f, 33, 422f).
Weder der Terminus »Kritik« scheint also trennscharf zu sein noch die Wortverbindung von Kritik und Psychologie – und kritische Intentionen lassen sich auch in Ansätzen und Untersuchungen aufweisen, die »Kritik« nicht im Namen führen.
Damit besteht für uns, wenn wir klären wollen, was »Kritische Psychologie« bedeutet, nicht nur das Problem, dass einerseits sich viele unterschiedliche Ansätze in der Psychologie als »kritisch« bzw. »critical« sehen und bezeichnen, sondern auch, dass Ansätze und einzelne Untersuchungen, die sich nicht eigens als »kritisch« bezeichnen, gleichwohl Kritik üben.
Das gibt uns Anlass, die Frage zu stellen, ob nicht recht eigentlich jede wissenschaftliche Psychologie, allgemeiner: jedwedes Bemühen, das den Namen »Wissenschaft« verdient, kritisch ist, sein muss. Und dies ist in der Tat so: Wissenschaft ist insofern immer schon kritisch, als sich die jeweiligen Ansätze, Autorinnen und Autoren in Auseinandersetzung mit anderen Ansätzen, also kritisch gegenüber anderen Ansätzen und Autorinnen und Autoren, legitimieren. So ist – um einige Beispiele aus der Psychologie(geschichte) anzuführen – die Psychoanalyse kritisch gegenüber dem Behaviorismus (und natürlich umgekehrt), systemische Ansätze (in der Therapie) kritisieren individuumszentrierte, die Gestaltpsychologie entwickelte sich in Kritik der assoziationistischen Psychologie, neuro-psychologische Erklärungen liegen im Streit mit sozio-psychologischen, was etwa die Erklärung oder das Verstehen von »Hyperaktivität« und »Aufmerksamkeitsdefizit« angeht, und die erwähnten Studien Milgrams stellen mit der Betonung situativer Aspekte des Autoritätsgehorsams eine alternative Erklärung dar zur Theorie der autoritären Persönlichkeit, die persönliche Dispositionen betont (Adorno 1973). Generell legitimieren sich viele experimentelle Untersuchungen mit der Kritik an vorherigen experimentellen Studien (wenn etwa auf der Basis der Dissonanztheorie lerntheoretischen Vorhersagen widersprechende Hypothesen aufgestellt und geprüft werden), die Literatur zur kritischen Einschränkung des Geltungsbereichs experimentell geprüfter theoretischer Aussagen durch Zusatzvariablen ist Legion (Markard 1984), ebenso die alternative Interpretation experimenteller Befunde etwa im Rahmen der »Sozialpsychologie des Experiments« (Bungard 1984) oder der »Management Impression Theory« (Mummendey 2002).
Die – beliebig zu verlängernde – Reihe dieser Beispiele für gegenseitige Kritik umfassender Orientierungen wie weniger weit reichender Theorien macht anschaulich, dass »Kritik« – wie es in der »Europäischen Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften« heißt (Röttgers 1990, 889) – für Wissenschaft geradezu ein Verpflichtungsbegriff, die Vorstellung unkritischer Wissenschaft ein Oxymoron, also in sich widersprüchlich, ist.
Nicht nur das: W.F. Haug (2006, 8) hat hervorgehoben, dass »Kritik« auch im außerwissenschaftlichen Bereich allgegenwärtig, geradezu ein Allerweltsbegriff (geworden) ist – aber auch ein »stachelloser Gemeinplatz«. Haug bezieht sich dabei auch auf das »Historische Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland« (Bd. 3, 1982). Darin heißt es im Stichwort »Kritik« (auch hier von K. Röttgers verfasst), der Begriff der Kritik sei »inhaltlich bagatellisiert und politisch depotenziert worden. Und dass man sich allgemein kritisch nennt, hindert nicht, dass radikale Kritik wie eh und je ebenso allgemein suspekt erscheint.« (Zit. nach Haug, a. a. O., 171)
Wenn das Beiwort »kritisch« im Terminus »Kritische Psychologie« nicht trivial sein soll, so muss »kritisch« hier eine spezifische Bedeutung besitzen, und diese besteht in der Verbindung von Wissenschafts- und Gesellschaftskritik (Markard 2000a). Aber bringt uns das wirklich weiter, wenn wir das oben Gesagte bedenken, dass selbst die Mainstream-Psychologie gesellschaftliche Probleme aufgreift und kritisiert?
Holen wir uns Rat bei Max Horkheimer, bei einer Passage, in der er darlegt, was er unter »kritischer Wissenschaft« oder »kritischem Denken« versteht: Dieses
»ist nicht nur darauf gerichtet, irgendwelche Missstände abzustellen, diese erscheinen ihm vielmehr als notwendig mit der ganzen Einrichtung des Gesellschaftsbaus verknüpft. Wenngleich es aus der gesellschaftlichen Struktur hervorgeht, so ist es doch weder seiner bewussten Absicht noch seiner objektiven Bedeutung nach darauf bezogen, dass irgend etwas in dieser Struktur besser funktioniere. Die Kategorien des Besseren, Nützlichen, Zweckmäßigen, Produktiven, Wertvollen, wie sie in dieser Ordnung gelten, sind ihm vielmehr selbst verdächtig und keineswegs außerwissenschaftliche Voraussetzungen, mit denen es nichts zu schaffen hat. Während es zum Individuum in der Regel hinzugehört, dass es […] seine Befriedigung und seine Ehre darin findet, die mit seinem Platz in der Gesellschaft verknüpften Aufgaben nach Kräften zu lösen und bei aller energischen Kritik, die etwa im Einzelnen angebracht sein sollte, tüchtig das Seine zu tun, ermangelt jenes kritische Verhalten durchaus des Vertrauens in die Richtschnur, die das gesellschaftliche Leben, wie es sich nun einmal vollzieht, jedem an die Hand gibt.« (1937, 180f)
Wie in einem Brennglas, scheint mir, werden hier verschiedene Facetten kritischen Denkens gebündelt, auf den Punkt gebracht. Gehen wir deshalb diese Facetten kurz durch:
(1) Kritisches Denken »ist nicht nur darauf gerichtet, irgendwelche Missstände abzustellen, diese erscheinen ihm vielmehr als notwendig mit der ganzen Einrichtung des Gesellschaftsbaus verknüpft«. Als »Missstände« dürften z. B. Gewalttätigkeiten unter Schülerinnen und Schülern oder gegen Menschen nicht »weißer« Hautfarbe ebenso gelten wie die Vernachlässigung von Kindern. Die (scheinbar) einfachste und nächstliegende »Lösung« wäre, diese Missstände den beobachtbaren Akteuren (»Schlägern«, »Rassisten«, »Rabenmüttern« bzw. Vätern) unmittelbar anzulasten und gegen diese dann Maßnahmen zu ergreifen; das mag im einzelnen Fall auch unvermeidlich sein – die Frage ist aber, inwieweit damit die entsprechenden Missstände tatsächlich abzustellen sind oder sich immer wieder reproduzieren. Horkheimers Problemfassung geht dabei nicht in die Richtung, bei den Einzelnen entsprechende Handlungsdispositionen zu diagnostizieren, sondern etwa folgende Frage zu stellen: Hat die physische Gewalt unter Schülerinnen und Schülern etwas mit jener strukturellen Gewalt zu tun, die darin liegt, dass die Schule – auch – ein Selektionsinstrument bei der Vergabe von Lebenschancen ist, und hat diese Selektionsfunktion mit jenem Konkurrenzmechanismus zu tun, der unsere Gesellschaft beherrscht, damit, dass entsprechende Existenzängste sich in Gewalttaten artikulieren? Ist Konkurrenz nicht ein Prinzip, das das Ruinieren anderer impliziert? Sind die Taten von »Rassisten« – auch – Ausdruck gesellschaftlicher Zustände, in denen Menschen vor allem unter dem Aspekt ihrer ökonomischen Verwertbarkeit beurteilt werden, in denen sie nach Herkunft und Hautfarbe klassifiziert und unterschiedlich behandelt werden, in denen »Würde« durchaus antastbar, eher also ein Konjunktiv als unhintergehbares Prinzip ist? Ist Kindesvernachlässigung – allein – Problem von Eltern oder auch Ausdruck von eingeschränkten Lebensperspektiven, verheerenden Wohnsituationen, unzureichenden gesellschaftlichen Angeboten für Kinder etc. Diese Frage zu stellen, bedeutet nicht, sie einfach mit »ja« zu beantworten, wohl aber eine grundsätzliche Skepsis gegenüber der illusionären Vorstellung, die erwähnten Missstände seien einfach abzustellen, ohne ihrer Eingebettetheit in der gesellschaftlichen Struktur nachzugehen. Das heißt nicht, dass im Rahmen dieser gesellschaftlichen Struktur »nichts zu machen« sei, wohl aber, dass ohne deren Einbeziehung die Grundlage der Missstände unangetastet bleibt.
(2) Kritisches Denken ist »weder seiner bewussten Absicht noch seiner objektiven Bedeutung nach darauf bezogen, dass irgend etwas in dieser Struktur besser funktioniere«. Dies lässt sich auf der Grundlage des bisher Gesagten so verdeutlichen: Diese Aussage bezieht sich nicht darauf, dass überhaupt nichts besser funktionieren soll, sondern zielt in Intentionen und Geltung auf Sachverhalte, an denen sich ein funktional relevanter Zusammenhang zur gesellschaftlichen Struktur aufweisen lässt. Es geht also nicht darum, dass das Tropfen eines Wasserhahns nicht abgestellt oder eine defekte Toilettenspülung nicht repariert werden sollte, sondern es geht um Sachverhalte, bei denen ein Eingriff zur Missstandsbehebung gleichzeitig, wenn nicht gar in erster Linie, eine Stabilisierung der – problematisierten – gesellschaftlichen Struktur mit sich bringt, insoweit deren wesentlicher oder konstituierender Bezug zum Problem ausgeblendet wird. Um hier auf eines der Beispiele aus (1) zurückzukommen: Wenn es Schulpsychologinnen und -psychologen gelingen sollte, die Zahl gewalttätiger Ausschreitungen zu vermindern, ist dies natürlich für die Opfer dieser Ausschreitungen ein Vorteil. Die mit Horkheimer aufzuwerfende Frage ist dann aber: Wie stabil ist der Erfolg, wenn Gewalttätigkeiten Ausdruck der skizzierten strukturellen Gewalt sind? Und: Falls die Gewalttätigkeiten einen unartikulierten Widerstand zum Ausdruck bringen, wird dann mit der Überwindung oder der Brechung dieses Widerstands die strukturelle Gewalt der Selektionsfunktion der Schule nur befestigt, reibungsloser gemacht? Würde es nicht eher darum gehen, dazu beizutragen, unartikulierten Widerstand gesellschaftlich so zu artikulieren, dass er sich nicht in Gewaltakten gegen Mitschülerinnen und Mitschüler richtet, sondern die in der Schule bestehenden Selektions- und Konkurrenzverhältnisse thematisiert? In eben diesem Sinne ist ›kritisches Denken‹ nicht auf reibungsloses Funktionieren aus, sondern darauf, den Reibungen auf den Grund zu gehen.
(3) »Die Kategorien des Besseren, Nützlichen, Zweckmäßigen, Produktiven, Wertvollen, wie sie in dieser Ordnung gelten, sind [dem kritischen Denken, M. M.] […] verdächtig«. Lässt sich meine Argumentation hier einfach fortführen? Ist nicht das Zurückdrängen (rassistischer) Gewalt oder von Verwahrlosung/Vernachlässigung gut, nützlich, zweckmäßig, wertvoll – egal wer das fordert, egal ob Gewaltverzicht und Fürsorge »in dieser Ordnung« gelten? Sind Gewaltverzicht und Fürsorge nicht sozusagen »Werte«, gegenüber denen nicht ernsthaft Opposition oder Kritik angemeldet werden kann? Was sollte dann also daran »verdächtig« sein? Verdächtig ist in den bisher beispielhaft angeführten Fällen und Konstellationen, dass bzw. wenn die Propagierung dieser »Werte« die für verschiedene Menschen unterschiedlichen gesellschaftlichen und materiellen Realisierungsbedingungen ausblendet, wenn bspw. dem Habenichts oder der überforderten Mutter empfohlen wird, »Frustrationstoleranz« zu entwickeln, wenn der Aussicht, dass, wer arbeiten wolle, das auch könne, die schreiende Diskrepanz zwischen den Zahlen offener Arbeitsstellen und »Jobsuchenden« im Wege steht. Aber es geht in Horkheimers Passage nicht um solche Diskrepanzen, deren Thematisierung durchaus in der Linie unserer bisherigen Argumentation liegt, es geht um mehr: Darum, dass es »Kategorien des Besseren …« gibt, die durchaus nicht ›oppositionsfrei‹, sondern zu ›hinterfragen‹ sind.
Das möge wieder ein Beispiel veranschaulichen: Welchen Interessen und Zielen psychologische Ausbildung und Praxis nützen sollen, was produktiv und wertvoll ist, ist in einem programmatisch gemeinten Band über Psychologie an Fachhochschulen (Günther 1999a) schon gar keine Frage mehr, sondern in der normativen Kraft des Faktischen schon beantwortet: »Wer am Marktgeschehen teilnehmen will, muss etwas für den Geschäftspartner Verwertbares anbieten.« (Günther 1999b, 25) Diese »Geschäftspartner« sind (natürlich nicht als solche bezeichnete) Kapitalisten, deren Meinungen zu Studiengängen in Umfragen erhoben werden (Müller & Kaune 1999, 138). Dabei kristallisiert sich heraus: Perspektive der Argumentation ist die Erhöhung praktischer Tüchtigkeit in einer widerspruchs- und klassenlos erscheinenden Gesellschaft. Eine ausbildungsrelevante Fragestellung lautet dementsprechend in diesem Rahmen des Wertvollen und Nützlichen, wie es in dieser Ordnung gilt: »Wie organisiert sich Frau Müller selber, um den gestellten Aufgabenumfang in der vorgegeben Zeit effizient und erfolgreich zu bewältigen?« (Weßling 1999, 72) Diese Frage sei ein Beispiel für die – von der Psychologie und deren Verhaltenstrainings zu leistende – »Förderung sozialer Handlungskompetenz« (73). Kritischem Denken muss der hier sich vollziehenden Begriffsverschiebung nachgehen, sie thematisieren und kann dann feststellen: In der Situation, in der Frau Müller sich zu bewähren hat, geht es gar nicht um soziale Handlungskompetenz, sondern um ein individuelles Bestehen in fremdbestimmt-asozialen Verhältnissen in im Übrigen gewerkschaftsfrei konzipierten Zonen.
(4) Für das kritische Denken sind die geltenden »Kategorien des Besseren, Nützlichen, Zweckmäßigen, Produktiven, Wertvollen […] keineswegs außerwissenschaftliche Voraussetzungen, mit denen es nichts zu schaffen hat.« Ist der Umstand, dass die oben erwähnte Frau Müller einen bestimmten Aufgabenumfang in einer bestimmten Zeit zu bewältigen hat, ein wissenschaftliches oder ein außerwissenschaftliches Thema? Sieht man darin ein außerwissenschaftliches Thema, besteht dessen wissenschaftlicher bzw. psychologischer Aspekt allein darin, mit welchen Mitteln man Frau Müller dazu befähigen kann, einen bestimmten Aufgabenumfang in einer bestimmten Zeit zu bewältigen. Dann hätte Wissenschaft – Psychologie – nur damit zu tun zu klären, wie bestimmte Ziele erreicht werden können, nicht aber damit, ob diese Ziele erreicht werden sollen, ob (und ggf. für wen) es sinnvoll ist, diese Ziele zu erreichen. Ist diese Trennung von Wissenschaft und Gesellschaft sinnvoll?
Ich will, weil ich im nächsten Kapitel ausführlich darauf zurück kommen werde, diese – für die Entstehung der Kritischen Psychologie wesentliche – Frage hier nicht weiter verfolgen, sondern zunächst nur die Bilanz vortragen, die Horkheimer aus seiner Bestimmung kritischer Wissenschaft zieht: Für »Subjekte kritischen Verhaltens« gelte: »diese Welt ist nicht die ihre, sondern die des Kapitals« (a. a. O., 181).
Wenn man mit Jameson (1996, 175) der Auffassung ist, dass der Marxismus »die Wissenschaft von den inhärenten Widersprüchen des Kapitalismus« ist, dann legt Horkheimers Bilanz die Fassung der Bedeutung von »kritisch« als »marxistisch« nahe. Eben dies meint auch Haug. Wenn Kritik kein »stachelloser Gemeinplatz« sein soll, ist die Frage zu stellen,
»wer wen oder was kritisiert, und dies von welchem Standpunkt aus. Der anstößige Name Marx gibt dem Begriff der Kritik seinen Stachel und seine Verheißung zurück, wenn es gelingt, den Impuls, für den dieser Name steht, aus seiner konstantinischen Wende1, der ersten Staatswerdung des marxistischen Sozialismus, zurückzugewinnen.« (2006, 8)
1.2 Klaus Holzkamps Vorstellung von (kritischer) Wissenschaft
Und in eben diesem Sinne ist die Kritische Psychologie, wie sie von Klaus Holzkamp und in dessen Arbeitszusammenhang entwickelt wurde, als »marxistisch«, als marxistische Perspektive auf den Zusammenhang von Psychologie- und Gesellschaftskritik, zu verstehen. (Das große »K« ist hierbei übrigens nichts weiter als eine Kennzeichnung der hier verhandelten Variante kritischer Psychologie.)
Meine Einführung in die Kritische Psychologie will dementsprechend nachvollziehbar machen, wie aus einer Kritik der vorfindlichen Psychologie die Kritische Psychologie in Richtung auf eine marxistische Subjektwissenschaft entwickelt wurde, und was dies theoretisch, methodisch und für die außerakademische Praxis bedeutet.
An der Ausarbeitung der Kritischen Psychologie waren viele beteiligt; gleichwohl stellt das Werk Klaus Holzkamps den zentralen Bezugspunkt dieses Ansatzes dar. Wenn ich mich deswegen in dieser Einführung auf seine Arbeiten konzentrieren werde, werde ich gleichzeitig deutlich zu machen versuchen, dass ohne die von anderen stammenden Arbeiten aus seinem Arbeitszusammenhang (dem ich selber seit Mitte der 70er Jahre angehörte), die Entwicklung der Kritischen Psychologie nicht möglich gewesen wäre. Gleichzeitig möchte ich Differenzierungen und Differenzen, die sich dabei ergeben haben, darstellen; auch offene Fragen und Probleme.
Eine Gefahr, die eine »Einführung in …« mit sich bringt, ist die »Kanonisierung«. Kanonisierung aber ist hinderlich und gefährlich für kritisches Denken, das sich im immer neuen Widerspruch, im Widersprechen, im Zuwiderhandeln bewähren muss (statt in Widersprüchen modische Flexibilität zu beweisen).2 Der Ausdruck »Einführung in …« vermittelt immer den Eindruck einer gewissen Abgeschlossenheit, des Festen, des sicher Gewussten, des Handhabbaren, des Festsetzens von eigentlich Bewegendem und sich Bewegendem. Oft hat Klaus Holzkamp ausdrücklich auf die Bedeutung hingewiesen, die der Dialog und die Auseinandersetzung mit den Studierenden für die Entwicklung beider Seiten hatte.
Auf der anderen Seite aber ist es kaum zu übersehen, dass viele Studierende, die sich mit der Kritischen Psychologie auseinandersetzen oder unter Bezug auf sie – etwa in Studien-Praktika – arbeiten wollen, diese dialogischen Möglichkeiten nicht (mehr) haben, dass ihnen grundlegende Kenntnisse der Geschichte und des Erkenntnis- und Problembestandes der Kritischen Psychologie kaum zugänglich sind, und dass sie deswegen an einer Einführung interessiert sind. Jedenfalls lassen es sowohl die Entwicklung der Kritischen Psychologie wie ihre geringe Repräsentanz an Hochschulen als sinnvoll, wenn nicht erforderlich, erscheinen, Geschichte und Denkweisen der Kritischen Psychologie (auch) in einer »Einführung« zu vermitteln.
Um dabei der Tendenz zur Kanonisierung entgegen zu wirken, werde ich mich bemühen, jene Haltung zu ›transportieren‹, die in Holzkamps »emphatischer« (1983b, 164) Bestimmung von Wissenschaft allgemein, also nicht allein kritischer Wissenschaft, zum Ausdruck kommt. Danach ist Wissenschaft
»ein prinzipielles Gegen-den-Strom-Schwimmen, dabei vor allem auch gegen den Strom der eigenen Vorurteile, und in der bürgerlichen Gesellschaft zudem gegen die eigene Tendenz zum Sich-Korrumpieren-Lassen und Klein-Beigeben gegenüber den herrschenden Kräften, denen die Erkenntnisse gegen den Strich gehen, die ihren Herrschaftsanspruch gefährden könnten. Demnach ist Wissenschaft quasi als solche Kritik und Selbstkritik: Aber nicht die konkurrenzbestimmte profilierungssüchtige Kritik vieler bürgerlicher Intellektueller, sondern eine Kritik zur Durchsetzung des menschlichen Erkenntnisfortschritts im Interesse aller Menschen gegen die bornierten Interessen der Herrschenden an der Fortdauer menschlicher Fremdbestimmung und Unmündigkeit.« (A. a. O., 163f.)
Die Notwendigkeit, die Bedingungen, die gesellschaftlichen und institutionellen Umstände der eigenen Arbeit und des eigenen Denkens mit zu reflektieren, macht Kritik zu einer Art Daueraufgabe, und zwar genau dann, wenn man sich selber bzw. die eigenen Ansprüche an Einsicht und Handeln nicht aufgeben will. Es sind dabei zwei Momente, die Holzkamp hervorhebt: die Bereitschaft zu Veränderung und Selbstkritik und eine Resistenz gegenüber jener Flexibilität, die zur Grundausstattung (»Schlüsselkompetenz«) bürgerlicher Anpassung und Wendigkeit gehört.
Schon sein Sich-Einlassen auf die Wissenschaftskritik der Studentenbewegung, mit der Holzkamp sich als gerade etablierter Wissenschaftler konfrontiert sah (und die ich im folgenden Kapitel nachzeichnen will), zeugt davon, wie er beide Momente verband. Vielleicht ist es überhaupt zum besseren Verständnis seines Werkes günstig, wenn ich vor dessen Rekonstruktion einige Bemerkungen zur Arbeitsweise Klaus Holzkamps mache (vgl. Markard 1997).
Sicher war Holzkamp ein streitbarer Wissenschaftler. Er suchte zwar Kontroversen nicht, wich ihnen aber auch nicht aus. Er argumentierte nicht nur wissenschaftlich, sondern auch politisch – nicht, weil er ein durch und durch politischer Mensch gewesen wäre – er sah dazu nur keine Alternative, weil er den gesellschaftlichen Konsequenzen seiner wissenschaftlichen Überlegungen nicht ausweichen wollte. Er verfolgte ihm wichtige Fragestellungen unabhängig von Theoriemoden, und er ließ sich dabei nicht von ursprünglich gemachten Zeitplanungen unter Druck setzen, eine Haltung, die mit wissenschaftsexternen Forschungs- und Zeitplanungen denkbar schlecht kompatibel ist.
In all diesen Dingen war er ein Gelehrter alten Stils. Ihm gingen die von Adorno kritisierten »Händlerqualitäten« ab, die Fähigkeiten eines Wissenschaftlertyps, der sich »unentbehrlich« macht durch »Kenntnis aller Kanäle und Abzugslöcher der Macht«, ihre »geheimsten Urteilssprüche« errät und von deren »behänder Kommunikation« lebt (Adorno 1951, 24). Er arbeitete alleine, brauchte Ruhe und Einsamkeit, diskutierte aber Probleme, Hypothesen und Resultate in verschiedenen – darunter (s. o.) studentischen – Arbeitszusammenhängen. Seiner Vorstellung von wissenschaftlicher Gemeinschaft war die Betriebsamkeit der scientific community fremd, deren Produktion vom Takt der Tagungen und vom Kalender der Kongresse gesteuert wird, und die den Wert von Forschung an der Höhe fristgerecht eingeworbener und ausgegebener Drittmittel misst. Studierende fasste er nicht als Objekte eines kanonisierten Lehr- und Prüfungswesens und -wissens. Vielmehr begriff er sie als mitdenkende, querdenkende, vorausdenkende, jedenfalls als Subjekte. So war ihm auch bewusst, dass eine sachfremde Hierarchie im Widerspruch zu einer Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden und einer damit verbundenen Diskussions-, Streit- und Lernkultur steht.
Es ist nicht nur die Kritische Psychologie, die in ihren konzeptuellen und methodischen Vorstellungen in Spannung zur Mainstream-Psychologie steht, auch die wissenschaftliche Haltung ihres Begründers war gelebte Kritik am Wissenschaftsbetrieb.
1992 gefragt, ob und wie es wohl mit der Kritischen Psychologie weitergehe, meinte Klaus Holzkamp, im – universitär institutionalisierten (!) – »Jammerfach Psychologie« gebe es (wie übrigens auch für die freudsche Psychoanalyse, auf die ich nicht in einem eigenen Kapitel, aber in verschiedenen Zusammenhängen eingehen werde) »für uns keine richtige Perspektive«. Aber es werde wohl – interdisziplinär – immer Leute geben, die sich auf die Kritische Psychologie »als Arbeitsrichtung […] beziehen und da weiterarbeiten« (1996a, 580).
Dazu will meine Einführung einen Beitrag leisten.
2. Die Bedeutung der Studentenbewegung und ihrer Wissenschaftskritik für die Entwicklung der Kritischen Psychologie
2.1 Zum gesellschaftlichen Hintergrund der Wissenschaftskritik der Studentenbewegung
Die Herausbildung und Entwicklung der Kritischen Psychologie ist von der Wissenschaftskritik der Studentenbewegung nicht zu trennen, in der die Frage nach der Funktion der Wissenschaften eine wesentliche Rolle spielte.
Noch in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts repräsentierten die Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland ein Feld institutioneller Bedingungen, das die Reflexion von Wissenschaft auf ihre gesellschaftlichen Aufgaben, Funktionen und Wirkungen hin nicht gerade beförderte. Diese Haltung, die mit dem Terminus »Elfenbeinturm«-Mentalität diskreditiert und verspottet wurde, verlor allerdings in dem Maße an unbefragter Selbstverständlichkeit, in dem offenkundig wurde, dass Wissenschaft (auch) ein Produktivfaktor ist, dass »Bildungsreserven« mobilisiert werden mussten, dass also die Gesellschaft eine gewisse Planung, eine quantitative Ausweitung und qualitative Veränderung im Forschungs-, Wissenschafts- und Bildungssektor brauchte.
Symptomatisch für die seinerzeitige Situation ist der sog. Sputnikschock: Im Kampf um die Eroberung des Weltraums hatte die Sowjetunion die erste Etappe gewonnen, als sie am 4. Oktober 1957 den ersten Erdsatelliten der Geschichte (»Sputnik 1«) in eine Erdumlaufbahn brachte und am 3. November desselben Jahres gleich einen zweiten (»Sputnik 2«) folgen ließ, sogar mit einem Lebewesen, einer Hündin namens Laika (die allerdings wegen Sauerstoffmangels nach 5 Tagen verendete) an Bord. Erst am 2. Februar 1958 folgte dann ein US-amerikanischer Satellit (»Explorer 1«). Am 12. September 1959 war es die sowjetische Sonde »Lunik 2«, die als erste den Mond traf; auch die ersten Bilder von der Rückseite des Mondes, die am 4. Oktober 1959 übermittelt wurden, stammten von einer sowjetischen Sonde. Danach wechselten sich die Erfolge ab, wobei allerdings mit ihrer im Fernsehen live übertragenen Mondlandung am 20. Juli 1969 die USA einen ausgesprochen prestigeträchtigen Knüller landeten.
Die Erfolge der Sowjetunion in der Systemkonkurrenz trugen dazu bei, die Gleichsetzung des bundesdeutschen Bildungssystems mit einer »Bildungskatastrophe« (Picht 1964) und damit die Reformbedürftigkeit dieses Bildungssystems ins allgemeine Bewusstsein zu rufen (zumal mit dem Bau der »Mauer« der Zufluss von in der DDR Qualifizierten in den »Westen« versiegte). Insofern waren die Studentenbewegung und ihre zeitweiligen Erfolge auch Ausdruck einer gesellschaftlichen Notwendigkeit, in deren Realisierung sich dann allerdings gegensätzliche – technokratische und emanzipatorische – Konzepte gegenüber standen (vgl. Bultmann & Weitkamp 1999).
Eine der zentralen Frage war (und ist) die, ob das Verhältnis von Wissenschaft und ihrer gesellschaftlichen Inanspruchnahme demokratisch zu organisieren ist oder nicht. Zunächst sah es in den Hochschulen nicht so aus, dass solche Fragen – zumindest öffentlich und systematisch – diskutiert wurden. Begünstigt wurde dies dadurch, dass faktisch nur der Nachwuchs des mehr oder weniger gehobenen Bürgertums und Bildungsbürgertums studierte. Die »Intelligenz« als eine auch für die gesellschaftliche Produktion zahlenmäßig bedeutsame Schicht existierte noch kaum. Zu studieren war gleichbedeutend mit besten Berufsaussichten. Es gab sehr viel weniger Studierende als heute, Mitbestimmung an den Hochschulen war faktisch ein Fremdwort, Institute wurden von den Direktoren wie Duodez-Fürstentümer verwaltet, Zwischenfragen in Vorlesungen galten fast als Körperverletzung, das allmählich aufkommende »Hinterfragen« von in Lehrveranstaltungen vorgetragenen Lehrmeinungen wurde allemal als Provokation aufgefasst (und musste entsprechend so gemeint sein – mit dann auch durchaus mobilisierendem Effekt): Vorlesungskritik als Form des Widerstandes gegen die »Untertanenfabrik« (Leibfried 1967).
Die hier begründete Tradition der Auseinandersetzung mit der Lehre an den Hochschulen wäre im Übrigen nach wie vor die Alternative zu dem, was derzeit als »Evaluation der Lehre« fungiert, sei es in infantilen »Prüf den Prof«-(Internet-)Rankings, sei es in fragebogenförmigen Umfragen, die Fachbereiche zum Semesterende veranstalten, und an denen teilzunehmen z. T. damit erzwungen wird, dass die Scheinvergabe an die Teilnahme an der Evaluation gekoppelt ist. Diese Art der »Evaluation« ist bloß ein (herrschaftsförmiges) Surrogat für Reformen und inhaltliche Auseinandersetzungen. Sie ersetzt nämlich Mitbestimmung und praktisches Eingreifen durch Stimmungs- und Meinungsumfragen (die wiederum auch zur Gehaltsregulation der Lehrenden funktionalisiert werden können); Wissenschafts- und Lehrkritik verkommt auf diese Weise zu einer Art lehrbezogener Trenderhebung und Wellnessberatung und zu Popularitätsindizes.
Die im »Elfenbeinturm« beflissen gepflegte strikte Trennung von Wissenschaft und Gesellschaft/Politik wurde von konservativer Seite damit legitimiert, dass die ›Nazizeit‹ ja zu Genüge gezeigt habe, wohin es führe, wenn die Wissenschaft politisiert, sozusagen unter politisches Kuratel gestellt werde. Gerade aus der Erfahrung des deutschen Faschismus und dessen Überwältigung der deutschen Universitäten sei die Konsequenz zu ziehen, Wissenschaft und Politik, Wissenschaft und gesellschaftliche Ansprüche strikt zu trennen. Was bei dieser Argumentation allerdings verloren ging (und was dann auch entsprechend gegen diese Argumentation eingewendet wurde), war Folgendes: Man kann diese Entwicklung genau umgekehrt sehen: gerade weil die Hochschulen der Weimarer Republik – formal – politisch so abstinent sich gaben, herrschte dort ein Konservatismus, in dessen Klima die Nazis an den Hochschulen vielfach leichtes Spiel hatten (vgl. Kiel 2000; Brunkhorst 2002; für Psychologie: Graumann 1985).
In dieser Gegenargumentation ist mitgedacht, dass das Fehlen politisch-gesellschaftlicher Reflexion nicht auch das Fehlen von Politik bzw. politisch-gesellschaftlichem Einfluss bedeutet, sondern nur dessen Unbemerktbleiben oder Verschweigen. Was also als »Elfenbeinturm«, als Isoliertheit der Hochschule von Politik und Gesellschaft, in Erscheinung tritt, ist eher eine illusionäre Selbstbespiegelung von Hochschul-Akteuren bzw. eine Verkennung seitens der Betrachter von außen. Anders formuliert: Was als Isoliertheit der Hochschule von Politik und Gesellschaft in Erscheinung tritt, ist in Wirklichkeit nur die mehr oder weniger unauffällige Übereinstimmung mit dem gesellschaftlichen, politischen und ideologischen Status quo, also mit der ›herrschenden Meinung‹.
Insofern ist es für das Verständnis der Wissenschaftskritik der Studentenbewegung (und damit der Herausbildung der Kritischen Psychologie) wichtig zu sehen, dass in dieser Zeit der gesellschaftliche Konsens über die Ordnung der Dinge erodierte. Diese Erosion reichte von neuen Formen des Zusammenwohnens (»Wohngemeinschaften«) über das Aufbrechen einer kruden wie prüden Sexualmoral bis hin – und das war das eigentlich Gefährliche – zur Infragestellung der politisch-moralischen Unangefochtenheit der westlichen Front in der Ost-West-Systemkonfrontation; prominentestes Beispiel ist die Kritik des Vietnamkrieges, in dessen Verlauf immer mehr Menschen Zweifel über die hehren Ziele der USA zu hegen begannen, Zweifel daran, ob der damals kommandoführende General Westmoreland dort tatsächlich die Freiheit verteidigte (oder nicht doch eigentlich more westland erobern wollte, wie seinerzeit gekalauert wurde).
Hinzu kam, dass mit einer wirtschaftlichen Rezession, die 1967 ihren Tiefpunkt erreichte, der Glaube an die Unaufhaltsamkeit und Endlosigkeit des wirtschaftlichen Aufschwungs (»Wirtschaftswunder«) zu bröckeln begann, und die Bundesrepublik mit Streiks konfrontiert wurde, deren Ausmaß signalisierte, dass es ›nicht einfach so weitergehen‹ konnte wie bis dahin. Mit der Großen Koalition unter dem CDU-Kanzler Kiesinger war das dahin bestehende Regierungsmonopol von CDU bzw. CDU und FDP schon gebrochen worden; 1969 kam dann die sozialliberale Koalition unter dem SPD-Kanzler Brandt an die Regierung.
In den Hochschulen brach sich die Erosion des gesellschaftlichen Konsenses Bahn u. a. mit der Aufdeckung skandalöser Beispiele der Verflechtung von Wissenschaft und Technik mit gesellschaftlicher Repression und internationaler Ausbeutung (etwa Baritz 1960): Ein für die Psychologie bedeutsames Beispiel ist hier neben der Optimierung von Motivationsstrategien zur Produktivitätserhöhung (vgl. Holzkamp-Osterkamp 1975, 14ff) die sog. counterinsurgency-Forschung (vgl. Streiffeler 1975, 24ff), also sozialwissenschaftliche Forschung mit dem Ziel, das Ausbrechen von Revolten gegen neokoloniale Ausbeutung in Ländern der dritten Welt zu verhindern, ohne bzw. statt die Bedingungen grundlegend zu ändern, oder da, wo solche Revolten nicht mehr zu verhindern waren, sie niederzuschlagen, zu isolieren, zu kanalisieren etc. Das betrifft natürlich auch den Einsatz von Naturwissenschaften (etwa chemische und biologische Kriegsführung) in solchen Zusammenhängen. Es liegt auf der Hand, dass derartige Kritik mit dem Erstehen und Erstarken von Befreiungsbewegungen in der sog. »Dritten Welt« verbunden, ohne diese kaum denkbar war.
2.2 Kann, darf, muss Wissenschaft »wertfrei« sein?
Damit bin ich nach dieser knappen Skizze der gesellschaftlichen Situation der Bundesrepublik zu Beginn der Studentenbewegung wieder bei der Problemstellung angekommen: Für kritisches Denken sind, wie in der Einleitung wiedergegeben, die geltenden »Kategorien des Besseren, Nützlichen, Zweckmäßigen, Produktiven, Wertvollen […] keineswegs außerwissenschaftliche Voraussetzungen, mit denen es nichts zu schaffen hat« (Horkheimer 1937, 180f).
Diese Feststellung richtet sich gegen die – im Sinne Horkheimers »traditionelle« – Auffassung, dass Wissenschaft »wertfrei« sei, keine Werturteile enthalte bzw. enthalten dürfe, nur mit von gesellschaftlichen Strukturen zu trennenden Fakten sich zu befassen habe.
Die Auseinandersetzung darüber macht den Kern des »Positivismusstreits« (Adorno et al. 1969) aus, der in der (deutschen) Soziologie ausgetragen wurde und der seinen Ausgang von zwei gegensätzlichen Beiträgen K. Poppers und T.W. Adornos zum Thema »Logik der Sozialwissenschaften« nahm, die auf einer Arbeitstagung der deutschen Gesellschaft für Soziologie im Jahre 1961 gehalten und diskutiert wurden.
In der (Berliner) Psychologie wurde die – im Sinne Horkheimers – »traditionelle« Position z. B. von Hans Hörmann, Ordinarius an der FU Berlin, vertreten (alle Zitate seines Vortrages im Wintersemester 1962/63 nach der Dokumentation in Holzkamp [1972c]). Die Psychologie, so Hörmann, könne selber keine Ziele setzen, sondern nur Wege zur Erreichung anderweitig – durch »Religion«, »Moral«, »Ideologie« (213 [217]) – gesetzter Ziele aufweisen. Wenn also eine derartige außerwissenschaftliche Instanz bspw.
»hohe Leistung als gut und damit erstrebenswert erklärt, dann kann die Psychologie Auskunft geben über die Zusammenhänge dieses Leistungsstrebens mit dem Gefüge der übrigen Persönlichkeitseigenschaften, über den Einfluss von Erfolg und Misserfolg auf diese Motivationsstruktur, über den Einfluss bestimmter frühkindlicher Erfahrungen auf die Entwicklung dieses Strebens. Das heißt, aus den Erkenntnissen der Psychologie kann – bestenfalls – abgeleitet werden, was man tun muss, um in einem Menschen ein hohes Leistungsstreben zu erzeugen. Aber die Psychologie sagt niemals, ob man in einem Menschen ein hohes Leistungsstreben erzeugen soll.« (Ebd.)
Gleichwohl, so Hörmann, befalle einen ein gewisses Unbehagen, wenn die Psychologie nur Wege, nicht aber Ziele zeigen könne, wenn sie etwa den Weg zu einem glücklichen Leben liefern könne, nicht aber sagen könne, was Glück sei. Und er stellt die Frage:
»Bricht die Psychologie nicht zu früh ab? Oder anders gefragt: Was richtet die praktisch-technische Anweisung auf das Ziel aus? Was stellt die Klammer zwischen Psychologie und Gesellschaft mit dem für sie konstitutiven [sic!] Wertsystem? Welches ist das Gelenk, in dem Psychologie und Gesellschaft ineinandergreifen? […] Es ist der Psychologe. In ihm artikuliert sich die wichtigste Beziehung zwischen Psychologie und Gesellschaft. […] Mit dieser Ortsbestimmung des Psychologen bürden wir diesem freilich eine schwere Last auf. Wir verweigern ihm den Elfenbeinturm der reinen Wissenschaft, wir verweigern ihm aber auch das frag- und sorglose Dasein eines bloßen Handlungsgehilfen der Gesellschaft.« (Ebd.)
Der dergestalt als »Klammer« zwischen Psychologie und Gesellschaft fungierende Psychologe müsse »wachsam« sein gegenüber seinen verschiedenen Auftraggebern, aber auch gegen sich selbst. »Wir sehen den Psychologen nicht als den Vertreter einer Wissenschaft, sondern als den Vertreter einer Gesellschaft, unserer Gesellschaft, weil das Wissen der Psychologie auf Gesellschaft sich bezieht und in die Gesellschaft wirkt«, und weil das »Ethos«, auf das der Psychologe sich beziehe, stets »gesellschaftsbezogen« sei. »Welchem Ethos er sich verpflichtet fühlen soll, das kann ihm die Psychologie nicht sagen.« Sie stelle aber hohe Anforderungen an ihn, u. a. »zu wissen, wie leicht zu lenken der Mensch ist, und dennoch der Freiheit zu dienen« (ebd.).
Nach der von Hörmann vorgetragenen Auffassung ist das Verhältnis zwischen Gesellschaft bzw. Politik und Psychologie gleichsam äußerlich, es besteht kein inhaltlicher Zusammenhang zwischen der Psychologie und ihren Fragen und Antworten mit der Verfasstheit der Gesellschaft. Die Psychologie wird als ein wertfreies Instrument angesehen, das seine gesellschaftliche Funktion erst mit den Anwenderinnen und Anwendern bzw. mit deren Charakter erhält. Welche Funktion die Inhalte der Psychologie für die Gesellschaft bzw. die Betroffenen haben, ist keine Frage der Psychologie als Erkenntnissystem, sondern abhängig davon, wer die Psychologie wie anwendet. Die Psychologie wird so gedacht wie ein Messer, das in der Hand der Köchin oder des Kochs positiv, in der Hand der Mörderin oder des Mörders negativ zu bewerten ist. (Die Kritik dieser Argumentationsfigur, mit der die Funktion der Psychologie auf die Person der Psychologinnen und Psychologen reduziert, also personalisiert wird, war auch einer der Ausgangspunkte kritisch-psychologischer Praxisforschung; vgl. Markard & Holzkamp, 1989)
Nach Klaus Holzkamps Einschätzung (1972c, 213 [217]) brachten die Ausführungen Hörmanns »das Gesellschafts- und Wissenschaftsverständnis der allermeisten Psychologen in der BRD präzise« zum Ausdruck. Bevor ich mich nun weiter mit diesem Gesellschafts- und Wissenschaftsverständnis auseinandersetze, möchte ich zeigen, welche (anfängliche) Bedeutung es auch bei Studierenden hatte, die im Zuge der Studentenbewegung das Fach »Psychologie« reflektierten – wobei diese Auffassung nach meiner Erfahrung auch heute nach wie vor einflussreich ist.
2.3 Erkenntnisoptimismus: Humanisierung als Implikat der Psychologie oder »psychologischer Gesetzmäßigkeiten«
In einem »Krofdorfer Manifest«, das am 23. Juni 1968 auf einem Verbandstag der studentischen Fachschaften Psychologie verabschiedet wurde, heißt es:
»Wir sind so vermessen, den Psychologen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft zuzuweisen. […] Die Psychologie befasst sich mit dem Verhalten des Menschen. Die Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens erlaubt es dem Psychologen, aufzuzeigen, wie die Gesellschaft verändert werden muss, um ihren Mitgliedern optimale Entfaltungsmöglichkeiten zu sichern. Sie befähigt die Psychologen andererseits, Individuen so zu verändern, dass sie auch in einer unterdrückenden Gesellschaft in der Lage sind, sich von sozialen Zwängen zu befreien und somit die Gesellschaft selbst freimachen zu können. Die Psychologie ist also eine Wissenschaft, die in besonderer Weise zur Verwirklichung der im Artikel 2 GG [Grundgesetz, M. M.] erhobenen Forderung beitragen kann!« (Zit. nach Mattes 1985, 292)
Artikel 2 des Grundgesetzes lautet:
»(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.«
Wie verhält sich die Position des studentischen Krofdorfer Manifestes zu der Position Hörmanns? In beiden Fällen gibt es keinen inhaltlichen, systematischen Zusammenhang zwischen der Psychologie als Erkenntnissystem bzw. zwischen psychologischen Konzepten wie »Leistung«, »Intelligenz«, »Begabung«, »Motivation« und der Verfasstheit der Gesellschaft. In beiden Fällen auch sind es zuvörderst, wenn nicht allein, die Psychologinnen und Psychologen, in deren Hand es liegt, welche gesellschaftliche Funktion die Psychologie bzw. welche Funktion sie für die betroffenen Individuen hat.
Schwieriger allerdings wird es bei der Argumentation bezüglich der Zielsetzung, mit der Psychologie betrieben wird oder werden soll. Hier legt das Krofdorfer Manifest nämlich nahe, dass, wenn Psychologinnen und Psychologen ihre »Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens« nutzen, sie damit auch wissen, wie Gesellschaft und Individuen zur »optimalen« Entfaltung letzterer zu verändern sind, anders formuliert, dass die Psychologinnen und Psychologen dann, wenn sie dies nicht tun, entweder keine oder zu wenig Ahnung von den »Gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens« haben oder deren Kenntnis hintergehen. Voraussetzung dieser Argumentation ist allerdings, dass die Psychologie inhaltlich nicht umstritten ist, dass sie nicht in verschiedenen, miteinander ggf. nicht kompatiblen Schulen (etwa Psychoanalyse vs. Behaviorismus) existiert. Danach ist die – auf diese Weise völlig abstrakt gedachte – Psychologie quasi automatisch emanzipatorisch, sind ihre Erkenntnisse zwangsläufig kritisch gegenüber gesellschaftlichen Verhältnissen, die menschliche Entwicklung behindern.
Es ist dieses Absehen von den unterschiedlichen Ansätzen in der Psychologie, die es dem Krofdorfer Manifest ermöglicht, das Fach als inhaltlich ungesellschaftlich und gleichzeitig als kritisch-emanzipatorisch zu denken – auf der Basis einer naiven, wenn man so will: erkenntnisoptimistischen Annahme. Diese Vorstellung ist der von Hörmann repräsentierten Position allerdings nicht eigen: Hier sind unterschiedliche – insgesamt wertneutrale – Kenntnisse und Methoden der Psychologie für durchaus unterschiedliche Ziele zu funktionalisieren, und zwar über die Zwecke, die Psychologinnen und Psychologen aus eigenem Antrieb oder von anderen beauftragt verfolgen.
Dass das Krofdorfer Manifest die Psychologie als Wissenschaft nicht »wertneutral« (sondern per se emanzipatorisch) fasst, liegt also daran, dass es die Ebene, auf der die Frage der Wertneutralität strittig werden kann, erst gar nicht realisiert: die Ebene der Umstrittenheit unterschiedlicher bis gegensätzlicher Theorien, Ansätze, Schulen (wie etwa der Streit zwischen Psychoanalyse und Verhaltenstheorie, wie ein Symptom aufzufassen sei: als Manifestation unbewusster und unbearbeiteter frühkindlicher Konflikte oder als Ausdruck eines Lernprozesses). So kann das Krofdorfer Manifest völlig unbefangen »den Menschen« als Objekt (der Bemühungen) von in psychologischen Gesetzmäßigkeiten bewanderten Psychologinnen und Psychologen auffassen – ganz im Sinne des experimentellen Schemas übrigens, auf das ich noch mehrfach zurückkommen werde. Der Effekt dieser Position ist aber unter dem hier wesentlichen Gesichtspunkt der Funktion der Psychologie derselbe wie der der Wertneutralität: Wissenschaft und Erkenntnis werden als mit gesellschaftlichen Verhältnissen nicht vermittelt gedacht.
Aber: Rede ich denn nicht selber auch von der Psychologie und ihrer Funktion, von der Kritik an der Funktion der Psychologie? Ja, soweit ich damit befasst bin, die auf die Psychologie bezogene Funktionsanalyse der Studentenbewegung in ihren (bis heute) relevanten Argumentationen zu rekonstruieren. Danach wird sich zeigen, dass die Kritik an dieser abstrakten Rede von der Psychologie ein wesentliches Moment der Entwicklung der Kritischen Psychologie war, die sich mit dem differenziellen Erkenntnisgehalt unterschiedlicher psychologischer Ansätze befassen musste. Ich bitte also bis dahin um etwas Geduld (vgl. die Kap. 5 und 6).
2.4 Psychologie als zu »zerschlagende« Herrschaftswissenschaft
Psychologie wurde aber auch als Herrschaftswissenschaft charakterisiert und kritisiert. In der Darstellung dieser Position kann ich an die in Kap. 2.1 skizzierte Kritik an der Verflechtung von Wissenschaft und Technik mit gesellschaftlicher Repression und internationaler Ausbeutung anknüpfen. Diese Kritik wurde im September 1968 auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie geltend gemacht, als Studierende dort ein Symposion mit dem Thema »Psychologie und politisches Verhalten« »umfunktionierten«, wie man derlei zu nennen pflegte, indem sie das Podium besetzten und 27 Thesen zu Psychologie vortrugen. Darin hieß es u. a.:
»Die Psychologie gehört zum Corpus derer, die über die schlechten Verhältnisse räsonieren, sie nicht abschaffen. Psychologie entwickelt sich zum Machtinstrument über Hilflose und Kinder. […] Jede der heutigen Wissenschaften perpetuiert [verewigt, M. M.] irrationale Herrschaftsformen. Die Abschaffung der Herrschaft muss sofort Thema der Psychologie sein. […] Psychologische Theorien werden daraufhin überprüft, ob sie nicht nur rattentauglich, sondern gesellschaftlich relevant sind. […] Die Möglichkeit, Theorien anachronistisch beizubehalten, verschanzt sich hinter dem Wertfreiheitsschild.« Nicht »Erleben und Verhalten« seien Gegenstand der Psychologie, sondern »die Manipulation des Menschen durch den Menschen, […] die Perpetuierung von Ideologie«. Es gehe um eine Gesellschaft, in der Psychologie überflüssig sei: »Jede Aktion, die eher zur Abschaffung der Psychologie führt als zu ihrer Restauration, ist historisch wahr. […] Kriterium für historische Wahrheit wäre das Ausbleiben des Bedarfs der Gesellschaft, Psychologen verfügbar zu haben, wenn diese sich einige Zeit der Gesellschaft verweigert hätten.« (Zit. nach Holzkamp 1972c, 218ff [222ff])
Diese Passagen sind – wie generell die 27 Thesen – insofern uneinheitlich, als sie zwischen inhaltlicher Auseinandersetzung mit der Psychologie (etwa bezüglich der Forderung, Theorien auf ihre Relevanz zu überprüfen) und deren mehr oder weniger pauschaler Ablehnung changieren. Diese Tendenz setzte sich wenig später bei einem »Kongress kritischer und oppositioneller Psychologen« in Hannover durch, deren Mehrheit am 16. Mai 1969 eine Resolution verabschiedete, die folgendes Fazit zog:
»Alle psychologischen Ansätze erweisen sich als unpolitisches Gewurstel. Wo Psychologen politische Praxis betreiben (z. B. in Betriebsbasisgruppen, in der Schüler- und Lehrlingsagitation), agitierten sie nicht als Psychologen: Denn die Psychologie ist traditionell und perspektivisch eine Wissenschaft, die systembedingte Konflikte zu eliminieren oder zu integrieren sucht (das gilt auch für die Psychologie in der DDR). Die Psychologie war und ist immer ein Instrument der Herrschenden. Sie ist folglich nur als Wissen über das Herrschaftssystem brauchbar. Die konkrete Alternative zum Traum von der Umfunktionierung der Psychologie zum Instrument des Klassenkampfes ist ihre Zerschlagung. Unsere praktischen Aufgaben müssen nun sein: 1. Das vorhandene psychologische Wissen als Wissen über das System einführen! (z. B. Analysierung und Vervielfältigung von Intelligenztests und deren Aufhebung als Machtinstrument.) 2. Die Zersetzung der Psychologie (z. B. in den Instituten). 3. Entwicklung einer Offensivstrategie an allen Punkten, wo die Psychologie im Verwertungsprozess relevant wird! Es gibt keine ›kritische‹ oder ›oppositionelle‹ Psychologie! D. h. es gibt keine revolutionäre Psychologie! ZERSCHLAGT DIE PSYCHOLOGIE!« (vgl. Holzkamp 1972c, 222 [225])
Es ist – ca. 40 Jahre später – vielleicht einfach, derartige Positionen zu belächeln. Aber: Hat die Forderung »Zerschlagt die Psychologie«, diese radikale Funktionskritik – unbeschadet ihrer etwas martialischen Formulierung – nicht Einiges für sich? Läuft nicht z. B. die Persönlichkeitspsychologie darauf hinaus, Menschen zu klassifizieren und nach gesellschaftlichen Erwünschtheiten zu sortieren, oder ist die Intelligenzdiagnostik nicht Mittel z. B. der Schülerselektion? Haben nicht Wissenschaftler wie Basaglia der Psychologie »Befriedungsverbrechen« vorgeworfen, wie es im Titel eines von Basaglia und anderen geschriebenen Sammelbandes heißt (Basaglia & Basaglia-Ongaro 1975)? Waren nicht massive Kämpfe zur Verbesserung der Lage von Psychoseerfahrenen und Psychiatriebetroffenen erforderlich (Psychiatrie-Enquete 1976; Wulff 1978, 1994, 2001)? Ist nicht die Idee, Intelligenztests zu vervielfältigen, um sie zu unterlaufen, durchaus in den »Testknacker«-Publikationen aufgegriffen worden (vgl. etwa aktueller: Rieh & Wagenpfeil 2003, hier allerdings nicht mit dem Ziel, die Psychologie zu desavouieren, sondern Einzelne zu befähigen, sich in den Tests durchzusetzen)?
2.5 Perspektive einer kritischen Psychologie?
Nur einen Tag ließ eine Gegenresolution auf sich warten, die im Kern die Möglichkeit und Notwendigkeit einer »kritischen Psychologie« behauptete,
»nicht als einen bloßen Reflex auf die herrschende, am logischen Positivismus ausgerichtete Psychologie, sondern einen Teil der Sozialwissenschaften, der seine Rechtfertigung aus dem emanzipatorischen Anspruch der kritischen Theorie erhält und der schlechten Wirklichkeit die Möglichkeit eines befreiten Daseins entgegenhält und dieses vorbereitet« (a. a. O., 224).
Ähnlich argumentierte eine Gruppe von Studierenden aus Basis- und Institutsgruppen in einem »Heidelberger Papier«, in dem der Psychologiekritik folgende Aufgaben gestellt werden:
»a) Analyse der Geschichte der Psychologie: Dabei ist die Psychologie aufzufassen als Vorstellung, die sich die Menschen (bzw. der geistig produzierende Teil) von sich selbst im Laufe der Geschichte gemacht haben. Es ist zu fragen: Wie sind diese Vorstellungen des Menschen von sich selbst aus der jeweiligen historischen Situation zu erklären? b) Analyse der ›wissenschaftlichen Psychologie‹ als Bestandteil der kapitalistischen Gesellschaft: Die Begriffe und Theorien der Psychologie müssen als diejenigen einer Klassengesellschaft analysiert werden […]. c) Analyse der Funktion der Tätigkeit von Psychologen in der kapitalistischen Gesellschaft: die Institutionen, in denen der Psychologe arbeitet (z. B. Schule), müssen analysiert werden; ob dieser der Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse dient oder den Kampf gegen sie unterstützen kann. Mit dieser Aufgabenstellung ist auch zugleich der Begriff ›Kritik‹ erläutert worden, wie er im marxistischen Sinne nur verstanden werden kann: es geht nicht darum, eine andere Meinung zu haben oder immanent wissenschaftliche Ergebnisse durch andere zu ›kritisieren‹; sondern es geht darum, die psychologische Forschung als historisches Produkt und als Element der gesellschaftlichen Totalität zu untersuchen.« (Zit. nach Mattes 1985, 302)
Diese Auffassung ist für unsere weitere Argumentation auch deshalb interessant, weil sie die Dimension des Geschichtlichen – auf neue Weise – in die Diskussion bringt. Zwar ist auch die Position »Psychologie ist bloß Herrschaftswissenschaft« in gewisser Weise geschichtlich, weil ja Herrschaft und die Wissenschaft »Psychologie« auf eine historische Epoche bezogen und inhaltlich verbunden werden. Nur: Die Sache scheint abgeschlossen und keine offene Forschungsfrage mehr zu sein. Die »Heidelberger« Argumentation dagegen ist insofern offen, als erstens Psychologie und Gesellschaft in einen noch genauer zu bestimmenden inhaltlichen Zusammenhang zu bringen sind, zweitens die Psychologie als Wissenschaft auch zu außerwissenschaftlichen Vorstellungen von menschlicher Subjektivität ins Verhältnis gesetzt werden soll, drittens die Psychologie bzw. die Arbeit der Psychologinnen und Psychologen den »Kampf« gegen die »kapitalistischen Produktionsverhältnisse« unterstützen sollen. Viertens (und vor allem) aber wird ein Kritikbegriff angedeutet, der den Standpunkt der Kritik ebenso historisiert wie deren Gegenstand.
Die Frage ist allerdings, ob und wie dieser Standpunkt der Kritik entfaltet werden kann.
Damit bin ich, nachdem ich die Wissenschafts- bzw. Psychologiekritik der Studentenbewegung in einigen prägnanten Positionen und Gegenpositionen markiert habe, an einem Wendepunkt meiner Darstellung angelangt. Es geht jetzt nämlich darum darzustellen, wie sich in diesem Feld der Auseinandersetzungen die Kritische Psychologie herausbildete. Dazu ist es zunächst erforderlich, jenen Mainstream der Psychologie, an dem sich Kritik entzündete, etwas zu skizzieren und später auch Problemdebatten im Fach selber einzubeziehen, an denen deutlich wird, dass es – unbeschadet der kritisch-psychologischen Kritik, eben auch Nebenströme oder -strömungen gibt, die, wie angekündigt, die Rede von der Psychologie als zu pauschal und deswegen als problematisch erscheinen lassen. Ein prominentes Beispiel dafür sind die Psychoanalyse bzw. psychoanalytische Richtungen, auf die – jenseits allgemeiner Funktionskritik der Psychologie – in der Studentenbewegung teilweise positiv Bezug genommen wurde (vgl. Mattes 1985, 294f). Schon an diesem Umstand lässt sich aber auch absehen, dass eine Kritische Psychologie einer differenziellen Erkenntniskritik bedarf, d. h., dass sie zwischen verschiedenen Ansätzen unterscheiden können muss, dass sie Kriterien für diese Unterscheidungen braucht, zumindest wenn sich auch die Aufgabe stellt, einen potenziellen Erkenntnisgehalt verschiedener Ansätze in Betracht zu ziehen (und daraus zu lernen).
Ich werde diese Fragestellungen und Entwicklungen im Zusammenhang mit der frühen Werkentwicklung von Klaus Holzkamp zum »Kritischen Psychologen« diskutieren. Dies schließt wiederum ein, dessen institutionelle und persönliche Situation im Zuge der bislang geschilderten Geschehnisse und Entwicklungen mit einzubeziehen.
3. Holzkamps Analyse und Kritik des experimentell orientierten psychologischen Mainstream
3.1 Klaus Holzkamps wissenschaftliche Entwicklung
Klaus Holzkamp wurde mit der Psychologie- und Wissenschaftskritik der Studentenbewegung konfrontiert, als er schon als Ordinarius am Psychologischen Institut der FU Berlin arbeitete. 1927 geboren, immatrikulierte er sich im Sommersemester 1949 an der FU im Fach Psychologie. Das psychologische Institut der FU war im Wintersemester 1948/49 von Oswald Kroh gegründet worden, so dass Klaus Holzkamp diesem Institut fast von den dessen Beginn an zugehörte. Sein Diplom machte er 1954; zwei Jahre später wurde er, vorher schon als studentische Hilfskraft beschäftigt, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er befasste sich theoretisch und experimentell mit Ausdruckspsychologie. Auf diesem Gebiet wurde er dann auch 1957 promoviert. Der Titel seiner Dissertation lautete »Ausdrucksverstehen im Erlebensaspekt. Eine experimentelle Untersuchung«. Die Einleitung und der erste Hauptteil dieser Untersuchung erschienen 1956 leicht verändert unter dem Titel »Ausdrucksverstehen als Phänomen, Funktion und Leistung« im »Jahrbuch für Psychologie und Psychotherapie« (1956), das dem 1955 verstorbenen Oswald Kroh gewidmet war.
Seit 1954 (bis 1957) war Holzkamp – mit Kripal Singh Sodhi und Rudolf Bergius – im Rahmen einer Auftragsforschung an Erhebungen über nationale Vorurteile beteiligt, hatte aber auch schon damit begonnen, sich (anderen Aspekten) der sozialen Kognition, speziell der Akzentuierung bei sozialer Wahrnehmung zu widmen (in Zusammenarbeit u. a. mit Peter Keiler und Erich Perlwitz). Nachdem er von 1957 an Lehrveranstaltungen über Tiefen- und Ausdruckspsychologie und über Methoden abgehalten hatte, wurde er 1967 schließlich Nachfolger Sodhis, d. h. Ordinarius im Fach »Sozialpsychologie«, um dann in der Nachfolge Hans Aeblis auch das Fach »Pädagogische Psychologie« zu vertreten (vgl. Holzkamp 1972c, 207f [212f]; Rösgen 2003).
Was bis dahin in seinen inhaltlichen Arbeiten eher mitgelaufen war, wurde für Holzkamp zunehmend bedeutsam: die Beschäftigung mit wissenschaftstheoretischen und methodologischen Grundlagenproblemen der Psychologie. Aus dieser Phase stammen seine beiden Monographien »Wissenschaft als Handlung« und »Theorie und Experiment in der Psychologie«, an denen er von 1959 bzw. 1962 arbeitete. Mit »Theorie und Experiment in der Psychologie« habilitierte er sich 1963; die Arbeit erschien 1964 als Buch. »Wissenschaft als Handlung« wurde, obwohl früher abgeschlossen, erst 1968 publiziert.
In beiden Arbeiten ging es um eine Methodenexplikation und -kritik des Experimentierens (vgl. auch Keiler 1987; Maiers & Markard 1987b, 14ff), allerdings dezidiert nicht mit dem Ziel, die »generelle Möglichkeit und Berechtigung des Experimentierens in der Psychologie […] in Zweifel zu stellen«, wie dies »vom ›Rande‹ des Faches aus« (1964, 4) geschehe, sondern aus der Überzeugung heraus, dass »das Experiment in der grundwissenschaftlichen Psychologie ein voll legitimes, (jedenfalls der Möglichkeit nach) fruchtbares, ja unersetzliches methodisches Mittel« darstelle (ebd.). Seine Kritik entstand für ihn vielmehr aus gewissen Vagheiten experimenteller Bemühungen Anderer und dem Unvermögen, diese Vagheiten bei eigenem Experimentieren mit Hilfe der überkommenen wissenschaftsmethodischen Anschauungen zu vermeiden (a. a. O., V).
Für beide Arbeiten zentral war das Problem, dass es keine klaren Beurteilungskriterien dafür gebe, welche Aussagekraft die in einer experimentellen Anordnung erzielten empirischen Resultate für die theoretische Aussage (Hypothese) hätten bzw. wie die bei Wiederholungen der Experimente ja immer wieder vorkommenden Abweichungen in den Resultaten in ihrem Erkenntnisgehalt zu beurteilen seien. In beiden Arbeiten wurde – konstruktivistisch (vgl. Keiler, a. a. O.; Maiers & Markard, a. a. O.; Holzkamp 1972c, 277ff [280ff]) – der Handlungsaspekt in wissenschaftlicher Erkenntnis hervorgehoben und damit die (auch mit dem Falsifikationsprinzip nicht überwundene) Vorstellung der bloßen Erfahrungsgeleitetheit wissenschaftlicher Erkenntnis kritisiert. Dagegen müsse wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung als wissenschaftliches Handeln zur Realisierung von Theorien begriffen werden: »Das Experimentieren ist für uns gekennzeichnet durch eine besondere Art des Realisationsbemühens, und zwar den Versuch, die einer Allgemeinaussage entsprechenden realen Gegebenheiten durch veränderndes Eingreifen in die Realität herzustellen.« (Holzkamp 1968, 253; Herv. entf., M. M.; vgl. auch Holzkamp 1964, 24) Während nun in »Wissenschaft als Handlung« dieses herstellende Realisieren mit vielen erkenntnistheoretischen Bezügen detailliert expliziert wurde, zentrierte sich »Theorie und Experiment« auf das (auch in »Wissenschaft als Handlung« schon diskutierte) Problem der »Repräsentanz«: »Wir spezifizieren nun unsere Problemstellung durch die Feststellung, dass die Beziehung zwischen ›theoretischen Sätzen‹ und ›experimentellen Sätzen‹ im Mittelpunkt dieser Abhandlung steht.« (Holzkamp 1964, 30, Herv. entf., M. M.) In Holzkamps Gesamtargumentation ist die »Repräsentanz« das dritte Kriterium zur Beurteilung des Erkenntniswerts experimenteller Arbeiten: Die beiden anderen Kriterien betreffen den Bestätigungsgrad empirischer Hypothesen und deren Integration in übergeordnete Theorien.
Das »Repräsentanz«-Problem bezieht sich also auf die Frage, inwieweit experimentelle Sätze theoretische Sätze repräsentieren:
»Während im TS [theoretischen Satz, M. M.] gemäß den Verknüpfungsprinzipien der zugehörigen Theorie Aussagen über ›theoretische Realität‹ enthalten sind, ist der ›experimentelle Satz‹ als unmittelbar sprachlicher Ausdruck dessen zu verstehen, was bei experimentellen Handlungen ›tatsächlich gemacht‹ werden und was ›dabei herauskommen‹ soll. ›Experimentelle Sätze‹ dürfen prinzipiell nichts anderes enthalten als Angaben über durchzuführende experimentelle Operationen und Behauptungen über zu gewinnende experimentelle Befunde, also, wie wir uns ausdrücken, Annahmen über ›Handlungs-Ereignis-Relationen‹.« (A. a. O., 28, Herv. entf., M. M.; vgl. auch 1968, 266)
Das Kernproblem der »Repräsentanz« besteht nun darin, dass theoretische Sätze sich nicht einfach in experimentelle Sätze umwandeln lassen, sondern dass sie »weder in einer noch in der anderen Richtung aufeinander rückführbar« sind (a. a. O., 270). Das bedeutet, dass gegenüber einem theoretischen Satz viele unterschiedliche experimentelle Sätze existieren können. Nehmen wir als einfachen theoretischen Satz die Frustrations-Aggressions-Hypothese: Wer frustriert wird, reagiert aggressiv. Diesem theoretischen Satz können viele experimentelle Sätze zugeordnet werden – anders formuliert, der theoretische Satz kann unterschiedlich operationalisiert werden: Frustration etwa als achtloses Zerreißen von Listen mit schriftlichen Kopfrechenergebnissen der Versuchspersonen durch eine Versuchsleiterin oder als Organisierung von Misserfolgen bei Aufgabenlösungen; Aggression kann als Zahl oder Intensität der den Mitversuchspersonen verabreichten Elektroschocks oder als Negativität der Bewertung anderer operationalisiert werden. Andersherum kann dieselbe Operationalisierung (derselbe experimentelle Satz) für unterschiedliche theoretische Sätze stehen. So kann die Organisierung von Misserfolgen auch die Operationalisierung von Hilflosigkeit sein und die Negativität in der Bewertung anderer kann die Operationalisierung dessen sein, dass man sich selber dadurch aufwertet (etwa im Sinne der Theorie der sozialen Identität, vgl. dazu Mummendey & Otten 2002, 99ff).
Diese Uneindeutigkeit zwischen theoretischem und experimentellem Satz ist übrigens eine Ursache dafür, dass experimentelle Befunde ›alternativ‹ interpretiert werden können: Nehmen wir an, dass jemand sich einstellungswidrig verhält, bspw. also etwas isst, was er eklig findet, und danach sagt: So eklig ist das eigentlich gar nicht. Diese Aussage ist einerseits dissonanztheoretisch zu interpretieren: Der Widerspruch zwischen Einstellung und Verhalten wird dadurch aufgelöst, dass sich die Einstellung in Richtung realen Verhaltens verändert. Sie kann aber auch im Sinne der Impression Management Theory interpretiert werden: Die Versuchsperson will den Eindruck erwecken, als habe es ihr doch nicht so schlecht geschmeckt. An experimentellen Forschungsbeispiel der dissonanztheoretisch inspirierten »Einstellungsänderung durch einstellungskonträres Verhalten« hat Abele (1980) gezeigt, wie »für gleiche und ähnliche Befunde alternative Erklärungsansätze« (36), bspw. seitens der »impression management«-Theorie (41), gegeben wurden.
Experimentelle Sätze und damit auch die entsprechenden Befunde sind also theoretisch mehrdeutig, und Holzkamps Bemühen ging darum, dies bei vorfindlichen Experimenten nachzuweisen bzw. Kriterien für eine möglichst hohe Repräsentanz experimenteller für theoretische Sätze zu gewinnen. Wie Peter Keiler (1987, 124) berichtet, lobte – der berühmte Experimentator – Wolfgang Köhler in einem Brief vom 27. August 1965 an Klaus Holzkamp dessen »Theorie und Experiment«:
»Ihr Buch sollten alle Psychologen als eine Aufforderung zur Selbstbesinnung und als Einführung in diese Kunst studieren. Es scheint mir auf diesem Gebiet eine alleinstehende Leistung darzustellen. […] Was ich mir nun wünschen möchte, ist vor allem, dass Sie bald ein praktisches Beispiel von allen diesen Dingen vorlegen, etwa in der Anwendung auf Wahrnehmungsfragen [in denen Holzkamp Köhler selber kritisiert hatte ‹Holzkamp 1964, 145›, M. M., worauf Köhler in dem Brief allerdings nicht eingeht], wie Sie sie selbst behandeln, ohne dass dabei die von Ihnen erwähnten Fehler auftreten.«
Keiler sieht Köhlers Reaktion als symptomatisch an (ebd.): Die Kritik zu goutieren und so lange zu »suspendieren«, wie Holzkamp keine praktische Lösung parat hat und vorführt. Das Problem ist aber, dass diese Lösung, wie Holzkamp im Nachwort zur zweiten Auflage von »Theorie und Experiment« (1981, 276f) rückblickend selber darlegt, nicht gelingen konnte und kann:





























