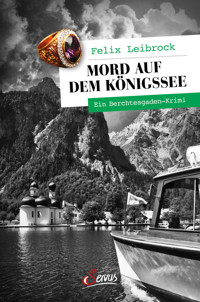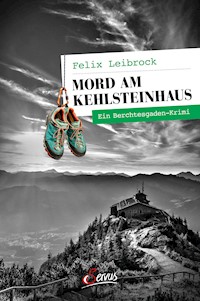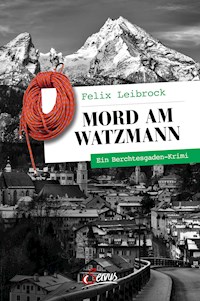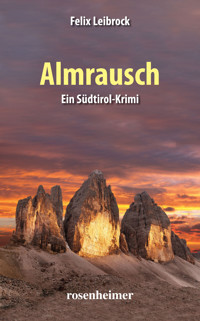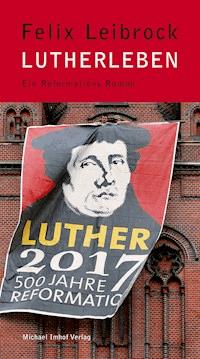4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Sascha Woltmann und Mandy Hoppe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
In Felix Leibrocks zweitem Weimar-Krimi "Eisesgrün" entdecken zwei Landschaftspfleger merkwürdige Hügelgräber. Das erste, kaum größer als ein Maulwurfshügel, enthält eine Holzkiste mit einer Puppe. Das zweite einen Golden Retriever. Das dritte schließlich zwingt die beiden, die Polizei zu verständigen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Ähnliche
Felix Leibrock
Eisesgrün
Kriminalroman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Ein neuer Fall für das Weimarer Ermittlerduo Sascha Woltmann und Mandy Hoppe:
Zwei Landschaftspfleger entdecken im Park merkwürdige Hügelgräber. Das erste, kaum größer als ein Maulwurfshügel, enthält eine Holzkiste mit einer Puppe. Im zweiten finden sie einen Golden Retriever. Das dritte schließlich zwingt die beiden, die Polizei zu verständigen, denn was sich vor ihren Augen befindet, sind eindeutig menschliche Knochen …
Inhaltsübersicht
Ich will das Herz des Pharao verhärten
2. Mose 7,3
Vom Eise befreit …
Goethe, Faust I, Osterspaziergang
Prolog
Der Herzinfarkt kam nicht überraschend. Ihr Geliebter verhielt sich feige. Das Amt entzog man ihr und raubte ihr damit die Ehre, den Stolz. Alles war so demütigend. Keine Nacht mehr, in der sie Ruhe fand. Kein Tag mehr, an dem sie aus der Grübelfalle herauskam. Sie hatte ihn geliebt, und er, er strafte sie, als es aufflog, dafür ab. Er musste die Fassade aufrechterhalten. Die Partei duldete nicht, dass sich solche Eskapaden herumsprachen. Also ließ er sie fallen. Seit damals spürte sie häufig Stiche im Herzen, dann dieses Rasen. Jetzt der Herzinfarkt.
»Los, bringen Sie sie jetzt runter in den OP. Wir fangen in einer Viertelstunde an.«
Von Anfang an hatte sie diesem Oberarzt nicht getraut. Sein Blick, der durch sie hindurchging. Sein aufgesetztes Lächeln, sein herrischer Ton. Sie, die Patientin, fühlte sich einer Willkür, deren Ziele ihr nicht klar waren, ausgeliefert. Erst presste man ihr ab, sich von der heimischen Klinik hierher verlegen zu lassen. Dann zwang man ihr die Unterschrift zur OP auf. Sie habe sonst keine Überlebenschance. Nur hier könne sie einen Bypass bekommen. »Warum nur hier?«, fragte sie verzweifelt. Aber der Oberarzt zeigte lediglich auf die Stelle im Formular, wo sie unterschreiben sollte.
»Wieso geht das jetzt so schnell mit der OP?«
Der jungenhafte Pfleger sah zu Boden. Ihm stand es nicht zu, ihre Frage zu beantworten. Wortlos fuhr er sie über den langen Gang. Der Oberarzt ging einige Meter vor ihnen her. Sie schwitzte vor Angst. In einem der großflächigen Fenster spiegelte sich ihr Konterfei, und sie erschrak: Die Wangen waren eingefallen, die leicht gebogene Nase trat spitz hervor. Entsetzt wandte sie sich ab, blickte auf ihre abgemagerten Finger, die aussahen wie die Zehen einer Krähe. Da beugte sich ein freundliches Gesicht über sie, strahlte sie warm an. Schwester Hanna.
»Wird schon. Seien Sie ganz ruhig. Einen Bypass zu legen, ist für uns Routine.«
Kurz vor der Eingangsschleuse des Operationssaals hielt der Pfleger an und rollte ihr Bett ein Stück zur Seite, drückte den automatischen Türöffner. Aus dem Augenwinkel sah sie den Gang entlang. Sie beobachtete, wie sich der Oberarzt Schwester Hanna in den Weg stellte. Er bedrängte sie, drückte sie gegen das Fenster. Oder täuschte sie sich?
Der Pfleger fuhr sie in die Eingangsschleuse. Schwester Hanna eilte jetzt auf den Operationssaal zu. Die Wangen gerötet, band sie sich die losen Haare mit einem Gummi zusammen.
»Wann ist sie so weit?« Der Oberarzt war auf dem Weg zum Waschraum zwischen den beiden Operationssälen.
»Dauert noch ein paar Minuten!« Die Anästhesistin hantierte mit einigen Beuteln herum und bereitete die Narkose vor.
Der Oberarzt verschwand im Waschraum, zog sich die OP-Kleidung an.
»Wir gehen nachher auf dreißig Grad Körpertemperatur!«, raunte er dem Kardiotechniker zu, während er den Operationssaal betrat.
»Dreißig Grad nur? Nicht tiefer? Sonst haben wir doch siebenundzwanzig, achtundzwanzig Grad!« Der Techniker machte keine Anstalten, den Temperaturknopf an der Herz-Lungen-Maschine entsprechend herunterzufahren. Unsicher sah er dem Arzt in die Augen, der sich die OP-Handschuhe zurechtzupfte. Eine gespannte Stille trat ein.
»Dreißig Grad!« Die Stimme des Oberarztes kam kalt, ließ keinen Widerspruch zu. Als Chirurg hatte er das Sagen bei der Operation, der Kardiotechniker musste sich fügen.
Ihr Herz raste. Wie soll man so ein aufgeregtes Herz operieren?, dachte sie sich. Sie sah zum Fenster in der Schleusentür. Wenn sie sich ein wenig aufstützte, könnte sie einen Blick in den Operationssaal erhaschen. Die Anästhesistin drehte ihr gerade den Rücken zu. Also probierte sie es. Sie schaffte es, mit Mühe. Pumpen, Flaschen, Schläuche erkannte sie. Zwei, drei Personen in grüner OP-Kleidung. Aufgeregt wanderten ihre Augen hin und her.
Der Anästhesiepfleger holte die Flasche mit der kardioplegischen Lösung und stellte sie in ein Eisbad neben der OP-Säule. Der Kardiotechniker überprüfte die Funktion der Schläuche an der Herz-Lungen-Maschine und nickte abschließend den anderen zu. Alles war vorbereitet. Der Oberarzt fluchte ungeduldig vor sich hin. Wo blieb nur die Patientin? Er ging zur Schleusentür, um durch das Fenster zu sehen, wie weit die Anästhesistin war. Da traf sein Blick auf ihren.
»Ja, ist die denn immer noch nicht weggetreten?«, brüllte er. Selbst durch die gut isolierte Schleusentür war das zu hören. Sekunden später spürte sie den Stich einer Nadel im Unterarm. Das Letzte, was sie sah, waren seine eisblauen Augen. Durch den schmalen Schlitz, den Mundschutz und Haube frei ließen, blickten sie kalt auf sie herab. Während sie hinwegdämmerte, zitterte sie.
Die kardioplegische Lösung tropfte über den sterilen Schlauch in die Aortenwurzel. Nach kurzer Zeit hörte das Herz auf zu schlagen. Die Herz-Lungen-Maschine arbeitete gleichmäßig wie ein Uhrwerk. Sie setzten die Klammern. Jetzt war es möglich, blutfrei zu operieren.
»Dreißig Grad. Es bleibt dabei?« Der Kardiotechniker runzelte die Stirn.
»Ja. Was soll diese Fragerei?« Der Oberarzt stieß einen missbilligenden Laut aus.
Schwester Hanna blickte irritiert zur Flasche mit der Lösung. Üblicherweise war die Lösung mit Kaliumchlorid farblos oder leicht gelblich. Diese aber schimmerte blau-grün. Die Farben auf dem Etikett der Flasche waren ungewohnt stark und klar. Was war das für eine Lösung? Und woher kam sie? Der Anästhesiepfleger hatte sie routinemäßig dem Kühlschrank entnommen. Doch am Vormittag hatte sie dort noch nicht gestanden, da war sich Schwester Hanna sicher.
»Herr Oberarzt, der Blutdruck ist zu hoch!« Der Kardiotechniker blickte eindringlich zum Operateur.
»Wie hoch?«
»Fast achtzig Millimeter Hg.«
Keine Reaktion. Einige Minuten operierte der Oberarzt stumm vor sich hin. Der Kardiotechniker sah zusehends verzweifelt auf seine Monitore. Er blickte in Richtung des Operateurs, der ihn ignorierte, dann zu Schwester Hanna und der Anästhesistin. Fast unmerklich schüttelten die beiden Frauen den Kopf. Sie alle wussten, wie entscheidend die möglichst tiefe Temperatur bei solchen Herzoperationen war. Nur so gelang es, den Sauerstoffverbrauch entscheidend zu senken. Dreißig Grad, das lag noch über der Flimmerschwelle des Herzens. Die Menge der Lösung und die über den Wärmetauscher an der Herz-Lungen-Maschine eingestellte Körpertemperatur mussten ineinandergreifen und sich ergänzen wie Yin und Yang. Aber hier und heute griff nichts ineinander. Die angezeigten Werte auf den Monitoren waren bedenklich.
»Doktor, wir müssen mit der Temperatur nach unten!« Es war mutig von ihm, dem Arzt zu sagen, was er zu tun hatte. Und das während einer OP! Aber hier ging es um Leben und Tod. Was blieb ihm anderes übrig? Trotzdem wagte er es nicht, eigenständig die Temperatur am Wärmetauscher zu korrigieren. Das würde ihn seine Stelle kosten. Noch schlimmer, denn der Oberarzt war bestens in der Partei vernetzt: Man würde ihn, den kleinen Kardiotechniker, einsperren. Wollte er das seiner Frau und den drei kleinen Kindern wirklich antun?
»Ich verstehe das auch nicht, Kollege«, schaltete sich die Anästhesistin ein. Sie war erst seit einem Monat in der Klinik. Jung, unerfahren und ohne Kenntnis der Hierarchien. Vorsichtshalber beließ sie es bei diesem schwachen Einwurf.
Der Oberarzt zischte etwas und griff nach dem Bypass. Einige Minuten später hatte er ihn gelegt.
»Sie können das Blut wieder aufwärmen!«, murmelte er. Der Kardiotechniker stellte den Temperaturknopf am Wärmetauscher auf achtunddreißig Grad. Die Operation schien gelungen, aber das Herz der Patientin fing nicht mehr an zu schlagen. Sie starb auf dem OP-Tisch.
»Warum sind Sie mit der Temperatur nicht weiter runtergegangen, Doktor?« Der Kardiotechniker hatte seine Emotionen nicht im Griff.
»Halten Sie gefälligst Ihren Rand! Sonst sind Sie heute zum letzten Mal dabei gewesen!«
Die Drohung des Oberarztes war unmissverständlich. Der Kardiotechniker sah zu Schwester Hanna hin. In ihren Augen standen Tränen.
Schwester Hanna betrat den Plattenbau und ging die vier Treppen zu ihrer Zwei-Raum-Wohnung langsam nach oben. Sie war frisch geschieden und lebte seit einigen Monaten alleine. Ein alter Schulkamerad, immer noch Junggeselle, machte ihr den Hof. Aber sie war noch nicht bereit, eine neue Beziehung einzugehen. Der Oberarzt ekelte sie an. Schon die halbe Schwesternschaft hatte er flachgelegt. Das wussten alle. Auch dass sie sein nächstes Opfer sein sollte, obwohl sie nicht in sein Beuteschema passte: sehr jung, langhaarig, schlank, sondern von alldem das genaue Gegenteil war. Aber weil sie ihn abwies, weckte sie seinen Jagdinstinkt. Dass es eine Krankenschwester gab, die ihm, dem Oberarzt, mit bester Perspektive auf den demnächst frei werdenden Chefarztposten, widerstand, ging ihm nicht in den Kopf. Konnte nicht sein. Also belauerte er sie, wartete auf eine Gelegenheit. Wie sollte sie sich wehren? Im Zweifelsfall würde ihr die Klinikleitung nicht glauben. Sie hatte keine Beweise für seine dreisten Annäherungsversuche. So hatte er ihr letztens so lange Aufgaben zugewiesen, bis der Schichtwechsel anstand und alle Kolleginnen bereits gegangen waren. Er passte sie vor der Frauenumkleide ab, und sie musste ihn mit aller Kraft wegschieben, um ihm zu entkommen. »Na warte!«, hatte er ihr verächtlich hinterhergerufen.
Sie hatte nach der Mittagsschicht bei ihrer Mutter noch vier Gläser Eingemachtes geholt. Die Stoffbeutel waren schwer. Müde stand sie vor der Eingangstür und kramte nach dem Schlüssel. Endlich fand sie ihn, steckte ihn ins Schloss, drehte ihn um und stieß mit einem Fuß die Tür auf. Dann ging alles blitzschnell. Sie mussten eine Etage höher auf sie im Treppenhaus gelauert haben. Unsanft stießen sie sie in die Wohnung, schlossen die Tür von innen.
»Psssst!« Bevor sie um Hilfe schreien konnte, drückte ihr einer von ihnen ein Tuch auf den Mund. »Sie bleiben absolut still. Verstanden? Entschuldigung, dass wir Sie so überfallen. Aber es ist zu Ihrer und unserer Sicherheit. Niemand darf erfahren, dass wir bei Ihnen waren.«
Sie nickte stumm. Endlich lockerte er den Griff und ließ sie wieder richtig atmen.
»Was wollen Sie?« Sie starrte die Vermummten entsetzt an. Einer zog sich die Wollmütze mit den Sehschlitzen vom Kopf. Jetzt erkannte sie ihn. Und wusste, was er zu wissen begehrte. Sie riskierte viel. Aber sie wollte auch nicht schweigen zu dem, was sie im Operationssaal erlebt hatte. Vielleicht war das der Ausweg. Sie erzählte. Und erzählte. Und erzählte.
Freitag, 14. März 2014
Ja, Ingo, das Übliche.«
Das Übliche, was Sascha Woltmann im Stehcafé der Bäckerei Baum am Weimarer Frauenplan zu sich nahm, waren ein Stück Schmandkuchen und eine Tasse Kaffee.
Sascha Woltmanns Gedanken kreisten wieder einmal um seine berufliche Zukunft. Er war fest entschlossen, von der Schutzpolizei zur Kripo zu wechseln, auch wenn die Aussichten nicht gerade rosig waren. Dafür gab es bei der Weimarer Schutzpolizei entschieden zu viele altgediente Kollegen, die ebenfalls den angeseheneren und spannenderen Arbeitsplatz bei der Kripo anstrebten. Weimarer Kollegen, die immer in Thüringen geblieben waren. Er dagegen war nach dem politischen Umbruch von 1989 und dem Abitur Anfang der neunziger Jahre nach West-Berlin gegangen. Jetzt war er mit Ehefrau Yvonne und den Kindern Ronny und Laura nach Weimar zurückgekehrt. Was hatte er gegen die viel älteren Ansprüche der Kollegen aufzubieten? Er hoffte auf einen Zufall, einen Wink des Schicksals, irgendeinen spektakulären Coup, der ihn in die Personalplanung des Innenministeriums und die Weimarer Kripo schwemmen würde.
»Sag mal, Sascha, was sagst denn du als Ordnungshüter eigentlich über diesen Politiker? Ich mein den, der da diese Kinderfotos gekauft hat. Du weißt schon, dieses Pornographie-Zeugs. Hammer, oder?«
Woltmann nahm eine Gabel Schmandkuchen. Während er kaute, dachte er nach. Mit einem Schluck Kaffee spülte er das letzte Stück Kuchen hinunter.
»Also, ja, Ingo, schwierige Sache.«
Baum genügten diese Worte, um zu einem langen Exkurs über die Politik auszuholen, über die verdorbenen Sitten, die dort herrschten.
»Da ist sich jeder selbst der Nächste, sage ich dir! Der eine ist korrupt, der andere taucht nie im Bundestag auf. Und jetzt gibt’s da einen, der … Also nee, Bilder von nackigen Kindern anschauen, wer macht denn so was!« Der Bäcker wog den Kopf hin und her und pfiff empört durch die Zähne. Er sah Woltmann herausfordernd an, geradeso als sei dieser der Urheber der ganzen Misere. Aber der schwieg.
»Erinnert mich an den Puppendoktor. Einer, den die Polizei irgendwann erwischt hat. Hast du von dem schon mal gehört?«
Woltmann schüttelte den Kopf. Baum war sichtlich stolz, einen Polizisten in seiner eigenen Materie belehren zu können.
»Der Karl hat mir von dem erzählt. Das ist mein Cousin in Eisenach. Der ist auch Bäcker! Also, dieser Puppendoktor, das war so einer, der hat sich an kleine Mädchen rangemacht. Hat damit geworben, dass er kaputte Puppen reparieren würde.«
Woltmann blickte jetzt gespannt zu Baum.
»Und?«
»Ja, das mit dem Reparieren war aber nur ein Vorwand. Irgendwann kam raus, dass der den Mädchen so komische Sachen an den Puppen gezeigt hat. Der hat die Puppen ausgezogen und an denen so rumgefummelt. Natürlich immer nur, wenn die Eltern nicht dabei waren.«
»Aber wieso waren die Mädchen denn ohne Eltern dort? Die lassen doch ihre kleinen Kinder nicht bei so einem, Ingo!«
»Doch. Der war ja ganz nett zu den Eltern. Und die Mädchen haben ihn sehr gemocht. Die Eltern sind zwischendurch zum Einkaufen. Beim Puppendoktor waren die Kleinen scheinbar in bester Obhut. Aber irgendwann hat eins von den Kindern den Eltern erzählt, was der so mit den Puppen macht.«
»Und dann?«
»Hat ihn eine Mutter angezeigt. Auf seinem Rechner hat man ganz viele Fotos von kleinen Mädchen gefunden. Und Puppen, der hatte eine Riesensammlung.«
»Puppen sammeln ist ja nicht verboten. Auch wenn es seltsam ist, kann ein erwachsener Mann Puppen sammeln.«
»Also ich weiß nicht, würdest du Puppen sammeln wollen, Sascha?«
Woltmann schüttelte wieder den Kopf. Abwesend blickte er aus dem Fenster. Erst nach einer Weile realisierte er, wen er da draußen gerade sah. Seine dreizehnjährige Tochter Laura schlenderte gemütlich mit einem semmelblonden Jungen über den Frauenplan. Hatte sie denn keine Schule?
Montag, 17. März 2014
Ein milder Winter neigte sich dem Ende zu. Noch zeigten sich die Wiesen des Tiefurter Parks in einem etwas matten Grün dem Auge des Betrachters, wenn er sich vom Schloss den sanften Abhang hinunter zur Ilm bewegte. Nur vereinzelt zirpten Buchfinken oder Blaumeisen, gurrte die eine oder andere Ringeltaube, oder pochten einsame Buntspechte die am Steilufer der Ilm hochschießenden Pappelstämme ab. Aber täglich schwoll das Vogelkonzert um einige Dezibel an. Immer mehr geflügelte Heimkehrer aus den Winterquartieren richteten es sich behaglich in den alten Parkbäumen ein, um sich zum geeigneten Zeitpunkt fortzupflanzen und die Brut aufzuziehen. Die Schneeglöckchen neigten ihre Häupter, geradeso als wollten sie ehrfürchtig das Feld vor dem bald wogenden Wiesengras, den Gänseblümchen und dem Huflattich räumen. Wie kleine Fallschirme blies ein leichter Wind erste Pollen umher. Nur noch wenige Wochen würde es dauern, bis die Wiesen mit ihrem satten Grün der Herde des Ilm-Schäfers eine vorzügliche Kraftnahrung boten.
»Sag mal, steht dein Angebot noch, mir bei der Dampfdusche zu helfen?«, fragte Heiner Falk.
Er saß neben Sören Droste, der den orangenen Multicar steuerte. Das Gefährt ruckelte auf einem der Parkwege gleich unterhalb des Schlosses unruhig hin und her. Droste und Falk waren seit fünf Jahren Kollegen bei der Gartenlust GmbH, einer privaten Firma für Gartenbau und Landschaftspflege. Voriges Jahr hatte die Firma erstmals den Zuschlag der Klassik Stiftung Weimar zur Pflege der Park- und Schlossanlagen erhalten.
»Ja, klar, was ich verspreche, halte ich auch. Wie stellst du dir das Teil denn genau vor?« Droste wischte sich mit dem rechten Ärmel kurz über das Gesicht und hielt gleich wieder das wackelnde Lenkrad mit beiden Händen fest.
Falk fasste den Haltegriff seitlich an der Innendecke. Bei jeder noch so kleinen Unebenheit des geschlängelten Kieswegs schlug sein Bein gegen das des Kollegen. Er fürchtete, auf der engen Bank ganz zu ihm hinüberzurutschen.
»Also, pass auf! Das Material habe ich mir in meiner alten Werkstatt zusammengesucht. Jedenfalls das meiste. Kannst gerne mal den Schlüssel haben und schauen, ob du da noch was Verwertbares findest.«
Falks alte Werkstatt war eine Klempnerei, die vor einigen Jahren insolvent gegangen war. Falks Chef hatte sich übernommen, wollte zu groß raus, indem er neben seinem Handwerksbetrieb auch noch ein Fliesengeschäft eröffnete. Dem Preisdruck der großen Baumarktketten konnte er nicht lange standhalten.
»Lüftungsgitter? Dampfgenerator? Hast du das alles schon?«
Droste war ein versierter Handwerker, hatte eine Lehre als Maurer gemacht und wollte nach dem Zusammenbruch der DDR ursprünglich das Abitur nachholen, um zu studieren. Doch die frühen neunziger Jahre waren goldene Zeiten für Handwerker gewesen. Er wechselte oft die Firmen, arbeitete viel, so dass er das Abitur nicht mehr nachmachte.
»Den Dampfgenerator besorgt mir ein Kumpel über seine Firma. Mit Prozenten!«
Falk zwinkerte Droste zu. Die Dampfdusche war der große Traum seiner Frau Renate. Sie war der Abschluss, die Krönung der Bauarbeiten, die Renate und Heiner Falk seit fünfzehn Jahren tagtäglich beschäftigten. Sie hatten sich mit dem Kauf des Häuschens in eine Lebensaufgabe gestürzt, nachdem sie 1989 von den Anwälten einer Erbengemeinschaft aus der Wohnung in der Weimarer Humboldtstraße hinausgedrängt worden waren. Man wollte das Gründerzeithaus komplett sanieren und zu deutlich angehobenen Preisen dem Immobilienmarkt wieder zuführen. Über eine Arbeitskollegin erfuhr Renate von der Möglichkeit, das Häuschen in Oberweimar für dreißigtausend D-Mark zu erwerben. Die Lehmhäuser in der Martin-Andersen-Nexö-Straße saßen geduckt wie Versteck spielende Kinder am Osthang der Stadt, auf dessen Kamm sich die Bahnstrecke nach Jena erstreckte. Das Ehepaar Falk kratzte seine dürftigen Ersparnisse zusammen, nahm einen Kredit auf und zog 1994 mit den beiden kleinen Kindern ein. Nur zwei Zimmer gab es: die Stube mit der Küche und das Schlafzimmer. Im Schlafzimmer stand das eheliche Bett, die Kinder schliefen auf zwei Matratzen, die sie tagsüber unter dem Bett der Eltern verstauten. Ein Bad gab es nicht, die blaue Sitzbadewanne aus Plastik war in einem Schrank verstaut und kam am Samstag, dem Badetag, zum Vorschein. Dann wurden sämtliche Möbel in den kleinen, steil ansteigenden Garten geschafft, und alle setzten sich nacheinander in das lauwarme Wasser. Wenn sich jemand die Haare waschen wollte, musste ein anderer mit einem Eimer warmen Wassers bereitstehen und ihm den schaumigen Kopf zum gegebenen Zeitpunkt damit übergießen. Falk, der neben handwerklichem Geschick auch viele hilfreiche Kumpels besaß, baute in den Folgejahren in viel Eigenarbeit das Häuschen aus: Ein Stockwerk kam hinzu, eine geflieste Terrasse mit Überdachung, ein Gemüsegarten. Nachdem die Kinder ihr eigenes Zimmer im ersten Stockwerk und auch ein kleines Bad hatten, stand als Letztes der Einbau einer Dusche im Erdgeschoss auf dem Plan. Eine ganz besondere Dusche sollte es werden, eine, mit der sich das Ehepaar Falk zum ersten Mal im Leben so etwas wie Luxus gönnen wollte: eine Dampfdusche!
Droste bremste den Multicar ruckartig ab. Beide Männer stiegen aus, ergriffen Schaufel und Besen und begannen, einige Stellen des Parkwegs mit Kies aufzuschütten und glatt zu kehren. Der Park in Tiefurt, dem beschaulichen Ortsteil im Weimarer Osten, stand die ganze Woche auf ihrem Einsatz- und Arbeitsplan. Auch wenn der Winter mild und niederschlagsarm gewesen war, gab es vieles auszubessern und für die Saison vorzubereiten. Vornehmlich am Schloss, das kaum mehr als ein Schlösschen war, fielen Arbeiten an. So war das hölzerne Rankengerüst für die Rambler-Rosen bis Ende der Woche zu erneuern. Heute aber galt es, einige Beete am Teehaus und am Musentempel zu bepflanzen.
»Wichtig ist, dass der Untergrund mit den Fliesen zuvor mit Tiefengrund behandelt wird. Sonst hast du da immer Ärger mit Feuchtigkeit. Ich hab mir den Einbau so einer Dampfdusche mal im Internet angeschaut. Hatte auch schon mal überlegt, so was bei mir einzubauen.«
Droste klaubte während seiner Rede einige Zigarettenkippen vom Boden auf und warf sie in einen braunen Müllsack.
»Ach ja. Und das Mauerwerk müssen wir absolut gut abdichten. Nachträglich kannste da nicht mehr viel korrigieren.«
Jetzt sah Droste zu seinem Kollegen hin, der die ganze Zeit über stumm geblieben war.
»Hallo, hörst du mir überhaupt noch zu?«
Falk stand auf den Besen gestützt da und blinzelte in die Ferne. Er murmelte etwas Unverständliches, ging dann in die Hocke und sah über die Grasnarbe hinweg.
»Da, schau mal, dahinten, siehst du das?«
Droste hielt sich die Hand schirmend gegen die aufsteigende Sonne über die Augen und blickte in die Richtung, die Falk ihm wies.
»Nee, was soll denn da sein?«
»Na, ganz da vorne, da ist doch was. Irgend so eine Erhebung!«
Falk ging einige Schritte in die Wiese hinein und forderte Droste mit einer Handbewegung auf, es ihm gleichzutun.
»Ja, jetzt seh ich’s auch. Sicher wieder Wühlmäuse.«
»Kann sein, aber irgendwie sieht das anders aus. Komm, wir fahren da mal hin.«
»Ja, okay, wir müssen die Bäume dort hinten eh noch prüfen. Wegen Astbruchs und so.«
Sie warfen Besen und Schaufel auf die Ladefläche und hoppelten mit dem Multicar über die Wiese bis zu der Erhebung. Wieder bremste Droste mit einem Ruck.
»Schau dir das an! Das ist doch nichts Natürliches. Junge, Junge. Die Erde hat jemand festgetreten. Alles voller Fußabdrücke.«
»Ja, sieht jedenfalls nicht nach Wühlmäusen aus.«
Die beiden Parkarbeiter standen jetzt links und rechts des Erdhaufens.
»Komm, wir graben den Haufen mal um.« Falk holte einen Spaten aus dem Korb, der an der Rückverkleidung der Fahrerkabine befestigt war. Mit einem kräftigen Tritt stieß er das Grabwerkzeug senkrecht mitten in den Haufen. Ein stumpfes Geräusch, ein Widerstand, der ihn in der Trittbewegung bremste, dann kippte der Spaten zur Seite, und Falk hätte fast das Gleichgewicht verloren.
»Da ist was vergraben, sag ich dir!«
Er ging nun vorsichtiger an die Sache heran, trug Schicht für Schicht die Erde ab. Schon bald lag eine schmale Holzkiste vor ihnen, wie sie typischerweise zum Versand von Weinflaschen verwendet wurde.
»Mensch, jetzt werden wir noch zu Schatzgräbern!« Falk strahlte Droste an. Das Zucken seiner Mundwinkel verriet aber auch eine gewisse Anspannung.
»Vorsicht, Sören!« Er hielt den Kollegen am Arm fest, der sich zur Kiste niederbückte. »Vielleicht ist da Sprengstoff drin. Von irgend so einem Verrückten, der das hier verbuddelt hat.«
»Sprengstoff? Ist das dein Ernst? Hier im Tiefurter Park? Oh, Mann! Ich glaub, du liest zu viele Krimis, Heiner!«
»Aber es kann doch nicht schaden, wenn wir die Polizei verständigen!«
»Wegen so einer lächerlichen Holzkiste? Ich glaub, das ist ganz harmlos. Warte!«
Falk schluckte und wich instinktiv zurück, als Droste die zugenagelte Kiste mit der Schaufelspitze aufzubrechen begann. Es knirschte, es krachte, dann platzte der größte Teil des Deckels ab.
Die beiden Parkarbeiter sahen in weit aufgerissene, azurblaue Augen über Wangen weiß wie Schnee, aber mit einem Hauch von rotem Puder. Ein rosa Rüschenkleid. Auf einem rubinroten Samtbettchen.
»Mannomann, das ist ja ein Ding!«
Falk nahm die Puppe vorsichtig aus der Holzkiste und bewunderte sie mit offenem Mund.
»Mensch, Sören, die hat jemand hier drapiert wie …«
»Die Kiste samt Inhalt und der ganzen Erde drauf sieht aus wie ein Grab. Ein frisches Grab.«
»Also echt! Ich würde sagen: Das ist ein Hochgrab. Die Puppe lag ja nicht in einem Loch unter der Erde. Sondern wurde auf den Boden gelegt und mit Erde überschüttet. Und die Erde haben sie sich da drüben geholt und dann hier festgetreten.«
Falk wies mit der rechten Hand zu den nahe gelegenen Bäumen, unter denen sichtbar Erde abgetragen worden war. Er kratzte sich am linken Ohr und atmete tief durch.
»Vielleicht Kinder, die Beerdigung gespielt haben.«
»Meinst echt? Das wär aber ziemlich makaber, oder?«
Falk sah verwirrt in die Augen der Puppe. Droste zog die Holzkiste aus dem Erdhaufen und inspizierte sie.
»Hier, schau, da steht was.«
»›TIM‹ kann ich erkennen.« Falk hatte seine Lesebrille aufgesetzt, was er sonst im Dienst tat nur, wenn er die Arbeitspläne studierte.
»Ja, und da, siehst du, hier auf der Seite, da stehen noch Zahlen. Eine Eins, eine Fünf, Moment …, eine Zwei und eine Vier. Fünfzehnhundertvierundzwanzig.«
Falk verstaute die Lesebrille wieder im Etui.
»Hast du eine Ahnung, was das bedeutet?«
Droste antwortete nicht und starrte auf den Boden. Nach einer Weile legte er die Puppe wieder in ihr Bett, schloss den Deckel über der Kiste und deponierte sie auf der Ladefläche des Multicars.
»Was willst du mit den Sachen machen?«, fragte Falk.
»Na, die Kiste kommt zum Brennholz, und die Puppe tun wir in die Fundkiste.«
»Ja, gute Idee!«
In der Fundkiste sammelte die Gartenlust GmbH alle Überbleibsel, die sich in den von ihr betreuten Parkanlagen fanden: Mützen, Schals, einzelne Handschuhe, einmal sogar ein rostiges Fahrrad, das jemand in die Ilm geworfen hatte. So alle zwei, drei Monate brachte ein Mitarbeiter die Stücke ins städtische Fundbüro, wo sie allerdings nur noch selten den Weg zu ihren eigentlichen Besitzern zurückfanden und, wenn wertlos, entsorgt, wenn höherwertig, versteigert wurden.
»Du, Sören, mir fällt da noch was ein. Die Nachrichten sind doch voll von diesem Politiker. Der mit den Kinderfotos. Meinst du, der Puppenfund könnte auch in so eine Richtung gehen? Ich meine, dass vielleicht ein Weimarer Pädophiler die Puppe vergraben hat?«
Droste sah seinem Kollegen nachdenklich in die Augen, dann griff er zum Spaten.
»Ach was, das kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte so einer eine Puppe vergraben?«
»Meinst du nicht, wir sollten das der Polizei melden? Also, ich meine, nur vorsorglich. Falls da irgendwas mit einem Kind passiert ist. Damit es nicht heißt, wir hätten da was verschwiegen.«
Droste lachte auf.
»Du willst der Polizei die Puppe melden? Eine Leiche, die eine Puppe ist? Also, komm, Heiner, jetzt spinn hier nicht rum. Die nehmen dich doch nicht für voll. Und weißt du, was unser Chef sagt, wenn wir einfach so die Polizei rufen?«
Falk schnipste mit den Fingern und deutete dann zustimmend mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Droste.
»Ja, da hast du recht. Der ist ja voll im Wahlkampf. Da dreht der durch. Seine Firma und Polizei. Geht vielleicht wirklich nicht.«
»Eben!«
Sie ebneten den Hügel in Windeseile ein. Sie mussten die verlorene Zeit einholen und waren deshalb den restlichen Vormittag damit beschäftigt, den Musentempel im Tiefurter Park zügig mit Blumenschmuck zu bepflanzen. In jenem Park, wo Goethe und Anna Amalia einst dem Theater in der freien Natur frönten, hatten auch sie heute ein besonderes Schauspiel erlebt. Eins, dem sie in Gedanken nachhingen, während sie Vergissmeinnicht, weiß-lila Tulpen und Schlüsselblumen in die geometrisch angeordneten und von Buchsbaumhecken umrandeten Beete einsetzten.
Als Heiner Falk am Abend jedoch die Nachrichten sah und sein Apoldaer Glockenpils aus der Flasche trank, fasste er einen Entschluss.
»Und was machst du mit so einem Studium dann beruflich?«
Dominik Ferber hatte diese Frage stets peinlich berührt, wenn sie ihm die Eltern, Verwandte oder frühere Mitschüler stellten. Lehrer wollte er auf keinen Fall werden. So erzählte er ihnen etwas von einem Job in einem Verlag, bei der Zeitung oder im Kulturmanagement, ohne selbst so richtig daran zu glauben. Er studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte in Tübingen, Berlin und Jena. Nach vierzehn Semestern schloss er die Prüfungen zum Magister 1998 erfolgreich ab. Aber was nun, Herr Magister? Als die letzte Klausur geschrieben, die Magisterarbeit bewertet und die Urkunde über den Abschluss zugestellt war, fiel er in ein tiefes seelisches Loch. Niemand rief ihn an, um ihn zu fragen, ob er diese oder jene Stelle haben wolle. Gleich einem Geier stürzte er sich wie alle anderen arbeitslosen Geisteswissenschaftler auf die wenigen Anzeigen in der ZEIT, die Stellen mit seiner Qualifikation anboten. Doch wenn überhaupt eine Antwort kam, dann ein Standardbrief. »Wir danken Ihnen für Ihre Bewerbung … haben uns aber für eine andere Bewerberin/einen anderen Bewerber entschieden … wir wünschen Ihnen viel Erfolg …«
Einmal erhielt er die Einladung zu einem Praktikum bei einer TV-Produktionsgesellschaft in Köln. Kabelhalten für den Kameramann. Brötchen und Kaffee besorgen für das Filmteam. Mehr lief da nicht. Die Kosten für die Unterkunft waren höher als die paar Mark, die man ihm für sein Praktikum bezahlte. Als größte Demütigung empfand er es jedoch, das Studentenzimmer in Jena aufgeben und ins elterliche Haus nach Weimar zurückziehen zu müssen. Da war einer in die große weite Welt der Wissenschaften und Künste ausgezogen und kam als arbeitsloser Akademiker zurück! Ihm fehlte das Geld, um sich das Leben in Jena weiterhin zu leisten. Erfolg hatte er nur mit einer Bewerbung als Hilfsarbeiter im Auslieferungslager von ALDI im Gewerbegebiet zwischen Weimar und Nohra. Dort verdiente er sich ein bisschen Geld, das er zum größeren Teil zurücklegte. Die Zeit des Grübelns war angebrochen. In Weimar liefen die Feierlichkeiten zum Kulturstadtjahr 1999, und er, der Kulturmanager, so nannte er sich selbst jetzt zynisch, war perspektivlos.
Es war ein Zufall, der ihn aus seiner Lethargie riss. Sein Vater war Außendienstmitarbeiter einer mittelgroßen Versicherungsgesellschaft, die 2001 auf ein rundes Jubiläum zurückblickte. Aus diesem Anlass war eine Festschrift geplant, in der auch die Geschichte der Versicherungsgesellschaft beschrieben und mit Fotos aus dem Firmenarchiv illustriert werden sollte. Ferber senior verstand es, bei seinen Vorgesetzten geschickt seinen Sohn ins Spiel zu bringen. So hatte Dominik endlich einen Zwei-Jahres-Vertrag für ein Projekt in der Tasche. Das beflügelte ihn, seine Lebensgeister erwachten. Zur gleichen Zeit eröffnete ihm Nadine, eine stille, kräftig gebaute Kollegin bei ALDI, mit der ihn ein One-Night-Stand nach der letzten Betriebsweihnachtsfeier verband und die ohne Schulabschluss war, dass sie von ihm schwanger sei. Sie mieteten nach der Geburt von Fabian ein kleines gesichtsloses Haus mit rostigen Rollläden und einem heruntergekommenen Garten in Tiefengruben, einem Dorf südlich von Weimar.
Neben der Recherche zur Geschichte der Versicherung jobbte Ferber weiter bei ALDI. 2001 eröffnete er mit dem angesparten Geld ein Schreibbüro. Dazu mietete er ein kleines Dachzimmer in der Weimarer Altstadt. Er ließ sich Visitenkarten drucken, befestigte an der Hauswand ein Firmenschild und knüpfte Kontakte zu regionalen Verlagen. In den Folgejahren schrieb er mehrere Weimarbücher für Touristen, gab Schreibkurse an Thüringer Volkshochschulen und akquirierte, nach der gelungenen Versicherungschronik, bundesweit gleich mehrere Aufträge zur Erstellung weiterer Firmen-Jubiläumsschriften. Langfristig arbeitete er an einer deutschen Kulturgeschichte, dargestellt an der einzigartigen Historie des Hotels Elephant am Weimarer Markt. Die Idee war ihm gekommen, als er sich mit einem ehemaligen Buchenwaldhäftling unterhielt. Der Mann aus Polen war zum sechzigsten Jahrestag der Befreiung des früheren Konzentrationslagers im Jahr 2005 nach Weimar gekommen und erzählte ihm, wie wichtig ihm das Übernachten in diesem Hotel war, von dessen Balkon einst Hitler zur jubelnden Masse gesprochen hatte. »Hitler ist weg, aber wir sind weiter da«, sagte der alte Herr mit brüchiger Stimme.
Neben dem Stolz auf seinen materiellen Erfolg erfüllte Ferber auch eine innere Zufriedenheit aufgrund seiner Tätigkeit. Sein kreatives Potenzial trat immer mehr hervor und gipfelte in seinem Angebot, Biographien für Menschen zu schreiben, die einen runden Geburtstag feierten und ihr Leben gerne in geschriebener Form den Kindern und Enkeln schenken wollten.
»Jedes Leben ist WERT-voll«, stand in großen Lettern auf der Broschüre, die er in den Weimarer Hotels und den Tourismus-Informationen in ganz Thüringen verteilte. Die Idee war ebenso einfach wie erfolgreich. Thüringen als das Bundesland in der Mitte Deutschlands war prädestiniert für Feiern von Familien, deren Mitglieder über die ganze Republik verstreut waren. Die Anreise war für alle ungefähr gleich weit. Städte wie Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar, Jena, ebenso Schlösser wie Beichlingen, Kochberg oder die Leuchtenburg boten mit ihrer reichen Kultur von Bach bis Bauhaus, ihren gastronomischen Angeboten – darunter die besten Klöße der Welt – und mit ihrer reizvollen Landschaft das ideale Ambiente für solche Feiern. Dominik Ferber beschrieb all diese Vorzüge und ergänzte sie um die Idee einer feierlichen Übergabe der Biographie der Jubilare an die Nachkommen. Er selbst offerierte sich als Verfasser dieser Biographie, die er mit Hilfe von aufgezeichneten Gesprächen mit den Jubilaren, Befragungen der Familie und Tagebüchern schrieb und um Fotos aus dem Familienbestand und von den Schauplätzen der Biographie ergänzte. Die gedruckte Ausgabe der Biographie war in der Regel nicht für den Buchhandel bestimmt. Sie erschien in einer limitierten, exklusiven Auflage für die Familie und Freunde, die sich zur Feier des runden Geburtstags oder der Jubelhochzeit in Thüringen einfanden. Ferber kooperierte mit einem Weimarer Buchbinder und bot die Ausgabe in pergamentenem Einband mit gravierten Goldlettern, auf Büttenpapier und in vielen anderen Varianten an. Auch für die Feier selbst stand Ferber mit Rat und Tat zur Seite: Die Auswahl der Lokalität, des Festmenüs, die ganze Tagesgestaltung, in Weimar zum Beispiel mit einer Kutschfahrt von der Altstadt zum Schloss Belvedere – all das hatte er in seinem Portfolio.
Der eigentliche Höhepunkt des Tages stellte das Ritual dar, mit dem er die Biographie während des Festmahls an den Jubilar übergab. Dazu offerierte er sich selbst als Redner, der das Leben des Jubilars in Schlaglichtern nacherzählte und es in Beziehung zur jeweiligen Stadt und zur Kulturgeschichte seiner Zeit brachte. Für Weimar war er wahlweise buchbar mit barocker Perücke als Nachtwächter zur Zeit Johann Sebastian Bachs, in Werther-Kleidung (blauer Frack, gelbe Weste, braune Stulpenstiefel, runder Filzhut) mit Sprachduktus der Goethezeit oder, mit aufgeklebtem Oberlippenbart, als Thomas Mann der Nachkriegszeit, der das zerstörte Weimar besucht. Auf Wunsch organisierte Ferber auch eine öffentliche Lesung mit dem Jubilar oder der Jubilarin in der Weimarer Buchhandlung Seidel mit Prosecco und Fingerfood, in diesem Fall auch mit der Option für Interessierte im Publikum, das Buch zu erwerben und signieren zu lassen.
Von Jahr zu Jahr liefen die Geschäfte Ferbers besser. Ja, er konnte es sich sogar leisten, Aufträge abzulehnen, wenn den Interessenten sein Angebot zu teuer war und sie feilschen wollten. Neben seiner Begabung im Verfassen von Büchern und Autobiographien entpuppte er sich auch als witziger und origineller Redner, etwas, was er in seinem Studium nicht gelernt hatte, jetzt aber durch viele Auftritte vor Publikum immer mehr vervollkommnete. Als Trauer-, aber auch als Festredner bei nichtkirchlichen Trauungen war er darum zusätzlich viel gefragt.
Nach einer tiefen Lebenskrise hatte Dominik Ferber somit doch noch berufliche Erfüllung gefunden. Die Beziehung mit seiner Lebensgefährtin Nadine bewegte sich an der Oberfläche, tiefgründige Gespräche waren nur selten möglich. Aber da es nur wenig Streit gab und Sohn Fabian ein aufgeweckter Junge war, arrangierte sich Ferber mit dieser Art von Familienleben und heiratete Nadine in der Sakristei der Weimarer Jakobskirche, dort, wo auch Goethe einst das Blumenmädchen Christiane Vulpius geehelicht hatte.
Jetzt, auf der Fahrt von seinem Tiefengrubener Häuschen in die Stadt hinein, liefen die Bilder der letzten fünfzehn Jahre vor seinem inneren Auge ab. Er staunte, welch überraschende Wende sein Leben genommen hatte. Er und Nadine überlegten, eine Eigentumswohnung in Weimar zu kaufen. Die Geschäfte gingen gut, und eine Finanzierung war möglich. Sohn Fabian, dessen Pubertät sich dem Ende zuneigte, hatte seinen Freundeskreis in Weimar und wollte gerne an ein Weimarer Gymnasium wechseln. Das war nur mit einem Wohnsitz in der Stadt möglich. Auch sonst sprach so manches für die Umzugspläne. Ferber hatte in den nächsten Tagen mehrere Wohnungsbesichtigungstermine vereinbart.
Er parkte den taubenblauen Opel Astra in der Nähe des Poßeckschen Gartens und ging durch die Amalienstraße zu seinem Büro, das sich im Dachgeschoss eines schmalen Hauses in der Brauhausgasse befand. Er liebte diesen täglichen Gang. Selten vergaß er beim Passieren des Frauenplans, einen Blick über die Einfriedungsmauer auf die Bäume in Goethes Garten zu werfen. Beim Betreten des Hausflurs leerte er den Briefkasten. Werbung fiel ihm entgegen, die Postkarte einer Jubilarin, die ihm für die »wunder-, wunder-, wunderbare Feier im Hotel Amalienhof« dankte. Als Letztes fischte er einen Brief aus Magdeburg, vom Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt für die Stasi-Unterlagen heraus. Er merkte, wie sich sein Puls beschleunigte.
In seinem Büro angekommen, setzte er schnell Kaffee auf und warf den Computer an. Seine Aktentasche legte er auf den Schreibtisch. Er ging zur Sitzgruppe am gläsernen Besprechungstisch. Dort ließ er sich auf der ockerfarbenen Couch nieder und öffnete den Brief der Stasi-Behörde. Er las Zeile für Zeile mehrmals durch und stellte fest, dass seine Hand dabei leicht zitterte.
Vor einem knappen Jahr hatte er die Anfrage erhalten, ob er sich vorstellen könne, die Biographie des Seniorchefs eines baden-württembergischen Pharmakonzerns zu schreiben. Obwohl Ferber seinen eigenen Marktwert einzuschätzen wusste, hatte ihn die Summe, die ihm Helmut van Bruns pauschal anbot, dann doch überrascht: Dreißigtausend Euro! Er suchte den alten Herrn bald nach dessen Anruf in seiner Villa am Horn in Weimar auf, wo er seinen Ruhestand verbrachte, und verständigte sich mit ihm über die Eckdaten seiner Biographie. Schon eine Woche danach waren zehntausend Euro als Anzahlung auf seinem Konto eingegangen. Das alles war professionell. Ferber stürzte sich in die Arbeit. Er recherchierte im Firmenarchiv, in den privaten Unterlagen. Er reiste ins Württembergische, unterhielt sich mit der Familie des Jubilars, mit Angestellten in der Produktion. Damals ahnte er noch nicht, auf was er bei diesen Recherchen stoßen würde. In jedem Fall führte die Biographie, so war er sich jetzt, nach einigen Monaten gründlicher Recherche, sicher, weit über die Person des Jubilars hinaus. Mit der Zeit fühlte er sich zusehends in die Rolle eines investigativen Journalisten versetzt, der einen Skandal aufdeckte. Ein Artikel im SPIEGEL aus dem Mai 2013 hatte seinen anfänglichen Verdacht jedenfalls bestätigt. Er weitete ohne Wissen seines Auftraggebers die Recherchen aus, reiste in die Stasiarchive nach Magdeburg, Leipzig, Erfurt, Gera, Suhl und suchte den Kontakt zu dem SPIEGEL-Redakteur. Auch traf er sich mit Betroffenen, besuchte entsprechende Foren im Internet und erstellte eine Chronologie über das, was vor dreißig Jahren passiert war.
Wie aber sollte er mit den gewonnenen Erkenntnissen umgehen? Dreißigtausend Euro waren eine Menge Geld! Wenn er den Skandal überging und die Biographie so schrieb, dass der Jubilar in einem glänzenden Licht dastand, wäre die Sache abgehakt, und er würde eine schöne Summe für den Erwerb der geplanten Eigentumswohnung einstreichen. Niemand vor ihm hatte sich mit den Quellen im Firmenarchiv befasst. Es sah auch nicht so aus, als würde sich noch jemals irgendwer dafür interessieren. Ohne Einwilligung der Familie van Bruns kam da sowieso niemand ran. Sollte er also einfach über den Skandal hinwegsehen? Das wäre vielleicht der für ihn günstigste Weg. Aber ginge das denn? Konnte er das mit seinem Gewissen vereinbaren? Du kannst, raunte ihm eine innere Stimme zu, doch danach wirst du niemals wieder in den Spiegel schauen können, wenn du das Verhalten der Brunshelp AG und ihres langjährigen Vorstandsvorsitzenden und mehrheitlichen Aktieninhabers in dieser Angelegenheit außen vor lässt!
Noch einige Minuten brütete er, das Schreiben der Stasi-Behörde auf seinen Knien, vor sich hin. Er überflog den Text.
»Der Eismann«, flüsterte er und legte den Brief zur Seite. Im Hintergrund blubberte die Kaffeemaschine. Dann beugte er sich auf der Sitzcouch vor, vergrub das Gesicht in den Händen und gab sich schließlich einen Ruck. In wenigen Wochen, am 12. April, war der achtzigste Geburtstag von Helmut van Bruns. Sollte die Geburtstagsfeier gelingen, als deren Höhepunkt die Präsentation der Biographie vorgesehen war, musste er vorher mit seinem Auftraggeber reden. Er wusste jetzt, dass er nicht über seinen Schatten springen konnte. Er fühlte sich, ganz Wissenschaftler in diesem Fall, der historischen Wahrheit verpflichtet. Noch einmal wollte er diese Woche alle Fakten, die er ermittelt hatte, durchgehen und übersichtlich zusammenstellen. Sie passten auf zwei, drei Blätter, die er van Bruns spätestens in ein, zwei Wochen vorlegen würde. Entschlossen stand er auf, schenkte sich Kaffee ein und zupfte einige Staubflusen von der Werther-Kleidung, die an einem Kleiderbügel am Garderobenständer hing.
Wie van Bruns reagieren würde, wenn er ihn mit der Wahrheit konfrontierte, war schwer abzuschätzen. Er musste für alle Fälle vorbeugen und rief die Telefonkontakte in seinem Smartphone auf.
»Seidel, ja?«
Der Buchhändler atmete schwer, offenbar ein Allergiker.
»Hier ist Dominik. Können wir uns mal besprechen, Gernot? Es geht um die Biographie dieses Pharmamenschen.«
»Ja, was ist da zu besprechen? Der wollte die Biographie doch nicht bei uns in der Buchhandlung vorstellen, oder?«
»Ja, schon. Aber ich müsste dich da in etwas einweihen. Kann ich bei dir vorbeikommen? Heute noch, sagen wir, um vierzehn Uhr?«
»Ja, das geht, bis dann!«
Ferber sah noch eine ganze Weile auf das Smartphone. Er war sich sicher, den richtigen Weg einzuschlagen. Nur kurz flog ihn Angst an. Dreißigtausend Euro standen auf dem Spiel. Das war sehr viel, wirklich sehr viel Geld. Aber dann wischte er mit einem gemurmelten »Ach was« seine Bedenken beiseite und gab sein Passwort in den Computer ein.
Er klickte einige Pfade zu Dateien an und öffnete die mit dem Namen Die Axt Satans. Sosehr ihn van Bruns und dessen Biographie in diesen Tagen auch beschäftigte, es gab noch andere Baustellen.
»Laura! Ronny! Sascha! Abendbrot!«
Sascha Woltmann erhob sich vom Sofa, klappte die ADACMOTORWELT zu und nahm am Esstisch gegenüber seiner Frau Yvonne Platz. Der heutige Streifendienst hatte wegen eines Auffahrunfalls mehrerer Autos kurz vor Schichtwechsel deutlich länger gedauert. Er war kurz eingenickt. Yvonnes Ruf in Richtung der Kinderzimmer hatte ihn geweckt.
»Du, Sascha, ich glaub, die haben beide ihre Kopfhörer auf. Kannst du mal nach ihnen schauen?«
Yvonne rührte den Tomatensalat um. Woltmann schlürfte noch ein wenig verschlafen in Richtung der beiden Zimmer. Wenig später kam er mit Ronny und Laura zurück.
»Echt voll ätzend, diese Nazis!« Ronnys picklige Gesichtshaut wirkte noch röter als sonst.
Woltmann griff sich ein Stück Vollkornbrot und beschmierte es mit Butter.
»Wie kommst du denn jetzt gerade darauf?«
Ronny erzählte von einigen Mitschülern, die in der Pause gerne über Ausländer herzogen und sich freuten, wenn sie dadurch den Protest anderer provozierten.
»Ich hab mir gerade ein Video angeschaut, das die heute auf dem Schulhof rumgezeigt haben. Echt krank!«
Ronny fuhr sich mit der Hand durch sein fast schulterlanges Haar und nahm sich vom Tomatensalat.
»Die haben eine dunkelhäutige Kandidatin von ›Germany’s Next Top Model‹ gezeigt – mit Ton natürlich, damit man hört, was die da gesprochen hat –, und danach voll abgekotzt.«
»Ich find die Kandidatin witzig«, schaltete sich Laura jetzt ein. Mit ihren dreizehn Jahren wusste sie über alles Bescheid, was GNTM betraf.
»Ach, Laura, hab ich ganz vergessen. Am Freitag hab ich dich auf dem Frauenplan gesehen. So um elf. Hast du da denn keine Schule gehabt?«
Woltmanns Frage trieb Laura das Blut in den Kopf. Sie wich seinem Blick aus.
»Hatte eine Freistunde.«
Woltmann überlegte, ob sie ihn vielleicht anschwindelte, oder ob es ihr nur peinlich war, weil er sie mit einem Jungen gesehen hatte?
»Ich hab übrigens in der Mathearbeit ein gutes Gefühl.« Laura wechselte das Thema. Vielleicht will sie nicht, dass ich wegen des Jungen nachbohre, sagte sich Woltmann.
Während sie sich zu dritt weiter unterhielten, driftete Yvonne Woltmann mit ihren Gedanken ab. Um die Mundwinkel bildeten sich kleine Fältchen. Die letzten Wochen schlief sie schlecht. Immer häufiger ertappte sie sich dabei, wie sie wehmütig an die Zeit in Berlin zurückdachte, wo die Familie bis vor einem knappen Jahr gelebt hatte. Sie vermisste ihre dortigen Freundinnen, obwohl sie häufig miteinander telefonierten. Doch Telefonieren war kein Ersatz für Begegnungen. Noch mehr aber belastete sie ihre berufliche Situation. In Berlin hatte sie viele Jahre im Zentrum für Flüchtlingshilfe gearbeitet, eine verantwortungsvolle Stelle, deren Inhalte weit über die von ihr gehaltenen Deutschkurse hinausgingen. Sie war für viele Migrationsfamilien Ansprechpartnerin, wenn nicht sogar Vertraute, um die sie sich geschickt und erfolgreich hinsichtlich vieler praktischen Fragen kümmerte. In Weimar tat sie sich mit einer Anstellung schwer. Zwar war sie für einige Monate am Sprachenzentrum der Bauhaus-Universität beschäftigt gewesen und hatte den Studierenden Weimar und die deutsche Kultur nähergebracht. Aber der Vertrag war ausgelaufen. Die Bezahlung war ohnehin nicht gut gewesen. Auch fehlten ihr bei dieser Tätigkeit, wie ihr immer klarer wurde, die sozialen Bezüge. Diejenigen, die sich einen solchen Sprachkurs in Weimar leisteten, waren liebenswerte, zumeist wohlhabende Studierende aus reicheren Ländern. In Berlin war sie dagegen im Auge des Taifuns gewesen: Flüchtlinge aus der ganzen Welt kamen erschöpft und perspektivlos an, und sie mit ihrer guten Vernetzung half ihnen effizient beim Stellen von Anträgen, Vermitteln von Anwälten usw. In Berlin brauchte man sie! Und in Weimar?
»Hier, Laura, nimm von dem Salat, ist gesund!«
Sie blinzelte ihrer Tochter zu, die mit ihrem Gewicht haderte, obwohl es sich dabei vielleicht nur um den bei Mädchen nicht unüblichen Pubertätsspeck handelte. Yvonne hing noch einem anderen Gedanken nach. Zum ersten Mal, seitdem sie mit Sascha verheiratet war, steuerte sie kaum etwas zur Familienkasse bei. Sie waren mehr oder weniger von einem Einkommen abhängig – und das war bei einem Schutzpolizisten überschaubar. Seit sie nach Weimar gezogen waren, drehte sie jeden Cent um, verglich die Werbeblätter der Discounter und versuchte zu sparen, wo es nur ging. Sie fühlte sich in einer finanziellen Abhängigkeit, die sie bisher nicht gekannt hatte. Schon seit jeher besaßen sie und Sascha getrennte Konten. Aber jetzt bewegte sich ihr Kontostand immer nur in eine Richtung, nämlich nach unten. Für manchen persönlichen Einkauf musste sie Sascha anpumpen, was ihr extrem schwerfiel. Ein Rest an Stolz war ihr geblieben.
Ihr fehlendes Einkommen brachte es auch mit sich, dass sie an die Reserven gehen mussten, wenn sie einen Urlaub planten. Den hatten sie sich jedes Jahr geleistet. Um den Zusammenhalt der Familie zu bewahren, musste das möglich sein. Auch ihre Beziehung zu Sascha hatte in den letzten Monaten gelitten. Sie unternahmen so gut wie nichts mehr zusammen. Ohne Urlaub würde das Zusammenleben wohl noch angespannter werden.
Nur einen kleinen Lichtblick gab es: In einer großen Weimarer Buchhandlung hatte sie im Weihnachtsgeschäft stundenweise an der Kasse ausgeholfen und Geschenke eingepackt. Sie werde bei Bedarf gerne wieder auf sie zurückkommen, sagte die Leiterin Frau Haase, als der letzte Kunde an Heiligabend das Geschäft verlassen hatte. Jetzt, mit der Leipziger Buchmesse und auf Ostern hin, war sie mit mehreren Schichten in der Buchhandlung eingeteilt. Dort arbeitete sie gerne, auch wenn sie sich heimlich wünschte, im Verkauf tätig zu sein. Sie wollte nicht nur Geschenke einpacken und Kunden, die in der Schlange standen, Pfefferminzbonbons anbieten, um ihnen die Wartezeit zu versüßen. Immerhin hatte sie ihr geisteswissenschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen. Da fühlte sie sich mit den jetzigen Aufgaben unterfordert.
»Na, meine Liebe, wo bist du denn mit deinen Gedanken?«
Sascha hatte seine warme und trockene Hand auf ihren Unterarm gelegt. Als hätte er ihre Gedanken erraten, nahm er einen Themenwechsel vor.
»Kinder, wir müssen jetzt mal beraten, wohin wir im Sommer in Urlaub fahren. Wird höchste Zeit mit dem Buchen.«
»Ich will an den Strand!«, rief Laura und meldete sich dabei wie in der Schule.
»Ja, am Strand chillen, find ich gut!« Ronny sah seine Schwester zufrieden an.
Woltmanns Mundwinkel rutschten leicht nach unten. Mit Ronny hatte er noch vor zwei, drei Jahren so manchen Berg in Südtirol bestiegen. Das gemeinsame Gipfelerklimmen zählte zu den glücklichsten Erinnerungen, die er mit seinem Sohn verband. Dass der diesmal nur am Strand rumliegen wollte, enttäuschte ihn.
»Aber Ronny, wir könnten doch mal wieder den Sass Rigais in der Geislergruppe angehen!«
»Nee, Papa, ist nicht mehr mein Ding. Strand ist besser. Vielleicht mach ich ’nen Surfkurs.«
»Also ich fand es in den Bergen immer schön.« Yvonne blickte jeden einzeln an. Die Kinder schüttelten den Kopf.
»Nein, Mama, das ist immer so anstrengend!« Laura rollte mit den Augen.
An der Haustür klingelte es. Helga und Heinrich Woltmann standen vor der Tür. Sascha bat sie hereinzukommen.
»Oh, ihr seid gerade beim Abendbrot, da wollen wir nicht stören«, sagte Oma Helga, nahm aber zugleich am Tisch Platz. Ihr Gemahl tat es ihr gleich.
»Bierchen?« Die Eltern nickten. Woltmann goss ihnen jeweils ein Glas ein.
»Tja, also, wir wollten etwas mit euch besprechen!« Heinrich Woltmann wischte sich den Schaum vom Mund.
»So, na was denn, Opa?« Die Anrede wählte Sascha Woltmann immer, wenn die Kinder zugegen waren.
»Also, Kinder, passt auf. Wir haben uns da was überlegt. Ich mein, mit dem Geld, da ist es ja im Moment bei euch nicht so dicke …«
Heinrich Woltmann sah nur für einen Bruchteil in Yvonnes Richtung, die sofort beschämt zu Boden blickte.
»Also, ich meine, solche Phasen gibt’s in jeder Familie. Als wir damals als junge Familie …«
»Heinrich, du wolltest doch was vorschlagen!« Helga wusste um Heinrichs Hang abzuschweifen.
»Ach ja, klar, also, wir haben uns überlegt, ob wir nicht diesen Sommer mit euch gemeinsam in Urlaub fahren.«
Ronnys Gabel fiel auf den Teller. Eine angespannte Stille trat ein. Die Blicke der vier jüngeren Woltmanns waren gleichermaßen konsterniert wie verblüfft. Eben hatten sie selbst noch über das Thema gesprochen. Jetzt die Idee der Großeltern.
»Also, ich meine, das ist ja nur ein Vorschlag. Es ist nämlich so, dass der Zaubitzer Rudi ja auch so ein schönes Wohnmobil wie wir hat. Der muss im Sommer aber wegen einer OP ins Krankenhaus und kann nicht wegfahren. Er hat deshalb angeboten, das Wohnmobil zu einem Freundschaftspreis …«
»Danke, Heinrich!« Yvonne fiel ihm ins Wort und blickte streng in Richtung der Schwiegereltern. Noch ein paar Fältchen mehr zeigten sich um ihre Mundwinkel herum. »Das ist nett gedacht von euch. Aber ich glaube nicht, dass wir das Angebot annehmen.«
Unter dem Tisch trat sie Sascha auf den Fuß. Der holte Luft, um etwas zu sagen, aber Helga Woltmann war schneller.
»Wir dachten zum Beispiel an Camping in der Lüneburger Heide. Das wird euch gefallen. Von dort aus könnten wir einen Abstecher ins Heide Park Resort in Soltau machen. Ronny, Laura, da gibt’s eine Achterbahn. Ach, wie hieß die noch mal, Heinrich?«
»Eine Ratatouille-Achterbahn!«
»Ratatouille?« Helga Woltmann blickte unsicher. »Das ist doch eine Gemüsepfanne!«
»Dann Katapult.«
»Ja, genau, danke, Heinrich, eine Katapult-Achterbahn. Das muss ganz dolle sein, Kinder. Fischers waren mit ihren Enkeln auch schon mal dort.«
Fischers, aha, die besten Freunde der Eltern stecken also auch hinter diesem Plan, dachte sich Woltmann und setzte sich ganz aufrecht hin.
»Ich finde das freundlich von euch. Aber wir möchten das nicht! Urlaub haben wir immer alleine gemacht. Und das soll auch so bleiben.«
Bei diesen Worten sah er zu Ronny und Laura, die aber ohnehin für den Vorschlag der Großeltern kein Feuer gefangen hatten.
»Kommt!« Sascha Woltmann erhob sich. »Ich bin eh mit dem Abendbrot fertig. Wir gehen ins Wohnzimmer. Ich wollte dir, Opa, zeigen, was in der neuen ADAC MOTORWELT steht. Da habe ich nämlich einen Beitrag über Anhängerkupplungen entdeckt.«
»ADAC?« Woltmann senior fühlte sich mit seinem Urlaubsvorschlag abgebügelt, fügte sich aber. »Diesen Verein nehm ich nicht mehr ernst. Aber zeig trotzdem mal her. Hatte noch gar keine Zeit, in mein Heft reinzuschauen.«
Was Sascha Woltmann nicht verriet: In der ADACMOTORWELT standen auch jede Menge Werbeanzeigen für Treppenlifte und Badewannenausstiegshilfen. Es konnte nicht schaden, wenn die Eltern mit diesen Themen unauffällig, aber rechtzeitig und immer wieder konfrontiert wurden. Solche Umbaumaßnahmen schob man meist so lange vor sich her, bis es zu spät war. Auch wenn die Eltern gerade erst in den Ruhestand gegangen sind, das Alter kommt schneller, als man denkt, sagte er sich. Er hatte bei einem Einsatz als Streifenpolizist in Berlin eine tote Frau gefunden, die einen Schlaganfall erlitten hatte. Ihr Mann saß neben ihr, demenzkrank und hilflos. Niemand hatte nach dem Ehepaar geschaut. Das sollte seinen Eltern nicht passieren. Nachdem er und seine Familie jetzt hier in Weimar lebten, konnten sie immer wieder nach dem Rechten im Haus der Eltern schauen und notfalls schnell Hilfe herbeiholen. Yvonne hatte ihm schon manches Mal vorgeworfen, er sei dabei, in diesem Punkt geradezu eine Paranoia zu entwickeln. Helga und Heinrich Woltmann waren fit wie zwei Turnschuhe und planten einen ereignisreichen Ruhestand mit Wohnmobilreisen, Englischkurs an der Volkshochschule und vielem mehr. »Mit sechsundsechzig Jahren, da fängt das Leben an«, hielt ihm Yvonne den Liedtitel von Udo Jürgens in solchen Momenten fröhlich entgegen. Aber das rang ihm stets nur ein gequältes Lächeln ab.
Dienstag, 18. März 2014
Der Mann im grünen Overall drückte sich schon eine halbe Stunde auf dem Parkplatz der Polizeiinspektion herum. Manchmal griff er zum Handy, telefonierte oder tat zumindest so.
Es war Nachmittag. Schichtwechsel bei der Streifenpolizei. Woltmann zog seinen Schottenschal zu und schlenderte zu seinem perlgrauen Škoda Octavia. Unter seinem Arm klemmte eine Tüte mit Brötchen, die er bei Ingo Baum gekauft hatte.
»Entschuldigung«, sprach ihn jetzt der Arbeiter an. Seine Stimme zitterte. Wie ein Wiesel auf der Flucht schaute er aufgeregt in alle Richtungen. »Darf ich Sie mal kurz was fragen?«
Woltmann blinzelte in die Sonne.
»Ja, was gibt’s?«
»Sind Sie Polizist?«
»Ja, warum?«
»Bei der Kripo?«
»Äh, warum möchten Sie das wissen?«
Die Frage nach der Kripo weckte Woltmanns Neugier.
»Weil, ich wollte etwas anzeigen, was wahrscheinlich völlig ohne Bedeutung ist. Vorsichtshalber, mein ich.«
Zwei Kollegen Woltmanns gingen an ihnen vorbei. Er zog den merkwürdigen Besucher etwas zur Seite.
»Sagen Sie mir erst mal, wer Sie sind!«
»Aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass das, was ich Ihnen sage, unter uns bleibt.«
Der Mann im Overall kramte nach einer Zigarette und zündete sie sich hastig an. Woltmann antwortete nicht.
»Ich heiße Falk. Heiner Falk.« Mehrere tiefe Züge an der Zigarette; der Kopf des Mannes verschwand in einer Wolke aus Qualm. »Ich bin Gartenarbeiter. Pflege hier die Parks.«
Der Rauch verzog sich wieder. Falk erzählte vom Fund im Tiefurter Park, der aufgebahrten Puppe im Grab. Die mysteriöse Inschrift erwähnte er nicht. Woltmann hörte zu, scheinbar teilnahmslos. Als Falk fertig war, öffnete er mit der Fernbedienung sein Auto.
»Ich kann Ihnen da nicht wirklich weiterhelfen. Tut mir leid.«
Er stieg in sein Auto und fuhr zügig vom Parkplatz der PI. Falk zündete sich eine weitere Zigarette an und begab sich zu seinem orangefarbenen Multicar. Droste war heute krank. An diesem Feierabend fuhr er alleine zurück zur Firma.