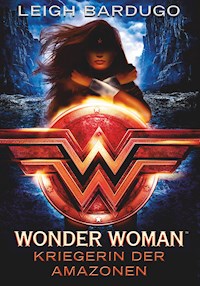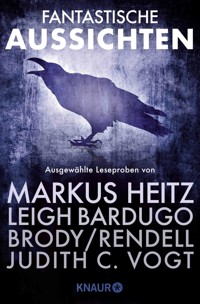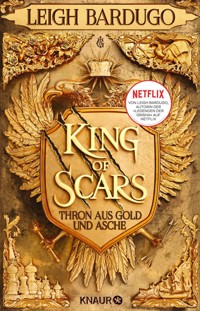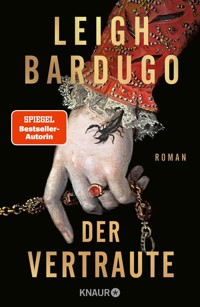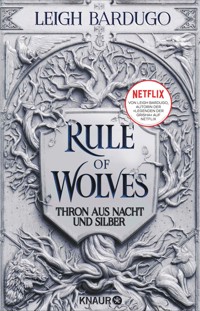12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Legenden der Grisha
- Sprache: Deutsch
Der zweite Teil der Grisha-Trilogie, Leigh Bardugos Fantasy-Bestseller über die magische Armee der Grisha und den Krieg um Ravka Nach ihrem furchtbaren Kampf gegen den Dunklen, den ältesten und mächtigsten der Grisha, mussten Alina und Mal aus Ravka fliehen. Doch selbst jenseits der Wahren See sind sie nicht sicher: Der Dunkle hat überlebt und ist entschlossener denn je, sich Alinas besondere Kräfte zunutze zu machen. Denn nur mithilfe ihrer Magie kann es ihm gelingen, den Thron von Ravka an sich zu reißen. In die Enge getrieben, bittet Alina schließlich den berüchtigten Freibeuter Stormhond um Hilfe und macht sich auf, die Armee der Grisha anzuführen. Mit ihrer Grisha-Trilogie hat Bestseller-Autorin Leigh Bardugo ein absolutes Fantasy-Highlight geschaffen, irgendwo zwischen Abenteuer, Märchen und zarter Romance. Das vom Krieg zerrissene Ravka, das ausgeklügelte Magie-System der Grisha und die lebendigen, facettenreichen Charaktere werden nicht nur Fans der Fantasy-Bestseller »Das Lied der Krähen« und »Das Gold der Krähen« begeistern. Entdecke das gesamte GrishaVerse Die Grisha-Trilogie ist in folgender Reihenfolge erschienen: - »Goldene Flammen« - »Eisige Wellen« - »Lodernde Schwingen« Die Krähen-Dilogie ist in folgender Reihenfolge erschienen: - »Das Lied der Krähen« - »Das Gold der Krähen« Die Thron aus Nacht und Silber-Dilogie besteht aus - King of Scars - Rule of Wolves Noch mehr Geschichten aus der Grisha-Welt: - »Die Sprache der Dornen« (illustrierte Märchen aus der Welt der Grisha) - »Die Leben der Heiligen« (illustrierte Heiligen-Legenden aus der Welt der Grisha) - »Demon in the Wood. Schatten der Vergangenheit« (Graphic Novel zur Vorgeschichte des Dunklen)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Leigh Bardugo
Eisige Wellen
Roman
Aus dem Englischen von Henning Ahrens
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nach ihrem furchtbaren Kampf gegen den Dunklen, den ältesten und mächtigsten der Grisha, mussten Alina und Mal aus Ravka fliehen. Doch selbst jenseits der Wahren See sind sie nicht sicher: Der Dunkle hat überlebt und ist entschlossener denn je, sich Alinas besondere Kräfte zunutze zu machen. Denn nur mithilfe ihrer Magie kann es ihm gelingen, den Thron von Ravka an sich zu reißen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Die Grisha
Karte
davor
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
danach
Danksagung
Glossar
Für meine Mutter, die daran glaubte,
als mir der Glaube fehlte.
Die Grisha
Soldaten der Zweiten Armee
Meister der Kleinen Künste
Orden der Lebenden und der Toten
Entherzer
Heiler
Orden der Beschwörer
Stürmer
Inferni
Fluter
Orden der Fabrikatoren
Durasten
Alkemi
davor
Früher, lange bevor sie die Wahre See befuhren, hatten der Junge und das Mädchen immer wieder von Schiffen geträumt: Schiffe, randvoll mit Geschichten, verzauberte Schiffe mit Masten aus wohlriechendem Zedernholz und mit Segeln aus purem Gold, von Jungfrauen gesponnen. Die Besatzung bestand aus weißen Mäusen, die Lieder trällerten und das Deck mit ihren rosa Schwänzchen schrubbten.
Die Verrhader war kein Zauberschiff, sondern eine Kogge der Kerch, schwer beladen mit Hirse und Melasse. Sie stank nach ungewaschenen Leibern und rohen Zwiebeln, die laut den Matrosen gegen Skorbut halfen. Die Besatzung fluchte und rotzte und spielte um die Rumrationen. Die junge Frau und der junge Mann bekamen schimmeliges Brot zu essen, und ihre Kabine war eine winzige Kammer, die sie sich mit zwei weiteren Passagieren und einem Fass gepökeltem Dorsch teilen mussten.
Aber das kümmerte sie nicht. Sie gewöhnten sich an das stündliche Läuten der Schiffsglocke, die Möwenschreie und das Kauderwelsch der Kerch. Das Schiff war ihr Königreich, das Meer ein unendlich breiter Burggraben, der ihnen die Feinde vom Leib hielt.
Der junge Mann passte sich dem Leben an Bord so umstandslos an wie allem anderen auch. Während seine Wunden verheilten, lernte er, Seemannsknoten zu binden und Segel zu flicken, und arbeitete gemeinsam mit der Besatzung an den Tauen. Er kannte keine Angst und kletterte barfuß in die Takelage. Die Seeleute staunten über seine Gabe, Delfine, Rochen und bunt gestreifte Tigersalmler zu erspähen, waren verblüfft, dass er immer genau wusste, wann und wo der seepockige, breite Rücken eines Wals aus den Wellen auftauchen würde. Sie sagten, wenn sie nur halb so viel Glück hätten wie er, würden sie sich eine goldene Nase verdienen.
Das Mädchen beunruhigte sie.
Nach drei Tagen auf See wurde sie vom Kapitän gebeten, möglichst unter Deck zu bleiben. Die Matrosen seien abergläubisch und meinten, eine Frau an Bord würde unheilvolle Winde heraufbeschwören. Über eine heitere, scherzende, lachende Frau, eine, die zum Spaß in die Trillerpfeife blies, hätte sich die Besatzung gefreut. Aber dieses Mädchen stand immer nur starr und stumm wie eine hölzerne Galionsfigur an der Reling, einen Schal um den Hals geschlungen. Es schrie im Schlaf und weckte alle Matrosen im Vordeck.
Also blieb ihr nichts anderes übrig, als tagsüber den dunklen Schiffsbauch zu durchstreifen. Sie zählte die Melassefässer, studierte die Seekarten des Kapitäns und nachts suchte sie Schutz in den Armen des Jungen. Sie standen auf dem Deck und hielten Ausschau nach Sternbildern: dem Jäger, dem Gelehrten, den Drei Dummen Söhnen, dem Rad mit den leuchtenden Speichen, dem Palast des Südens mit den sechs schiefen Türmen.
Sie versuchte, so lange wie möglich mit dem Jungen unter Deck zu bleiben, erzählte Geschichten und stellte Fragen. Sie wollte nicht schlafen, weil sie wusste, dass dann die Träume wiederkehren würden. Manchmal träumte sie von den zerstörten Skiffs mit den schwarzen Segeln, von Blut auf den Planken, von Menschen, die in der Finsternis schrien. Noch schlimmer waren die Träume, in denen ein bleicher Prinz seine Lippen auf ihren Nacken drückte, die Hände auf den Reif legte, der ihren Hals umschloss, und ihre Macht aufrief, die daraufhin blendend hell im Sonnenschein aufblitzte.
Immer wenn sie von ihm träumte, schreckte sie zitternd aus dem Schlaf hoch. Dann vibrierte der Nachhall der Macht in ihrem Körper, und sie spürte das warme Licht auf der Haut.
Der Junge schloss sie fester in die Arme und murmelte ihr leise etwas ins Ohr, damit sie wieder einschlief.
»Das ist nur ein Albtraum«, flüsterte er. »Irgendwann bist du diese Träume los.«
Er verstand nicht – sie sehnte sich trotz allem nach ihren Träumen, weil sie nur noch dort ihre Macht gefahrlos anwenden konnte.
Der Junge und das Mädchen standen an der Reling, während die Verrhader sich dem Land näherte, und betrachteten die Küste von Novyi Zem.
Schließlich liefen sie durch ein Gewimmel von Masten und gerefften Segeln in den Hafen ein.
Hier lagen Schaluppen und Dschunken, von den Shu Han für felsige Küstengewässer konstruiert, bewaffnete Kriegsschiffe und Vergnügungsboote, schwere Koggen und Walfänger der Fjerdan. Auf einer bauchigen Strafgaleere, die bald in die südlichen Kolonien aufbrechen würde, wehte ein Banner mit roter Spitze, das vor Mördern an Bord warnte. Als die Verrhader daran vorbeiglitt, hätte das Mädchen schwören können, Ketten klirren zu hören.
Dann erreichte die Kogge ihren Liegeplatz. Man senkte die Laufplanke auf die Mole. Hafenarbeiter und Besatzung begrüßten einander lautstark, lösten Taue, bereiteten das Löschen der Ladung vor. Der Junge und das Mädchen suchten die Menschenmenge im Hafen nach dem Karmesinrot der Entherzer und dem Blau der Beschwörer ab, nach dem Aufblitzen der Gewehre von Soldaten aus Ravka.
Und dann war es so weit. Der Junge ergriff ihre Hand. Nach der tagelangen Arbeit an den Tauen war seine Handfläche rau und schwielig. Als sie auf die Planken der Mole traten, schien der Boden unter ihren Füßen zu schwanken.
Die Seeleute lachten. »Vaarwel, fentomen!«, riefen sie.
Die beiden gingen weiter, taten ihre ersten Schritte in der neuen Welt.
Bitte, betete das Mädchen im Stillen zu den Heiligen, die sie hoffentlich erhörten, lasst uns hier in Sicherheit sein. Lasst uns hier ein Zuhause finden.
1
Wir hielten uns nun schon zwei Wochen in Cofton auf, aber ich fand mich immer noch nicht zurecht. Die Stadt lag westlich der Küste von Novyi Zem im Binnenland, viele Meilen von dem Hafen entfernt, in dem wir an Land gegangen waren. Bald würden wir uns tiefer ins Landesinnere wagen, bis in die urtümliche Grenzmark von Zemeni. Dort, so hofften wir, wären wir endgültig in Sicherheit.
Ich studierte meinen kleinen, selbst gezeichneten Stadtplan und machte mich auf den Heimweg. Ich traf Mal täglich nach der Arbeit, um mit ihm zur Herberge zurückzukehren, aber heute war ich vom vertrauten Weg abgewichen, um das Abendessen zu kaufen, und hatte mich verlaufen. Die mit Kohl und Kalbfleisch gefüllten Pasteten, die ich in meinem Lederbeutel verstaut hatte, stanken penetrant. Der Händler, der sie als Delikatesse der Zemeni angepriesen hatte, hatte mich vermutlich übers Ohr gehauen, aber das konnte mir egal sein, denn in letzter Zeit schmeckte sowieso alles, was ich aß, nach Asche. Mal und ich waren nach Cofton gekommen, um Geld für unsere Weiterreise nach Westen zu verdienen. Die Stadt, das Zentrum des Jurda-Handels, war umgeben von Feldern, auf denen die kleinen Blumen mit den orangefarbenen, anregend wirkenden Blüten angebaut wurden. In Ravka galten sie als Seltenheit, aber die Menschen hier verbrauchten sie gleich büschelweise. Manche Matrosen auf der Verrhader hatten sie gekaut, um während der langen Wachen nicht einzuschlafen. Die Männer schoben die getrockneten Blüten am liebsten hinter ihre Unterlippe, die Frauen trugen sie am Handgelenk in bestickten Beuteln bei sich. Jedes Schaufenster, an dem ich vorbeikam, warb für eine andere Sorte: Goldblatt, Die Wucht, Fegefeuer, Rausch & Ruhm. Einmal sah ich, wie ein bildhübsches Mädchen einen ganzen Mundvoll rostroten Saft in einen dieser Bronzenäpfe spuckte, die vor jeder Ladentür standen. Eine ekelhafte Sitte in Zemeni, an die ich mich wahrscheinlich nie gewöhnen würde.
Ich bog mit einem Seufzer der Erleichterung in die Hauptstraße ein, hier fand ich mich endlich wieder zurecht. Cofton kam mir immer noch unwirklich vor. Die Stadt hatte etwas Grobes und Unfertiges. Fast alle Straßen waren ungepflastert, und die Gebäude mit ihren dünnen Holzwänden und flachen Dächern erweckten den Eindruck, jeden Moment einstürzen zu wollen. Trotzdem zeugte die Stadt von Reichtum: Alle Fenster waren verglast, die Kleider der Frauen waren aus Samt und oft mit Spitzenstickereien verziert. In den Auslagen der Läden wurden keine Gewehre, Messer oder Kochtöpfe zum Kauf angeboten, sondern Schlemmereien, Kostbarkeiten und Nippes. Sogar die Bettler trugen Schuhe. So sah es in einem Land aus, das sich nicht ständig im Krieg befand.
Als ich an einem Schnapsladen vorbeiging, sah ich aus den Augenwinkeln, wie etwas Rotes vorbeihuschte. Korporalki. Mein Herz hämmerte, ich duckte mich in den Schatten zwischen zwei Häusern und griff nach der Pistole an meiner Hüfte.
Zuerst der Dolch, ermahnte ich mich und ließ die Klinge aus dem Ärmel gleiten. Ja kein Aufsehen erregen. Pistole nur im Notfall. Macht als letzter Strohhalm. Ich vermisste wieder meine von den Fabrikatoren angefertigten Handschuhe, die ich in Ravka gelassen hatte. Sie waren von kleinen Spiegeln bedeckt, sodass ich meine Gegner bei Zweikämpfen mühelos blenden konnte. Sie waren eine gute Alternative zum »Schnitt«, der jeden Feind der Länge nach halbierte. Wenn mich ein Entherzer der Korporalki entdeckte, hätte ich allerdings keine Wahl. Denn die Entherzer, die Lieblingssoldaten des Dunklen, konnten mein Herz zum Stillstand bringen oder meine Lunge zerquetschen, ohne mich auch nur zu berühren.
Nachdem ich eine Weile gewartet hatte, die feuchte Hand fest um den Griff des Dolchs geschlossen, warf ich einen Blick um die Ecke. Ich sah einen mit Fässern beladenen Karren. Der Kutscher hatte die Pferde gezügelt und sprach mit einer Frau, deren Tochter ungeduldig auf und ab sprang und ihren dunkelroten Rock flattern ließ.
Keine Korporalki. Sondern nur ein kleines Mädchen. Ich sank gegen die Mauer, holte tief Luft und versuchte, mich wieder zu beruhigen.
So wird es nicht für immer sein, rief ich mir in Erinnerung. Je länger du in Freiheit bist, desto unbeschwerter wirst du dich fühlen.
Eines Tages würde ich aus einem Schlaf erwachen, in dem mich keine Albträume geplagt hatten, und ohne Angst durch die Straßen gehen. Doch bis dahin würde ich meinen Dolch immer bei mir tragen und mich auf das Gewicht des Grisha-Stahls in meiner Hand verlassen.
Ich trat wieder auf die belebte Straße und schlang den Schal enger um meinen Hals. Das war inzwischen eine Marotte von mir. Unter dem Schal verbarg sich Morozovas Reif, der mächtigste Kräftemehrer aller Zeiten, an dem man mich sofort erkannt hätte. Ohne diesen Reif wäre ich nur einer von vielen abgemagerten, verlotterten Flüchtlingen aus Ravka gewesen.
Aber was sollte ich tun, wenn sich das Wetter besserte? Im Sommer konnte ich wohl kaum Wollschals oder Mäntel mit hochgeklapptem Kragen tragen. Andererseits wären Mal und ich im Sommer hoffentlich schon weit weg von den überlaufenen Städten und neugierigen Blicken. Dann wären wir endlich allein. Bei diesem Gedanken durchrieselte mich ein nervöser Schauder.
Ich überquerte die Straße, wich Kutschen und Pferden aus, ließ meinen Blick wachsam über die Menschen gleiten, weil ich erwartete, dass jeden Moment Opritschki oder Grisha über mich herfallen würden. Oder Söldner der Shu Han oder Meuchelmörder der Fjerdan, vielleicht auch Soldaten des Zaren von Ravka oder gar der Dunkle selbst. Sie alle konnten uns gerade jagen. Mich jagen, korrigierte ich, denn ohne mich wäre Mal immer noch ein Fährtensucher in der Ersten Armee und kein Fahnenflüchtiger, der sich seines Lebens nicht mehr sicher sein konnte.
Ich hatte plötzlich ein Bild aus der Vergangenheit vor Augen: schwarzes Haar, schiefergraue Augen, das strahlende, triumphierende Gesicht des Dunklen, während er die Macht der Schattenflur entfesselte. Bevor ich ihm den Sieg entrissen hatte.
In Novyi Zem erfuhr man mühelos Neuigkeiten, nur leider gab es keine guten. Laut einem kürzlich aufgekommenen Gerücht hatte der Dunkle das Gefecht in der Schattenflur überlebt und sammelte nun im Verborgenen seine Kräfte für einen nochmaligen Versuch, nach Ravkas Thron zu greifen. Das klang sehr unglaubwürdig, aber ich wusste natürlich, dass es ein schwerer Fehler gewesen wäre, den Dunklen zu unterschätzen. Die anderen Geschichten, die uns zu Ohren kamen, waren ebenso beunruhigend: Angeblich breitete sich die Schattenflur seit einiger Zeit immer weiter nach Osten und Westen aus und trieb Flüchtlinge vor sich her; angeblich gab es einen neuen Kult um eine Heilige, die das Licht der Sonne beschwören konnte. Ich verdrängte den Gedanken daran. Mal und ich führten ein neues Leben. Wir hatten Ravka hinter uns gelassen.
Ich beschleunigte meine Schritte und erreichte bald den Platz, wo ich mich jeden Abend mit Mal traf. Er war schon da, lehnte am Rand des Brunnens und unterhielt sich mit einem Zemeni-Freund, den er bei der Arbeit im Lagerhaus kennengelernt hatte. Der Name war mir gerade entfallen. Hieß er Jep? Oder Jef?
Der von vier großen Wasserspeiern gespeiste Brunnen war prächtig, vor allem jedoch praktisch, denn in seinem Becken wuschen Mädchen und Dienerinnen die Wäsche, und alle verschlangen Mal mit Blicken. Wie sollte es auch anders sein? Seine Haare, früher militärisch kurz, waren so lang, dass sie sich in seinem Nacken ringelten. Sein Hemd, feucht vom Sprühwasser des Brunnens, klebte am Oberkörper, und nach den vielen Tagen auf See war er braun gebrannt. Er warf den Kopf zurück, lachte über die Worte seines Freundes und tat so, als würde er die Frauen, die ihn verlockend anlächelten, nicht wahrnehmen.
Wahrscheinlich kennt er das so gut, dass er es gar nicht mehr bemerkt, dachte ich bedrückt.
Bei meinem Anblick strahlte er und winkte mir. Die Waschfrauen drehten sich nach mir um und tauschten ungläubige Blicke. Ich wusste, was sie sahen: ein mageres Mädchen mit strähnigen, stumpfbraunen Haaren und fahlen Wangen, mit Fingern, gelb vom Verpacken der Jurda-Blumen. Ich war nie eine jener Schönheiten gewesen, die alle Blicke auf sich zogen, und jemand, der mich kannte, hätte mir sofort angesehen, dass ich meine Macht schon seit Wochen nicht mehr eingesetzt hatte. Ich hatte kaum Appetit, schlief schlecht, und die Albträume taten den Rest. All diese Gesichter brachten den gleichen Gedanken zum Ausdruck: Warum war ein Mann wie Mal mit einer Frau wie mir zusammen?
Ich drückte den Rücken durch und versuchte, die Blicke zu ignorieren. Mal nahm mich in den Arm, zog mich dicht an sich. »Wo warst du?«, fragte er. »Ich habe mir schon Sorgen gemacht.«
»Ein paar wütende Bären haben mir aufgelauert«, murmelte ich an seiner Schulter.
»Hast du dich etwa wieder verlaufen?«
»Wie kommst du denn darauf?«
»Erinnerst du dich noch an Jes?«, sagte er und nickte zu seinem Freund hinüber.
»Wie dir geht?«, fragte Jes gebrochen auf Ravkan und streckte mir eine Hand hin. Er schaute so todernst drein, dass ich mich fragte, was los war.
»Bestens, danke«, antwortete ich auf Zemeni. Er erwiderte mein Lächeln nicht, sondern tätschelte nur sanft meine Hand. Jes war wirklich ein schräger Vogel.
Wir plauderten noch eine Weile, aber Mal schien zu spüren, dass ich immer unruhiger wurde. Ich hielt mich nur nicht gern länger im Freien auf, weil ich ständig damit rechnete, dass plötzlich jemand meinen Namen brüllte oder mich am Arm packte. Also verabschiedeten wir uns, aber bevor Jes ging, warf er mir wieder einen mitleidigen Blick zu und flüsterte Mal etwas ins Ohr.
»Was hat er zu dir gesagt?«, fragte ich, als er über den Platz davonschlenderte.
»Hm? Ach, nichts. Du hast Blütenstaub in den Augenbrauen. Schon gemerkt?« Er wischte ihn behutsam weg.
»Vielleicht finde ich das ja schön.«
»Verzeihung.«
Als wir uns vom Brunnen entfernten, beugte sich eine der Wäscherinnen so weit vor, dass ihr Busen fast aus dem Kleid fiel.
»Wenn du mal Lust auf mehr als Haut und Knochen hast«, rief sie Mal zu, »dann habe ich hier etwas, das dich in Wallung bringt.« Ich erstarrte. Mal warf einen Blick über die Schulter und musterte die junge Frau von Kopf bis Fuß. »Nein«, sagte er schließlich trocken. »Hast du nicht.«
Die junge Frau lief vor Wut und Scham knallrot an. Die anderen Wäscherinnen kicherten schadenfroh und bespritzten sie mit Wasser. Ich versuchte, selbstsicher dreinzuschauen, konnte mir ein dümmliches Grinsen aber nicht verkneifen.
»Danke«, murmelte ich, als wir den Platz in Richtung unserer Herberge überquerten.
»Wofür?«
Ich verdrehte die Augen. »Dafür, dass du meine Ehre verteidigt hast, Dummkopf.«
Er riss mich in den Schatten unter einem Vordach. Panik flammte in mir auf, weil ich glaubte, dass Gefahr drohte, doch im nächsten Moment zog er mich an sich und küsste mich fest auf den Mund.
Als er losließ, hatte ich hochrote Wangen und wacklige Beine.
»Um ehrlich zu sein«, sagte er, »habe ich kein großes Interesse daran, deine Ehre zu verteidigen.«
»Schon kapiert«, stieß ich hervor und hoffte, nicht zu atemlos zu klingen.
»Außerdem«, sagte er, »muss ich jede Minute auskosten, bevor wir wieder in unserem Loch sind.«
Das Loch war Mals Name für unsere Herberge. Sie war überfüllt und schmutzig und bot keinerlei Privatsphäre, aber die Zimmer waren billig. Er grinste so schelmisch wie immer, dann zog er mich wieder zwischen die vielen Menschen, die auf der Straße unterwegs waren. Meine Schritte fühlten sich trotz meiner Erschöpfung viel beschwingter an. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass wir zusammen waren, und mir war etwas schwummerig. In der Grenzmark würde es weder neugierige Herbergsgäste noch unerwünschte Störungen geben. Mein Herz tat einen kleinen Satz – schwer zu sagen, ob es an meiner allgemeinen Nervosität oder an der Aufregung lag.
»Und? Was hat Jes zu dir gesagt?«, fragte ich noch einmal, sobald ich wieder einen klareren Kopf hatte.
»Er hat gesagt, ich soll gut auf dich aufpassen.«
»Mehr nicht?«
Mal räusperte sich. »Und … er hat gesagt, er wolle zum Gott der Arbeit beten, damit er dein Leiden lindert.«
»Mein was?«
»Kann sein, dass ich ihm erzählt habe, du hättest einen Kropf.« Mir klappte die Kinnlade herunter. »Wie bitte?«
»Na ja – ich musste ihm doch erklären, warum du immer an diesem Schal rumfummelst.«
Ich ließ die Hand sinken. Ich hatte schon wieder an meinen Schal gefasst, ohne es zu merken.
»Und deshalb hast du ihm erzählt, ich hätte einen Kropf?«, flüsterte ich fassungslos.
»Ich musste mir irgendetwas ausdenken. Außerdem verleiht es dir etwas Tragisches … Hübsches Mädchen mit riesiger Geschwulst – na, du weißt schon.«
Ich schlug ihm auf den Arm.
»Autsch! Es gibt Länder, da ist ein Kropf sehr beliebt, weißt du?«
»Gibt es auch Länder, in denen Eunuchen sehr beliebt sind? Ich könnte dich nämlich problemlos in einen verwandeln.«
»Mann, bist du blutrünstig!«
»Mein Kropf treibt mich in den Wahnsinn.«
Mal lachte, aber ich sah, dass seine Hand immer auf der Pistole lag. Das Loch befand sich in einer ziemlich üblen Gegend von Cofton, und wir hatten viel Münzgeld dabei – unseren gesamten Lohn, den wir gespart hatten, um ein neues Leben beginnen zu können. Nur noch ein paar Tage, dann hätten wir genug beisammen, um Cofton hinter uns zu lassen, den Krach, die von Blütenstaub erfüllte Luft; und die Angst, die uns ständig im Nacken saß. Dann wären wir an einem Ort in Sicherheit, wo es niemanden interessierte, was in Ravka geschah. Wir wären an einem Ort, wo es keine Grisha gab und wo man nie etwas von einer Sonnenkriegerin gehört hatte.
Und wo niemand eine braucht. Dieser Gedanke hob meine Laune nicht gerade, war mir in letzter Zeit aber immer wieder durch den Kopf gegangen. In diesem fremden Land war ich zu nichts nütze. Mal konnte jagen, Fährten lesen, und er war ein guter Schütze. Meine einzige Gabe bestand darin, eine Grisha zu sein. Ich vermisste es, das Licht aufzurufen, und mit jedem Tag, an dem ich meine Macht ungenutzt ließ, wurde ich schwächer und kränklicher. Ich kam schon aus der Puste, wenn ich neben Mal herlief, und die Tasche war fast zu schwer für mich. Wenn ich die Jurda-Blumen in der Scheune verpackte, stellte ich mich so lahm und ungeschickt an, dass ich ständig kurz davor war, meine Arbeit zu verlieren. Der Lohn war schlecht, ich hatte jedoch arbeiten wollen, um wenigstens irgendetwas zu tun. Ich hatte das Gefühl, in meine Kindheit zurückversetzt worden zu sein: Mal, der Alleskönner, und Alina, die zu nichts zu gebrauchen war.
Ich verdrängte diesen Gedanken. Gut möglich, dass ich nicht mehr die Sonnenkriegerin war, aber das traurige Mädchen von damals war ich auch nicht mehr. Ich würde schon eine Möglichkeit finden, etwas zu unserem neuen Leben beizutragen.
Der Anblick unserer Herberge stimmte mich nicht heiterer. Sie war dreistöckig und brauchte dringend einen neuen Anstrich. Das Schild im Fenster warb in fünf Sprachen mit heißen Bädern und ungezieferfreien Betten. Nachdem ich Bett und Bad ausprobiert hatte, wusste ich, dass das Schild fünfsprachig log. Aber da Mal bei mir war, fand ich es nicht ganz so schlimm.
Wir erklommen die Stufen der klapprigen Veranda und betraten die Schenke, die den größten Teil des Erdgeschosses einnahm. Nach dem Lärm und dem Staub der Straße empfand ich sie als kühl und still. Zu dieser Stunde saßen meist einige Arbeiter an den zerkratzten Tischen und versoffen ihren Tageslohn, aber heute war der Gastraum leer bis auf den mürrisch dreinschauenden Wirt, der hinter der Theke stand.
Er war ein eingewanderter Kerch, und ich hatte das sichere Gefühl, dass er Leute aus Ravka nicht ausstehen konnte. Vielleicht hielt er uns auch für Halunken. Wir waren vor zwei Wochen angekommen, dreckig, abgerissen und ohne Gepäck, und hatten mit einer goldenen Haarnadel bezahlt, die er bestimmt für Diebesgut hielt. Was ihn aber nicht davon abgehalten hatte, sich die Nadel zu schnappen und uns im Gegenzug ein schmales Bett in einem Zimmer zu geben, das wir uns mit sechs anderen Gästen teilen mussten.
Wir hatten ihn noch nicht ganz erreicht, da knallte er schon den Schlüssel auf den Tresen und schob ihn ungefragt zu uns hin. Der Schlüssel hing an einem geschnitzten Hühnerknochen. Noch so ein reizendes Detail.
Mal bat in dem altmodischen Kerch, das er auf der Verrhader aufgeschnappt hatte, um eine Schüssel mit heißem Wasser, damit wir uns waschen konnten.
»Kostet extra«, brummte der Wirt, ein untersetzter Kerl mit schütteren Haaren und Zähnen, die gelb waren vom Jurda-Kauen. Mir fiel auf, dass er schwitzte. Obwohl es nicht besonders warm war, standen Schweißperlen auf seiner Oberlippe.
Auf dem Weg durch die Schenke drehte ich mich noch einmal nach ihm um. Er sah uns nach, die kleinen Augen verengt, die Arme vor der Brust verschränkt. Meine Nervosität kehrte zurück.
Ich blieb am Fuß der Treppe stehen. »Der Mann mag uns wirklich nicht«, sagte ich.
Mal, der schon die Treppe hinaufging, zuckte mit den Schultern. »Nein, aber er mag unser Geld. Und in ein paar Tagen ist er uns los.«
Ich versuchte, mich zu beruhigen. Ich war schon den ganzen Nachmittag angespannt gewesen.
»Na gut«, brummte ich und folgte Mal. »Aber ich würde trotzdem gern wissen, wie man ›Du bist ein Esel‹ auf Kerch sagt – nur für alle Fälle.«
»Je bent ezel.«
»Im Ernst?«
Mal lachte. »Das Fluchen ist das Erste, was die Matrosen einem beibringen.«
Der dritte Stock der Herberge war in einem noch schlechteren Zustand als die Schenke. Der Teppich war fadenscheinig und verblichen, der finstere Flur stank nach Tabak und Kohl. Alle Zimmertüren, an denen wir vorbeigingen, waren geschlossen, hinter jeder herrschte Stille. Ich fand das unheimlich, aber vielleicht waren die Leute ja unterwegs.
Das einzige Licht fiel durch ein trübes Fenster ganz hinten im Flur. Während Mal mit dem Schlüssel hantierte, warf ich einen Blick hinaus, sah die unten vorbeirumpelnden Karren und Kutschen. Auf der anderen Straßenseite stand ein Mann unter einem Balkon und sah zur Herberge hinauf. Er zupfte an Kragen und Ärmelaufschlägen, als wären seine Kleider neu und würden nicht richtig passen. Als sich unsere Blicke trafen, wandte er rasch den Kopf ab.
Angst durchzuckte mich.
»Mal«, flüsterte ich und griff nach seinem Arm. Doch es war zu spät. Die Tür schwang auf.
»Nein!«, schrie ich und riss die Hände hoch. Eine blendende Kaskade aus Licht rollte durch den Flur. Dann packten mich grobe Hände und drehten mir die Arme auf den Rücken. Ich wollte mich wehren, trat und schlug um mich, wurde aber in das Zimmer geschleift.
»Ganz ruhig.« Die Stimme aus der Ecke klang gelassen. »Ich fände es zu bedauerlich, deinem Freund schon jetzt den Bauch aufschlitzen zu müssen.«
Die Zeit schien sich zu verlangsamen. Mein Blick glitt durch das schäbige Zimmer mit der niedrigen Decke. Ich sah die Waschschüssel auf dem wackligen Tisch, sah die in einem schmalen Strahl Sonnenlicht tanzenden Staubflocken, die blitzende Klinge, die auf Mals Kehle lag. Der Mann, der ihn festhielt, hatte ein höhnisches Grinsen aufgesetzt, das ich nur allzu gut kannte. Ivan. Und da waren weitere Männer und Frauen, alle in Mänteln und Hosen, wie sie die Kaufleute und Arbeiter der Zemeni trugen, doch ich erkannte mehrere Gesichter aus meiner Zeit in der Zweiten Armee. Grisha.
Hinter ihnen, eingehüllt in Schatten, saß der Dunkle auf dem wackligen Stuhl wie auf einem Thron.
Für einen Augenblick herrschte Totenstille im Zimmer. Ich konnte Mals Atem und das Scharren von Stiefeln hören. Auf der Straße rief ein Mann einen Gruß. Mein Blick haftete wie gebannt auf den Händen des Dunklen – seine langen weißen Finger lagen entspannt auf den Stuhllehnen. Mir ging der absurde Gedanke durch den Kopf, dass ich ihn noch nie in Alltagskleidung gesehen hatte.
Dann wurde ich mit Wucht von der Wirklichkeit eingeholt. Sollte es so enden? Kampflos? Ohne einen einzigen Schuss? Ohne Gebrüll? Meiner Brust entrang sich ein wütendes, ohnmächtiges Schluchzen.
»Nehmt ihr die Pistole ab und durchsucht sie nach anderen Waffen«, befahl der Dunkle leise. Ich spürte, wie das tröstliche Gewicht der Feuerwaffe von meiner Hüfte genommen und der Dolch aus der an meinem Unterarm befestigten Scheide gezogen wurde. »Ich befehle ihnen jetzt, dich loszulassen«, sagte er, nachdem ich entwaffnet worden war. »Aber denk daran, dass Ivan dem Leben des Fährtensuchers ein Ende setzt, wenn du auch nur einen einzigen Finger rührst. Hast du verstanden?«
Ich nickte kurz und steif.
Er hob einen Finger und die Männer ließen mich so ruckartig los, dass ich ein, zwei Schritte bis in die Mitte des Zimmers stolperte. Dort blieb ich wie versteinert und mit geballten Fäusten stehen.
Ich hätte den Dunklen mit meiner Macht halbieren oder diese ganze erbärmliche Herberge bis zu den Grundmauern spalten können. Aber Ivan hätte Mal zuvor die Kehle durchgeschnitten.
»Wie habt ihr uns gefunden?«, keuchte ich.
»Ihr habt eine sehr kostbare Spur hinterlassen«, sagte er und warf mit lässiger Geste etwas auf den Tisch. Mit einem leisen Klimpern landete es neben der Waschschüssel. Ich erkannte eine der goldenen Nadeln, die Genya vor vielen Wochen in mein Haar gewoben hatte. Wir hatten mit diesen Nadeln alles bezahlt: die Schiffspassage über die Wahre See, die Kutschfahrt nach Cofton, das schmuddlige, nicht ganz ungezieferfreie Bett.
Im Zimmer knisterte es unheilvoll, als der Dunkle sich vom Stuhl erhob. Alle Grisha schienen Luft geholt zu haben und nun den Atem anzuhalten. Ihre Furcht war mit Händen zu greifen, und mich durchzuckte ein Schrecken. Untergebene waren dem Dunklen immer mit Ehrfurcht und Respekt begegnet, aber diese Angst war neu. Sogar Ivan schien sich in seiner Haut nicht ganz wohlzufühlen.
Der Dunkle trat ins Licht. Ich entdeckte ein feines Gespinst von Narben auf seinem Gesicht. Ein Korporalki hatte die Wunden geheilt, aber sie hatten ihre Spuren hinterlassen. Die Volkra hatten ihn also mit ihren Klauen gezeichnet. Gut so, dachte ich selbstzufrieden, auch wenn das nicht angebracht war. Es war nur ein kleiner Trost, aber immerhin war die makellose Schönheit des Dunklen dahin.
Er stand da und betrachtete mich. »Wie gefällt dir das Leben im Verborgenen, Alina? Du siehst nicht gut aus.«
»Du auch nicht«, erwiderte ich. Und das lag nicht nur an den Narben. Er trug die Erschöpfung zwar wie einen eleganten Mantel, aber sie war ihm anzusehen. Er hatte fahle Ringe unter den Augen, und die markanten Wangenknochen traten stärker hervor als früher.
»Mag sein. Aber es hat sich gelohnt«, sagte er und verzog die Lippen zur Andeutung eines Lächelns.
Ein Schauder lief mir über den Rücken. Gelohnt? Wofür?
Er streckte einen Arm nach mir aus, und ich musste mich zusammenreißen, um nicht zurückzuzucken. Aber er griff nur nach einem Zipfel meines Schals und zog behutsam daran. Die grobe Wolle löste sich, glitt von meinem Nacken und sank zu Boden.
»Wie ich sehe, machst du dich wieder einmal kleiner, als du bist. Diese Maskerade steht dir nicht.«
Ich war kurz beunruhigt. Hatte ich nicht vor Minuten das Gleiche gedacht? »Schön, dass du dir Gedanken um mich machst«, murmelte ich.
Er strich über den Halsreif. »Er gehört genauso mir wie dir, Alina.« Ich schlug seine Hand weg. Die Grisha um uns herum regten sich ängstlich. »Dann hättest du ihn mir nicht um den Hals legen sollen«, fauchte ich. »Was willst du?«
Ich wusste natürlich längst, dass er alles wollte – Ravka, die Welt, die Macht der Schattenflur. Seine Antworten interessierten mich nicht. Er sollte nur weitersprechen. Dass dieser Moment kommen würde, hatte ich gewusst, und ich war darauf vorbereitet. Ich würde nicht zulassen, dass er mich noch einmal in die Fänge bekam. Ich warf Mal einen kurzen Blick zu in der Hoffnung, dass er begriff, was ich vorhatte.
»Ich möchte dir danken«, sagte der Dunkle. Damit hatte ich nicht gerechnet. »Mir danken?«
»Für das Geschenk, das du mir gemacht hast.«
Mein Blick zuckte zu den Narben auf seiner bleichen Wange.
»Nein«, sagte er mit leisem Lächeln, »nicht die. Aber sie halten die Erinnerung wach.«
»Woran?«, fragte ich wider Willen neugierig.
Seine schiefergrauen Augen blieben ausdruckslos. »Daran, dass jeder Mann zum Narren gemacht werden kann. Nein, Alina. Du hast mir etwas viel Größeres geschenkt.«
Er wandte sich ab. Ich sah noch einmal rasch zu Mal.
»Im Gegensatz zu dir«, sagte der Dunkle, »weiß ich, was Dankbarkeit ist, und ich will sie dir zeigen.«
Er hob die Hände. Dunkelheit erfüllte das Zimmer.
»Jetzt!«, schrie ich.
Mal rammte einen Ellbogen in Ivans Seite. Ich breitete im selben Moment die Hände aus. Licht flammte auf und blendete die Grisha. Ich bündelte meine Macht zu einer Sichel aus gleißendem Licht. Für mich gab es nur ein Ziel: den Dunklen zu treffen. Ich spähte in die wogende Finsternis, um ihn zu finden. Aber irgendetwas stimmte hier nicht.
Ich hatte oft erlebt, wie der Dunkle seine Macht eingesetzt hatte. Aber dies war anders. Die Schatten umsurrten und umschwirrten meine Kugel aus Licht. Sie kreisten immer schneller, verwoben sich zu einer wabernden Wolke, die schnarrte und summte wie ein Schwarm hungriger Insekten. Ich widersetzte mich ihr mit aller Kraft, aber sie wand sich, wich aus, kam immer näher.
Mal stand neben mir. Er hatte Ivan das Messer entwunden.
»Bleib dicht bei mir«, sagte ich. Auf gut Glück ein Loch in den Fußboden zu brennen wäre besser, als die Hände in den Schoß zu legen. Ich konzentrierte mich, konnte spüren, wie die Macht des Schnitts mich erbeben ließ. Ich hob den Arm … und da schälte sich eine Gestalt aus der Finsternis.
Das ist ein Trick, dachte ich, als die Gestalt auf uns zukam. Das muss ein Trugbild sein.
Das Geschöpf bestand aus einem Gespinst von Schatten, sein Gesicht war formlos und zeigte keine Miene. Der Körper schien unablässig zu schwanken und zu verschwimmen und sich dann wieder zusammenzufügen: Arme und Beine, große Pranken, die in angedeuteten Klauen ausliefen, ein breiter Rücken mit zwei Schwingen, die zuckten und ruckten und sich dabei wie ein Tintenfleck ausbreiteten. Das Geschöpf glich einem Volkra, nur war seine Gestalt menschlicher. Und es fürchtete sich nicht vor dem Licht. Es fürchtete sich nicht vor mir.
Das ist nur ein Trugbild, redete ich mir panisch ein. Das ist nicht echt. Dieses Wesen verstieß gegen alle Gesetze, denen die Grisha-Mächte gehorchten. Kein Grisha konnte etwas Körperliches hervorbringen; wir konnten kein Leben erschaffen. Trotzdem kam dieses Geschöpf auf uns zu, und die Grisha aus dem Gefolge des Dunklen drückten sich ängstlich gegen die Zimmerwände. Dies flößte ihnen also so viel Furcht ein.
Ich verdrängte mein Entsetzen und bündelte meine Macht. Ich schwang einen Arm, ließ das Licht in einem gleißenden, unbarmherzigen Bogen niedersausen, der das Geschöpf glatt durchschnitt. Ich glaubte kurz, es würde weiter vordringen, aber es begann zu wabern und zu glühen wie eine Wolke voller Blitze und zerplatzte dann. Ich war kaum zu Atem gekommen, da reckte der Dunkle die Hand, und ein neues Ungeheuer erschien, danach ein zweites und ein drittes.
»Das hast du mir geschenkt«, sagte der Dunkle. »Das ist das Geschenk, das ich auf der Schattenflur erhalten habe.« Sein Gesicht strahlte Allmacht und zynische Freude aus. Aber ich sah ihm auch die Anstrengung an. Was immer er da tat, es kostete ihn viel Kraft. Mal und ich wichen zur Tür zurück, während die Wesen auf uns zukamen. Plötzlich schoss eines blitzschnell vorwärts. Mal führte einen Hieb mit dem Messer. Das Wesen hielt wankend inne, packte Mal und schleuderte ihn wie eine Puppe beiseite. Das waren keine Trugbilder.
»Mal!«, schrie ich.
Ich ließ den Schnitt niedergehen, und das Wesen verbrannte zu nichts. Aber das zweite fiel rasend schnell über mich her. Als es mich packte, durchfuhr mich Ekel. Sein Griff fühlte sich an, als würden unzählige winzige Insekten über meine Arme krabbeln.
Das Wesen riss mich von den Beinen, und ich begriff, wie sehr ich mich geirrt hatte. Denn es hatte ein Maul – ein zuckendes, gähnend tiefes Loch, das beim Öffnen unzählige Reihen von Reißzähnen entblößte. Und ich spürte sie alle, während sie tief in meine Schulter eindrangen.
Es tat unbeschreiblich weh, und ich sackte wie ein nasser Sack auf den Fußboden. Die Schmerzen gingen in endlosen Wellen durch mich hindurch. Ich konnte die Wasserflecken unter der Decke sehen, das hoch über mir aufragende Wesen, das bleiche Gesicht von Mal, der neben mir kniete. Seine Lippen formten meinen Namen, aber ich hörte ihn nicht. Ich versank im Strudel der Bewusstlosigkeit.
Das Letzte, was ich hörte, war die Stimme des Dunklen – so deutlich, als würde er neben mir liegen und den Mund gegen mein Ohr pressen, damit nur ich hören konnte, was er sagte: Ich danke dir.
2
Wieder die Finsternis. In meinem Inneren zieht und zerrt es, und ich taste nach dem Licht – vergeblich.
»Trink.«
Ich öffne die Augen. Ivans grimmiges Gesicht schiebt sich in mein Blickfeld. »Übernimm du das«, knurrt er.
Im nächsten Moment beugt Genya sich über mich. Sie ist schöner denn je, sogar in ihrer zerschlissenen roten Kefta. Träume ich?
Sie drückt etwas gegen meine Lippen. »Trink das, Alina.«
Ich will den Becher wegschlagen, kann die Hände aber nicht bewegen.
Meine Nase wird zugekniffen. Ich reiße unwillkürlich den Mund auf, und Brühe rinnt durch meine Kehle. Ich muss husten und spucken.
»Wo bin ich?«, stoße ich hervor.
Eine andere Stimme, kalt und klar: »Schafft sie wieder nach unten.«
Wir brechen in der Kutsche aus dem Dorf auf. Die Straße ist holprig, und auf der Rückfahrt nach Keramzin knallt Ana Kuyas kantiger Ellbogen immer wieder gegen meine Rippen. Mal, der auf der anderen Seite sitzt, weist uns lachend auf alles hin, was wir draußen vorüberziehen sehen.
Das kleine dicke Pferd zieht geduldig die Kutsche, schüttelt die struppige Mähne, als wir den letzten Hügel hinauffahren. Auf halber Strecke überholen wir ein Paar, das am Rand des Weges geht. Der Mann pfeift fröhlich, schwenkt den Stock im Takt der Melodie. Die Frau, die einen Salzblock auf den Schultern trägt, trottet mit gesenktem Kopf hinterher.
»Sind sie sehr arm?«, frage ich Ana Kuya.
»Es gibt ärmere Leute.«
»Und warum kauft er sich keinen Esel?«
»Er braucht keinen Esel«, sagt Ana Kuya. »Er hat eine Frau.«
»Ich heirate Alina«, sagt Mal.
Unsere Kutsche rollt an den beiden vorbei. Der Mann zieht die Mütze und ruft gut gelaunt einen Gruß.
Mal erwidert den Gruß ebenso gut gelaunt, lächelt und winkt und fällt dabei fast herunter.
Ich verrenke mir beinahe den Hals, als ich mich nach der Frau umdrehe, die mit ihrem Mann kaum Schritt halten kann. Sie ist genau genommen noch ein Mädchen, aber ihre Augen wirken alt und müde.
Ana Kuya, der nichts entgeht, sagt: »Das ist das Schicksal von Bauernmädchen, die nicht das Glück haben, von der Güte des Herzogs zu profitieren. Seid also immer dankbar und schließt ihn abends in eure Gebete ein.«
Die Ketten klirren.
Genyas besorgtes Gesicht. »Ihr könnt so nicht mehr lange weitermachen. Es schadet ihr.«
»Kümmere dich um deinen eigenen Kram«, faucht Ivan.
Der Dunkle steht im Schatten, ganz in Schwarz. Ich spüre Wellengang, und mir wird schlagartig bewusst, dass wir uns an Bord eines Schiffes befinden – wir sind auf See.
Bitte lasst mich weiterträumen.
Ich bin wieder auf dem Weg nach Keramzin, betrachte den gesenkten Kopf des Pferdes, das sich den Hügel hinaufmüht. Als ich mich erneut umdrehe, hat die junge Frau, die den schweren Salzblock schleppt, mein Gesicht. Neben mir in der Kutsche sitzt Baghra. »Der Ochse spürt sein Joch«, sagt sie, »aber spürt der Vogel das Gewicht seiner Flügel?«
Ihre Augen sind kohlrabenschwarz. Sei dankbar, sagt ihr Blick. Sei dankbar. Sie reißt am Zügel.
»Trink.« Schon wieder diese Brühe. Aber ich wehre mich nicht mehr, möchte mich nicht verschlucken. Ich sinke zurück, lasse die Augen langsam zufallen, gleite hinab in einen Dämmerzustand, bin zu schwach, um zu kämpfen.
Eine Hand legt sich auf meine Wange.
»Mal«, krächze ich.
Die Hand wird fortgezogen. Dann nichts mehr.
»Weckt sie.« Die Stimme ist mir unbekannt. »Ihr müsst sie aus diesem Zustand holen.«
Meine Augenlider flattern. Ist das ein Traum? Ein junger Mann beugt sich über mich: Strubbelhaare, schiefe Nase. Er erinnert mich an den altklugen Fuchs aus einer der Fabeln, die Ana Kuya immer erzählte: schlau genug, um der ersten Falle zu entwischen, aber leider so dumm, in die zweite zu tappen. Hinter dem Fuchs steht ein weiterer Mann, ein wahrer Riese. Ich habe noch nie einen so großen Menschen gesehen. Seine Augen schimmern golden und sind mandelförmig wie die der Shu.
»Alina«, sagt der Fuchs. Woher kennt er meinen Namen?
Die Tür geht auf, und ich sehe ein drittes fremdes Gesicht, das einer jungen Frau mit kurzen dunklen Haaren und dem gleichen Goldschimmer in den Augen wie der Riese.
»Sie kommen«, sagt sie.
Der Fuchs flucht. »Legt sie wieder hin.« Der Riese tritt näher. Die Dunkelheit umfängt mich von Neuem.
»Nein, bitte …«
Zu spät. Ich versinke in Finsternis.
Ich bin ein Mädchen, und ich erklimme einen Hügel. Meine Stiefel versinken im Matsch, und mein Rücken tut weh, denn ich schleppe einen schweren Salzbrocken. Als ich das Gefühl habe, keinen weiteren Schritt mehr tun zu können, werde ich plötzlich hochgehoben. Der Salzbrocken fällt von meinen Schultern, zerbricht auf dem Boden in Stücke. Ich steige auf, höher und immer höher. Unter mir sehe ich einen Einspänner, und die drei Insassen schauen staunend und mit offenem Mund zu mir auf. Mein Schatten gleitet zuerst über sie hinweg, danach über die Straße und die winterlich kahlen Felder – der dunkle Schemen eines Mädchens, dem plötzlich Flügel gewachsen sind, Flügel, die sie hoch über der Erde dahintragen.
Das Erste, was ich ganz eindeutig nicht träumte, waren das Schlingern des Schiffes, das Knarren der Takelage und das Klatschen des Wassers gegen den Schiffsrumpf.
Ich wollte mich umdrehen, doch bei dieser Bewegung durchzuckte stechender Schmerz meine Schulter. Ich rang nach Atem, schoss in die Senkrechte wie die Klinge eines Klappmessers, riss die Augen auf. Mein Herz raste, und ich war hellwach. Eine Welle von Übelkeit schüttelte mich, und ich blinzelte die Lichtpünktchen weg, die vor meinen Augen tanzten. In der Luft lag ein penetranter Geruch, der meinen Magen nicht gerade beruhigte. Ich zwang mich, tief und rasselnd Luft zu holen.
Genyas rote Kefta war blau bestickt, eine Farbkombination, wie sie keine andere Grisha trug. Das Gewand war schmutzig und stellenweise fadenscheinig, aber ihre Locken waren makellos frisiert, und sie war schöner als jede Königin. Sie setzte einen Zinnbecher an meine Lippen.
»Trink«, sagte sie.
»Was ist das?«, fragte ich misstrauisch.
»Einfach nur Wasser.«
Als ich ihr den Becher abnehmen wollte, stellte ich fest, dass meine Handgelenke in Ketten lagen. Ich hob ungeschickt die Hände. Das Wasser schmeckte metallisch, aber ich war wie ausgetrocknet. Ich trank und hustete, trank durstig weiter.
»Langsam«, sagte sie und strich mir die Haare aus dem Gesicht, »sonst wird dir schlecht.«
»Wie lange?«, fragte ich mit einem Blick auf Ivan, der in der Tür lehnte und mich betrachtete. »Wie lange war ich nicht bei Bewusstsein?«
»Etwas über eine Woche«, antwortete Genya.
»Eine Woche?«
Panik ergriff mich. Ivan hatte meinen Herzschlag eine ganze Woche gedrosselt, damit ich bewusstlos blieb.
Als ich auf die Beine kam, schoss mir das Blut in den Kopf. Ich wäre umgekippt, wenn Genya mich nicht gestützt hätte. Ich kämpfte gegen meine Benebelung an, schüttelte sie ab, torkelte dann zum Bullauge und warf einen Blick durch das beschlagene Glas. Nichts. Nur blaues Meer. Weder Hafen noch Küste. Wir hatten Novyi Zem weit hinter uns gelassen. Ich kämpfte gegen die Tränen an, die mir in die Augen zu treten drohten.
»Wo ist Mal?«, fragte ich. Als ich keine Antwort bekam, drehte ich mich um. »Wo ist Mal?«, wollte ich von Ivan wissen.
»Der Dunkle will dich sehen«, sagte er. »Kannst du selbst laufen, oder muss ich dich tragen?«
»Gib ihr eine Minute Zeit«, bat Genya. »Dann kann sie etwas essen und sich das Gesicht waschen.«
»Nein. Führt mich zu ihm.« Genya runzelte die Stirn.
»Mir geht es gut«, sagte ich trotzig, obwohl ich mich schwach und wacklig auf den Beinen fühlte. Ich hatte auch Angst, wollte mich aber auf keinen Fall wieder in die Koje legen. Außerdem brauchte ich kein Essen, sondern Antworten.
Beim Verlassen der Kabine schlug uns bestialischer Gestank entgegen – nicht der übliche Schiffsgeruch nach Brackwasser, Fisch und Körperausdünstungen, den ich von unserer Fahrt auf der Verrhader kannte, sondern etwas viel Ekelhafteres. Ich musste würgen und schloss den Mund. Plötzlich war ich froh, nichts gegessen zu haben.
»Was stinkt hier so?«
»Blut, Knochen, Tran«, sagte Ivan. Wir waren an Bord eines Walfängers. »Man gewöhnt sich daran«, fügte er hinzu.
»Du gewöhnst dich daran«, gab Genya zurück und rümpfte die Nase.
Sie brachten mich zu einer Luke, die an Deck führte. Ivan stieg die Treppe hinauf, und ich folgte ihm so rasch wie möglich, weil ich endlich dem finsteren Schiffsbauch und dem Fäulnisgestank entkommen wollte. Wegen meiner Fesseln fiel mir der Aufstieg schwer, und Ivan, der auf den letzten Stufen die Geduld verlor, packte meine Handgelenke und hob mich auf Deck. Ich atmete die kalte Luft tief ein und blinzelte in das grelle Licht.
Alle Segel waren gehisst. Der Walfänger durchpflügte die Wellen, angetrieben von drei Stürmern, die in blauer, wehender Kefta und mit erhobenen Armen neben den Masten standen. Ätheralki des Ordens der Beschwörer. Vor ein paar Monaten war ich noch eine von ihnen gewesen.
Die Besatzung des Schiffes bestand aus grobschlächtigen Männern, fast alle barfuß, weil sie auf den feuchten Planken nicht ausrutschen wollten. Keine Uniform, sie waren also keine Militärangehörigen. Und eine Flagge hatte man auch nicht gehisst.
Die anderen Grisha aus dem Gefolge des Dunklen waren unter den Matrosen leicht zu erkennen, nicht nur wegen der bunten Keftas, sondern auch, weil sie müßig an der Reling lehnten, auf das Meer schauten oder plauderten, während die Seeleute arbeiteten. Ich sah sogar eine Fabrikatorin mit purpurfarbener Kefta, die vor einer Taurolle saß und las.
Als wir auf dem Deck an zwei riesigen, schmiedeeisernen Kesseln vorbeikamen, stieg mir wieder der beißende Gestank in die Nase, der mir unten fast die Sinne geraubt hätte.
»Das sind die Kessel, in denen Tran ausgekocht wird«, sagte Genya.
»Auf dieser Reise waren sie noch nicht in Gebrauch, aber der Gestank hält sich ewig.«
Grisha und Matrosen drehten sich nach uns um, als wir vom Heck zum Bug gingen. Vor dem Besanmast hob ich den Kopf und erblickte hoch oben den jungen Mann und die dunkelhaarige Frau, die ich im Traum gesehen hatte. Sie saßen wie zwei Raubvögel in der Takelage und schauten aus ihren goldschimmernden Augen auf uns herab.
Sie waren mir also nicht im Traum erschienen. Sie waren tatsächlich in meiner Kabine gewesen.
Ivan führte mich zum Bug des Schiffes. Dort erwartete mich der Dunkle. Er hatte uns den Rücken zugekehrt, blickte über den Bugspriet zum blauen Horizont. Seine schwarze Kefta bauschte sich wie ein tintenschwarzes Kriegsbanner.
Genya und Ivan verneigten sich und ließen uns allein.
»Wo ist Mal?«, stieß ich heiser hervor, denn meine Kehle war noch rau.
Der Dunkle drehte sich nicht um, schüttelte aber den Kopf und sagte: »Immerhin bist du durchschaubar.«
»Tut mir leid, wenn ich dich langweile. Wo ist er?«
»Woher willst du wissen, dass er noch lebt?«
Mein Magen krampfte sich zusammen. »Weil ich dich kenne«, sagte ich mit einer Gewissheit, die ich so nicht empfand.
»Und wenn er tot wäre? Würdest du dich dann ins Meer stürzen?«
»Nicht, ohne dich mitzureißen. Wo ist er?«
»Dreh dich um.«
Ich fuhr herum. Weit hinten auf dem Deck, hinter einem Gewirr von Tauen und Takelage, sah ich Mal. Er stand zwischen zwei Wächtern der Korporalki, doch sein Blick war auf mich gerichtet. Er hatte darauf gewartet, dass ich mich umdrehte. Ich wollte auf ihn zugehen. Der Dunkle packte mich am Arm.
»Hiergeblieben«, sagte er.
»Ich will mit ihm sprechen«, bat ich und hasste mich für die Verzweiflung in meiner Stimme.
»Auf keinen Fall. Ihr zwei habt die dumme Angewohnheit, Unbesonnenheit mit Heldenmut zu verwechseln.«
Der Dunkle hob eine Hand, und Mal wurde abgeführt.
»Alina!«, brüllte er, woraufhin ein Wächter ihm heftig ins Gesicht schlug.
»Mal!«, schrie ich, als sie ihn mit großer Anstrengung unter Deck schleiften. »Mal!«
Ich riss meinen Arm aus dem Griff des Dunklen und sagte mit wuterstickter Stimme: »Wenn du ihm wehtust …«
»Ich werde ihm nicht wehtun«, erwiderte er. »Jedenfalls so lange, wie er noch von Nutzen für mich ist.«
»Ich verlange, dass man ihm nichts antut.«
»Er hat nichts zu befürchten, Alina. Aber nimm dich in Acht, denn wenn einer von euch beiden aufmuckt, wird der andere dafür büßen. Das habe ich auch ihm schon gesagt.«
Ich schloss die Augen und versuchte, meine rasende Wut und die Hoffnungslosigkeit niederzukämpfen. Wir waren wieder dort, wo wir begonnen hatten. Ich nickte kurz.
Der Dunkle schüttelte den Kopf. »Ihr macht es mir so leicht: Wenn ich ihn steche, bist du es, die blutet.«
»Das begreifst du einfach nicht, oder?«
Er tippte auf Morozovas Halsreif, fuhr mit den Fingern über meine Kehle. Die Berührung war sanft, öffnete aber sofort die Verbindung zwischen uns, und ich wurde von der Macht durchhallt, als wäre eine Glocke angeschlagen worden.
»Ich begreife genug«, sagte er leise.
»Ich will ihn sehen«, sagte ich gepresst. »Täglich. Ich will den Beweis, dass es ihm gut geht.«
»Aber gern. Ich bin nicht grausam, Alina. Nur vorsichtig.«
Ich hätte fast gelacht. »Hast du mich darum von einem deiner Ungeheuer beißen lassen?«
»Nein, das war nicht der Grund«, sagte er, ohne mich aus den Augen zu lassen. Sein Blick glitt zu meiner Schulter. »Tut es weh?«
»Nein«, log ich.
Seine Lippen verzogen sich zur Andeutung eines Lächelns. »Du wirst genesen«, sagte er. »Aber deine Wunde wird nie ganz verheilen. Selbst die Grisha sind da machtlos.«
»Diese Geschöpfe …«
»Die Nichevo’ya.«
Die Nichtwesen. Ich erschauderte, als ich mich an ihr Surren und Schnarren und ihre gähnenden Mäuler erinnerte. Meine Schulter pochte schmerzhaft. »Was sind sie?«
Er verzog den Mund. Das Narbengespinst in seinem Gesicht war fast unsichtbar; es glich dem Geist einer Landkarte. Eine Narbe verlief gefährlich dicht neben dem rechten Auge, das er offenbar fast verloren hätte. Dann legte er mir eine Hand auf die Wange, und als er sprach, klang er beinahe zärtlich.
»Sie sind nur der Anfang«, flüsterte er.
Er ließ mich am Bug stehen. Ich spürte noch immer seine Berührung auf der Haut, mein Kopf schwirrte von Fragen.
Bevor ich meine Gedanken ordnen konnte, erschien Ivan und zerrte mich wieder über das Deck. »Nicht so schnell«, protestierte ich, aber er riss mich nur umso heftiger mit. Ich verlor das Gleichgewicht. Weil ich den Sturz mit meinen in Ketten liegenden Händen nicht abfangen konnte, schlug ich mit den Knien auf den Planken auf. Ich zuckte zusammen, als sich ein Splitter in mein Fleisch bohrte.
»Weiter«, befahl Ivan. Ich rappelte mich schwerfällig auf, doch er trat mir die Beine weg, und ich knallte noch einmal auf die Planken.
»Ich sagte: Weiter!«
Da wurde ich von einer großen Hand behutsam auf die Füße gestellt. Als ich mich umdrehte, erblickte ich zu meiner Überraschung die dunkelhaarige Frau und den Riesen.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie.
»Kümmert euch um euren eigenen Kram«, sagte Ivan zornig.
»Sie ist Sturmhonds Gefangene«, erwiderte das Mädchen. »Und sie muss dementsprechend behandelt werden.«
Sturmhond. Der Name kam mir bekannt vor. War dies sein Schiff? Und seine Besatzung? Auf der Verrhader hatte man von ihm gesprochen. Er war ein Freibeuter und Schmuggler aus Ravka, berühmt und berüchtigt, weil er die Blockade der Fjerdan durchbrochen und durch das Kapern gegnerischer Schiffe reich geworden. Er segelte allerdings nicht unter dem Doppeladler.
»Sie ist die Gefangene des Dunklen«, sagte Ivan, »und eine Verräterin.«
»Vielleicht an Land«, gab die junge Frau zurück.
Ivan brabbelte etwas auf Shu, das ich nicht verstand. Der Riese lachte nur.
»Dein Shu ist jämmerlich«, sagte er.
»Außerdem nehmen wir von dir keine Befehle entgegen, egal, in welcher Sprache«, fügte die junge Frau hinzu.
Ivan grinste. »Ach, nein?« Er machte eine Geste. Die junge Frau griff sich an die Brust und sackte auf ein Knie.
Bevor ich mich’s versah, zog der Riese einen blitzenden Krummsäbel und stürmte los. Ivan machte gelassen eine weit ausholende Handbewegung. Der Riese verzerrte das Gesicht, ließ sich aber nicht aufhalten und näherte sich Ivan.
»Lass sie in Ruhe«, sagte ich und zerrte hilflos an der Kette. Ich konnte mein Licht zwar mit gefesselten Händen aufrufen, vermochte es aber nicht zu lenken.
Ivan ignorierte mich. Er ballte die Hand zur Faust. Der Riese blieb wie angewurzelt stehen, und der Säbel entglitt seinen Fingern. Schweißperlen traten auf seine Stirn, während Ivan das Leben aus seinem Herzen presste.
»Immer schön brav, je scho«, mahnte Ivan.
»Du bringst ihn um!«, sagte ich voller Panik. Ich wollte Ivan umwerfen und rammte ihm eine Schulter in die Seite.
Da ertönte ein lautes, doppeltes Klicken.
Ivan erstarrte, sein Grinsen verflog. Hinter ihm stand ein junger, hochgewachsener Mann, der ungefähr in meinem Alter war, vielleicht ein paar Jahre älter – Strubbelhaare, eine krumme Nase, die bestimmt schon ein paarmal gebrochen worden war. Der listige Fuchs.
Er drückte eine gespannte Pistole gegen Ivans Hals.
»Ich bin ein großzügiger Gastgeber, Blutrünstling. Aber in jedem Haus gelten Regeln.«
Gastgeber. Dies war also Sturmhond. Er wirkte viel zu jung, um Anführer oder Kapitän zu sein.
Ivan ließ die Hände sinken.
Der Riese schnappte nach Luft. Das Mädchen kam auf die Beine, immer noch eine Hand an die Brust gedrückt. Beide atmeten schwer, und in ihren Augen stand der blanke Hass.
»So ist es brav«, sagte Sturmhond zu Ivan. »Ich bringe die Gefangene jetzt in ihre Unterkunft, und du kannst abzischen und tun … Nun, was immer du so tust, während alle anderen arbeiten.«
Ivan zog eine Grimasse. »Ich denke nicht –«
»Nein, eindeutig nicht. Warum also jetzt damit anfangen?« Ivan errötete vor Zorn. »Du kannst nicht –«
Sturmhond beugte sich zu ihm vor. Er klang plötzlich nicht mehr heiter. Seine Leutseligkeit wich einem rasiermesserscharfen Ton, als er sagte: »Mir ist vollkommen egal, wer du an Land bist, denn auf diesem Schiff bist du nur Ballast. Außer ich ließe dich über die Planke gehen – dann wärst du wenigstens Futter für die Haie. Ich mag Haie. Kein schöner Anblick, aber er sorgt für etwas Abwechslung. Denk daran, wenn du das nächste Mal auf meinem Schiff jemanden bedrohen willst.« Er trat einen Schritt zurück und fügte mit der alten Heiterkeit hinzu: »Du darfst jetzt gehen, Haifutter. Verschwinde zu deinem Herrn und Meister.«
»Das vergesse ich nicht, Sturmhond«, zischte Ivan.
Der Kapitän verdrehte die Augen. »Hervorragend. Genau das war meine Absicht.«
Ivan machte auf den Hacken kehrt und stapfte davon. Sturmhond schob die Pistole ins Holster und lächelte. »Erstaunlich, wie schnell man das Gefühl hat, dass ein Schiff überfüllt ist, wie?« Er klopfte der jungen Frau und dem Riesen auf die Schulter.
»Gut gemacht«, sagte er leise.
Die beiden starrten Ivan hinterher. Die junge Frau hatte die Fäuste geballt.
»Ich will keinen Ärger«, mahnte der Kapitän. »Kapiert?«
Die beiden wechselten einen Blick und nickten dann mürrisch.
»Gut«, sagte Sturmhond. »Geht an die Arbeit. Ich bringe sie unter Deck.« Die beiden nickten wieder. Und zu meiner Verblüffung verneigten sie sich kurz vor mir, bevor sie verschwanden.
»Sind sie miteinander verwandt?«, fragte ich und sah ihnen nach.
»Sie sind Zwillinge«, antwortete er. »Tolya und Tamar.«
»Und du bist Sturmhond.«
»Nur an guten Tagen.« Er trug eine Lederhose, eine Pistole an jeder Hüfte und einen seegrünen Gehrock mit großen Goldknöpfen und ausladenden Ärmelaufschlägen, ein Kleidungsstück, das ich eher in einem Ballsaal oder auf einer Opernbühne als auf einem Schiff erwartet hätte.
»Und was hat ein Pirat auf einem Walfänger zu suchen?«, fragte ich.
»Freibeuter«, verbesserte er mich. »Ich nenne mehrere Schiffe mein Eigen. Der Dunkle wollte einen Walfänger, also habe ich ihm einen besorgt.«
»Du hast ihn gestohlen?«
»In Besitz genommen.«
»Du warst in meiner Kabine.«
»Es gibt viele Frauen, die nachts von mir träumen«, sagte er leichthin und lenkte meine Schritte zum Heck.
»Ich war wach, als ich dich gesehen habe«, beharrte ich. »Ich brauche …«
Er hob eine Hand. »Du verschwendest nur deinen Atem, meine Hübsche.«
»Du weißt doch gar nicht, was ich sagen wollte.«
»Du wolltest mir deine Notlage schildern und mich um Hilfe bitten, mir sagen, dass du mir zwar nichts zahlen kannst, aber ein reines Herz hast – das Übliche eben.«
Ich blinzelte. Genau das hatte ich sagen wollen. »Aber …«
»Verschwendung von Atem, Verschwendung von Zeit, Verschwendung eines herrlichen Nachmittags«, sagte er. »Ich mag es nicht, wenn Gefangene misshandelt werden, alles andere ist mir egal.«
»Du …«
Er schüttelte den Kopf. »Meine Unempfänglichkeit für Leidensgeschichten ist berüchtigt. Ich will deine Geschichte also nicht hören, außer es kommt ein sprechender Hund darin vor. Ist das so?«
»Was ist so?«
»Kommt ein sprechender Hund darin vor?«
»Nein«, fauchte ich. »Aber es geht um die Zukunft eines Zarenreichs und all seiner Bürger.«
»Ein Jammer«, sagte er, packte mich am Arm und führte mich nach achtern zur Luke.
»Ich dachte, du arbeitest für Ravka«, sagte ich wütend.
»Ich arbeite für den fettesten Geldbeutel.«
»Du würdest dein Land also für ein bisschen Gold an den Dunklen verkaufen?«
»Nein. Für viel Gold«, erwiderte er ganz offen. »Ich bin nicht billig zu haben, das kann ich dir versichern.« Er zeigte auf die Luke. »Nach dir.«
Ich ging mit Sturmhonds Hilfe wieder nach unten zu meiner Kabine, wo ich von zwei Wächtern der Grisha eingesperrt wurde. Der Kapitän verneigte sich und verschwand dann ohne ein weiteres Wort.
Ich setzte mich auf meine Koje, vergrub das Gesicht in den Händen. Sturmhond konnte sich noch so ahnungslos stellen – ich wusste, dass er in meiner Kabine gewesen war, und das musste einen Grund gehabt haben. Oder griff ich in meiner Verzweiflung nach dem allerletzten Strohhalm?
Als Genya mir ein Tablett mit dem Abendessen brachte, lag ich zusammengekrümmt und mit dem Gesicht zur Wand in meiner Koje.
»Du solltest einen Happen essen«, sagte sie.
»Lass mich in Ruhe.«
»Wenn man schmollt, bekommt man Falten.«
»Und wenn man lügt, bekommt man Warzen«, erwiderte ich mürrisch. Sie lachte, trat ein und stellte das Tablett ab. Dann ging sie zum Bullauge und betrachtete ihr Spiegelbild im Glas. »Vielleicht sollte ich mir die Haare blond färben«, sagte sie. »Das Rot der Korporalki passt nicht zu meiner natürlichen Haarfarbe.«
Ich warf einen Blick über die Schulter. »Du würdest mit deiner Schönheit sogar dann alle Mädchen auf dieser Welt überstrahlen, wenn du von Kopf bis Fuß mit trockenem Schlamm bedeckt wärst.«
»Stimmt«, sagte sie grinsend.
Ich verzog keine Miene. Sie betrachtete seufzend ihre Stiefelspitzen. »Ich habe dich vermisst«, sagte sie.
Ihre Worte versetzten mir einen überraschend heftigen Stich. Denn ich hatte sie auch vermisst, obwohl ich mir dabei wie eine Idiotin vorgekommen war.
»Warst du mir jemals eine echte Freundin?«, fragte ich.
Sie setzte sich auf die Kante meiner Koje. »Spielt das eine Rolle?«
»Ich würde gern wissen, wie blöd ich war.«
»Ich war gern mit dir befreundet, Alina. Aber ich bereue keine meiner Taten.«
»Und die Taten des Dunklen? Was ist damit?«
»Ich weiß, dass du ihn für ein Ungeheuer hältst, aber er versucht nur, das Richtige für Ravka und für uns alle zu tun.«
Ich stemmte mich auf die Ellbogen. Ich durchschaute die Lügen des Dunklen nun schon so lange, dass ich vergaß, wie viele Menschen immer noch auf ihn hereinfielen. »Er hat die Schattenflur erschaffen, Genya.«
»Der Schwarze Ketzer …«
»Den Schwarzen Ketzer hat es nie gegeben«, sagte ich und enthüllte ihr damit die Wahrheit, die ich vor Monaten im Kleinen Palast von Baghra erfahren hatte. »Der Dunkle hat einem erfundenen Vorfahren die Schuld an der Schattenflur gegeben, aber der Dunkle war immer derselbe, und es geht ihm nur um Macht.«
»Das kann nicht sein. Er hat schon immer versucht, Ravka von der Schattenflur zu befreien.«
»Wie kannst du so etwas sagen? Hast du vergessen, was er mit Novokribirsk getan hat?«
Der Dunkle hatte die Macht der Ödsee missbraucht, um die ganze Stadt auszulöschen, hatte seine Stärke demonstriert, um seine Feinde einzuschüchtern und den Beginn seiner Herrschaft zu markieren. Und ich hatte ihm dies ermöglicht.
»Ich weiß, dass es einen … Zwischenfall gab.«
»Einen Zwischenfall? Er hat Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Menschen getötet.«
»Und die Besatzung des Skiffs?«, fragte sie leise.
Ich holte ruckartig Luft und sank zurück auf die Koje, starrte lange die Decke an. Ich wollte es eigentlich gar nicht wissen, aber die Frage hatte mir während der langen Überfahrt und all der Wochen, die seit dem Vorfall verstrichen waren, im Nacken gesessen. Also fragte ich:
»Gab es … gab es weitere Überlebende?«
»Außer Ivan und dem Dunklen?« Ich nickte.
»Zwei Inferni, die ihnen zu entkommen halfen«, sagte sie. »Ein paar Soldaten der Ersten Armee. Und eine Stürmerin namens Nathalia, aber sie starb wenige Tage später an ihren Verletzungen.«
Ich schloss die Augen. Wie viele Menschen waren an Bord des Sandskiffs gewesen? Dreißig? Vierzig? Mir wurde übel. Ich hatte wieder ihre Schreie und das Kreischen der Volkra im Ohr, konnte wieder Schießpulver und Blut riechen. Ich hatte diese Menschen für Mals Überleben und meine Freiheit geopfert, und nun schien es, als wären sie umsonst gestorben. Wir waren erneut in die Fänge des Dunklen geraten, und er war mächtiger denn je.
Genya griff nach meiner Hand. »Du hast getan, was du tun musstest, Alina.«
Ich lachte kehlig auf und riss meine Hand weg. »Sind das die Worte, die du vom Dunklen hörst, Genya? Erleichtert dir das die Sache?«
»Nein. Wohl kaum.« Sie senkte den Blick auf ihren Schoß, raffte und straffte die Falten ihrer Kefta. »Er hat mir die Freiheit geschenkt, Alina«, sagte sie. »Was soll ich denn tun? In den Palast zurückkehren? Zum Zaren?« Sie schüttelte heftig den Kopf. »Nein. Ich habe mich entschieden.«
»Und die anderen Grisha?«, fragte ich. »Sie können sich doch nicht alle auf die Seite des Dunklen geschlagen haben. Wie viele sind in Ravka geblieben?«
Genya erstarrte. »Ich glaube nicht, dass ich mit dir darüber sprechen sollte.«
»Genya …«
»Iss, Alina. Und ruh dich aus. Wir werden das Eis bald erreichen.«
Das Eis. Dann kehrten wir also nicht nach Ravka zurück. Dann segelten wir nach Norden.
Sie stand auf und klopfte den Staub von ihrer Kefta. Sie scherzte über die Farbe, aber ich wusste, wie viel sie ihr bedeutete, denn sie bewies, dass sie tatsächlich eine Grisha war – dass sie beschützt und geschätzt wurde, keine Dienerin mehr war. Ich musste an die rätselhafte Krankheit denken, die den Zaren vor dem Putsch des Dunklen geschwächt hatte. Genya hatte zu den wenigen ausgewählten Grisha gehört, die Zugang zur Zarenfamilie gehabt hatten. Und dies hatte sie ausgenutzt, um ein Anrecht darauf zu erwerben, Rot zu tragen.
»Genya«, sagte ich, als sie bereits an der Tür stand. »Noch eine letzte Frage.«
Sie blieb stehen, eine Hand auf dem Knauf.