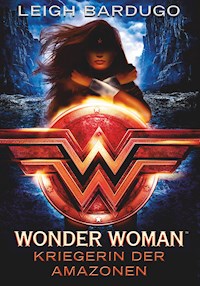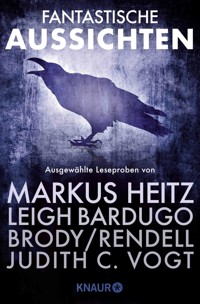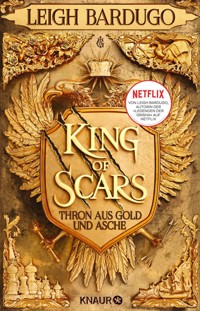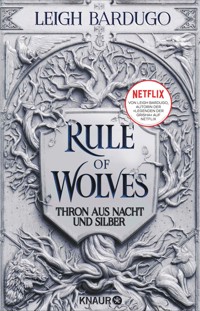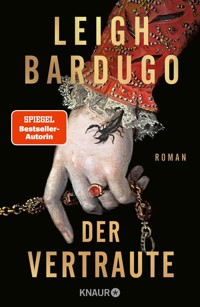
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Magie, Alchemie und ein unsterblicher Vertrauter mit einem tödlichen Geheimnis: Packende historische Fantasy voller Romantik von der Königin der Phantastik Leigh Bardugo Spanien zu Beginn des Goldenen Zeitalters: In einem heruntergekommenen Haus in Madrid nutzt die junge Luzia Cotado einen Hauch von Magie, um die endlose Schufterei als Küchenmädchen zu überstehen. Doch als ihre intrigante Herrin entdeckt, dass ihre Dienerin ein Talent für kleine Wunder besitzt, verlangt sie, dass Luzia diese Gabe einsetzt, um die gesellschaftliche Stellung der Familie zu verbessern. Dieses Unterfangen nimmt eine gefährliche Wendung, als Antonio Pérez, der in Ungnade gefallene Sekretär des Königs, auf Luzia aufmerksam wird. Pérez schreckt vor nichts zurück, um die Gunst des Hofes zurückzuerlangen. Und der spanische Herrscher ist noch immer von der Niederlage seiner Armada erschüttert und sucht verzweifelt nach einem Vorteil im Krieg gegen Englands ketzerische Königin. Luzia ist fest entschlossen, diese eine Chance auf ein besseres Leben zu ergreifen, und taucht ein in die Welt von Sehern, Alchemisten, Heiligen und Gaunern, in der die Grenzen zwischen Magie, Wissenschaft und Betrug schon bald verschwimmen. Um zu überleben, muss sie alles wagen – auch wenn das bedeutet, dass sie die Hilfe von Guillén Santangel in Anspruch nehmen muss, ihrem unsterblichen Vertrauten, dessen eigene Geheimnisse sich für beide als tödlich erweisen könnten. Der neue Fantasy-Bestseller von Leigh Bardugo: Eine magische Liebesgeschichte im Goldenen Zeitalter Spaniens zur Zeit der Inquisition Tauche tiefer ein in die magische Welt der Bestseller-Autorin Leigh Bardugo: - »Das neunte Haus« (Alex-Stern-Reihe 1) - »Wer die Hölle kennt« (Alex-Stern-Reihe 2) - »Goldene Flammen« (Grisha-Trilogie 1) - »Eisige Wellen« (Grisha-Trilogie 2) - »Lodernde Schwingen« (Grisha-Trilogie 3) - »Das Lied der Krähen« (Krähen-Dilogie 1) - »Das Gold der Krähen« (Krähen-Dilogie 2) - »King of Scars« (»King of Scars« 1) - »Rule of Wolves« (»King of Scars« 2) - »Die Sprache der Dornen« (illustrierte Märchen aus der Welt der Grisha) - »Die Leben der Heiligen« (illustrierte Heiligen-Legenden aus der Welt der Grisha) - »Demon in the Wood. Schatten der Vergangenheit« (Graphic Novel zur Vorgeschichte des Dunklen)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Leigh Bardugo
Der Vertraute
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Alexandra Jordan und Sara Riffel
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Madrid, zu Beginn des Goldenen Zeitalters: Die junge Luzia Cotado nutzt einen Hauch von Magie, um die endlose Schufterei als Küchenmädchen zu überstehen. Doch als ihre intrigante Herrin entdeckt, dass Luzia ein Talent für kleine Wunder besitzt, zwingt sie sie, ihre Gabe einzusetzen, um die gesellschaftliche Stellung der Familie zu verbessern. Bis Antonio Pérez, der in Ungnade gefallene Sekretär des Königs, auf Luzia aufmerksam wird. Der spanische Herrscher ist von der Niederlage seiner Armada erschüttert und sucht verzweifelt nach einem Vorteil im Krieg gegen England - und Pérez schreckt vor nichts zurück, um die Gunst des Hofes zurückzuerlangen. Luzia ist fest entschlossen, diese eine Chance auf ein besseres Leben zu ergreifen, und taucht ein in die Welt von Sehern und Alchemisten, Heiligen und Gaunern. Um zu überleben, muss sie alles wagen - auch wenn das bedeutet, dass sie die Hilfe eines unsterblichen Vertrauten in Anspruch nehmen muss, dessen eigene Geheimnisse sich für beide als tödlich erweisen könnten.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Bemerkung der Autorin
Danksagung
Für meine Familie – Bekehrte, Vertriebene und Geister
A mi familia – conversos, exiliados, y fantasmas
A mi famiya – konvertidos, surgunlis, i fantazmas
Kapitel 1
Wäre das Brot nicht verbrannt, so wäre dies eine ganz andere Geschichte. Wäre der Sohn der Köchin in der Nacht zuvor nicht zu spät heimgekommen, hätte die Köchin nicht gewusst, dass er sich mit dieser Theaterdichterin herumtrieb. Sie hätte nicht die ganze Nacht wach gelegen und sich um seine unsterbliche Seele gesorgt und um die Zukunft möglicher Enkelkinder getrauert und wäre somit am nächsten Tag auch nicht so müde und abgelenkt gewesen, dass ihr das Brot verbrannte. Und wäre das Brot nicht verbrannt, hätte das darauffolgende Unglück vielleicht ein anderes Haus getroffen als die Casa Ordoño, in einer anderen Straße als der Calle de Dos Santos.
Hätte Don Marius an jenem Morgen seine Frau auf die Wange geküsst, bevor er das Haus verließ, so wäre dies eine fröhlichere Geschichte. Hätte er sie mein Schatz, mein Täubchen, meine Schöne genannt, hätte er den blauen Lapislazuli an ihren Ohren bemerkt, oder die Blumen, die sie in die Diele gestellt hatte, hätte Don Marius seine Frau nicht ignoriert, um zu Hernán Saravias Ställen zu reiten und sich Pferde anzuschauen, die er sich niemals leisten könnte, dann wäre Doña Valentina vielleicht gar nicht in die Küche hinuntergegangen, und die ganze Tragödie wäre in den Rinnstein und von dort ins Meer geflossen. Dann wäre wohl das Schlimmste, was jemand hätte erleiden müssen, eine Schüssel traurig aussehender Muscheln gewesen.
Doña Valentina war von kalten, achtlosen Eltern großgezogen worden, die wenig für sie empfunden hatten außer einer vagen Enttäuschung darüber, dass sie ihrer lauen Schönheit wegen wohl keine gute Partie machen würde. Und so war es auch. Don Marius Ordoño besaß ein schwindendes Vermögen, ein paar Olivenhaine, die keine Früchte abwarfen, und ein nicht kleines, aber doch unscheinbares Haus in einer der besseren Straßen von Madrid. Er war das Beste, worauf Valentina mit ihrer bescheidenen Mitgift und ihrem noch bescheideneren Antlitz hoffen konnte. Marius war schon einmal verheiratet gewesen, mit einer rothaarigen Erbin, die nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit vor eine Kutsche geraten und zu Tode getrampelt worden war und ihn ohne Kinder oder eine einzige Münze von der Mitgift ihrer Eltern zurückgelassen hatte.
An ihrem Hochzeitstag trug Valentina einen Schleier aus goldener Spitze und Elfenbeinkämme im Haar. Als Don Marius ihr gemeinsames Abbild in dem wässrigen Spiegel sah, der im Empfangszimmer seines Hauses an der Wand lehnte, wurde er von einem Auflodern von Lust überrascht, vielleicht ausgelöst vom hoffnungsvollen Blick seiner Braut oder seinem eigenen Aussehen im Hochzeitsanzug. Viel eher lag es aber wohl an den Brandykirschen, die er den Morgen über gegessen hatte. Er hatte sie sich in die Backen gesteckt und langsam gekaut, anstatt sich mit seinem neuen Schwiegervater zu unterhalten. In jener Nacht fiel er in einem Anfall von Leidenschaft über seine Braut her und flüsterte ihr Gedichte ins Ohr. Mehr als ein paar ungelenke Stöße brachte er jedoch nicht zustande, bevor ihn Schwindel überkam und er die halb verdauten Brandykirschen quer über die Hochzeitslaken erbrach, die Valentina in wochenlanger Arbeit selbst bestickt hatte.
In den kommenden Monaten und Jahren erinnerte sich Valentina dennoch beinahe wehmütig an jene Nacht zurück. Die von Brandykirschen angeheizte Inbrunst ihres Mannes sollte nämlich das einzige Zeichen von Leidenschaft oder Interesse bleiben, das er ihr gegenüber zeigte. Im Grunde war sie nur von einem lieblosen Zuhause in ein anderes übergewechselt, was aber nicht hieß, dass ihr der Mangel an Liebe nichts ausmachte. Die Sehnsucht, die Doña Valentina verspürte, konnte sie nicht auf salonfähige Weise in Worte fassen, und sie hatte auch keine Ahnung, wie sie zu stillen wäre, und so verbrachte sie ihre Tage damit, ihren wenigen Angestellten mit Zurechtweisungen auf die Nerven zu gehen, blieb dabei aber stets unzufrieden.
Deswegen ging sie an diesem Morgen auch in die Küche hinunter – nicht nur einmal, sondern zweimal.
Seit die Köchin erfahren hatte, dass ihr Sohn von der Theaterdichterin Quiteria Escárcega besessen war, war sie nicht mehr sie selbst. Doña Valentina hatte es sich darum zur Aufgabe gemacht, jeden Morgen in der Küche nach dem Rechten zu sehen. Als sie an diesem Tag die Treppe hinunterstieg und die zunehmende Wärme spürte, wurde sie vom unverkennbaren Geruch verbrannten Brotes begrüßt und wäre vor Freude darüber, endlich einmal einen echten Grund zur Beschwerde vorbringen zu können, beinahe in Ohnmacht gefallen.
Doch die Köchin war nicht da.
Valentina wollte auf sie warten, obwohl die Hitze der Feuerstelle sie zum Schwitzen brachte. Ihre Wut kochte ebenfalls immer heißer in ihr hoch, und sie legte sich schon einen langen Vortrag über Verschwendung, Nachlässigkeit und den allgemeinen Charakter der Köchin zurecht. Dann klopfte es jedoch oben an der Haustür, und Valentina wusste, dass es vielleicht jemand war, der mit ihrem Gatten über seine Oliven sprechen wollte. Womöglich war es sogar eine Einladung? Unwahrscheinlich, aber allein der Hoffnung wegen setzte sie sich in Bewegung. In der Casa Ordoño gab es sonst niemanden, der zur Tür gehen konnte. Ihr Gatte hatte klargestellt, dass sie sich keine weiteren Angestellten leisten konnten und dass Valentina von Glück reden konnte, dass sie eine Köchin und ein Küchenmädchen hatte, die ihr zur Hand gingen. So musste sie also ihre Wut beiseiteschieben und die Stufen wieder hochstapfen, wobei sie sich das feuchte Gesicht mit dem Ärmel abtupfte.
Als sie ein weiteres Mal die Treppe hinunterstieg, diesmal mit einem ungelesenen Brief von ihrem Vater im Ärmel, hörte sie die Köchin mit der gedrungenen Küchenmagd reden, die immer einen dumpfen Kellergeruch verströmte und den Blick nie von ihren unbeholfenen Füßen hob, wenn sie durchs Haus stolperte.
»Águeda«, rief Valentina beim Betreten der Küche, und ihre Stimme vibrierte vor Genugtuung, als sie zu ihrer berechtigten Schelte anhob, »kannst du mir sagen, weshalb du das Vermögen meines Gatten und meine Zeit verschwendest und schon wieder das Brot verbrennen lässt?«
Die Köchin schaute sie bekümmert an; ihre Augen waren vom Weinen um ihren albernen Sohn gerötet. Dann richtete sie den Blick auf den Tisch in der Mitte der Küche, wo das Brot in der schwarzen Backform stand.
Noch bevor Valentina ihrem Blick folgte, spürte sie Röte in ihre Wangen steigen. Die Möglichkeit einer Blamage kam wie ein plötzlicher Gewittersturm über sie. Das Brot ruhte einem kleinen goldenen Kissen gleich in seinem eisernen Bett, die Kruste wölbte sich glänzend goldbraun, perfekt aufgegangen und perfekt gebacken.
Doña Valentina wollte das Brot untersuchen, mit dem Finger darauf drücken und es als Schwindel entlarven. Dasselbe Brot war vor wenigen Minuten noch schwarz und verbrannt gewesen, die Kruste in der Hitze eingefallen. Und sie wusste auch ganz genau, dass es kein anderer Laib war, der aus dem Feuer gezogen worden war, um den ersten zu ersetzen, weil sie die Eisenform mit der leicht eingedellten Ecke erkannte.
Es war unmöglich. Sie war nur für wenige Minuten weg gewesen. Sie wollen mir einen Streich spielen, dachte Valentina. Die dumme Köchin und das dumme Küchenmädchen wollen mich aufs Glatteis führen, damit ich mich echauffiere und wie eine Närrin dastehe.
Den Gefallen würde sie ihnen nicht tun.
»Dir ist das Brot schon einmal verbrannt«, sagte sie von oben herab, »und es war sicher nicht das letzte Mal. Sorg dafür, dass unser Mittagessen pünktlich auf den Tisch kommt.«
»Wird Don Marius zum Essen zu Hause sein, Señora?«
Valentina hätte der Köchin am liebsten in das selbstgefällige Gesicht geschlagen. »Ich glaube nicht«, sagte sie angespannt. »Aber zwei meiner Freundinnen kommen zu Besuch. Was bereitest du heute zu?«
»Das Schweinefleisch, Señora. Genau wie Sie gesagt haben.«
»Nein«, berichtigte Valentina sie. »Ich wollte die Wachteln. Das Schweinefleisch ist natürlich für morgen.«
Wieder starrte die Köchin sie an, ihre Augen hart wie Kohlestücke. »Selbstverständlich, Señora.«
Valentina wusste nur zu gut, dass sie um das Schweinefleisch gebeten hatte. Sie hatte die Mahlzeiten des Haushalts eine Woche im Voraus geplant, so wie sie es immer tat. Aber die Köchin sollte ruhig daran erinnert werden, dass dies Valentinas Haus war und man sich über sie nicht lustig machte.
Nachdem Doña Valentina gegangen war, rupfte Luzia die Wachteln und hörte die Köchin, die das gekochte Schweinefleisch wegstellte, wütend vor sich hin murmeln. Töpfe und Pfannen klapperten – die Köchin machte einen Aufstand, dabei konnten sie das Schweinefleisch auch noch gut bis morgen aufheben. Doña Valentinas Benehmen war es, was Águedas ohnehin schon miserable Laune noch weiter verschlechtert hatte. Luzia war beinahe dankbar dafür. Eine wütende Águeda war bessere Gesellschaft als eine trübsinnige Águeda.
Doña Valentinas Unzufriedenheit machte sich jedoch überall bemerkbar, und jedes Mal, wenn sie die Küche betrat, befürchtete Luzia, ihre Verbitterung könnte die Milch sauer werden lassen oder das Gemüse verderben. Ihre Tante hatte sie vor langer Zeit gewarnt, dass manche Leute Kummer mit sich brachten wie schlechtes Wetter. Sie hatte ihr die Geschichte von Marta de San Carlos erzählt, die, von ihrem Geliebten sitzen gelassen, die laubbedeckten Pfade beim Alcázar entlangging und dabei so lange und bitterlich weinte, dass selbst die Vögel mit einstimmten. Noch Jahre später wurde jeder, der die Gärten betrat und die Vögel zwitschern hörte, von Trauer erfasst. Jedenfalls hatte Luzias Tante es so gesagt.
Als Luzia das verbrannte Brot gesehen hatte, hatte sie ohne viel Nachdenken mit der Hand darübergestrichen und die Worte gesungen, die ihre Tante sie gelehrt hatte: »Aboltar kazal, aboltar mazal.« Ein Wandel des Ortes, ein Wandel des Schicksals. Sie hatte sehr leise gesungen. Die Worte waren nicht ganz Spanisch, so wie auch Luzia nicht richtig spanisch war. Aber Doña Valentina würde sie niemals in ihrem Haus dulden, nicht mal in der dunklen, heißen, fensterlosen Küche, wenn sie auch nur einen Hauch Judentum an ihr wahrnähme.
Luzia wusste, dass sie vorsichtig sein musste. Ihr fiel es jedoch schwer, sich nicht hin und wieder die Arbeit zu erleichtern, wenn alles so anstrengend war. Nachts schlief sie auf dem Kellerboden, auf einer selbst genähten Lumpendecke mit einem Sack Mehl als Kissen. Vor dem Morgengrauen stand sie auf und ging hinaus in die kalte Gasse, um sich zu erleichtern. Dann kehrte sie ins Haus zurück und fachte das Feuer an, um danach zur Plaza del Arrabal zu gehen und Wasser vom Brunnen zu holen, wo sie anderen Küchenmägden, Wäscherinnen und Hausfrauen begegnete und ihnen einen guten Morgen wünschte. Am Brunnen füllte sie ihre Eimer und trug sie auf den Schultern zurück in die Calle de Dos Santos. Sie brachte das Wasser zum Kochen, sammelte das Ungeziefer aus der Hirse und setzte das frische Brot an, wenn sich Águeda nicht schon darum gekümmert hatte.
Eigentlich war es Aufgabe der Köchin, auf den Markt zu gehen, aber seit ihr Sohn sich in die hübsche Theaterdichterin verliebt hatte, ging Luzia mit dem kleinen Geldbeutel die Stände entlang und suchte nach dem besten Preis für Lammfleisch, Knoblauch und Haselnüsse. Sie war schlecht im Feilschen, wenn sie sich also auf dem Rückweg zur Casa Ordoño allein auf einer leeren Straße wiederfand, schüttelte sie manchmal den Korb und sang: »Onde iras, amigos toparas.« Wohin du auch gehst, mögest du Freunde finden – und flugs waren es nicht mehr sechs Eier im Korb, sondern ein Dutzend.
Als Luzias Mutter noch am Leben gewesen war, hatte sie Luzia immer gewarnt, ihre Erwartungen seien zu hoch, und behauptet, es läge daran, dass Luzia am selben Tag geboren worden war, an dem die dritte Frau des Königs gestorben war. Damals hatten sich die Höflinge in ihrer Trauer gegen die Palastmauern geworfen, und ihr Wehklagen war in der ganzen Stadt zu hören gewesen. Dabei sollten Tote eigentlich nicht betrauert werden, weil sonst das Wunder der Wiederauferstehung ausblieb. Der Tod einer Königin war jedoch etwas anderes. Die Stadt sollte sie betrauern, und ihr Leichenzug war ein Spektakel, das allenfalls mit dem ihres Stiefsohns Carlos ein paar Monate zuvor vergleichbar war. Luzias erste Schreie nach ihrer Geburt mischten sich also mit dem Weinen der Madrileños um ihre verstorbene Königin. »Das hat dich verwirrt«, sagte Blanca. »Du dachtest, ihr Weinen gälte dir, und das hat dich zu ehrgeizig gemacht.«
Einmal, obwohl ihre Tante sie davor gewarnt hatte, hatte Luzia versucht, das Freundschaftslied auch auf die Münzen anzuwenden. Im Geldbeutel hatte es fröhlich geklimpert, aber als sie hineingegriffen hatte, hatte sie etwas gebissen. Zwölf kupferfarbene Spinnen waren aus dem Beutel gefallen und davongerannt. Sie hatte zum Käse, dem Kohl und den Mandeln singen müssen, um den Verlust der Münzen wieder wettzumachen, und Águeda hatte sie trotzdem töricht und nichtsnutzig genannt, als sie den dürftigen Inhalt des Einkaufskorbs gesehen hatte. Das kam dabei raus, wenn man zu ehrgeizig war.
Tante Hualit hatte nur gelacht, als Luzia ihr davon erzählt hatte. »Wenn uns ein bisschen Magie reich machen könnte, wäre deine Mutter in einem Palast voller Bücher gestorben, und ich hätte es nicht mit weiß Gott wem alles treiben müssen, um an dieses schöne Haus zu gelangen. Du hattest Glück, dass du nur mit einem Spinnenbiss davongekommen bist.«
Die Worte der Lieder stammten von ihrer Tante; sie kannte sie aus Briefen, die in Ländern jenseits des Meeres verfasst wurden. Die Melodien dagegen dachte Luzia sich selbst aus. Sie kamen ihr einfach so in den Sinn, ließen ihre Zunge vibrieren – wenn sie den Zucker verdoppeln musste, weil sie kein Geld für neuen hatten, das Feuer anfachen, weil die Glut erloschen war, oder das Brot retten, weil die Kruste zu stark verbrannt war. Kleine Mittelchen gegen kleine Katastrophen, um die langen Arbeitstage erträglicher zu machen.
Sie hatte nicht wissen können, dass Doña Valentina an diesem Morgen schon in der Küche gewesen war und das verbrannte Brot in der Form gesehen hatte. Luzia war zwar mit gewissen Talenten geboren worden, die Gabe, in die Zukunft zu sehen, gehörte jedoch nicht dazu. Visionen oder Trancezustände hatte sie nie. Und sie konnte aus verschüttetem Salz auch nicht herauslesen, was noch geschehen würde. Wenn sie es könnte, dann hätte sie gewusst, dass sie das Brot an diesem Morgen lieber in Ruhe lassen sollte und dass es weit besser war, Doña Valentinas Ärger zu ertragen, als ihr Interesse zu wecken und sich dadurch in Gefahr zu bringen.
Kapitel 2
Valentina besaß keine Zofe, deshalb war es Aufgabe der Küchenmagd, ihr abends beim Auskleiden zu helfen, die Kerzen zu löschen, die Fenster fest zu verschließen und die Nachttöpfe unter die Betten zu stellen. Für gewöhnlich gelang es Valentina, das Mädchen zu ignorieren. Sie war leidlich fleißig und in ihren Woll- und Leinenkleidern angemessen farblos – nicht der Typ, der Aufmerksamkeit erregte. Das war einer der Gründe, warum Valentina sie eingestellt hatte, auch wenn ihr, um der Wahrheit die Ehre zu geben, kaum eine andere Wahl geblieben war. Der Lohn, den sie zahlen konnte, war niedrig, und da es im Haus nur zwei Angestellte gab, war die Arbeit hart.
Als das Mädchen an diesem Abend die Ösen an Valentinas Kleid aufhakte und den Staub davon abbürstete, fragte sie jedoch: »Wie ist dein Name?« Sie musste ihn irgendwann mal gekannt haben, hatte ihn aber zu selten benutzt, um ihn sich zu merken.
»Luzia, Señora«, sagte das Mädchen, ohne von ihrer Arbeit aufzuschauen.
»Und hast du einen Verehrer?«
Luzia schüttelte den Kopf. »Nein, Señora.«
»Wie schade.«
Valentina rechnete mit einem gemurmelten Ja, Señora. Stattdessen verstaute Luzia das zusammengelegte Kleid in der Truhe und sagte: »Es gibt Schlimmeres für eine Frau, als allein zu sein.«
Im Haus meiner Mutter war ich glücklicher. Der Gedanke kam ungebeten, die plötzliche Trauer war überwältigend. Aber natürlich gab es keine größere Schande als eine unverheiratete Tochter, nichts Nutzloseres als eine Frau ohne Ehemann und Kinder. War dieses Mädchen glücklich? Valentina wollte die Frage schon laut stellen, biss sich jedoch auf die Lippe. Was spielte es für eine Rolle, ob eine Dienstmagd glücklich war, solange sie ihre Arbeit verrichtete?
»Du und die Köchin, ihr wolltet euch heute über mich lustig machen, nicht wahr?«
»Nein, Señora.«
»Ich weiß, was ich gesehen habe, Luzia.«
Jetzt schaute das Mädchen hoch, und Valentina bemerkte zu ihrer Überraschung, dass ihre Augen dunkelbraun, beinahe schwarz waren.
»Was haben Sie gesehen, Señora?«, fragte das Mädchen, ihr Blick war so klar wie das Wasser des Manzanares. Valentina wurde sich mit einem Mal bewusst, dass sie beide allein im Zimmer waren. Die Stille im Haus drängte sich ihr auf – und ihre eigene Schwäche. Fast kam es ihr so vor, als hätte sie einen Schrank geöffnet und einen Wolf darin vorgefunden.
»Nichts«, brachte Valentina hervor, beschämt über das Zittern in ihrer Stimme. »Ich habe nichts gesehen.« Sie stand auf und durchquerte das Zimmer, um etwas Distanz zwischen sich und das Küchenmädchen zu bringen. »Dein Blick ist reichlich anmaßend.«
»Verzeihung, Señora.« Luzia richtete die Augen wieder auf den Boden.
»Geh«, sagte Valentina mit einer, wie sie hoffte, unbekümmerten Geste.
Aber nachdem Luzia gegangen war, verriegelte sie die Tür hinter ihr.
In dieser Nacht schlief Luzia nicht, und am nächsten Tag ging sie keine Risiken ein. Sie wartete, bis das Wasser kochte, ohne das Aufheizen mit einem gesungenen Wort zu beschleunigen. Sie holte Holz für den Küchenherd, ohne eine Silbe zu sprechen, um es anzuzünden. Sie konnte erst wieder richtig durchatmen, als sie die Straße zu San Ginés entlangeilte. Seit dem Vorkommnis mit dem Brot hatte Doña Valentina sie genau beobachtet. Nach Magie suchte sie dabei nicht; vielmehr glaubte sie, Luzia und die Köchin wollten ihr einen albernen Streich spielen.
Auf die Straße hinaus konnte Valentina ihr jedoch nicht folgen. Eine Frau ihres Standes durfte das Haus nur in Begleitung ihres Ehemanns, ihres Vaters oder eines Geistlichen verlassen. Luzia hatte Geschichten von reichen Damen gehört, die aus dem Fenster gestürzt waren und sich mehrere Knochen gebrochen hatten. Eine war sogar gestorben, weil sie sich zu weit hinausgelehnt hatte, um Neuigkeiten zu erfahren. Wenn Luzia müde war oder ihr der Rücken wehtat, spielte sie manchmal ein Spiel mit sich selbst: Würde sie lieber den ganzen Tag auf einem Kissen sitzen und sticken, dafür aber das Leben nur durch ein Fenster sehen? Oder ein weiteres Mal zum Brunnen gehen? Wenn die Eimer leer waren, fiel ihr die Antwort leicht. Waren sie voll, sah die Sache anders aus.
Als sie vom Haus wegging, spürte sie Doña Valentinas Blick vom Fenster im Obergeschoss auf sich ruhen, doch Luzia schaute nicht hoch und lief so schnell sie konnte zu San Ginés. Die Windungen der staubigen Straßen waren ihr wohlvertraut, die anderthalb Kilometer schwanden unter ihren Füßen dahin.
Luzias Tante hatte ihr eingeschärft, dass sie sich jeden Tag in der Kirche blicken lassen sollte. Als sie jedoch das dunkle Hauptschiff betrat, musste sie an ihre Mutter denken, die irgendwo unter ihren Füßen begraben lag. In San Ginés wurde ständig jemand begraben; die Steine wurden angehoben, wieder eingesetzt und dann erneut entfernt und die Leichen neu verteilt, um mehr Platz zu schaffen.
Blanca Cotado war in einem Armenhospital gestorben. Ihr Leichnam war mit den anderen Toten bei einem Begräbniszug zur Schau gestellt worden, damit die Geistlichen Almosen für die Totenmessen sammeln konnten. Luzia war damals zehn Jahre alt gewesen, und sie erinnerte sich an die Anweisungen ihrer Mutter, die wahren Gebete, die sie wie ein geheimes Echo in ihrem Kopf sprechen sollte. Es war ein Spiel, das sie und ihre Mutter gemeinsam gespielt hatten – eine Sache sagen und eine andere denken, die wenigen Brocken Hebräisch, die wie angeschlagene Teller in der Familie weitergereicht wurden. Luzia wusste nicht, ob Gott sie hören konnte, wenn sie in den kühlen Schatten von San Ginés betete, oder ob er ihre Sprache verstand. Manchmal beunruhigte sie das, aber heute hatte sie andere Sorgen.
Sie schlenderte durch die Osttür der Kirche nach draußen in den angrenzenden Garten mit der Statue der stillenden Heiligen Jungfrau in der Mitte.
»Sie könnte Ruth sein«, hatte ihr Vater gesagt. »Sie könnte Esther sein.«
Aber ihre Mutter hatte von einer langen Reihe Gelehrter abgestammt, und deshalb hatte sie geflüstert: »Diese Statuen sind nicht für uns.«
Luzias Füße trugen sie eine verschlungene Nebenstraße entlang, die zur Plaza de las Descalzas und dann weiter zu einem Backsteinhaus mit einer in den Türrahmen geschnitzten Weinrebe führte. Luzia kam alle paar Wochen hierher, obwohl sie es nach Möglichkeit am liebsten jeden Tag getan hätte. Sie trug stets frische Bettwäsche in ihrem Marktkorb bei sich, damit sie vorgeben konnte, sie bei Hualits Hausangestellten abgeben zu wollen, falls jemand aus irgendeinem Grund danach fragte. Es fragte jedoch nie jemand. Luzia wusste, wie man sich unsichtbar machte.
Einmal hatte sie Hualits Gönner, Víctor de Paredes, aus dem Haus ihrer Tante kommen sehen. Er hatte schwarzen Samt getragen und war in eine noch schwärzere Kutsche gestiegen, als würde er in einem schattigen Brunnen verschwinden, ein Stück Nacht, das sich der Nachmittagssonne widersetzte. Um Fragen aus dem Weg zu gehen, war sie an Hualits Tür vorbeigelaufen und hatte so getan, als wollte sie woandershin; einen kurzen Blick ins Innere der Kutsche hatte sie sich dennoch nicht verkneifen können. Sie hatte nur de Paredes’ Stiefel gesehen und ihm gegenüber, in einer Ecke, einen schlanken, kränklich wirkenden jungen Mann mit glatter, glänzender Haut, Haaren im kühlen Weiß einer Taubenbrust und Augen, die funkelten wie Austernschalen. Als sie dem Blick seiner blassen Augen begegnet war, hatte sie das merkwürdige Gefühl gehabt, aus ihren Schuhen gehoben zu werden, und sie war schnell weitergeeilt und hatte erst dann einen Bogen zurück geschlagen, als sie sich sicher sein konnte, dass die Kutsche abgefahren war. Es war noch Winter, doch zu ihrer Überraschung hatten die Mandelbäume, die in der Straße ihrer Tante über die Mauern ragten, schon zu blühen begonnen. Ihre Zweige waren mit dichten Büscheln zitternder weißer Blüten besetzt.
Heute waren keine Mandelblüten zu sehen, keine tintenschwarze Kutsche vor dem Haus, und Tante Hualit öffnete ihr selbst die Tür und winkte sie mit einem Lächeln herein.
Steife Spitze und schwarzer Samt waren gerade in Mode, und Hualit trug beides, wann immer sie das Haus verließ, seit sie Catalina de Castro de Oro war, die Mätresse von Víctor de Paredes. Zu Hause dagegen, in dem eleganten Hof mit dem plätschernden Springbrunnen, trug sie Gewänder aus gefärbter Seide. Ihr dichtes schwarzes Haar fiel ihr in nach Bergamotte duftenden Wellen über die Schultern.
Luzia wusste, das alles war nur Schein. Ein Mann wie Víctor de Paredes liebte das Exotische, und Hualit war noch aufregender als die Paradieskörner, die in den Bäuchen seiner Schiffe eintrafen. De Paredes’ Schiffe sanken nie, ganz gleich, wie rau die See war, und überall in der Hauptstadt flüsterte man sich zu, das sei ein Zeichen für Gottes Gunst. Hier im Hof dagegen schwärmte er, Catalina de Castro de Oro sei sein Glücksbringer, und Luzia fragte sich manchmal, ob Hualit ihren Gönner womöglich tatsächlich verzaubert hatte, da ihr Schicksal so stark von seinem abhing.
»Etwas stimmt nicht«, sagte Hualit, nachdem die Tür geschlossen war. Mit eisernem Griff packte sie Luzias Kinn und blickte ihr prüfend ins Gesicht.
»Wenn du mich loslässt, kann ich das Rätsel für dich lösen.«
Hualit schnaubte. »Du klingst verärgert, aber ich rieche Furcht.«
Sie bedeutete Luzia, sich mit ihr auf das niedrige Sofa in der Hofecke mit den kunstvoll angeordneten bestickten Kissen zu setzen. Wirklich maurisch war das alles nicht, aber dekadent genug, um de Paredes das Gefühl des Verbotenen zu geben. Außerdem passte die Kulisse zu Hualit. Alles an ihr war weich und üppig, ihre honigfarbene Haut, ihre leuchtenden Augen. Luzia wünschte sich oft, sie wäre nur mit einem Bruchteil des Aussehens ihrer Tante geboren worden, aber Hualit schnalzte dann jedes Mal bloß mit der Zunge und sagte: »Du bist nicht klug genug für Schönheit, Luzia. Du würdest sie wie Münzen verschwenden.«
Hualits Hausmädchen Ana stellte Wein und einen Teller mit Oliven und Datteln auf den niedrigen Tisch und tätschelte Luzia die Schulter, als sei sie ihr Lieblingshaustier. Ana war die einzige Angestellte ihrer Tante, eine kräftige Frau, die ihr silbriges Haar in drei verschlungenen Flechtzöpfen auf dem Rücken trug. Sie spielte gern Karten und kaute Anissamen, und – am wichtigsten – sie tratschte nicht.
»Woher weißt du, dass du ihr trauen kannst?«, fragte Luzia, als das Hausmädchen gegangen war.
»Sie hatte schon tausend Gelegenheiten, mich zu verraten, und hat es nie getan. Wenn sie sich damit so viel Zeit lässt, dann ist sie womöglich schon tot, ehe sie ihre Chance ergreift.« Hualit goss Wein in winzige Jadebecher. »Aber warum fragst du mich das jetzt? Und warum siehst du so beunruhigt aus? Zwischen deinen Brauen klafft ein tiefer Spalt, als hätte dir jemand einen Spaten in die Stirn gerammt.«
»Lass mich hierbleiben«, sagte Luzia unwillkürlich. Der Herbst hatte begonnen, und die Blätter der Weinreben, die sich um die Säulen im Hof wanden, waren leuchtend orange verfärbt. An manchen Stellen waren sie abgefallen, und die verflochtenen grauen Ranken kamen zum Vorschein, deren Früchte längst zum Trocknen geerntet worden waren. »Ich kann einfach nicht in dieses Haus zurückkehren.« Doña Valentina zu fürchten und zu hassen war schon schlimm genug, aber sie zu bemitleiden, wenn sie einsam an ihrem Fenster saß und auf ihren Ehemann wartete, der kein richtiger Ehemann war, das war unerträglich.
»Dein Vater würde es mir niemals verzeihen, wenn ich deine Tugend befleckte.«
Luzia zog ein finsteres Gesicht. »Ich werde die Casa Ordoño mit krummem Rücken, kaputten Knien und Händen so rau wie Sand verlassen, aber zumindest meine kostbare Tugend wird unversehrt sein.«
Hualit lachte nur. »Richtig.«
Luzia war versucht, den Jadebecher auf den Fliesen zu zerschmettern. Aber der Wein schmeckte zu gut, und die halbe Stunde, in der sie Datteln gegessen und Hualits Geschichten über den Königshof gelauscht hatte, war ihr zu teuer. Als Luzias Mutter gestorben und die Erschütterung in ihrem Leben zu einem regelrechten Erdbeben geworden war, hatte sie gehofft, Hualit würde sie in ihrem Haus arbeiten lassen, aber ihr Vater war damals noch klar genug bei Verstand gewesen, um es zu verbieten. »Wenn du im Haus einer Sünderin arbeitest, wird das das Ende deiner Tugend sein«, hatte er gesagt. »Du wirst nie einen Ehemann oder ein eigenes Zuhause haben.«
Allerdings hatte Luzia ohnehin keine Ahnung, wie sie einen Ehemann finden sollte, wenn sie tagein, tagaus nur in der Casa Ordoño schuftete und Doña Valentinas Forderungen erfüllte. Auf dem Weg zum Markt schaute sie sämtlichen jungen Männern ins Gesicht – und auch den älteren. Aber sie war zu geübt darin, unsichtbar zu sein. So ging sie an den Fleischern, Fischhändlern und Bauern vorbei, ohne bemerkt zu werden. Inzwischen war sie weit über zwanzig und hatte noch nie einen Verehrer gehabt, hatte noch nicht mal einen Mann geküsst, bis auf den Betrunkenen, der sie einmal auf dem Markt gepackt und versucht hatte, sein stoppliges Gesicht auf ihres zu drücken, bis sie ihm gegen das Schienbein getreten hatte.
Gehört und gesehen hatte sie schon vieles – Männer und Frauen auf den Knien in engen Gassen mit hochgehobenem Rock und heruntergelassener Hose, verschleierte Schönheiten in ihren Kutschen beim Prado, feine Damen und Huren, im Dunkeln kaum auseinanderzuhalten; das derbe Gerede an den Ständen auf der Plaza.
»Was macht eine gute Frau aus?«, hatte ein Priester eine Schauspieltruppe auf dem Weg in die Mentideros gefragt.
»Sie müsste gut mit der Nadel umgehen können«, antwortete ein junger Schauspieler an die Menge gewandt. »Oder ein Talent für Konversation haben«, fuhr er fort. »Oder den Schwanz eines Mannes in sich aufnehmen und ihn zusammenpressen können, bis er Engel sieht«, rief er dann, und die Menge brach in Gelächter aus, während der Priester bellte, dass sie alle in der Hölle schmoren würden.
Als Don Marius’ Vater krank geworden war, hatte die Familie Luzia zum Haus des alten Mannes geschickt, um ihm beim Waschen zu helfen. Man hatte sie in seine Schlafkammer geführt, und sie hatte mit dem Rücken an der geschlossenen Tür gelehnt, Waschschüssel, Seife und Handtuch fest umklammernd, und hatte jedes Gebet geflüstert, das ihr eingefallen war, fest überzeugt, dass man sie mit einem Toten allein gelassen hatte. Sie hatte seinen dürren Körper betrachtet, bis sie bemerkt hatte, dass sich seine schmale Brust hob und senkte. Als sie ihn jedoch waschen wollte, hatte er ihre Hand gepackt und sie um seinen Schwanz gelegt. Weich und pulsierend war er gewesen, wie eine kleine Maus. Der Alte hatte einiges an Kraft besessen, aber sie hatte ihm die andere Hand über Nase und Mund gelegt, bis er sie losließ. Sie hatte sie erst wieder weggenommen, als seine wässrigen Augen aus den Höhlen traten.
»Ich werde Sie jetzt waschen, Don Estevan, und Sie werden still liegen, oder ich breche Ihnen Ihre armselige kleine Wurzel ab.«
Danach war er gefügig gewesen. Er hatte sogar beinahe zufrieden gewirkt.
Das war das ganze Ausmaß ihrer Erfahrungen mit dem männlichen Körper.
»Es muss doch noch mehr geben«, sagte sie, stellte den Wein ab und schloss die Augen. »Wozu lesen lernen, wenn ich ein Leben ohne Bücher führen muss? Wozu Latein pauken, wenn ein Papagei mehr Gelegenheit hat, diese Sprache zu sprechen, als ich?«
»Nur Gott allein weiß, wozu wir bestimmt sind«, sagte Hualit. »Und jetzt iss noch eine Dattel. Die helfen gegen sauren Magen und Selbstmitleid.«
Kapitel 3
Als das Küchenmädchen zur Kirche gegangen war, holte Doña Valentina ihre kleine Silbergabel heraus. Das Kleid in ihrem Schoß war nicht gerade ihr liebstes, aber sie besaß nur drei. Der neue Modestil war nüchtern und schlicht. Er sollte eine schmale Taille betonen – die sie noch hatte, weil sie nie schwanger geworden war. Dazu wurden Perlenketten und Juwelen als Schmuck getragen – die sie nicht hatte. Sie schob die beiden Zinken der Gabel unter den Faden an der Seite des Kleids, um die Naht aufzutrennen. Sollte sie sich irren, ließe sich der Schaden leicht beheben.
Valentina wusste nicht recht, warum sie das tat, aber sie musste ständig an das Brot denken, an das ausdruckslose Gesicht der Köchin und an die Küchenmagd, die vom Tisch weggetreten war. Wenn sie sich tatsächlich über sie lustig gemacht hätten, hätten die beiden belustigter ausgesehen. Aber die Köchin war wütend und verwirrt gewesen so wie immer. Und das Küchenmädchen Luzia hatte viel eher einen verängstigten Eindruck gemacht.
Valentina hatte Gerüchte von Illusionen und Wundern gehört, die bei Hofe geschahen. Lucrecia de León hatte von der Zukunft geträumt, der in Ungnade gefallene Prophet Piedrola hatte behauptet, mit den Engeln zu sprechen, und die Mendozas hatten angeblich einen weisen Heiligen in ihren Diensten, der Gegenstände mit Gedankenkraft bewegen konnte. Valentina hatte Derartiges natürlich nie mit eigenen Augen gesehen. Eine Einladung für La Casilla, geschweige denn in den Alcázar, hatte sie nie erhalten und würde sie auch nie. Es sei denn …
Aber ihr Es sei denn roch nach Verzweiflung, und während sie sich über die Naht ihres Kleides beugte und Fäden durchtrennte wie ein Vogel, der nach Würmern pickt, war sie beinahe von sich selbst angewidert. Ihre Schande schien sie zu verfolgen, sie vorwärtszutreiben, das Schlimmste in ihr hervorzukehren.
Sobald Luzia von der Kirche zurück war, stieg Valentina zur Küche hinab. Sie schrie die Köchin an und behauptete, es seien Rüsselkäfer im Reis, den sie danach quer über den Boden verstreute, damit die Küchenmagd ihn aufkehren und auf den Knien umherkriechen musste, um alle Körnchen einzusammeln. Sie verlangte nach Wasser für ein Bad, obwohl sie schon tags zuvor eines gehabt hatte, und als Luzia Wasser auf dem Boden verkleckerte, verpasste sie ihr eine so saftige Ohrfeige, dass das Mädchen rückwärtsstolperte.
Valentina war völlig außer Atem, fühlte sich ängstlich, als glitten ihr ihre Zügel durch die Hände, als hätte sie plötzlich den Verstand verloren. Es gab nichts, was sie nicht tun würde.
»Bring mir mein Kleid«, knurrte sie. »Beeil dich.« Beinahe erwartete sie, dass sich Reißzähne durch ihr Zahnfleisch gebohrt hatten, dass ihre Fingerspitzen in Krallen endeten. Verwundert betrachtete sie ihr bleiches Mondgesicht im Fensterglas, und beinahe hätte sie vergessen, Luzia zu beobachten, die den schwarzen Samt aus der Truhe nahm, die aufgerissene Naht entdeckte und zögerte. Valentina sah, wie sie hochschaute und sich vergewisserte, dass Valentina mit dem Rücken zu ihr stand, dann hörte sie ein leises Summen.
Luzia brachte das Kleid zu ihrer Herrin. Valentinas Hände zitterten, als sie es entgegennahm.
Die aufgetrennte Naht war verschwunden.
Luzia wusste, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht hatte, als sie in Doña Valentinas Augen sah. An diesem Abend wirkten sie hektisch, wie das unstete Blau aufgewühlten Wassers.
Sie stand mit ihrer Herrin in der stillen Schlafkammer, und sie hielten beide das schwarze Kleid fest, als wollten sie es gemeinsam zusammenfalten, weglegen und vergessen.
»Du wirst heute zum Abendessen kommen«, sagte Valentina und leckte sich über die farblosen Lippen. »Wenn wir das Obst servieren, wirst du uns eine Vorführung geben.«
Luzia wusste nicht, was sie sagen sollte, außer: »Das kann ich nicht.«
»Du wirst es tun«, sagte Valentina, und ein Lächeln trat auf ihre Lippen. »Du musst.«
»Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen.«
Valentina packte sie am Handgelenk. »Lass das«, zischte sie. »Du hast mein Kleid repariert. Du hast das Brot gerettet. Du wirst tun, was ich von dir verlange, oder ich setze dich noch heute Abend auf die Straße. Denk dran, was es bedeuten würde, als Frau allein zu sein, ohne Arbeit, ohne Schutz. Denk daran, bevor du dich ein weiteres Mal sträubst.«
Luzia konnte nicht nachdenken, konnte nicht begreifen, was vor sich ging. Sie durfte nicht tun, was Valentina verlangte. Die Magie selbst war harmlos, nur ein kleiner Spaß, eine Sinnestäuschung, und in den Händen einer armen, aber frommen Christin nichts, wovor man sich fürchten musste. Doch wenn jemand genauer hinschaute, was würde er sehen? Wenn jemand sich die Mühe machte, Luzias Abstammung zu überprüfen, zu fragen, wer ihre Eltern, ihre Großeltern waren? Die Familie ihres Vaters stammte aus Portugal. Vielleicht würde das ihre Herkunft schwerer nachverfolgbar machen. Aber wie war es mit der Familie ihrer Mutter? Alle tot und begraben oder verbrannt, aber so gefährlich für sie, als würden sie auf der Straße predigen.
Sag, du bist nur ein einfaches, törichtes Mädchen, das ein paar magische Worte gelernt hat. Es war alles bloß ein Spiel.
Und wenn Doña Valentina wissen wollte, wo sie diese Dinge gelernt hatte, was würde sie dann sagen?
Valentina musste in ihrem Gesicht gesehen haben, wie Luzia innerlich kapitulierte, denn sie ließ ihr Handgelenk los und klopfte ihr sanft auf die Hand. »Zieh eine saubere Schürze an, bevor du zu uns kommst. Und steh nicht so krumm da, als würdest du auf die nächste Maulschelle warten.«
Ihre restlichen Aufgaben an diesem Nachmittag erledigte Luzia wie in Trance. Sie half der Köchin, die kalten Salate zuzubereiten, den Pastetenteig auszurollen und die Ochsenzunge in hauchdünne Scheiben zu schneiden. Sie füllte kleine Schüsseln mit warmem Wasser und Lavendel, damit die Gäste sich die Hände waschen konnten. Tante Hualit beschrieb gern die Festmahle in den Häusern ihrer reichen Freunde, wo Hunderte Gerichte serviert wurden und zwischen den Gängen Spaßmacher und Tänzer auftraten. Bei den Ordoños reichte es dagegen nur für Fischpastete, Ochsenzunge und Salat. Luzia trug die Pasteten die Treppe hoch und stellte sie auf den schweren Tisch an der Wand des Esszimmers. Valentina servierte die Gerichte selbst.
Treppe hoch, Treppe runter. Die Gänge wurden einer nach dem anderen aufgetragen, schneller, als es üblich war – ein Hinweis darauf, dass die Gespräche ins Stocken geraten waren und der Abend wohl nicht allzu erfolgreich verlief. Luzia richtete die Zunge auf einer Servierplatte an, schöpfte Soße in einen Krug und hörte, wie die Köchin Escárcega, Escárcega, Escárcega murmelte, als sei der Name der Theaterdichterin ein Fluch.
Luzia dachte daran, was Valentina über ihre Haltung gesagt hatte, und straffte den Rücken. Es war jedoch schwierig, den schlurfenden Gang der Dienerin abzulegen, den sie so lange perfektioniert hatte. Besser nicht gesehen werden. Besser nicht bemerkt werden. Am liebsten wäre sie zu Hualit gelaufen, aber dann hätte sie zugeben müssen, was für ein Dummkopf sie gewesen war.
Was habe ich getan?, fragte sie sich wieder und wieder. Was soll ich tun?
Die Antwort lautete natürlich: nichts. Sie würde einfach gar nichts tun. Am Kopfende des Tisches stehen und sich zum Narren machen, sich vielleicht mit etwas bekleckern. Die kleine Blamage würde sie ertragen und Doña Valentina ebenso. Vielleicht würde sie Luzia auf die Straße setzen, aber vielleicht würde sie auch Mitleid haben oder kein anderes Mädchen finden, das für ihren mickrigen Lohn arbeiten wollte. Vielleicht gehen die Gäste nach Hause, bevor das Obst serviert wird, dachte Luzia, während sie die roten, mit Wein vollgesogenen Birnen in der hübschen Schüssel betrachtete. Sie lauschte und hoffte, das Kratzen von Stühlen zu hören, wenn die Gäste oben vom Tisch aufstanden, die Tür, die geöffnet und geschlossen wurde, wenn sie sich verabschiedeten. Stattdessen vernahm sie nur Doña Valentinas Stimme, ihr Flüstern, das die Treppe hinunterdrang wie ein Finger aus Rauch, der sich auffordernd krümmte. »Luzia.«
Die Köchin lachte, als Luzia sich eine saubere Schürze umband. »Na, ziehst du dein bestes Kleid an?«
»Ich habe gehört, Quiteria Escárcega hat zwei Geliebte und treibt es mit beiden gleichzeitig«, sagte Luzia gehässig und genoss das kurze Vergnügen, den Mund der Köchin aufklappen zu sehen. Sie nahm sich die silberne Schüssel mit den Birnen.
Ich gehe zu Tante Hualit, dachte sie, während sie die Treppe hochstieg. Ich wandere nach Toledo und fange ein neues Leben an. Sie würde betteln müssen, so wie ihr Vater. Nur dass selbst das für eine Frau keine sichere Arbeit war.
»Diesmal wird Luzia servieren«, sagte Doña Valentina, als Luzia mit den Birnen eintrat.
Kerzen leuchteten auf der Anrichte, dem Esstisch, dem Kaminsims. Im Haus eines Adligen wurde dergleichen erwartet, aber Luzia wusste, dass sie wegen der Ausgaben wochenlang nur Brot und Sardinen essen würden. Don Marius hockte am Kopfende des Tisches und sah grimmig und gelangweilt aus.
Luzia ging langsam durch den Raum, hielt das Gefäß mit den Birnen unbeholfen in der Armbeuge und den sperrigen Löffel in der anderen Hand. Sie war sich des Schweigens bewusst, des Mangels an Gesprächen und Gelächter. Sie spürte Valentinas eifrigen Blick, die anderen Gäste dagegen übersahen sie geflissentlich – heute Abend waren es nur zwei: Don Gustavo und seine juwelenbehängte Gattin.
Als Luzia endlich die letzte Birne aus der Schüssel geschöpft hatte, machte sie kehrt und ging so schnell auf die Tür zu, dass sie beinahe über ihre eigenen Füße gestolpert wäre.
»Luzia!«, sagte Valentina scharf.
Luzia erstarrte mit der silbernen Schüssel im Arm.
»Stimmt was nicht mit ihr?«, flüsterte Don Gustavos Gattin, deren Perlenketten wie Licht auf Wasser glänzten.
»Stell die Schüssel ab und komm her«, sagte Valentina mit hoher, heiterer Stimme. »Luzia will uns etwas zeigen, ein wenig Unterhaltung für unsere Gäste.«
Daraufhin lehnte Don Gustavos Gattin sich vor. »Kann sie singen? Ich liebe ein schönes Villancico. Man hört die Leute morgens auf dem Marktplatz singen.«
Don Marius rutschte auf seinem Stuhl herum.
Doña Valentina holte ein verbranntes Brötchen aus ihrer Tasche und legte es auf den Tisch. Es sah aus, als hätte jemand einen Stein durchs Fenster geworfen, der inmitten der wertvollen Glaskelche und altmodischen Zinnteller gelandet war.
Don Marius’ Lachen klang unfreundlich. »Bist du verrückt geworden?«
»Ist es ein Trick?«, fragte Don Gustavo und strich sich über den Bart. »Ich habe in Córdoba mal ein Mädchen gesehen, das eine ganze Orange in den Mund nehmen konnte.«
Doña Valentina schürzte die Lippen wegen der Obszönität, mehr konnte sie jedoch nicht tun. »Luzia«, drängte sie.
In Luzia regte sich Leichtsinn. Sie wollte nach dem Brötchen greifen und es wieder schön und appetitlich machen, aber sie hielt die Hände still. Würde Valentina noch bis morgen früh warten oder sie gleich heute Abend auf die Straße setzen? Und wenn sie es tat, würde Hualit Luzia aufnehmen?
Tu nichts, sagte sie sich. Sei nichts. Wenn sie es sich ganz fest wünschte, würde sie vielleicht einfach langsam in den Steinwänden verschwinden.
»Nun?«, fragte Don Gustavo.
»Nun?«, wiederholte Don Marius.
Doña Valentina streckte die Hand aus und kniff Luzia in den Arm. Aber sie rührte sich nicht.
»Schick sie einfach in die Küche zurück«, sagte Don Marius. »Es ist spät.«
»So spät ist es nun auch wieder nicht«, widersprach Valentina.
Luzia schaute nicht vom Tisch hoch, von dem verbrannten Brötchen und den Kerzen, aber sie hörte das Elend in Valentinas Stimme. Ein festlicher Abend sollte so früh nicht enden. Wenn doch, dann hatten Gastgeber und Gastgeberin versagt, und sollte sich das herumsprechen, würde es weniger Einladungen geben. Valentina würde an ihrem Fenster sitzen und mit Don Marius allein zu Abend essen. Aber das war nicht Luzias Problem.
Don Gustavo seufzte tief und schob seinen Stuhl zurück. »Es wird Zeit, dass wir uns …«
»Luzia will uns etwas zeigen«, beharrte Valentina.
»Was ist los mit dir, Weib?«, knurrte Don Marius. »Das ist peinlich für mich und dieses Haus.«
»Ich wollte doch nur …«
»Es gibt keine größere Last als eine törichte Ehefrau. Ich möchte mich bei euch entschuldigen, Don Gustavo, meine Freunde.«
»Bitte«, sagte Valentina. »Ich … Wenn ihr gesehen hättet …«
»Und sie plappert immer noch weiter.«
Don Gustavo lachte. »Wie sagen es die Dichter? Gott hat den Frauen Schönheit gegeben, um die Männer in Versuchung zu führen, und Sprache, um sie in den Wahnsinn zu treiben.«
Luzia wollte nicht hinschauen. Sie wollte nicht die Tränen in Valentinas Augen glänzen sehen, das Feixen der perlenbehängten Frau, Don Marius’ und Don Gustavos selbstgefällige, vom Wein gerötete Mienen. Sie wollte nicht nach einem der Kelche aus venezianischem Glas greifen – Hochzeitsgeschenke, die Doña Valentina nur zu besonderen Anlässen hervorholte, klar und vollkommen wie Regentropfen.
Doch sie tat es und zerschmetterte das Glas auf dem Tisch.
Im Raum wurde es still. Die Gäste starrten sie an. Don Gustavos Frau legte bestürzt die Hände über den Mund.
Luzia hatte das Gefühl, durch die Decke nach oben zu schweben, durch das Dach hinauf in den Nachthimmel, als hätten ihre Arme die Kontur verloren, sich nach außen gebogen und in Schwingen verwandelt. Valentina hätte die Stimmung erkannt, die sich in Luzias Blut ausbreitete, das wilde und schreckliche Potenzial, derselbe verrückte Wagemut, der sie dazu gebracht hatte, den Reis zu verschütten und Luzia ins Gesicht zu schlagen.
Es gibt nichts, was ich nicht tun würde.
Luzia klatschte laut in die Hände, um die Worte zu übertönen, die sie flüsterte, ein rasches Summen. Sie breitete die Hände über dem zersprungenen Kelch aus, und die Bruchstücke schwebten aufeinander zu wie Blütenblätter in einer unsichtbaren Brise, eine zitternde Rose aus Splittern, die sich kaum einen Atemzug später wieder zu einem Trinkglas zusammenfügten.
Die Gäste keuchten auf. Valentina stieß ein freudiges Seufzen aus.
»Gelobt sei Gott«, rief Don Gustavo.
»Maravillosa!«, sagte seine Frau.
Don Marius’ Mund blieb offen stehen.
Luzia sah ihr Spiegelbild im Kelch, verwandelt und doch unverändert, vollkommen gemacht und zugleich zerstört.
Kapitel 4
Luzia konnte nicht schlafen. Sie lag auf dem Lehmboden der Speisekammer und starrte zu den Regalen hoch, den Gefäßen mit Eingelegtem, den baumelnden Knoblauchketten, den Schinken, die wie abgetrennte Gliedmaßen von der Decke hingen. Sie spielte mit dem Gedanken, sich eine Kerze anzuzünden und zu lesen, aber alles, was sie besaß, war eine Anleitung zum würdigen Sterben von Alejo de Venegas. Ihre Tante hatte sie ihr bei ihrem letzten Besuch gegeben, und Luzia hatte sie hinter einem Krug mit Soleiern versteckt, den nie jemand anrührte.
»Nächstes Mal Gedichte«, hatte Luzia ihre Tante angefleht.
Hualit hatte bloß gelacht. »Nimm, was du kriegen kannst, und sei froh darüber.«
Aber Luzia bezweifelte, dass selbst Gedichte jetzt ein großer Trost wären. Sie hatte nicht geweint, auch wenn sie sich wünschte, sie könnte es. Stattdessen starrte sie nur in die Dunkelheit, unfähig zu begreifen, was sie getan hatte. Sie fühlte sich, als würde sie am Fuß einer Mauer stehen und hochschauen. Sie hatte keine Ahnung, wie hoch oder wie breit die Mauer war oder welche Form das Gebäude hatte. Stand sie vor einem Palast oder einem Gefängnis?
Es ist vorbei, sagte sie sich. Es ist getan. Valentina ist besänftigt. Der Morgen wird anbrechen, und du wirst aufwachen und das Brot ansetzen und zum Markt gehen und weiter nichts.
Das sagte sie sich immer wieder, bis sie schließlich eindöste.
Bei Morgengrauen war die Luft kalt, und es war noch niemand auf der Straße, bis auf die Katzen und die Bauern und Fischer, die sich irgendwo in der Nähe der Plaza etwas zuriefen. Sie ging zum Brunnen, füllte ihre Eimer und versuchte, nicht nachzudenken. Lorenzo Botas saß auf seinem Stuhl bei den Ständen der Fischverkäufer. Er saß dort den ganzen Tag, gab Wechselgeld heraus und wickelte Makrelen ein, bis er schließlich einschlief und vom Stuhl fiel, woraufhin sein Sohn ihn sich über die Schulter warf und ihn nach Hause trug.
»Die Garrucha«, hatte Águeda ihr mal erzählt. »Sie haben Lorenzo an die Decke gehängt und seine Füße mit Gewichten beschwert. Dann haben sie ihn runterfallen lassen. Ich weiß nicht, wie oft. Danach haben seine Knochen nicht mehr richtig zusammengepasst.«
»Warum haben die Inquisitoren ihn festgenommen?«
»Weil er einen Witz über die Heilige Jungfrau gemacht hat. Einen schmutzigen Witz. Er war immer schon ein schmutziger alter Mann. Wenn er früher zur Beichte gegangen wäre, könnte er jetzt vielleicht noch laufen.«
Luzia versuchte auf dem Heimweg nicht an die Knie des alten Mannes zu denken, die aus den Gelenken gerutscht waren. Sie war nicht dasselbe Mädchen, das gestern Abend in seiner sauberen Schürze am Tisch gestanden hatte und sich von Mitleid, Wut oder etwas ähnlich Sinnlosem hatte mitreißen lassen. Die Nacht war ein Traum gewesen, das Glas kein Glas, sondern eine Seifenblase, die im selben Atemzug, in dem sie geboren worden war, wieder zerplatzt war. Wenn Luzia einfach nicht darüber nachdachte, dann war es vielleicht nie passiert.
Sie hielt den Gedanken über das Nicht-Nachdenken fest, als würde sie die Seifenblase vorsichtig in den Händen halten. Sie dachte nur an das Mehl und das Wasser und das Ansetzen des Brotteigs, an die Hitze des Kochfeuers, die papierne Haut der Zwiebeln unter ihren rauen Händen, ihren Duft beim Schneiden, der ihr die Tränen in die Augen trieb. Sie bemerkte Águeda, die durch die Küchentür eintrat, das Rasseln und Scheppern von Töpfen und Pfannen, während die Köchin sich an die Arbeit machte. Heute war ihr Gemurmel ein Trost. Luzia dachte nicht darüber nach, dass Doña Valentina an diesem Morgen noch nicht die Treppe hinuntergekommen war, um sich über sie zu beschweren. Sie überhörte absichtlich das Klopfen an der Haustür, das oben durch die Zimmer hallte.
In der Casa Ordoño bekam man nur selten Besuch, und niemals so früh am Morgen.
Zwanzig Minuten später klopfte es erneut, ein plötzliches Trommeln, das wie das Poltern von Hufen klang. Luzia stieß ein Zischen aus, als sie mit dem Messer den Knoblauch verfehlte und sich stattdessen in den Finger schnitt.
»Dumme Pute!« Águeda schlug Luzia mit einem hölzernen Kochlöffel auf die Hand. »Hör auf, das Gemüse vollzubluten.«
Luzia band sich ein Tuch um den Finger und arbeitete weiter. Águeda hatte zu singen begonnen, als hätte Luzias Blutopfer sie fröhlicher gestimmt.
Das Pochen des eisernen Türklopfers ging den ganzen Morgen weiter.
Águeda schnalzte mit der Zunge. »Was geht da oben vor sich? Ist jemand gestorben?«
Vielleicht, dachte Luzia, vielleicht.
»Luzia.« Valentinas Stimme schlängelte sich in die Küche. Ihre Schritte waren an diesem Morgen leicht, als würde sie die Treppe hinuntertanzen, und ihre Wangen schienen im trüben Licht zu leuchten. »Komm mit.«
Valentina führte Luzia in ihre Zimmer im zweiten Stock. Den Reiz der Vorfreude hatte sie bis dahin nie gekannt. Marius’ Werben um sie war ernst und kurz gewesen, die Vorbereitungen für ihre Hochzeit nüchtern. Als sie das Haus ihrer Eltern verlassen hatte, war das mit so viel Pomp geschehen, als würde ein Schrank an eine andere Wand gerückt. Nun jedoch war sie aufgekratzt und beschwingt. Obwohl sie sich noch nie betrunken hatte, war dieses Gefühl so neu, so schwindelerregend, dass sie sicher war, dass sich ein Übermaß an Alkohol so anfühlen musste.
»Schau nur!«, sagte sie und deutete auf ihren Frisiertisch, auf dem mehrere gefaltete Briefe verteilt lagen.
Die Küchenmagd starrte stumm auf die Fülle von Papier – wie ein Mädchen, das noch nie Zucker gekostet hatte und nun vor einer Festtafel voller Kuchen stand.
»Das sind Einladungen«, erklärte Valentina.
»Ich weiß. Aber können Sie es sich denn leisten, sie alle zu bewirten?«
Valentina hätte das Mädchen am liebsten geohrfeigt. Und warum auch nicht? Allerdings stellte sie zu ihrem Ärger fest, dass es ihr nicht mehr klug erschien. Angst hatte sie keine, sagte sie sich. Sie wollte bloß vorsichtig sein, wie mit einem teuren Stück Spitze oder einer kunstvoll gefertigten Brosche.
Zumindest konnte sie sich das Mädchen aus den Augen schaffen. »Schön. Dann geh zurück in die Küche, und viel Spaß mit dem Bratspieß.«
Luzia ging, als würde sie nichts lieber tun. Valentina fragte sich, warum sie dem albernen Mädchen die Einladungen überhaupt gezeigt hatte. Die Freuden der Aufregung waren ihr fremd, daher wusste sie auch nicht, woher der Drang kam, andere in dieses glühende Gefühl einzuweihen, ihr eigenes Glück zu vermehren, es in ein Glas zu füllen und mit jemandem zu teilen. Valentina raffte die Einladungen zusammen; sie ruhten wie kleine weiße Tauben in ihren Händen. Beinahe spürte sie ihre Herzen schlagen, so voller Möglichkeiten. Muñoz. Aguilar. Llorens. Olmeda. Keine großen Namen, aber gute. Auf jeden Fall besser als ihr eigener. Diese Leute hatten sie eingeladen, weil sie wussten, dass Valentina verpflichtet wäre, die Geste in gleicher Weise zu erwidern, und sie dadurch Gelegenheit erhielten, vielleicht ein Wunder zu erleben. Valentina besaß keine schweren silbernen Kerzenständer, keine versierten Musiker, die für ihre Gäste spielten. Sie konnte keinen Fasan oder Safranpfirsiche auf den Tisch bringen. Sie hatte nur die dickköpfige und übellaunige Luzia Cotado.
Luzia mit ihrem Kellergeruch, die so ärmlich gekleidet war, dass es einiges über Valentinas Haushalt aussagte. Sie lief zu ihrer Truhe. Eine feine Dame würde Luzia eines ihrer eigenen abgelegten Kleider geben. Aber Valentina hatte keines, das sie weggeben konnte. Die grässliche Wahrheit war, dass Luzia recht hatte. Valentina wusste nicht, wie sie all die Gäste bewirten sollte, wenn sie gezwungen war, ihre Gastfreundschaft zu erwidern, und wenn sie zu einer Gegeneinladung nicht imstande war, durfte sie keine einzige der Einladungen annehmen. All ihre kostbaren Tauben würden davonfliegen.
»Ich werde Geld leihen.« Marius stand in der Tür. Sie war so erschrocken, dass ihr der Truhendeckel auf die Finger fiel und sie einen Schmerzensschrei unterdrücken musste. Sie versteckte die Hände auf dem Rücken, und ihr wurde bewusst, dass sie sich gar nicht daran erinnern konnte, wann sie ihren Ehemann das letzte Mal an der Tür zu ihrem Schlafzimmer gesehen hatte. »Wir werden unseren Gästen Fleisch servieren können.«
Sie machte einen kleinen Knicks.
»Uns ist da etwas Gutes passiert«, sagte er.
Sie fühlte sich hin- und hergerissen zwischen der Freude über sein Lob und dem Wunsch zu rufen, dass es nicht einfach nur so passiert war. Es war nicht Gottes Hand, die die Sterne bewegte, oder Regen, der über der Stadt niederging. Sie, Valentina, hatte ihrem Bauchgefühl vertraut und dem Mädchen eine Falle gestellt, damit es seine Gabe offenbarte, und so vielleicht eine Wende ihres Schicksals eingeleitet. War es Blasphemie, so zu denken? Die Sünde Stolz war ihr ebenso fremd wie dieses aufregende Gefühl.
»Sie ist nicht besonders klug«, sagte Valentina.
»Und auch nicht hübsch«, erwiderte Marius. »Aber vielleicht ist das nicht nötig.«
Valentina zwang sich, ihr Abbild im Spiegel zu ignorieren, den breiten Fleck ihres gewöhnlichen Gesichts. Sie hoffte, dass Marius recht hatte, dass es im Leben nicht auf Schönheit ankam, sondern auf den rechten Willen.
In den folgenden Tagen und Wochen wunderte sich Luzia immer wieder aufs Neue, wie Don Marius für all die Kerzen aufgekommen war, die wie Weizenbüschel mit zusammengebundenen Dochten eintrafen, für das Lamm- und Schweinefleisch und den Fisch am Freitag, für den süßen Wein und die Päckchen mit Gewürzen. Ungeheuerlich, wie schnell sich die Nachricht verbreitet hatte! Aber sie war dankbar für die Abende, an denen Doña Valentina und Don Marius anstatt zu Hause bei Freunden speisten.
Das Geflüster der Hidalgoswurde von Dienern und Dienerinnen belauscht und in die Spülküchen und auf die Märkte getragen. Doña Valentina hatte ein Mädchen unter ihrem Dach, das Milagritos vollbringen konnte. Doch wie wunderbar waren diese kleinen Wunder? Tja, das war schwer zu sagen. Vielleicht war auch alles nur Trickserei – aber gute Trickserei. Und war die Chance auf solch eine Unterhaltung es nicht wert, dass Don Marius einem einen Abend lang den Wein wegtrank und man Doña Valentinas armselige Konversation ertragen musste? Also kamen sie in die Casa Ordoño und aßen den dürftigen Eintopf und die schmalen Fleischstücke, die Valentina ihnen vorsetzte. Sie ertrugen die lauwarme Brühe und die ebenso laue Unterhaltung, und wenn sie endlich genug gelitten hatten, entschuldigte sich Valentina und rief das Küchenmädchen herbei.
Jeden Abend servierte Luzia das Obst, und jeden Abend wurde einem von Valentinas Gästen ein schlanker Glaskelch gereicht, der im Kerzenschein in allen Regenbogenfarben funkelte. Der ausgewählte Gast nahm ihn erwartungsfroh in die Hände und zerschmetterte ihn dann – manchmal mit dem nervösen Wagemut der Blasphemie oder dem betonten Selbstbewusstsein eines Spielers, der eine hohe Karte auf den Tisch legt – auf dem Fußboden. Die anderen Gäste fuhren kreischend hoch, als hätten sie sich erschreckt. Doch wieso sollten sie überrascht sein, wenn von Anfang an klar war, dass jemand das Glas im Laufe des Abends zerbrechen würde? Eine Frage, die sich Luzia jedes Mal stellte, sie aber nie laut aussprach. Stattdessen klatschte sie in die Hände oder stampfte mit dem Fuß auf, um ihre geflüsterten Worte zu übertönen. Die Melodie kam ihr über die Lippen wie Funken, die von einem Luftzug davongetragen wurden. Die Glassplitter wirbelten hoch und setzten sich wieder zusammen; der Kelch war wieder ganz.
Jeden Abend keuchten und jubelten die Gäste.
»Wie geht das?«, fragten sie. »Was ist der Trick?«
»Na, na«, sagte Don Marius dann und strahlte Luzia wie ein liebevoller Vater an. Sein Finger klopfte auf den Tisch, als gebe er den Takt eines Liedes vor. »Das ist ihr Geheimnis.«
»Ist sie stumm?«, fragte eine Frau. Die Perlen, die von ihren Ohren herabhingen, waren so groß wie Wachteleier.
»Eine Dienerin, die nicht sprechen kann?«, sagte ihr Mann. »Dios, hätten wir doch alle solch ein Glück.«
»Bist du stumm, Luzia?«, fragte Don Marius ebenso herzlich wie zuvor – ein großzügiger Mann, der gern Geschenke verteilte. Es war das erste Mal, dass er nicht im Befehlston mit ihr sprach, auf jeden Fall das erste Mal, dass er ihren Namen benutzte.
Luzia schaute nicht hoch, aber sie stellte sich vor, wie Valentina ihre Serviette im Schoß knetete, den Stoff so fest packte, als sei es Luzias Hand, um sie insgeheim zum Sprechen aufzufordern, damit ihr eine Peinlichkeit erspart blieb und Don Marius endlich einmal zufrieden war.
»Nein, Señor«, sagte sie. »Ich weiß nur nichts zu sagen.« In Wahrheit wüsste sie jede Menge zu sagen. Über den dünnen Eintopf und die Perlenohrringe und den Preis für Salz und die unangenehme Erkenntnis, dass selbst Magie zur Plackerei werden konnte. Aber das war nichts, was die Leute hier hören wollten.
»Mich hat das noch nie vom Reden abgehalten!«, brüllte er, und alle brachen in lautes Gelächter aus.
Wenn ich tatsächlich Wunder wirken könnte, dachte Luzia, dann würdet ihr nicht mehr lachen.
An diesem Abend löste sie die Frisur ihrer Herrin. Die Zöpfe waren so fest geflochten, dass Valentinas Gesicht zu erschlaffen schien, nachdem sie aufgebunden waren. Luzia kämmte das Haar aus, dessen Farbe irgendwo zwischen Blond und Braun lag, ein schlammiger Fluss in ihren Händen.
»So kann es nicht weitergehen«, sagte sie, ohne mit dem Kämmen aufzuhören, angenehm überrascht über die Schwere ihrer Worte.
Valentina packte ihre Hand. Ihre Haut war nicht glatt wie die einer reichen Frau, dafür musste sie zu viele Arbeiten selbst erledigen. »Es wird weitergehen, oder ich setze dich auf die Straße.«
Valentinas Griff wirkte jedoch so, als hielte sie sich an einem nassen Seil fest und hätte Angst, den Halt zu verlieren und ins Meer zu stürzen. Als müsste sie zusehen, wie ein Schiff voller Gäste davonsegelte, eine leuchtende Galeone voller Geplauder und Sinnesfreuden.
Luzia schaute Valentina durch den Spiegel in die Augen. »Ich glaube nicht, dass Sie das tun werden.«
»Was willst du?«
»Geld.«
»Ich habe kein Geld.«
»Dann habe ich auch keine Wunder mehr.«
Valentina griff sich ans linke Ohrläppchen und nahm den Perlenohrring ab. Mit den warm glänzenden Kugeln an den Ohren der Frau, die an diesem Abend zu Gast gewesen war, konnte er nicht mithalten. Aber es war die erste Perle, die Luzia je in der Hand gehalten hatte.
Natürlich nützte ihr der Ohrring nichts. Wenn sie versuchen würde, ihn zu verkaufen, würde man sie des Diebstahls bezichtigen. Und doch hielt sie ihn selbst dann noch fest umklammert, als sie auf dem Boden der Speisekammer einschlief. Ein Mond, den sie vom Himmel gepflückt hatte, obwohl das gänzlich unmöglich war. Ein Schatz, der nur ihr gehörte.
Kapitel 5
Zehn Tage vergingen, bis Luzia wieder zur Messe gehen durfte.
Doña Valentina hatte sich tausend Aufgaben ausgedacht, die erledigt werden mussten, um sie davon abzuhalten, das Haus zu verlassen.
»Du kannst nächsten Sonntag in die Kirche gehen«, sagte sie. »Das muss reichen.«
Luzia betrachtete das frisch geputzte Wildgeflügel, das für das Abendessen bereitlag. Die Nacktheit der bleichen, pickeligen Leiber hatte etwas Anklagendes an sich. Ihre Finger taten ihr vom Rupfen weh.
»Wir reden hier über meine Seele«, sagte sie und senkte die Stimme, als könnte der Teufel selbst sie hören. »Das muss reichen.«
Valentina würde sie mit Freuden der ewigen Verdammnis anheimfallen lassen, wenn sie dafür einen Platz an dem richtigen Tisch erhielt, das wusste Luzia, aber es würde ein schlechtes Licht auf die Hausherrin werfen, wenn ihr Küchenmädchen nicht in der Kirche erschien, die heilige Kommunion entgegennahm und die Beichte ablegte. Im trüben Licht der Küche sah Luzia, wie Valentina darüber nachdachte, welch schmaler Grat zwischen kleinen Wundern und dem Verbrechen der Hexerei lag.
»Águeda …«, begann Valentina.
»Ich gehe in San Sebastián zur Messe«, sagte die Köchin.
»Aber …«
Sie wurde von Águedas Hackmesser unterbrochen, das die Hälse der Vögel auf dem Tisch durchtrennte. Jeder entschlossene Hieb machte ihren Standpunkt klar: Ich bin Köchin, keine Aufpasserin.
»Also gut«, sagte Valentina. »Aber nicht herumtrödeln. Ich erwarte dich in einer Stunde zurück. Keine Ahnung, warum du so lange für die Beichte brauchst, wenn du gar nichts zu beichten hast.«
Ich habe eine Menge mordlüsterne Gedanken zu beichten, wollte Luzia sagen, konnte sich jedoch gerade noch beherrschen. Zu Hualit und zurück würde sie es niemals in einer Stunde schaffen, aber sie würde trotzdem zur Kirche gehen. Wenn sie sich zum Beten niederkniete, könnte sie zumindest mal ihre Füße ausruhen.