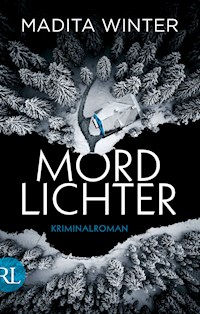12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Mördersuche im hohen Norden Schwedens.
Alljährlich im März findet am schwedischen Polarkreis ein spektakuläres Langlaufrennen statt. Auch Anelie Anderson, die leitende Polizistin aus Jokkmokk, freut sich auf diesen Tag, doch noch während des Rennens wird sie zu einem Tatort gerufen. Ein Läufer ist auf der Strecke tot zusammengebrochen. Was erst wie ein Unfall mit einem Skistock aussieht, entpuppt sich als heimtückischer Mord. Bei dem Toten handelt es sich um einen Millionär, der ganz im Norden auf seinem luxuriösen Anwesen gelebt hat. Doch wie genau wurde der Mann getötet und warum? Als Anelie der Wahrheit näherkommt, gerät sie selbst ins Visier des Täters ...
Packend erzählt und voller Atmosphäre – ein rätselhafter Mordfall im magischen Arctic Circle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Über das Buch
Alljährlich am letzten Samstag im März findet im schwedischen Polarkreis das spektakuläre Langlaufrennen Nordenskiöldsloppet statt. In der grandiosen Winterlandschaft der Arktis müssen Amateure wie Profis 220 Kilometer auf gespurten Loipen durch diese eisige Wildnis überstehen. Während des Rennens wird Anelie Anderson, die leitende Polizistin aus Jokkmokk, zu einem Einsatz gerufen. Ein Läufer ist auf der Strecke tot zusammengebrochen. Als sie dort eintrifft, bietet sich ihr ein grausiger Anblick. Dem Toten wurde offenbar ein Auge ausgestochen. Was anfangs wie ein furchtbarer Unfall aussieht, entpuppt sich bei der Leichenschau als heimtückischer Mord. Der Mann wurde getötet, aber mit welcher Waffe?
Die Ermittlungen fördern weitere rätselhafte Ungereimtheiten zutage. Bei dem Toten handelt es sich um einen geheimnisvollen Millionär, der hier oben im Norden zurückgezogen auf seinem luxuriösen Anwesen gelebt hat. Wer könnte ein Motiv für diesen grausamen Mord haben? Die deutsche Freundin des Millionärs gerät in den Fokus der Ermittler. Sie scheint ein gigantisches Vermögen zu erben, doch sie scheint ein wasserdichtes Alibi zu haben. Immer mehr Rätsel tun sich auf. Bis Anelie selbst in höchste Gefahr gerät.
Über Madita Winter
Hinter Madita Winter verbirgt sich das Autorenpaar Madita und Stefan Winter, das tatsächlich in der Abgeschiedenheit auf einer Halbinsel in der nordschwedischen Wildnis lebt. Die deutsche Journalistin und Autorin ist wegen ihres Mannes vor vier Jahren in die Nähe von Jokkmokk gezogen. Dort wurde die Idee geboren, Lappland als Kulisse für einen Kriminalroman zu verwenden.
Bisher erschien ein Kriminalroman mit der Protagonistin Anelie Anderson: »Mordlichter«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Madita Winter
Eisjagd
Kriminalroman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Impressum
Ich sehe deinen Geist am Himmel Wenn Nordlichter tanzen He-lo e loi-la Ich höre dich nachts mich anrufen Immer wenn Wind weht He-lo e loi-la Ich kann deinen Geist am Himmel sehen Wenn Nordlichter tanzen He-lo e loi-la …
Aus dem Joik »Spirit in the Sky« von Keiino
1
Seit Monaten arbeitet er wie besessen an seinem Plan. Er will endlich ans ganz große Geld kommen. Wie viele Stunden er investiert hat, weiß er nicht mehr, aber in drei Tagen wird sein Tag X sein, und dafür muss er die letzten Vorbereitungen abschließen.
Einen Moment lang ruht sein Blick auf der Waffe. Seine Fingerspitzen gleiten über den Schaft, als würde er die Brust einer Frau liebkosen. Er kostet diesen Moment aus. Lange hat er gewartet, jetzt rückt sein Ziel in greifbare Nähe. Er atmet ein und aus, ihm ist, als wäre sein Plan bereits vollendet.
Fast widerwillig reißt er sich los und beginnt damit, alle Utensilien in den verschließbaren Schlitten zu verstauen. Dabei überprüft er nochmals penibel seine Ausrüstung. Er muss jeden noch so kleinsten Fehler vermeiden, wenn sein Plan gelingen soll. Waffe, Zielfernrohr, Fernglas, Sandsack, Rentierfell, Schneetarnkleidung, Tarnkopfmaske, Tarnhandschuhe, Schuhe, alles landet in dem abschließbaren Schlitten. Die Sachen sind komplett und in bestem Zustand. Dann hängt er den Schlitten an das Schneemobil. Es kann losgehen.
Seine Augen brennen, hier draußen herrscht eine grausame Lichthölle. Das grelle Sonnenlicht, das mit dem strahlenden Weiß von Schnee und Eis konkurriert, blendet ihn schmerzhaft. Rasch setzt er seinen Helm auf, klappt das dunkle Visier herunter und macht sich auf den Weg.
Nach wenigen Minuten biegt er auf einen vorgespurten Winterweg ein, den andere schon vor Monaten mit ihren Schneemobilen angelegt haben. Er folgt dieser Spur knapp zwanzig Kilometer, bevor er in ein kleines Waldstück abbiegt und mit einem im Sichtschatten liegenden Umweg sein Ziel erreicht. Er war vor Wochen schon einmal hier gewesen, um die beste Stelle für sein Vorhaben auszukundschaften.
Nun drosselt er das Tempo, fährt im Schritttempo weiter und späht vorsichtig durch die Bäume. Er muss sicherstellen, dass ihn niemand entdeckt oder beobachtet. Er stoppt das Schneemobil und stellt den Motor ab. Schneeschuhe braucht er nicht, der Schnee ist hier mittlerweile fast wie auf diesem Winterweg stark komprimiert und beinhart. Er öffnet den Deckel seines Schlittens und nimmt alles heraus, was er braucht.
Er nutzt einen großen Felsen als Deckung, breitet ein Rentierfell am Boden aus und legt den extra angefertigten Sandsack vor sich auf den Boden. Dann kniet er sich darauf, legt den vorderen Teil seiner Waffe auf dem Sandsack ab und sucht nach einer guten und stabilen Liegeposition. Langsam und ruhig atmet er ein und aus, spürt, wie sich die Schulterstütze an seine Schulter schmiegt und der Abstand seines Auges zu seinem Zielfernrohr perfekt passt. Vorsichtig dreht er am Dioptrienausgleich und der Vergrößerung seines Zielfernrohres, bis die Schärfe so eingestellt ist, wie er es gewohnt ist.
Bei seiner ersten Auskundschaftung hier hat er in zweihundert Meter Entfernung ein kleines braunes Band an einem Ast befestigt, das er jetzt genau durch sein Zielfernrohr beobachtet. Heute herrscht Windstille. Wieder verändert er die Scharfeinstellung, diesmal genau auf die Distanz zu seinem Ziel. Exakt 97 Meter hat er bei seinem letzten Besuch vor Ort mit seinem Entfernungsmesser ermittelt.
Seit Monaten trainiert er für diesen einen perfekten Schuss, und schon längst trifft er auf diese Entfernung einen fünf Zentimeter großen Kreis mit jedem einzelnen Schuss, auch bei Wind, und das bei einem sich leicht von ihm wegbewegenden Ziel.
Er wird jetzt keinen Probeschuss machen, keine verräterischen Spuren am Ziel hinterlassen. Was er heute hier tut, ist, sich erneut mit den Begebenheiten vertraut zu machen. Er will diesen Ort und die Stimmung hier verinnerlichen, alles in sich aufsaugen. Üben kann er anderswo. In den Bergen hat er, geschützt vor fremden Blicken, sein Ziel lebensgroß, mit viel Mühe und großer Detailverliebtheit nachgebaut, um sich immer wieder bewusst in diese Situation zu bringen, sie durchzuspielen, sie zu erleben. Dort übt er das Schießen.
Wieder atmet er ruhig und langsam ein und aus, sein Auge verschmilzt förmlich mit dem Fadenkreuz seiner Optik, während sein Zeigefinger sich an den Abzug legt. Vor seinem geistigen Auge erscheint sein Ziel, und er durchlebt die Situation, als wäre alles real im Hier und Jetzt. Obwohl er beide Augen offen hat, scheint nur das rechte Auge am Fadenkreuz sehen zu können. Konzentriert atmet er aus, der Druck seines Zeigefingers am Abzug wird fast unmerklich stärker.
»Klack«, schnalzt er mit seiner Zunge.
Treffer.
Er ist ganz ruhig, innerlich eiskalt.
Es gibt nicht den Hauch eines Zweifels, er wird sein Ziel nicht verfehlen, und niemand wird herausfinden, dass er es war. Langsam erhebt er sich und lässt seinen Blick über die Landschaft streichen. Es ist niemand hier, er ist allein. Ruhig und doch zügig verstaut er alles wieder in seinem Schlitten und macht sich auf exakt derselben Route auf den Rückweg.
Drei Tage noch, dann wird es geschehen.
2
Laute Musik dröhnt an meine Ohren. Blind wie ein Maulwurf taste ich mit meiner rechten Hand nach der Quelle und schalte das lärmende Ungetüm aus. Ruhe. Ich atme tief aus. Meine Finger suchen nach dem Schalter der kleinen Nachttischlampe, die über meinem Kopf an der Wand hängt.
Licht. Ich schlage die Augen auf und schaue nach oben. Mein Tag beginnt so makellos wie die Zimmerdecke über mir, ohne dunkle Stellen, ohne Schatten auf der Seele. Ich habe wunderbar geschlafen, tief und traumlos wie seit Langem nicht mehr. Da ich in den zurückliegenden Wochen nach meiner letzten Mordermittlung oft unter schlechteren Bedingungen aufgewacht bin, genieße ich diese ungewohnte Tatsache umso mehr. Ich habe durchgeschlafen, und kein einziger Albtraum hat mich während der Nacht heimgesucht. Regungslos bleibe ich liegen und spüre diesem fast vergessenen Gefühl der Leichtigkeit nach.
In diesem wohligen Dämmerzustand suche ich tastend nach Daniel. Ich greife ins Leere, das Bett neben mir ist kalt. Verwirrt versuche ich meine Gedanken zu sortieren, dann fällt es mir schlagartig wieder ein. Daniel ist ja längst aufgestanden, um rechtzeitig zu seinem Treffpunkt zu kommen. Dass ich nicht gehört habe, wie er aufgestanden ist, bringt mich aus dem Konzept. Normalerweise wache ich beim leisesten Geräusch sofort auf.
Seltsam, irgendwie ist heute alles so anders. Ich genieße dieses anders. Wohlig rekle ich mich ein letztes Mal unter der Bettdecke. Dann gebe ich mir einen Ruck, werfe die Decke beiseite und setze mich auf, um meinen warmen Kokon zu verlassen.
Die Leuchtziffern meines Radioweckers verraten mir, es ist 04:15 Uhr, nicht meine gewohnte Zeit, um aufzustehen. Aber heute ist ein besonderer Tag, heute findet der Nordenskiöldsloppet statt. Ich möchte unbedingt dabei sein, wenn die 423 gemeldeten Läufer kurz nach Sonnenaufgang an den Start gehen, um an dem alljährlich am letzten Samstag im März stattfindenden längsten und härtesten Langlaufrennen der Welt teilzunehmen.
Dieser Skimarathon wird im klassischen Langlaufstil ausgetragen. Um Punkt sechs Uhr werden Profis wie Amateure auf ihren schmalen Skiern loslaufen, um die vor ihnen liegenden 220 Kilometer gespurten Loipen von Jokkmokk nach Kvikkjokk und zurück quer durch die nordschwedische Wildnis zu bewältigen. Ungefähr die Hälfte der Strecke wird über zugefrorene und verschneite Seen führen.
Die Idee für diesen Skimarathon stammt ursprünglich von dem Polarforscher Adolf Erik Nordenskiöld, der 1884 das erste Rennen veranstaltete. Damit wollte er beweisen, dass die in Lappland nomadisch lebenden Sami dazu imstande waren, so riesige Entfernungen am Stück zurückzulegen. Er sollte recht behalten.
Irgendwer muss sich an dieses legendäre Rennen erinnert haben und hat vor einigen Jahren diesen Skimarathon als das härteste Langlaufrennen der Welt wieder aufleben lassen. Der Nordenskiöldsloppet wird wie jedes Jahr seine Opfer fordern, es wird sie niederwerfen und gnadenlos vernichten. Aber es wird auch Sieger krönen, die um ihr Leben gekämpft und den Dämon bezwungen haben. Einige werden ein persönliches Drama erleben, andere den Tag ihres Lebens.
Daniel hat keine Zeit, um dem Start beizuwohnen. Er trifft sich mit den anderen Bewohnern Randias, wie wir unseren kleinen Nachbarort Randijaur liebevoll nennen, an einem der neunzehn Verpflegungspunkte, um die Sportler während des Rennens mit Getränken, Snacks und Zuspruch zu versorgen. Dafür gibt es viel vorzubereiten, und deswegen musste er heute so früh weg. Seine Schwester Liv wird ebenfalls an diesem Posten mithelfen. Ich will später zu ihnen stoßen.
Nach einer schnellen Dusche und einem doppelten Espresso im Stehen breche ich auf. Ich muss mich beeilen, wenn ich rechtzeitig am Startpunkt sein will. Bevor ich das Haus verlasse, wappne ich mich für die arktische Kälte, die mich draußen erwartet. Zuerst ziehe ich meine Arbeitskleidung an, eine dunkelblaue Hose, ein T-Shirt, ein dunkelblaues Hemd, auf dem unübersehbar POLIS geschrieben steht. In Stockholm musste ich keine Uniform tragen, hier leider schon. Über meine ungeliebte Uniform kommt eine wattierte Hose. Es folgen gefütterte Winterstiefel, Wollmütze, Kaschmirschal, Daunenanorak und Handschuhe. Zuletzt setze ich die Stirnlampe auf und trete ins Freie. Den Helm lasse ich liegen. Für meine kurze Fahrt übers Eis verzichte ich darauf.
Draußen ist es stockdunkel, aber meine Stirnlampe taucht die Umgebung in grelles Licht. Ich werfe einen Blick auf das Außenthermometer, das neben der Eingangstür unseres Blockhauses hängt. Es zeigt nur minus zehn Grad. Die unmenschliche arktische Winterkälte liegt definitiv hinter uns. Ich spüre den Frühling, der unaufhaltsam mit Riesenschritten näher kommt. Die Dunkelheit des Winters zieht sich allmählich zurück, die Tage werden spürbar heller, bis die Nacht vollends vertrieben ist und es wochenlang ununterbrochen hell bleiben wird.
Das diesjährige seltsame Wetter hat uns nach einem grimmig kalten Dezember und frostigen Januar mit Temperaturen weit unter 30 Grad Celsius im Februar und März ungewöhnlich warme Temperaturen beschert. Tagsüber sind sie häufig in die Pluszone gerutscht, was den Schnee angetaut hat, der dann nachts bei den Minusgraden wieder zu einer beinharten Eisfläche gefroren ist. Seit Wochen kämpfen wir uns durch dieses ständige Auf und Ab der Temperaturen mit spiegelglatten Wegen und Straßen. Ich trage inzwischen zur Sicherheit Spikes an den Schuhsohlen, nachdem ich zweimal auf dem blanken Eis vor unserem Haus ausgerutscht bin.
In diesem Jahr ist wettertechnisch nichts normal, vielleicht macht sich der Klimawandel auch hier mit seinen Kapriolen bemerkbar, oder der befürchtete Polsprung wird Wirklichkeit, von dem keiner so recht weiß, ob und wann er eintritt und welche Folgen er für uns haben wird.
Aber seit fünf Tagen herrschen tagsüber glücklicherweise wieder durchgehend Minustemperaturen und damit ideale Bedingungen für die präparierten Loipen, durch die in wenigen Stunden wild entschlossene Läufer bei diesem verrückten Rennen über Schnee und Eis fliegen werden.
Ereignisse wie der alljährliche Wintermarkt Anfang Februar oder dieses Rennen Ende März sind Highlights hier oben. Sie bringen viele Touristen nach Jokkmokk und in die Polarregion, sorgen für Abwechslung und Aufregung und unterbrechen den ansonsten vorherrschenden Dornröschenschlaf für eine kurze Zeit. Und das Wetter spielt auch mit. Laut Vorhersage wird es die nächsten beiden Tage halten. Es soll voraussichtlich weder schneien noch stürmen. Aber hundertprozentige Sicherheit gibt es im Polarkreis nie.
Ich schwinge mich auf mein Schneemobil, das vor dem Haus parkt, und drücke den Startknopf des Lynx Commander. Während ich bei laufendem Motor darauf warte, dass die Anzeige im Armaturenbrett die Aufwärmphase des Schneemobils als beendet signalisiert, lasse ich meinen Blick schweifen, soweit es in den Lichtkegeln der Scheinwerfer meiner Stirnlampe und des Skooters möglich ist.
Trotz des diffusen Lichts kann ich erkennen, wie schnell sich die Natur in den letzten Tagen verändert hat. Der Polarkreis hat acht Jahreszeiten, die das Wechselspiel der Natur widerspiegeln. Der Winter ist die längste Jahreszeit und kann acht Monate dauern, wobei er aus einem Frühwinter, einem Hauptwinter und einem Spätwinter besteht. Danach beginnt der Frühling, gefolgt vom Frühsommer, dann von dem eigentlichen, wenn auch kurzen Sommer und schließlich dem Spätsommer, der in den Herbst übergeht und wieder den Frühwinter einleitet.
Der Hauptwinter dauert normalerweise von November bis Ende März. Aber Schnee und Eis von Oktober bis Mai sind die Regel, nicht die Ausnahme. In der Winterzeit verschwindet die gesamte Polarregion unter einem weichen, dicken Schneeteppich und verwandelt sich in einen unwirklichen Ort von atemberaubender Schönheit. Einem Magier gleich verzaubert die arktische Kälte die Natur mithilfe von Schnee, Eis und Frost in eine mondartige Traumlandschaft, gesäumt von bizarr anmutenden Wächtern, die sich erst mit der Schneeschmelze wieder in Fichten, Tannen und Birken zurückverwandeln.
Ich liebe diese Zeit, die mich mit ihrer mystischen Verwandlung wie ein Kind voll ehrfurchtsvoller Bewunderung staunen lässt. Doch dieses Jahr hat der Winter mit ungewohnten Wetterphänomenen überrascht. Durch vorangegangene Tauphasen haben sich die Bäume aus ihren Eismänteln geschält, die zuvor meterdicke, makellos weiße Schneefläche auf den zugefrorenen See ist in sich zusammengesackt und von Fichtennadeln übersät, die Polarwinde herbeigeschafft haben. Der Schneeteppich wirkt dadurch schmutzig und zerschlissen. Dieser Übergang gefällt mir überhaupt nicht. Von mir aus könnte der Frühling sofort beginnen. Wenigstens hat dieses eigenartige Wetter nicht das Rennen gefährdet.
Die Signallampe hört auf zu blinken, der Motor meines Schneemobils hat die nötige Vorwärme erreicht, und ich kann starten. Da sich unser Blockhaus auf einer Halbinsel befindet, stehen unsere Wagen meistens gegenüber am anderen Seeufer, das ich jetzt bequem mit dem Schneemobil erreichen kann. Wir könnten zwar über einen langen holprigen Feldweg direkt zum Haus fahren, aber wenn der See zugefroren ist, ziehen wir es vor, gegenüber zu parken und die letzte Strecke mit dem Skooter zu bewältigen. Ansonsten müssten wir den ganzen Weg regelmäßig vom Schnee räumen, eine sehr anstrengende, zeitraubende Arbeit, die wir uns so schenken können.
Ich fahre langsam mit Halbgas über den zugefrorenen See zum anderen Ufer hinüber, parke den Skooter und wechsle die Fahrzeuge. Bis zu meinem Ziel werde ich voraussichtlich eine Dreiviertelstunde brauchen. Ich schalte das Radio an und lausche während der Autofahrt durch die Dunkelheit der Stimme, die aus meinen Lautsprechern dringt. Alles dreht sich um das heutige Spektakel. Das Rennen wird auf dem zugefrorenen See von Purkijaur fünfzehn Kilometer hinter Jokkmokk beginnen, dann zum Wendepunkt in Arrenjarka bei Kvikkjokk führen und schließlich im Sportstadium von Jokkmokk auf dem zugefrorenen Talvatis-See enden.
Die Radiostimme verrät mir, dass der Norweger Andreas Nygaard, der absolute Favorit und dreimalige Seriensieger, wieder an dem Rennen teilnehmen wird. 2017 schaffte er die Strecke unter schwersten Bedingungen mit heftigem Schneefall, grausamer Kälte und böigen Polarwinden in 11 Stunden 48 Minuten. Im Jahr darauf brauchte er bei noch schlechterem Wetter eine Stunde länger. Der Radiosprecher orakelt, dass in diesem Jahr aufgrund der perfekten Wetterbedingungen eine Rekordzeit unter den Profiläufern um neun Stunden möglich sein könnte und dass ganz Schweden darauf hofft, diesen verdammten Norweger endlich zu schlagen. Beiläufig erwähnt er, dass der beste Schwede namens Johan Loevgren im vergangenen Jahr nur Platz sechs erreicht hat.
Anhand dieser Information beschleicht mich Skepsis, ob wir den Norweger dieses Jahr besiegen können. Aber der Polarkreis hält immer eine Überraschung bereit und das Nordenskiöldsloppet ebenfalls.
3
In Purkijaur angekommen, habe ich Probleme, einen Parkplatz zu finden. Nach einigen erfolglosen Versuchen stelle ich mein Auto entnervt in einem Halteverbot am Straßenrand ab und lege mein Schild mit der Aufschrift POLIS unübersehbar auf das Armaturenbrett. Ich habe es eilig. Wenn ich den Start nicht verpassen will, muss ich mich sputen. Und wer wollte schon etwas dagegen tun, schließlich bin ich die einzige Polizistin hier weit und breit.
Bis vor Kurzem waren wir noch zu zweit gewesen, aber seit mein Kollege Arne nach einem Herzinfarkt in den vorzeitigen Ruhestand gegangen ist, bin ich der letzte uniformierte Mohikaner in einem Radius von über hundert Kilometern. Dass ich die kleine Polizeistation in Jokkmokk weiter leiten darf, stand lange auf der Kippe. Polizeichefin Ylva Wallin hatte nach vielen Budgetdiskussionen geplant, diesen Außenposten zu schließen und alle Zuständigkeiten in das Polizeipräsidium ins über zweihundert Kilometer entfernte Lulea zu verlagern, mit dem Argument, dass eine Polizeistation in Jokkmokk nach Abwägung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses aus Gründen der Kostenersparnis nicht zwingend notwendig wäre. Dieser bürokratische Wahnsinn hätte mein berufliches Ende bedeutet.
Aber ein Mord, der unlängst verübt wurde, hat glücklicherweise zu einem Umdenken geführt, Ylva hat mir ein weiteres Jahr geschenkt. Danach will sie neu über meinen Posten entscheiden. Der Preis für ihre Gnadenfrist ist jedoch, dass ich keinen Ersatz für Arne bekommen habe. Ich hatte auf Sigge, einen jungen Kollegen aus Lulea, als Nachfolger gehofft, aber diesen Wunsch hat sie mir abgeschlagen.
Mein Verhältnis zu meiner obersten Chefin war von Beginn an nicht einfach gewesen. Ich weiß, dass sie mich für überqualifiziert und überflüssig zugleich in dieser abgelegenen Region hält. Seit sie als erste Frau die Position des Polizeipräsidenten in Lulea eingenommen hat, zeigt sie sich von einer verbissenen Seite und wittert überall Feinde. Vielleicht wird man so, wenn man sich gegen hauptsächlich männliche Konkurrenz oder kollegiale Missgunst behaupten muss. Beim Amtsantritt ist ihr viel Feindseligkeit entgegenschlagen, aber sie hat sich schnell einen Ruf als knallharte, durchsetzungsfähige Polizeichefin erarbeitet. Mir ist das alles egal, solange Ylva mir nicht das Leben schwer macht. Ich will meine Arbeit so gut wie möglich verrichten, mehr nicht. Dabei kann ich auf bürokratische Hürden oder dumme Anweisungen aus Lulea gänzlich verzichten.
Als ehemalige führende Ermittlerin in der Stockholmer Mordkommission bin ich in Jokkmokk natürlich eine Fehlbesetzung. Hier sind Delikte wie Trunkenheit, Drogen, Einbrüche, Diebstahl, Wilderei, Körperverletzung die Regel. Morde gehören eigentlich nicht dazu, besser gesagt, gehörten. Ich muss an meinen zurückliegenden Fall denken, der sich als Serienmord entpuppt hatte. Die zuvor verschwundenen Opfer waren alle als vermisste Personen behandelt worden, nach dem Motto, wer sich im Polarkreis verläuft, ist selber schuld. Entweder tauchen sie wieder auf, oder die Wildnis ist zu ihrem Grab geworden. Schwerverbrechen werden in Mittelschweden und den Vororten von Stockholm verübt, aber nicht in dieser abgelegenen Region in Lappland. So dachte man zumindest, und so konnte ein Serienmörder hier jahrelang morden, ohne dass es irgendwem aufgefallen wäre. Da hatte es erst meine kriminalistische Erfahrung und Hartnäckigkeit gebraucht, um die Spuren richtig zu deuten.
»Anelie!«, höre ich jemanden meinen Namen rufen.
Es ist Arne, und er winkt mir ungeduldig zu. Mein pensionierter Kollege ist groß genug, um aus der Menschenmenge herauszuragen. Ich schiebe mich durch die eng beieinanderstehenden Schaulustigen bis zu ihm durch.
»Hej, Arne«, begrüße ich ihn. »Wie geht’s?«
»Bestens! Aber wo ist Daniel?« Er schaut sich suchend nach ihm um.
»Schon in Randia am Verpflegungsposten.«
»Ach ja, klar«, murmelt er, packt meinen Arm und zieht mich mit sich. »Lass uns näher an den Start gehen, damit wir nichts verpassen. Du bist spät dran, es geht gleich los.«
Während ich mich von ihm durch die Menge ziehen lasse, sehe ich mich prüfend um. Abgesehen von den Touristen, Sportlern, Begleitern und Schaulustigen, die sich seit Tagen hier tummeln, ist die Lage ruhig. Ich entdecke nichts, was mich als Polizistin beunruhigen sollte. Die Stimmung unter den Menschen ist fröhlich und entspannt. Die Sonne ist am Horizont schon zu erkennen. Der noch dunkle Himmel ist wolkenlos, und es verspricht ein herrlicher Tag zu werden. Endlich sind die Tage wieder länger und heller. Sonnenaufgang ist um 06:00 Uhr, Sonnenuntergang um 19:30 Uhr.
»Da ist Leif«, sagt Arne überrascht und deutet auf unseren Staatsanwalt aus Lulea. »Läuft der auch mit?«
Ich entdecke Leif Björk, der in Sportklamotten steckt und gerade damit beschäftigt ist, seine Startnummer am Trikot zu befestigen. Ich lasse Arne kurz stehen und laufe zu ihm hinüber. »Hej, Leif.«
Er sieht zu mir und lächelt. »Hej, Anelie, bist du dienstlich oder privat hier?«
Ich zucke mit den Schultern. »Etwas von beidem. Und du?« Dumme Frage. Ich weiß ja, dass der Staatsanwalt eine Sportskanone ist und ständig an irgendwelchen Wettkämpfen teilnimmt.
»Ich werde heute diesen Kerl hier schlagen.« Leif grinst und sieht zur Seite. »Darf ich dir den neuen Chef der Rechtsmedizin Lulea, Dr. Filip Gustafsson, vorstellen.«
»Hej, Filip.« Ich duze ihn wie in Schweden üblich. »Ich bin Anelie Andersson, Polizei Jokkmokk.«
Ich gebe ihm diese Information, da wir noch nicht persönlich miteinander zu tun hatten.
»Hej, Anelie«, sagt er vergnügt und beugt sich leicht zu mir. »Leif weiß noch nicht, dass er null Chance gegen mich hat. Lassen wir ihn also in diesem Glauben. Aber er wird das Rennen und unsere Wette haushoch verlieren.«
Leif wirft Filip einen vielsagenden Blick zu. »Träum weiter.«
»Um was habt ihr denn gewettet?«, will ich wissen.
»Der Verlierer, und das wird Leif sein«, antwortet mir Filip vergnügt, »muss den Gewinner, also mich, in das beste Gourmetrestaurant von Stockholm, ins Tak, zum Essen einladen. Flug und Hotel inklusive.«
Leif prustet los. Die beiden erinnern mich an kleine Jungs. Das wird ein teures Vergnügen, ahne ich. Ich habe während meiner Zeit in Stockholm nie im Tak gegessen, da es schier unmöglich gewesen ist, dort einen Tisch zu bekommen, und außerdem hat dieses Sternerestaurant exorbitante Preise. Doch für die beiden scheint das kein Hindernis zu sein.
Am Startpunkt kommt plötzlich Hektik auf.
»Ich denke, ihr solltet euch besser auf eure Positionen begeben«, sage ich zu ihnen. »Es geht gleich los. Viel Glück!«
Damit lasse ich die beiden stehen und kehre zu Arne zurück. Und schon ertönt auch eine Stimme aus einem der Lautsprecher und kündigt den Start an. Die kleine Gruppe der Profiläufer steht an vorderster Stelle, sie werden vor der erheblich größeren Schar von Amateuren starten. Auch die letzten Läufer begeben sich nun hektisch auf ihre Startpositionen. Dann beginnt die Lautsprecherstimme herunterzuzählen, und endlos lange Sekunden später zerreißt der Startschuss die angespannte Stille.
Die Profiläufer explodieren förmlich und stürzen sich in die Loipen. Schnell zieht sich das Starterfeld auseinander. Die Läufer fliegen in weiten Bogen über den gefrorenen See und verschwinden im Wald, gefolgt von den anderen Teilnehmern, die sich wie hungrige Wölfe an die Fersen der davonstürmenden Eisläufer heften.
»Siehst du den mit der Startnummer 234?«, sagt Arne und deutet auf einen Mann, der an uns vorbeischießt, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. »Das ist Stig Eriksson. Er stammt von hier und will unbedingt den Preis für den besten Amateur gewinnen.«
»Ist das ein wichtiger Preis?«
»Wer’s braucht«, meint Arne und grinst schief. »Kriegst halt einen Pokal. Das war’s.«
»Aha. Und hat er Chancen?«
Arne nickt. »Er hat sich das ganze Jahr akribisch darauf vorbereitet und soll laut eigener Aussage in Topform sein.«
»Kennst du ihn näher?«, will ich wissen.
»Mehr oder weniger. Na ja, eher weniger. Stig ist ein Einzelgänger. Seit dem Tod seines Vaters und seiner Mutter wohnt er quasi allein auf diesem mondänen Anwesen in der Nähe von Vaikijaur.«
Jetzt klingelt es bei mir. »Ist das dieser reiche Typ, der an der Börse Millionen verdient haben soll?« Ich habe ihn einige Male flüchtig in Jokkmokk gesehen, aber wir haben nie ein Wort miteinander gewechselt.
»Genau, das ist Stig. Er stammt nicht nur aus einer reichen Familie, er hat auch aus dem vorhandenen Vermögen noch mehr gemacht. Ich vermute, dass er aus purer Langeweile an dem Rennen teilnimmt, weil er ja sonst nichts zu tun hat, als seine Millionen zu horten.«
»Aber mit Geld allein gewinnt man doch noch kein Rennen, oder?«, entgegne ich.
»Vielleicht ja doch«, beharrt Arne. »Stig hat sich extra zwei Profitrainer engagiert, die das ganze Jahr mit ihm gearbeitet haben. Außerdem soll er ein Höhentraining absolviert haben. Vermutlich hat er auch Spezialski mit eingebautem Turboantrieb«, lästert mein ehemaliger Kollege. »Mit Geld kannst du deine Chancen wohl doch erheblich verbessern.«
Ich verkneife mir einen Kommentar. »Lass uns ins Akerlund fahren und frühstücken, mir knurrt der Magen. Sei mein Gast.«
Das lässt sich Arne nicht zweimal sagen. Ich spüre, dass er sich über meine Gesellschaft freut. Vermutlich langweilt ihn das Rentnerleben schon, auch wenn er es nie sagt. Auf der anderen Seite kennt Arne Gott und die Welt und hat sicher keinen Mangel an Bekannten und Freunden, mit denen er sich verabreden kann. Aber ich mag mir gar nicht vorstellen, was es bedeutet, nicht mehr arbeiten zu gehen.
Hätte Ylva die Polizeistation in Jokkmokk zugemacht, hätte mich das gleiche Schicksal ereilt, mit dem einzigen Unterschied, dass ich erheblich jünger als Arne und noch lange nicht im Rentenalter bin. Ich liebe meine Arbeit, auch wenn sie längst nicht mehr so aufregend und abwechslungsreich ist wie zu meiner Zeit als Ermittlerin in der Stockholmer Mordkommission. In meinem letzten Jahr dort hatte ich eine Einheit geleitet, die sich mit Serienmorden und anderen Gewaltverbrechen sexueller Natur befasste. Der Sumpf, in den ich dabei gezogen worden war, war entsetzlich gewesen, und ich trauere dieser Zeit nicht hinterher. Es genügt mir völlig, eine kleine, unbedeutende Polizeistation zu leiten, denn was mir das Leben hier oben im schwedischen Polarkreis ansonsten zu bieten hat, ist mehr, als ich mir wünschen kann. Aber ohne meinen Beruf möchte ich auch nicht sein.
»Kann ich bei dir mitfahren?«, fragt Arne und reißt mich aus meinen Gedanken.
»Logisch.«
Als wir zwanzig Minuten später im Akerlund in Jokkmokk eintreffen, erwartet uns ein prall gefülltes Hotelrestaurant. Nicht nur uns hat der Hunger auf ein gutes Frühstück hierhergetrieben. Neben den Hotelgästen haben sich auch viele Journalisten einquartiert und belagern fast alle Tische mit aufgeklappten Laptops und ihrem Equipment. Mich beschleicht die leise Befürchtung, hier keinen Platz mehr zu finden.
Katrin, die Hotelbesitzerin, hat uns entdeckt und kommt auf uns zu. »Hej, hej. Sucht ihr nach einem freien Plätzchen?«, fragt sie und lächelt uns vergnügt an. Als Geschäftsfrau ist dieser Trubel genau nach ihrem Geschmack.
Arne und ich nicken einträchtig.
»Dann kommt mal mit.«
Katrin führt uns ein paar Stufen nach unten in den kreisrunden Konferenzraum, der in seiner Bauweise einem traditionellen Samizelt nachempfunden ist. Dieser Raum ist normalerweise nur für spezielle Events geöffnet, aber aufgrund des Ansturms hat Katrin ihn mit weiteren Tischen bestückt. Und hier gibt es noch Platz für uns. Wir hängen unsere Jacken über die Stuhllehnen und legen unsere Mützen und Handschuhe auf den Tisch. Dann kehren wir ins Restaurant zurück, und ich gehe direkt zur Bar, wo auch die Kasse steht. Ich bezahle wie hier oft üblich im Voraus. Dann begeben Arne und ich uns ans Buffet und stellen uns in die lange Reihe.
»Was für ein Auflauf«, murmelt Arne, »hat mehr was von einem Wespennest.«
Ich kann nicht heraushören, ob ihm der Trubel zusagt oder missfällt. Ich selbst fühle mich hin und her gerissen. Einerseits genieße ich die Abwechslung in dem sonst so beschaulichen Dreitausend-Seelen-Örtchen, zumal der ganze Zauber übermorgen wieder vorbei sein und die gewohnte Ruhe einkehren wird. Anderseits ist mir diese Hektik fremd geworden. Ich habe mich längst an das ruhige Leben im Polarkreis gewöhnt.
Als wir endlich am Buffet an der Reihe sind, laden wir unsere Tabletts randvoll, denn ein zweites Mal wollen wir uns hier nicht mehr anstellen müssen. Vorsichtig balancieren wir unsere Frühstücksberge durch die Menge zurück an unseren Tisch.
»Nächste Woche geht klar?«, frage ich Arne, der genüsslich Rührei mit Lachsstreifen verzehrt.
»Logisch.« Er grinst übers ganze Gesicht.
Es ist nicht zu übersehen, wie er sich auf die anstehende Woche freut. Sein Alter zu akzeptieren ist eine Sache, den Ruhestand hinzunehmen eine ganz andere, auch wenn es kein Entrinnen gibt, hat Arne mir am Tag seiner Pensionierung erklärt.
Ich habe Urlaub angemeldet. Daniel und ich wollen endlich über die Berge ins norwegische Narvik fahren und von dort weiter auf die Lofoten. In dieser Zeit wird Arne mich vertreten und in Jokkmokk die Stellung in der Polizeistation halten. Nach dem Nordenskiöldsloppet sollte es hier wieder ruhig sein.
»Du bist Anelie Andersson, oder?«
Eine Frau ist an unseren Tisch gekommen und schaut mich fragend an.
Ich blicke kurz auf. »Ja.«
»Tut mir leid, euch hier stören zu müssen, aber ich muss eine Anzeige erstatten.«
»Aha«, sage ich und wende mich der Besucherin zu.
Arne hat bereits eine weitere Ladung Rührei mit viel Lachs auf der Gabel arrangiert und will das kunstvolle Gebilde gerade erwartungsvoll in seinen Mund schieben, als seine Hand auf halbem Weg erstarrt. Die Enttäuschung über diese abrupte Störung steht ihm ins Gesicht geschrieben, und so wandert seine Gabel wieder zurück auf den Teller. Mir geht es nicht anders. Ich lege mein dick mit Lachs belegtes Brötchen, in das ich gerade herzhaft hineinbeißen wollte, zurück auf den Teller und sehe auf. Die junge Frau, die an unseren Tisch gekommen ist, hat hellgraue Augen und ein offenes Gesicht. An ihrer Gakti, ihrer klassischen, farbenfrohen Tracht, kann ich erkennen, dass sie eine Sami ist. Sie trägt eine Luhka, den Poncho in dem typischen Blau, eine Naiselakki, die Mütze mit Ohrenklappen, und Natukkaat, handgemachte Schuhe aus Rentierpelz.
»Um was geht’s?«, frage ich.
»Ich bin Ana Maenpaa. Jemand hat eines meiner Rentiere brutal abgeschlachtet.« Sie gibt mir ihr Smartphone, auf dem ich mir die Fotos ansehen soll.
Das tote Rentier ist furchtbar zugerichtet. Ich sehe eine Schusswunde weit unterhalb des Halses. Trotz der Hitze, die hier im Restaurant herrscht, durchfährt mich ein eiskalter Schauder. Ein drückendes Schweigen senkt sich über den Raum wie eine Decke, die alles erstickt.
»Diese Verletzung war nicht tödlich«, sagt sie mit leiser Stimme. »Wie die Spuren im Schnee verraten, hat das Tier viele Stunden am Boden gestrampelt, bis es verendet ist. Und es ist leider nicht das einzige. Es gibt viele davon. Auch Hassmails und Morddrohungen, ich habe alles gesammelt.«
Die Zeit dehnt sich in die Länge, während ich mir die anderen Fotos ansehe. Ich sehe grausame Misshandlungen, blutige Felle, verendete Tiere, ein furchtbarer Anblick. Ich verstehe sofort, worum es hier geht. Vor Kurzem hat der Oberste Gerichtshof in Stockholm der Klage einer ersten Samigemeinde stattgegeben und ihr das Recht verliehen, darüber zu bestimmen, wer von nun an in deren Gebiet jagen und fischen darf. Nach diesem Urteil sollen nicht mehr die staatlichen Kommunen wie bisher die Jagdlizenzen für die Kleinwildjagd und die Fischerei vergeben, sondern nur noch die jeweiligen Samigemeinden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die anderen Sameby ebenfalls dieses Recht einklagen werden. Nicht-Sami fürchten nun um ihre Jagd- und Fischereigründe.
Ich hatte gehofft, dass es bei verbalen Attacken und Unmutsbekundungen bleiben würde. Aber die Fotos der toten Tiere zeigen, dass dieser Unfrieden zwischen den Ureinwohnern Lapplands und den Nicht-Sami erneut begonnen hat. Diese Bilder mit den grausam zugerichteten Rentieren machen mich traurig. Rentiere sind nicht gerade clever, aber es sind schöne, drollige Tiere, und sie können rein gar nichts für irgendwelche lebensfremden Gerichtsurteile.
»Dazu müssen wir rüber in die Polizeistation gehen«, sage ich. »Kommst du mit, Arne?«
Das ist weniger eine Frage, denn da ich nächste Woche im Urlaub sein werde, muss Arne als mein Vertreter sich vorerst um diese Angelegenheit kümmern. Wir lassen unser Frühstück stehen und brechen auf. Diesen Tag habe ich mir anders vorgestellt. Und er fängt gerade erst an.
4
Unsere kleine Polizeistation, die sich, zentral gelegen am ersten Kreisverkehr, am Europaweg 45 in Jokkmokk befindet, ist typisch schwedisch auf das Nötigste reduziert. Es gibt einen Flur, der in einem kleinen Badezimmer endet. In diesem Flur stehen diverse Schränke für die Ablage und eine Kommode mit einer Kaffeemaschine. Rechts im Flur gehen zwei Türen ab, die in die beiden Büros führen, in der Zwischenwand gibt es ein Fenster mit einer Jalousie. Jedes Büro hat ein Fenster zur Straße, einen Schreibtisch, zwei Aktenschränke, einen Drucker, eine große magnetische Pinnwand. In meinem Büro steht zusätzlich noch ein kleiner Besprechungstisch, im anderen Büro gibt es eine Schlafcouch. Links vom Flur führen ebenfalls zwei Türen ab zu zwei kleinen Zellen.
Ich setze mich an meinen Schreibtisch und nehme Anas Anzeige auf. Die hübsche, junge Sami-Frau sitzt mir gegenüber und legt nacheinander Computerausdrucke mit Hassmails auf meinen Schreibtisch, die nicht schrecklicher sein könnten. Arne sitzt auf der Schreibtischkante und liest die E-Mails vor. Nach ungefähr einer Stunde haben wir alles zu Protokoll genommen, die Bilder ausgedruckt, mit Datum versehen und alle wichtigen Anmerkungen dazu angefügt.
»Da müssen unsere Computerspezialisten in Lulea ran«, sage ich, als ich alle Fakten notiert habe. »Kannst du uns dazu bitte deinen Laptop oder Rechner bringen?«
Anhand der IP-Adresse sollte es keine große Kunst sein, die Absender der E-Mails ausfindig zu machen. Aber diejenigen zu finden, die diese Rentiere getötet haben, ist komplizierter.
»Und ich brauche die Projektile aus den Tierkörpern. Habt ihr alle toten Tiere eingesammelt?«
Meine Ermittlungen in diesem Fall sind die gleichen wie bei einer Mordserie. Auch wenn es sich nur um Tiere handelt, macht das für mich keinen Unterschied.
»Wir konnten sie so nicht liegen lassen«, sagt Ana.
»Verstehe, aber könntest du mir auf einer Karte einzeichnen, wo ihr die Tiere gefunden habt? Vielleicht gibt es ein Muster, vielleicht können wir so das Gebiet eingrenzen, in dem der oder die Täter agieren, und kommen so auf ihre Spur.«
Ana nickt stumm.
»Ich werde die Kollegen von der Spurensicherung in Lulea bitten, hierherzukommen und sich alles anzusehen.«
Ich verschweige meine Befürchtung, dass meine Vorgesetzte in Lulea mir dabei nicht zur Seite, sondern vermutlich aus Kostengründen im Weg stehen wird. Sie wird wohl nicht die Kavallerie schicken, wenn es sich bei den Mordopfern um Rentiere handelt. Trotzdem will ich es nicht unversucht lassen. Ich muss mir eine gute Argumentation überlegen, um Ylva vom Gegenteil zu überzeugen. Es geht um den Frieden hier oben, es steht viel auf dem Spiel.
»Bitte, findet diejenigen, die das getan haben«, sagt Ana und steht auf.
»Wir werden alles tun, um das hier aufzuklären und zu beenden«, verspreche ich.
Sie lächelt mich mit traurigen Augen an.
Als Ana verschwunden ist, bleiben wir tief betroffen vor dem ausgedruckten Material zurück.
»So eine verdammte Scheiße«, flucht Arne aufgebracht und schlägt mit der Hand so stark auf die Tischplatte, dass meine Tasse klirrt. »Was denken sich diese Idioten in Stockholm dabei, ein so weltfremdes Urteil zu fällen. Hocken in ihrer blöden Großstadt, in ihren warmen Büros, glotzen den ganzen Tag in ihre doofen Computer, weit weg von alldem hier oben und machen uns das Leben mit ihren dummen Entscheidungen zur Hölle. Das wird uns noch viel Ärger bereiten.« Arne redet sich in Rage.
»Nicht, wenn wir das stoppen«, unterbreche ich ihn.
»Die bisherige Regelung hat gut funktioniert, jetzt werden einige Hardliner-Sami versuchen, uns zu diktieren, wo und wann wir was jagen dürfen, und uns dafür auch erheblich mehr für die Lizenzen abknöpfen. Das wird noch für viel Unruhe sorgen.«
»Vielleicht wird es ja nicht so schlimm, wir …«, versuche ich, ihn zu beschwichtigen.
»Davon hast du noch keine Ahnung, du stammst nicht von hier«, fällt er mir erbost ins Wort. Dann besinnt er sich und reißt sich am Riemen. »Wir brauchen jetzt eine gute Strategie, um das aufzuklären. Wo fangen wir an? Der oder die Täter könnten überall zuschlagen.«
»Wir sollten eine Versammlung mit allen Züchtern der Region einberufen. Vielleicht können wir sie davon überzeugen, ihre Tiere in Gruppen zu sammeln«, schlage ich vor. »Wir könnten dann diese Bereiche mit versteckten Wildkameras überwachen und so den oder die Täter auf frischer Tat ertappen. Die toten Tiere zeugen von viel blindem Hass. Ich glaube nicht, dass dieser Hass schon getilgt ist. Ich bin sicher, es ist noch nicht zu Ende.«
Arne zeigt mit dem Daumen nach oben. »Ich werde mich sofort nach dem Rennen darum kümmern. Aber wenn du glaubst, dass Ylva uns bei den Ermittlungen helfen wird, bist du gewaltig auf dem Holzweg.«
Ich weiß. »Ich muss sie überzeugen, es geht um das friedliche Zusammenleben hier bei uns.«
»Viel Erfolg.« Sein sarkastischer Unterton ist unüberhörbar.
»Wünsch ich dir auch, denn du musst dich nächste Woche um diese Ermittlungen kümmern«, sage ich, »ich bin im Urlaub. Schon vergessen?«
»Na, super«, schnaubt er.
Ich kann sehen, wie es in seinem Kopf rattert.
»Aber ich werde am Montagmorgen noch mit Ylva reden«, verspreche ich ihm. »So, und jetzt fahre ich nach Randia zu Daniel. Kommst du mit?«
Arne schüttelt den Kopf. »Ich bin anderweitig verabredet. Hejdo.« Damit lässt er mich sitzen und verschwindet.
Während ich zu Daniel fahre, muss ich an dieses umstrittene Urteil denken. Das Stockholmer Oberste Gericht hat in seiner Entscheidung zur Begründung auf die historisch angestammten Rechte der Sami auf diesem Territorium verwiesen. Seit Jahrtausenden treiben die Sami ihre Rentiere durch ganz Lappland, das von Nordskandinavien bis nach Russland reicht. Die heutige Samibevölkerung wird auf ungefähr 80 000 geschätzt. Davon lebt etwa die Hälfte in Norwegen, die andere Hälfte verteilt sich auf Schweden, Finnland und Russland. Im 16. Jahrhundert wurde Schwedisch-Lappland kolonialisiert, was zu vielen Konflikten zwischen den als Nomaden lebenden Sami und den zugezogenen Schweden führte, die ein bäuerliches Leben pflegten. Grund und Boden wurden aufgeteilt, und das von Freiheit geprägte Leben der Sami änderte sich drastisch. Anfang des 20. Jahrhunderts schrieb die schwedische Regierung ein besonders dunkles Kapitel, als sie die Sami zum minderwertigen Volk erklärte. Ähnlich wie bei den australischen Aborigines kam es zu Zwangsumsiedlungen, Kinder wurden ihren Eltern weggenommen und in schwedischen Schulen gezwungen, ihre Kultur zu vergessen. Es war verboten, samisch zu sprechen oder die traditionelle Tracht zu tragen. Zu dieser Zeit wurde es von vielen Teilen der schwedischen Bewohner als Schande angesehen, Sami zu sein.
Das ist glücklicherweise vorbei. Heute genießen die Sami viele Sonderrechte aufgrund ihrer Historie, aber diese nun umgedrehte Ungleichbehandlung führt immer wieder zu Problemen und Streit zwischen Sami und Schweden. Es war und ist ein Balanceakt zwischen den verschiedenen Ansprüchen und Forderungen, die im fernen Stockholm oft nicht verstanden werden. Ein solches Urteil trägt nicht zum Frieden bei. Ich finde dieses Urteil auch nicht in Ordnung, aber ich werde nicht dabei zusehen, wie irgendwelche Mistkerle hier Tiere quälen, abschlachten und zur Schau stellen. Wir müssen diesem schrecklichen Treiben rasch ein Ende setzen, mit oder ohne Ylvas Hilfe.
Nach einer Stunde Autofahrt habe ich den Verpflegungspunkt fast erreicht und parke meinen Wagen. Die letzten Meter muss ich zu Fuß gehen. Am Versorgungsposten herrscht ein reges Kommen und Gehen. Ich entdecke Daniel, der damit beschäftigt ist, die Langläufer mit heißer Suppe zu versorgen. Ich sehe verschwitzte Sportler mit blauen Lippen, denen die Erschöpfung ins Gesicht gemeißelt ist, während bei anderen nicht der Hauch von Müdigkeit vorhanden zu sein scheint. Für manche wird dieser Ultralauf zu einem Horrortrip werden, für andere zu einem unvergesslichen Erlebnis mit euphorischen Ergebnis. Nicht alle Läufer legen hier eine Rast ein, um sich zu stärken. Manche laufen einfach weiter, und das Tempo, mit dem sie durch die Loipen fliegen, macht mich sprachlos. Sie sind verdammt schnell unterwegs.
Ich geselle mich zu Daniel, der mich an sich drückt und mit einem leidenschaftlichen Kuss begrüßt. Ich spüre seine fröhlich aufgekratzte Stimmung.
»Und wie läuft’s hier?«, will ich wissen.
»Bestens. Das ist ein super Rennen und brutal schnell heute.«
»Wer führt?«
Daniel rollt vielsagend mit seinen Augen.
Ich verstehe, der Norweger. »Und was ist mit unseren Leuten?«
Er wackelt leicht mit dem Kopf. »Noch ist nichts entschieden.«
Dann entdecken wir Stig mit der Startnummer 234, der, ohne sein Tempo zu reduzieren, sich unserem Posten nähert. Er wird offensichtlich von zwei Verfolgern begleitet. Die Anfeuerungsrufe schwellen an, und die Lautstärke erreicht ein ohrenbetäubendes Maß. Auch das Tempo dieser Dreiergruppe ist unglaublich schnell für Amateure. Sie liefern sich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen und schrecken auch vor kleineren Bodychecks nicht zurück. Abwechselnd hat immer ein anderer die Nase vorn. Ihre Energie scheint unerschöpflich.
»Mannomann, die geben vielleicht Gas. Da wird mir ja nur vom Zuschauen schlecht«, erkläre ich staunend.
»Ein Mördertempo haben die drauf«, ruft Daniel lachend. »Wenn die sich nicht blau laufen, wird das eine Hammerzeit.«
Unmittelbar vor dem Ausgang unserer Servicestelle bremst Stig plötzlich ab. Ein Mann und eine Frau scheinen ihn bereits erwartet zu haben. Stig wechselt blitzschnell die Ski, und ich beobachte, wie die Frau ihm anerkennend auf die Schulter klopft, während der Mann vor Stig am Boden kniet und an dessen Skibindung hantiert.
»Wer sind die beiden?«, frage ich Daniel.
»Sie ist eine ehemalige Biathletin und Rekordhalterin namens Sofia Lundqvist. Er heißt Matti Fransson, ein ehemaliger Champion unter den Langläufern. Aber jetzt ist er ein renommierter Fitnesscoach für Profis. Stig hat sich das echt was kosten lassen, dass die beiden das ganze Jahr mit ihm trainiert haben. Dazu gehört auch, dass sie ihn jetzt während des ganzen Rennens in festgelegten Zeitintervallen an bestimmten Punkten mit allem versorgen, was er benötigt, wie zum Beispiel neu gewachsten Skiern zum Wechseln. Das läuft genauso ab wie bei den Profis.«
»Arne hat mir erzählt, dass Stig große Ambitionen hat.«
Daniel nickt. »Ja, er könnte dieses Jahr wirklich der beste Amateur werden.«
»Hej, Anelie.«
Ich drehe mich um und entdecke Liv, Daniels Schwester, und Sigge, meinen Kollegen aus Lulea, beide mit großen Kartons bewaffnet, die sie zum Versorgungsposten bringen. Verdutzt sehe ich den beiden nach. Mit Sigge hätte ich hier am allerwenigsten gerechnet.
5
Plötzlich ist da nur noch Schmerz. Überall. Grenzenlos. Gewaltig. Es gibt keine einzige Stelle mehr in seinem Körper, die ihn nicht peinigt. Jede Zelle schreit vor Qual angesichts der Anstrengung. Seine Muskeln und seine Lungen brennen wie Feuer. Während seiner Vorbereitungszeit hat er diese Schmerzen kennen und respektieren gelernt. Das ist der Preis, den er dafür bezahlen muss, seinen Körper diesen Strapazen auszusetzen. Sein Körper will das nicht, sein Ego schon.
Aber heute ist dieser Schmerz anders. Kein Wunder, bislang hat er noch nie eine so lange Strecke in diesem Tempo an einem Stück absolviert. Es ist seine Premiere. Davor hat er nur geübt, diesen Schmerz zu kontrollieren, damit er nicht die Überhand gewinnt und ihn besiegt. Heute überschreitet er eine neue, ihm bisher unbekannte Grenze.
So hat sich sein Körper noch nie aufgebäumt. Er beißt die Zähne zusammen und kämpft sich weiter. Ohne auch nur ein klein wenig nachzugeben, gleitet er durch die Loipe, rammt dabei seine Stöcke in den harten Schnee, wirbelt ihn auf und hinterlässt kleine Fontänen hinter sich.
Tannen und Fichten säumen wie Schaulustige seinen Weg. Während er auf Langlaufskiern den Polarkreis bezwingen will, überquert er wellige Kuppen, sanfte Täler, dichte Waldstücke und weite Ebenen. Die Eiszeit hat diese Landschaft einst mit ihren Gletschern geformt und ihr diesen archaischen Charme verliehen, wie es keine Menschhand je fertigbringen würde. Unter anderen Umständen hätte er diese Schönheit zu schätzen gewusst, eine Pause eingelegt und die Winterlandschaft verträumt betrachtet. Doch jetzt hat er keinen Blick für die Wunder der arktischen Natur. Er sieht nur die Parallelspuren der Loipe vor sich, die Kurven, die Anstiege, die Abfahrten und die Rentierspuren entlang der Loipen. Sonst nichts.
Seit dem Start in Purkijaur kämpft er sich Meter um Meter voran. Sein ganzes Sein dreht sich um ein einziges Ziel, er will bei diesem Rennen gewinnen. Dazu muss er diese 220 Kilometer auf seinen Langlaufskiern überstehen, egal, wie sehr sein Körper sich aufbäumt. Gemeinsam mit seinen beiden Trainern hat er in den zurückliegenden Monaten die Strecke analysiert und in Etappen eingeteilt. 220 Kilometer im Polarkreis sind schlimmer als ein Ironman auf Hawaii. Er hat gelernt, wie er den Streckenverlauf managen muss, um durchzuhalten, wie er sein Tempo halten kann, ohne sich blau zu laufen.
Das größte Risiko ist, dass das Blut nicht mehr genug Sauerstoff zu den Muskeln transportieren kann. Dann übersäuern die Muskeln, die entstandene Milchsäure kann nicht mehr abgebaut werden, und die Leistungsfähigkeit bricht abrupt zusammen. Wenn das passiert, schafft man es nicht mehr ins Ziel, der Körper streikt, als hätte jemand einfach den Stecker gezogen. Er kennt und fürchtet dieses Phänomen, das bei aller mentalen Stärke einen Läufer gnadenlos vernichten kann.
Dagegen hat er sich so gut wie möglich gewappnet. Er weiß exakt, wann und wo er seinem Körper Pausen gönnen muss, um ausreichend Energie zur Verfügung zu haben. Seine ausgeklügelte Taktik wird ihn vor diesem jähen Ende bewahren und dabei helfen, diese mörderische Tortur zu überstehen. Mal katapultiert er sich mithilfe eines kraftvollen Doppelstockschubs nach vorn, um währenddessen seine Beine zu schonen. Dann folgt eine Etappe, in der er die Beine arbeiten lässt, sich Schritt für Schritt durch die Loipe schiebt und dabei seinem Oberkörper eine Pause gönnt.
Aber erst im Ziel wird er wissen, ob diese Strategie aufgegangen ist. Bis dahin gilt es, Kilometer um Kilometer zurückzulegen und nicht einen Moment nachzulassen.
Er absolviert einen langen Anstieg und genießt die steile Abfahrt, die dahinter folgt. Die Läufer der professionellen Spitzengruppe waren ihm schon auf ihrer Rückrunde entgegengekommen. Für sie wird das Rennen bald zu Ende sein, für ihn noch lange nicht. Er wird deutlich länger brauchen als der beste Profiläufer, aber er wird erheblich früher im Ziel ankommen als all die anderen Amateure.
Wie im Rausch kämpft er sich auf der Strecke weiter durch den Schnee. Inzwischen hat auch er den Wendepunkt hinter sich gelassen und befindet sich auf dem Rückweg wie die Profiläufer vor ihm. Der Rückweg wird circa zwanzig Kilometer länger sein, da Start- und Zielpunkt nicht identisch sind.
Bei Kilometer 110 geht es durch lichte Wälder und über welliges Terrain, gefolgt von einer Seepassage, bevor es erneut in den Wald geht. Er pusht sich den langen, steilen Anstieg in Richtung Kilometer 125 hinauf, als würde sich dahinter das Ziel befinden, hält, oben angekommen, weiter das Tempo und gleitet durch Wälder und Forste. Endlich erreicht er eine Servicestation, wo ihn seine beiden Trainer mit einem neuen Paar Ski versorgen und er sich gierig eine dampfende Suppe gönnt, gefolgt von Energieriegeln und Keksen. Frisch gestärkt, setzt er eine Minute später sein Rennen fort.
Seit Stunden kleben zwei andere Läufer an ihm. Er hasst diese Lutscher, die sich in seinem Windschatten mitziehen lassen, um Energie zu sparen. Irgendwann hat er genug und tauscht kurz die Rollen, nur um den lästigen Konkurrenten vorzugaukeln, er wäre müde geworden. Als er hinter dem einen Läufer herfährt, kann er zu seiner Zufriedenheit erkennen, dass dieser keine Chance haben wird. Also geht er wieder nach vorn und zieht das Tempo deutlich an. Nur einer der Läufer kann ihm noch folgen, also wiederholt er das Spiel und lässt diesen vor. Doch er spürt, dass dies sein Rennen sein wird. Niemand kann oder wird ihn heute aufhalten. Er ist sicher, sein verbliebener Kontrahent wird auch bald schlappmachen. Alles ist gut, ist sein letzter Gedanke. In vier Tagen hat er Geburtstag, den 40.
Wie von einem tödlichen Blitz getroffen, fällt er plötzlich nach vorn. Er spürt nichts, kein einziger Gedanke flutet sein Gehirn, als er seine letzten Atemzüge aushaucht. Er ist von den Antworten auf alle seine Fragen nur noch einen allerletzten Herzschlag entfernt. Er sieht nicht, wie sein Blut den Schnee tiefrot färbt. Sein geschundener Körper erschlafft. Sein Todeslauf ist zu Ende.
6
Ein paar verirrte Schneeflocken, die der auffrischende Wind von den Bäumen gepustet hat, taumeln verloren durch die Luft. Vor dieser traumhaften Naturkulisse fliegen die Läufer auf ihren Bahnen an mir vorüber. Es ist ein surreales Bild, wie die Körper in ihrem rhythmischen Auf und Ab vorbeigleiten. Ich höre das regelmäßige Schnalzen, wenn die Läufer ihre Stöcke gleichzeitig in den Schnee rammen, um dann den Schub aufzunehmen, sich abzustoßen und nach vorn zu katapultieren. Ihr Atem dampft aus Mund und Nase, sie schieben sich mit Schultern, Armen und Stöcken nach vorwärts. Ihre Ski gleiten durch die beiden schmalen Rinnen, begleitet von den Anfeuerungsrufen und dem Beifall der Schaulustigen, die die Strecke säumen.
Es ist ein mitreißendes Spektakel, und ich habe alle Hände voll zu tun, diejenigen Läufer zu versorgen, die ihren wilden Ritt kurz unterbrechen, um sich mit Tee, Suppe oder Energieriegeln zu stärken oder einfach nur Luft zu holen. Mitleid mit den Läufern, die sich noch auf dem Hinweg zum Wendepunkt befinden, wallt in mir auf. Viele von ihnen sehen fix und fertig aus, obwohl sie noch nicht einmal die Hälfte geschafft haben. Nicht alle werden trotz größtem Kampfgeist und unbändiger Leidenschaft das Ziel erreichen. Auch wenn ich nur am Versorgungsposten herumstehe und Essen und Getränke verteile, spüre ich inzwischen die Müdigkeit und Kälte in allen Gliedern. Wie muss es erst den Läufern gehen, die seit vielen Stunden unterwegs sind.
»Wie lange müssen wir noch hierbleiben?«, frage ich Daniel.
Er schaut kurz auf seine Uhr. »Müde? Eine Stunde noch, dann hauen wir ab. Okay?«
Er zieht mich an sich. Ich lege meinen Kopf an seine Brust und lausche seinem Herzschlag. »Es schlägt, ich kann’s hören.«
Er sieht mich mit seinen hellblauen Augen an. Ich genieße diesen Moment, der nur uns beiden gehört inmitten dieses Trubels.
»Heute Abend gehen wir in den Hot Tub«, flüstert er mir ins Ohr.
Mir wird ganz warm bei dem Gedanken daran, inmitten dieser großartigen Landschaft in der Dunkelheit im Freien in der riesigen Außenbadewanne zu sitzen und das heiße Wasser zu genießen. Wohlig seufze ich vor Vorfreude.
Das Klingeln meines Mobiltelefons beendet jäh diesen schönen Augenblick. Ich löse mich aus Daniels Umarmung und fische mein Telefon mit klammen Fingern aus der Jackentasche. Auf dem Display erkenne ich, dass es sich bei dem Störenfried um Arne handelt. Er redet ruhig, aber ohne Pause. Schweigend lausche ich seiner Stimme.
»Wo?«, frage ich.
Ich stecke das Mobiltelefon weg und drehe mich zu Daniel um. »Vier Kilometer hinter dem drittletzten Versorgungsposten bei Pelnibäcken gab es einen Zwischenfall. Ich muss weg. Ich nehme Sigge mit.«
»Ist was mit einem Läufer?«, fragt Daniel alarmiert.
Ich nicke. »Es gibt einen Toten.«
Auf der Fahrt zu dem Servicepunkt Purkijaur informiere ich Sigge über alles, was ich von Arne per Telefon erfahren habe. Ein Läufer soll bei einer Bergab-Passage in voller Fahrt unvermittelt zusammengebrochen sein. Einer der Läufer hat das Unglück am nächsten Servicepunkt gemeldet, an dem auch Arne zufällig gerade war.
»Wahrscheinlich hat sich der Läufer völlig überanstrengt«, mutmaßt Sigge. »Selbst Profis unterschätzen oft die Strapazen eines solchen Rennens.«
Auch ich habe die Vermutung, dass ein Sportler wegen Überanstrengung oder einer unerkannten Vorerkrankung verstorben sein könnte. Unwissenheit und Selbstüberschätzung sind ein häufiger Grund für Notfälle unter Teilnehmern bei derartigen extremen Sportveranstaltungen. Arne erwartet uns am Servicepunkt mit einer Karte der Rennstrecke, auf der die Unglücksstelle eingezeichnet ist. Er hat zwei Schneemobile für uns organisiert, um schnell an den Teil der Rennstrecke zu gelangen, wo der Tote sein soll. Außerdem hat er den Bestatter unterrichtet, damit der Verunfallte sofort geborgen wird. Denn das Rennen wird definitiv weitergehen.
Ende der Leseprobe