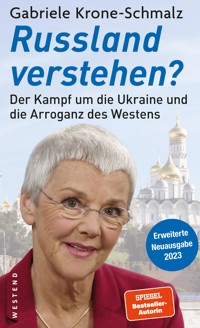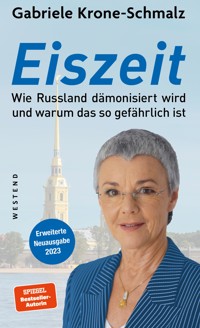
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Sprache: Deutsch
Welche Politik sollten wir unter den aktuellen Bedingungen gegenüber Russland verfolgen? Eigentlich müsste über diese Frage offen gestritten werden. Stattdessen werden diejenigen, die Friedensverhandlungen mit Russland fordern, als Putin-Versteher diffamiert und ausgegrenzt. Und das, obwohl es um die wichtigste Frage überhaupt geht: das friedliche Zusammenleben. Gabriele Krone-Schmalz legt eine erweiterte und aktualisierte Neuausgabe ihres Buches Eiszeit vor. Seit Kriegsbeginn 2022 stellt sich für viele nicht mehr die Frage, ob man, wie im Untertitel dieses Buchs, von einer Dämonisierung Russlands reden kann. Denn was kann verbrecherischer sein, als ein Land zu überfallen? Wird also Russland nicht dämonisiert, sondern ist tatsächlich der Dämon, als der es immer und immer wieder beschrieben worden war? Aber stimmt das so? Wer sich mit der jüngeren Geschichte auseinandersetzt, kommt nicht umhin, sich zu fragen, wer hier agiert und wer reagiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ebook Edition
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2023
ISBN: 978-3-98791-034-0
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2023
Umschlaggestaltung: Westend Verlag, Frankfurt am Main
Gabriele Krone-Schmalz
Eiszeit
Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist
Inhalt
Titel
Eiszeit 2023
Von Untertönen und Zerrbildern
Ausblick
Vorwort
Russlands Rückkehr
Verspieltes Vertrauen
Der Zusammenbruch unter Jelzin
Der neue Mann
Die Revolutions-GmbH
Die NATO-Perspektive für Georgien und die Ukraine
Der Kampf um Südossetien und Abchasien
Wer hat 2008 den Georgienkrieg begonnen?
»Heute sind wir alle Georgier«
Das Erbe des Imperiums
Die schöne neue Weltordnung
Der Showdown
Jenseits von Schwarz und Weiß
Der freie Wille eines Volkes
Moskaus rote Linie
Das Ringen um die Ukraine
Putsch in Kiew
Eine Regierung aus NATO-Befürwortern
Der Aufstand in Syrien
Syrien und der Westen
Öl ins Feuer
Was will »das« syrische Volk?
Gut und Böse
»Njet«
Wer blockiert Minsk II?
Wenn nur Russland dopt, warum gewinnen dann die anderen?
Die historische Verantwortung Deutschlands
Verdachtsberichterstattung
»Grizzly Steppe«
Wer bedroht wen?
Die weltweiten Militärausgaben im Vergleich
Truppenstärken und Militärstützpunkte
Aggressiv oder defensiv?
Die US-Raketenabwehr und das nukleare Gleichgewicht
»Wir hatten auf eine Partnerschaft gehofft, aber dazu kam es nicht«
Ein Neuanfang unter Obama?
Das Atomabkommen mit dem Iran
Eine klassische Rüstungsspirale
»Wandel durch Annäherung«
Tanz am Abgrund
Die Aktualität des Harmel-Berichts
Wer hat Angst vor wem?
Für eine neue Entspannungspolitik
Die »Strategie des Friedens«
Westliche Illusionen
»Die Welt hat aufgehört, sich an Russland den Hintern abzuwischen«
Selber denken
Dank
Anmerkungen
Russlands Rückkehr
Der Showdown
Gut und Böse
Wer bedroht wen?
»Wandel durch Annäherung«
Selber denken
Karten
Orienteriungspunkte
Titel
Inhaltsverzeichnis
Eiszeit 2023
Als ich am 24. Februar 2022 in den Nachrichten hörte, dass Russland die Ukraine überfallen hat, war ich überrascht und geschockt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Bis zum Schluss bin ich davon ausgegangen, dass der Aufbau dieser gigantischen militärischen Drohkulisse an Russlands Westgrenzen Ende 2021 und Anfang 2022 – so riskant und überzogen er auch gewesen sein mochte – einem einzigen Ziel diente, nämlich ernst zu nehmende Verhandlungen mit dem politischen Westen zu erzwingen.
Plötzlich wirkte der Begriff »Dämonisierung Russlands«, von der im Untertitel des Buches Eiszeit die Rede ist, deplatziert und zynisch. Denn was kann verbrecherischer sein, als ein Land zu überfallen? Russland wird also nicht dämonisiert, sondern ist tatsächlich der Dämon, als der es immer und immer wieder beschrieben worden war? Aber stimmt das so? Das vorliegende Buch ist 2017 erstmals erschienen und beschreibt Russlands Rückkehr auf die Weltbühne nach dem Zerfall der Sowjetunion. Brandherde wie Syrien spielen eine Rolle, die eingefrorenen Regionalkonflikte um Abchasien und Südossetien, natürlich die Chronologie des Georgienkrieges von 2008, über den nach wie vor sowohl in der Politik als auch in den Medien fälschlich behauptet wird, Russland habe ihn begonnen, und selbstverständlich das Ringen um die Ukraine. Die neue Weltordnung wird beschrieben, in der für Russland – als eine im internationalen Geschehen zu vernachlässigende ehemalige Weltmacht, die nach den Worten von US-Präsident Obama zur »Regionalmacht« abgestiegen war – kein Platz mehr zu sein schien. Demzufolge brauchte man auf Russland auch keine Rücksicht mehr zu nehmen und platzierte beispielsweise Raketenabwehrsysteme, die sich technisch relativ leicht in Angriffssysteme umbauen lassen, in Polen und Rumänien, also in unmittelbarer Nähe Russlands. Die NATO bewegte sich immer weiter auf Russlands Grenzen zu und hatte mit der für die Ukraine und Georgien in Aussicht gestellten Mitgliedschaften eine Schmerzgrenze für Russland überschritten. Der detaillierte Blick auf die sich gegenüberstehenden Militärpotenziale von NATO und Russland (siehe ab Seite 212) provoziert die Frage, wer hier wen bedroht, nicht zuletzt vor dem Hintergrund offen geäußerter Regime-Change-Fantasien westlicher Staaten. Kurz zusammengefasst: Nach dem Kalten Krieg und dem proklamierten Ende der Konfrontationspolitik in den späten Achtzigern des vorigen Jahrhunderts und dem beidseitig geäußerten Willen zur Zusammenarbeit wurden die Beziehungen zunehmend kälter und unversöhnlicher und führten zu einer Eiszeit auf nahezu allen Ebenen. Flankiert wurde diese Entwicklung von Verdachtsberichterstattung, sobald Russland involviert war. Ganz gleich, worum es sich handelte, die »Guten« und die »Bösen« standen von vornherein fest (siehe dazu ab Seite 170).
Die Chronologien zu den angesprochenen Themen finden Sie in diesem Buch, untermauert durch einen umfangreichen Anmerkungsapparat. Bei der Gelegenheit sei erwähnt, dass hier erstmals die Quellen der Enthüllungsplattform Wikileaks umfassend ausgewertet wurden, auf der große Mengen geheimer oder als vertraulich eingestufter Dokumente anonym veröffentlich worden sind. Die Auswertung dieser Quellen war vor allem beim Raketenabwehrsystem in Polen und Rumänien hilfreich, besonders mit Blick auf Absichtserklärungen und tatsächliches Vorgehen (siehe ab S. 236).
Wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen, muss über Zusammenhänge und Vorgeschichten informiert sein, um sich ein Bild machen zu können. Das ist die Grundlage für die Gestaltung der Zukunft. Deshalb hat das vorliegende Buch auch heute noch Relevanz, obwohl es 2017 erstmals erschienen ist und ich am Text keine Zeile verändert habe.
In diesen emotional aufgeheizten Zeiten empfiehlt es sich, jedes nur denkbare Missverständnis so gut es geht auszuschließen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle betonen, dass ich mich nicht an einer Schwarz-Weiß-Malerei beteilige, auch nicht mit umgekehrtem Vorzeichen: »wir« die Bösen und »die Russen« die Guten. Allerdings erachte ich es für notwendig, die fehlenden Stücke in dem Mosaik beizusteuern, das unvollständig den Eindruck erweckt, als habe sich der politische Westen überhaupt nichts zuschulden kommen lassen. Es geht nicht ums Aufrechnen nach dem Motto: Russland hat 2014 mit Blick auf die Krim und 2022 durch den Einmarsch in die Ukraine das Völkerrecht verletzt, die USA und die NATO haben das bereits 1999 in Bezug auf den Kosovokrieg und 2003 durch den Angriff auf den Irak getan. Nichtsdestotrotz darf man diese Chronologie nicht aus dem Auge verlieren oder sogar beide Augen zudrücken, weil »wir« für dieses Verhalten angeblich gute Gründe hatten. Recht ist nicht teilbar. Moral auch nicht. Ich möchte mit diesem Buch und mit Russland verstehen? dazu beitragen, Schieflagen zu beseitigen, weiße Flecken zu füllen, Fragen zu stellen, wohl wissend, dass einige nicht beantwortet werden. Ich beanspruche keine Deutungshoheit. Ich biete Fakten und Analysen an, versuche Hintergründe auszuleuchten und Zusammenhänge herzustellen, auf deren Basis man sich realistische Gedanken über die Gestaltung der Zukunft machen kann. Es ist Sache des Lesers, seine Schlüsse aus den geschilderten Sachverhalten zu ziehen, aber die Sachverhalte selbst müssen wenigstens bekannt sein. Denn es hilft bei der Suche nach Lösungen nicht, alles, was nicht in die Mainstream-Argumentation passt, wegzulassen oder von vornherein als russische Propaganda zu diskreditieren. Vielleicht kommen manche Leser zu anderen Schlussfolgerungen als ich. Na und? Dann kann man auf dieser Basis zivilisiert und respektvoll streiten. Und sich nicht so verhalten wie Bundeskanzler Scholz im August 2023 auf einer Wahlkampfveranstaltung. Er schleuderte Menschen, die durch das Friedenssymbol der Taube deutlich machten, dass sie nicht hinter den Waffenlieferungen der Bundesrepublik stehen, ungehalten entgegen: »Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden.« Wer zu solchen Bildern greift, sollte wissen, dass »gefallene Engel« die Personifizierung des Bösen darstellen. »Respekt für Dich«, das stand auf Wahlplakaten zur Bundestagswahl 2021, die das Porträt von Olaf Scholz zeigten.
Dieses Vorwort hier dient unter anderem dazu, einen Blick auf die Zeit zwischen Ersterscheinungsdatum und August 2023, also der Drucklegung dieser Ausgabe, zu werfen. Da nahezu zeitgleich auch Russland verstehen? in einer erweiterten Neuauflage erschienen ist, wird sich die eine oder andere Wiederholung nicht vermeiden lassen. (Denn ich kann nicht davon ausgehen, dass sich jeder beide Bücher kauft.)
Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine drängen sich Fragen auf: Was ist passiert, dass Russland diesen Schritt unternommen hat, der in jeder Beziehung den eigenen Interessen zu widersprechen scheint? Russland wird noch in den nächsten Jahrzehnten damit beschäftigt sein, verlässliche staatliche Strukturen zu schaffen und seine Wirtschaft zukunftstauglich zu machen. Ein Krieg ist dabei ein ruinöser Störfaktor. Vor dem Krieg habe ich Russlands Interessen immer folgendermaßen skizziert: Ruhe im Inneren und an den Grenzen, um den komplizierten Umgestaltungsprozess, der längst nicht abgeschlossen ist, weiterzuführen. Austausch und Zusammenarbeit mit dem Ausland, um sich weiterzuentwickeln. Akzeptanz und Sicherheitsgarantien des Westens, um sich auf die inneren Aufgaben konzentrieren zu können. Was also war passiert?
Mit den Hauruck-Erklärungen zu Beginn: Putin ist durchgeknallt, krank oder verrückt, aber in jedem Falle extrem imperialistisch unterwegs, heute ist es die Ukraine, morgen Polen und die baltischen Staaten und übermorgen stehen die Russen in Berlin – damit will ich mich nicht zufriedengeben. Auch der schnellen Beurteilung, Putin habe das von langer Hand vorbereitet, sei schon immer ein Monster gewesen und jetzt zeige er sich auch so, will ich mich nicht anschließen. Wer die Fakten seiner ersten und in Teilen auch noch seiner zweiten Amtszeit ohne Schaum vorm Mund analysiert, kann dieser Interpretation nicht folgen. Die Weichenstellungen innerhalb der russischen Gesellschaft und die zahlreichen Kooperationsangebote an den politischen Westen in dieser Phase sprechen dagegen. Die Rückwärtsbewegung hat erst sehr viel später eingesetzt. Zudem – hätte der russische Präsident von Beginn an vorgehabt, die Ukraine anzugreifen, dann stellt sich die Frage, warum er das nicht schon vor acht oder zehn Jahren getan hat. Da standen die Chancen für ein schnelles erfolgreiches Ergebnis aus russischer Sicht wesentlich besser, da die Ukraine noch nicht so hochgerüstet war wie im Februar 2022, dem Datum des russischen Einmarsches.
Zu den im politischen Westen vernachlässigten Sachverhalten gehören auf jeden Fall die Zustände im östlichen Teil der Ukraine. Dort herrscht seit 2014 Krieg. Kiew nannte das allerdings auch nicht Krieg, sondern Anti-Terror-Operation. 2014 hatten sich die Verwaltungsbezirke Donezk und Luhansk im Donbas für unabhängig erklärt, weil sie den Umsturz in Kiew nicht mitmachen wollten, der für sie nichts Gutes verhieß. Dazu ausführlicher in Russland verstehen? und im vorliegenden Buch ab Seite 116. Das Tragische an der Entwicklung war, dass es den sogenannten Separatisten zunächst nur darum ging, innerhalb der Ukraine mehr Rechte zu bekommen. Die überwiegend russischsprachige Bevölkerung dort war von Kiew lange Jahre vernachlässigt worden und geriet angesichts der russlandfeindlichen Entwicklungen in Kiew ins Visier der neuen Machthaber. Eine sinnvolle Föderalisierung, wie von einigen ukrainischen Präsidenten der Vergangenheit erfolglos versucht, wäre vermutlich hilfreich gewesen. Sogar noch während der Unterstützung durch russische Kräfte im Osten der Ukraine, ging es immer noch um mehr Autonomie innerhalb des Landes. Die Unabhängigkeitserklärung und Loslösung von der Ukraine wurden erst später ein Thema. Der Ausgangspunkt war ein innerukrainischer, der innerukrainisch hätte gelöst werden können, ohne die eine Seite der Bevölkerung in Bausch und Bogen zu Terroristen zu erklären, die es mit Waffengewalt zu bekämpfen gilt. Das Elend in diesen Gebieten ist den Menschen in westlichen Gesellschaften jedenfalls nicht in der Weise vor Augen geführt worden wie jetzt in anderen Teilen der Ukraine nach dem Einmarsch Russlands. Es war offenbar nicht von Interesse, obwohl dieser Kampf nach unterschiedlichen Angaben zwischen 10 000 und 14 000 Zivilisten das Leben gekostet hat. In Donezk gibt es seit dem 1. Juni 2017 ein Denkmal für Kinder, die Opfer von Bombardements geworden sind, auf dem fast zweihundert Namen stehen. Beobachter der OSZE haben nahezu täglich Artilleriedetonationen registriert, unmittelbar vor dem russischen Angriff Hunderte Explosionen pro Tag.
Das ukrainisch-russische Verhältnis war spätestens seit der Aufnahme der Krim in die Russische Föderation ruiniert. Das Jahr 2021 markierte insofern eine weitere Eskalationsstufe, als der ukrainische Präsident Selenskyj ein Dekret erließ, in dem die Rückeroberung der Krim ausdrücklich genannt wurde. Einige Zeit später begann man damit, ukrainische Streitkräfte im Osten und Süden des Landes zusammenzuziehen, was Russland natürlich nicht verborgen geblieben ist. Nach unterschiedlichen Quellen handelte es sich dabei um 60 000 bis 80 000 Soldaten. Parallel dazu fanden zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee diverse NATO-Manöver statt und die Zahl der Aufklärungsflüge der USA an der ukrainisch-russischen Grenze stieg signifikant. Im November 2021 haben die USA und die Ukraine ein Abkommen über strategische Partnerschaft geschlossen, in dem sowohl die NATO-Perspektive der Ukraine als auch die Rückeroberung der Krim als Ziele genannt wurden. Und im Januar 2022, also einen Monat vor dem russischen Angriff, hat die NATO die Ukraine eingeladen, an der NATO-Agenda 2030 mitzuarbeiten, das heißt dem Strategiepapier der NATO. Und das, obwohl die Ukraine gar kein NATO-Mitglied ist.
Im Dezember 2021 laufen die diplomatischen Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen, unter anderem zwischen Russland einerseits und den USA, der NATO und einzelnen europäischen Staaten andererseits, auf Hochtouren. Es werden Ultimaten gestellt, aber zu ernst gemeinten Verhandlungen kommt es nicht. Nach Angaben des gewöhnlich sehr gut informierten ehemaligen Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, General a. D. Harald Kujat – der Militärausschuss ist die höchste militärische Autorität der NATO –, muss man sich diese Phase im Zeitraffer wie folgt vorstellen:
Über die Vertragsentwürfe Russlands für künftige Abkommen mit den USA und der NATO, die russische Sicherheitsinteressen berücksichtigen, werden keine ernsthaften Verhandlungen geführt. Am 24. Februar 2022 startet der russische Angriff auf die Ukraine. Ende Februar, Anfang März 2022 nähern sich russische Truppen der ukrainischen Hauptstadt Kiew. In Istanbul beginnen im März russisch-ukrainische Verhandlungen, um eine Niederlage der Ukraine abzuwenden. Nach großen Verhandlungsfortschritten bietet Russland an, seine Truppen als Zeichen des guten Willens zurückzuziehen, was auch geschieht. Das bereits paraphierte Verhandlungsergebnis wird jedoch von der Ukraine nicht unterzeichnet. Putin sprach später davon, dass eine »friedliche Lösung« erreicht wurde, die jedoch auf Druck des Westens nicht zustande kam.
Selbst wenn man einwenden will, dass der Rückzug russischer Truppen auch der eigenen Fehleinschätzung geschuldet war, so lag doch ein Papier auf dem Tisch, über das beide Seiten mit ernsten Absichten verhandelt haben und das einen gesichtswahrenden Rückzug zu diesem frühen Zeitpunkt ermöglicht hat.
In diesem Zusammenhang ist ein Interview interessant, das der ukrainische Präsident Selenskyj im März 2022, also nach Kriegsbeginn, CNN gegeben hat: »But everyone in the West told me that we do not have any chance of NATO or E. U. membership. I asked them not to drive the Ukrainian people into a corner because our people are brave and the West should also be brave in telling directly to the Ukrainian people that, well, you are not going to be a NATO-E. U. member. They do not have a consolidated position and I requested that personally. I requested them personally to say directly that we are going to accept you into NATO in a year or two or five. Just say it directly and clearly or just say no, and the response was very clear, you are not going to be a NATO or E. U. member, but publicly the doors will remain open.« (»Aber alle im Westen haben mir gesagt, dass wir keine Chance auf eine NATO- oder EU-Mitgliedschaft haben. Ich habe sie gebeten, das ukrainische Volk nicht in die Enge zu treiben, denn unser Volk ist mutig, und der Westen sollte ebenfalls mutig sein und dem ukrainischen Volk direkt sagen, nun, ihr werdet nicht Mitglied der NATO und der EU werden. Sie haben keine klare Position, und die habe ich persönlich eingefordert. Ich habe sie persönlich aufgefordert, direkt zu sagen, dass sie uns in ein oder zwei oder fünf Jahren in die NATO aufnehmen werden. Sagen Sie es einfach direkt und deutlich oder sagen Sie einfach Nein, und die Antwort war sehr klar: Sie werden kein Mitglied der NATO oder der EU sein, aber öffentlich bleiben die Türen offen.«)
Dass aus den vielversprechenden Vereinbarungen, die in Istanbul ausgehandelt worden waren, nichts geworden ist, liefert aus russischer Sicht erneut einen Beweis dafür, dass man, wie schon bei den Minsker Abkommen, Verhandlungspartnern aus dem Westen nicht trauen kann. Minsk I (September 2014) und Minsk II (Februar 2015) – damit sollte damals weiteres Blutvergießen verhindert und eine politische Perspektive für eine föderalisierte Ukraine geboten werden. Nach späteren Aussagen der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die an den Verhandlungen beteiligt war, dienten die Abkommen lediglich dazu, Zeit zu gewinnen, um die Ukraine wehrhafter machen zu können. In dieser Phase lief die substanzielle militärische Unterstützung aus dem Westen gerade erst an. Eine Umsetzung der ausgehandelten Punkte von Minsk war also weder im Interesse der Ukraine noch des politischen Westens. Russland allerdings wurde für die Nichtumsetzung des Abkommens mit Sanktionen belegt.
Apropos Verhandeln und Verhandlungsbereitschaft. Nach meinem Eindruck stellt sich die Sache politisch, aber vor allem medial so dar, als grenze es an Verrat, Diplomatie aufrichtig und nicht nur als Worthülse ins Spiel zu bringen. Dabei ist die Argumentation alles andere als stringent. Einerseits wird behauptet, Putin wolle gar nicht verhandeln. Andererseits heißt es, man dürfe jetzt nicht mit Putin verhandeln, da es ihm in der momentanen militärischen Situation nur in die Hände spiele. Russland müsse erst in eine schwächere Position gebracht werden, durch noch mehr westliche Waffenlieferungen und durch noch härtere Sanktionen.
Diese Strategie beinhaltet Risiken, die in einer freien Gesellschaft wie der unseren deutlich beim Namen genannt werden sollten. Bundeskanzler Scholz betont immer mal wieder, man wolle trotz der Unterstützung der Ukraine nicht zur Kriegspartei werden. Das ist von existenzieller Bedeutung für uns alle. Das heißt, es empfiehlt sich zu wissen, wo genau die Grenzlinie verläuft, die man tunlichst nicht überschreiten sollte. Dazu hat der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages bereits am 16. März 2022 auf eine entsprechende Anfrage geantwortet: »Als völkerrechtlich gesichert kann gelten, dass die militärische Unterstützung einer bestimmten Konfliktpartei in Form von Waffenlieferungen, einer Zurverfügungstellung von militärischer Ausrüstung oder Ähnlichem noch nicht die Grenze zur Konfliktteilnahme überschreitet.« Und weiter: »Erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei beziehungsweise Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen.« Das heißt, wir befinden uns bereits seit geraumer Zeit außerhalb des gesicherten Bereichs. Die Bundeswehr hat sogar eine Führungsrolle innerhalb eines EU-Ausbildungsprogramms übernommen.
Müsste über derlei – im wahrsten Sinne des Wortes – existenzielle Fragen nicht offen und öffentlich debattiert werden? Wie weit gehen wir denn in der Unterstützung der Ukraine, wenn wir damit den eigenen Interessen schaden, nicht nur wirtschaftlich, sondern mit Blick auf Krieg und Frieden? Was ist denn mit dem Eid, den Bundeskanzler und Minister bei Amtsantritt feierlich ablegen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden? Was ist denn mit dem Friedensgebot im Grundgesetz? Diese Debatten finden in der sogenannten Mitte der Gesellschaft eher nicht statt. Ich halte das nicht nur für einen Fehler, sondern für systemgefährdend, denn es führt zur Aushöhlung demokratischen Denkens und das sollten wir in Deutschland nach unserer Vorgeschichte nicht riskieren.
Der damalige US-Präsident John F. Kennedy hat nach der heil überstandenen Kuba-Krise Anfang der sechziger Jahre gesagt: »Wenn ich eine Lehre daraus gezogen habe, dann, dass man eine Atommacht nicht in die Enge treiben darf.« Für alle, die das nicht mehr so präsent haben, es ist immerhin sechzig Jahre her: Das nukleare Wettrüsten im Rahmen des Kalten Krieges lief auf Hochtouren und die damalige Sowjetunion hatte auf Kuba Mittelstreckenraketen und atomare Sprengköpfe stationiert, was die USA »vor ihrer Haustür« nicht dulden wollten. Die USA ihrerseits hatten vorher entsprechende Waffen in der Türkei platziert. Durch eine – im übrigen völkerrechtswidrige – US-amerikanische Seeblockade vor Kuba bestand das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen den beiden Atommächten. Die Welt stand ohne Übertreibung am Rande ihrer eigenen Vernichtung und es ist den »Tauben« auf beiden Seiten zu verdanken, dass es dazu nicht gekommen ist. Die Dramatik rund um dieses Geschehen wird mit dem Wort »Krise« nur sehr unzureichend beschrieben. Vielleicht liegt ein Grund dafür, dass sich zurzeit die Scharfmacher und Hardliner so viel Gehör verschaffen können, darin, dass ihnen und ihrem Publikum aufgrund ihres Alters beziehungsweise ihrer Jugend die eigene Erfahrung fehlt, um die Bedeutung von Krieg und Zerstörung zu ermessen. Die Kriegsgeneration stirbt langsam aus und das Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit von Frieden offenbar auch. Ich hatte das Glück, Krieg nicht selbst erleben zu müssen, aber ich konnte, auch in meiner Familie, mit einer ganzen Reihe von Menschen sprechen, die den vielfältigen Schrecken von Krieg nicht entkommen sind. Und ich weiß durch die Trümmergrundstücke rund um mein Zuhause, wie Städte aussehen, die Bombenhagel platt gemacht hat. Viertel, in denen es weder eine Munitionsfabrik noch sonst ein lohnendes militärisches Ziel gab. Nur Wohnhäuser und Zivilisten.
Zurück zum Verhandeln, zur Diplomatie und zu der oft wiederholten Aussage, Putin wolle nicht verhandeln. Am 17. Juni 2023 war eine hochrangige afrikanische Delegation in Moskau. – Bemerkenswerterweise geben sich nicht europäische Delegationen in Moskau die Klinke in die Hand, obwohl der Krieg, schon gar, wenn er sich ausweiten sollte, in erster Linie Europa noch mehr verwüsten oder ganz vernichten wird, sondern afrikanische und chinesische. – Beim Pressetermin mit der afrikanischen Delegation am 17. Juni 2023 hat der russische Präsident erklärt: »Wir sind offen für einen konstruktiven Dialog mit allen, die Frieden wollen, der auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit und der Berücksichtigung der legitimen Interessen der unterschiedlichen Seiten beruht.« – Meines Wissens ist das nicht weiter aufgegriffen worden. Die gängige Lesart ist klar: Der russische Präsident lügt sowieso und man kann ihm nichts glauben. Die ukrainische Seite hat sich mit Blick auf Verhandlungen mittlerweile selbst blockiert. Nachdem sich Präsident Selenskyj einen Monat nach Kriegsbeginn noch in der Weise geäußert hatte, dass er sich bei gewissen Sicherheitsgarantien durch die internationale Gemeinschaft einen neutralen Status für die Ukraine vorstellen könne und mit dem in Istanbul ausgehandelten Abkommen offenbar einverstanden war, hat er im Oktober 2022 Verhandlungen mit Putin per Dekret verboten. Und am 23. August 2023 hat das ukrainische Parlament in seinem eigenen Pressedienst um 17.00 Uhr folgendes veröffentlicht: »Die Werchowna Rada der Ukraine (das Parlament, d. Verf.) verabschiedete eine Resolution, die jegliche territoriale Zugeständnisse zur Beendigung des Krieges ausschließt.« Der Auslöser für diesen Beschluss (Reg.-Nr. 9626) waren laut gewordene Vorschläge in dieser Richtung.
Und nun? Immer modernere und schlagkräftigere Waffensysteme sind im Gespräch beziehungsweise werden geliefert oder zumindest zugesagt. Auffällig ist dabei die Zurückhaltung der USA, die zwar in großem Umfang liefern, aber sich – bisher jedenfalls – eindeutige Grenzen gesetzt haben. Dazu gehört die Überlegung, keine Waffensysteme zur Verfügung zu stellen, die in der Lage sind, weit ins russische Kernland vorzudringen. Im Gegensatz zu europäischen Ländern sind die USA nicht davon überzeugt, dass sich die Ukraine an ihre offiziellen Zusagen hält, nur das eigene Land zu verteidigen und russisches Territorium nicht einzubeziehen. Der bereits zitierte Harald Kujat macht es in einem Interview im August 2023 konkret: »Weil sie (die USA, d. Verf.) den ukrainischen Zusicherungen nicht vertrauen, derartige Waffen nur auf ukrainischem Territorium einzusetzen, haben die USA HIMARS-Raketenwerfer nur mit Projektilen geliefert, die eine Reichweite von 85 km haben, nicht die mit 150 km Reichweite.« Und weiter: »Die USA überlassen es den Europäern, amerikanische F-16 zu liefern, und die Abrams-Panzer lassen auch auf sich warten. Dass die Ukraine entgegen ihrer Zusicherung kürzlich Streumunition bei einem Angriff auf das Stadtgebiet von Donezk gegen zivile Ziele eingesetzt hat, bestätigt die amerikanische Zurückhaltung.«
Währenddessen wird in Deutschland geprüft (bis zur Drucklegung dieses Buches war noch keine Entscheidung gefallen), ob man das hochleistungsfähige Taurus-System, diesen Luft-Boden-Marschflugkörper mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern an die Ukraine abgibt. Die aus Großbritannien und Frankreich stammenden und bereits in der Ukraine befindlichen Marschflugkörper haben eine wesentlich kürzere Reichweite.
»Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen.« Diese Aussage geht der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock leicht über die Lippen. Man kann es auch auf EU-Ebene immer wieder hören. Manche Politiker, die sich zurückhaltender ausdrücken, werden in Interviews moralisch geradezu genötigt, genau diese Aussage zu treffen. Aber was das konkret heißen soll, bleibt im Dunkeln. Vor allem auch mit Blick darauf, was es im Umkehrschluss bedeutet, dass nämlich Russland den Krieg verliert. Ich erinnere an die Aussage von John F. Kennedy nach einigermaßen heil überstandener Kuba-Krise.
Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch gewinnt? Ich kann mittlerweile kaum noch glauben, dass diejenigen, die sich voller Überzeugung in der Weise äußern, tatsächlich hinter ihren eigenen Worten stehen. Die USA scheinen uns auch in dieser Hinsicht mal wieder voraus zu sein. Dort mehren sich parteiübergreifend die Stimmen, die emotionslos feststellen, dass die Ukraine mehr oder weniger das erreicht hat, wozu sie militärisch in der Lage ist. Daran können auch weitere Waffenlieferungen nichts ändern. Was in der öffentlichen Diskussion oftmals nicht ausreichend berücksichtigt wird – kein Wunder, die Kriegsthematik im eigenen Land ist etwas völlig Neues – sind militärtaktische Aspekte, die aber jenseits von konkreten Waffensystemen und Personalstärken von entscheidender Bedeutung sind. Expertentum ist nicht notwendig, um auf folgende Fragen zu kommen: Wie wirkt es sich aus, wenn ein Land in dieser dramatischen Bedrohungssituation auf zusammengewürfelte Waffensysteme angewiesen ist, deren Ersatz und Reparatur nur unzureichend gewährleistet werden kann? Was bedeutet es, wenn Ausbildung und Schulung, die sich normalerweise über Monate und Jahre erstrecken, in Crashkursen von allenfalls ein paar Wochen vermittelt werden sollen? Ich habe gelernt, dass mindestens so wichtig wie die Qualität und Leistungsfähigkeit einzelner Waffensysteme deren Einsatz »im Verbund« ist. So spricht auch Oberst a. D. Ralph D. Thiele vom Institut für Strategie-, Politik-, Sicherheits- und Wirtschaftsberatung (ISPSW) davon, »dass die russischen Verteidigungslinien stehen«. Diese seien »exzellent befestigt«, so Thiele, und er ergänzt: »Die Russen machen es den Ukrainern sehr schwer vorzurücken, zumal sie den Kampf der verbundenen Waffen auch mit der Unterstützung von Kampfhubschraubern und Kampfflugzeugen führen können.« Alles muss ineinandergreifen und von entsprechend geschultem und erfahrenem Führungspersonal effizient eingesetzt werden. Westliche Militärberater allein, die es seit Jahren zahlreich in der Ukraine gibt, können das nicht leisten. Wie soll das mit dem Krieggewinnen in Anbetracht der tatsächlichen Gegebenheiten eine realistische Option sein? In dieser Rechnung taucht die extrem unterschiedliche Personalstärke mit Blick auf die Ukraine einerseits und Russland andererseits noch gar nicht auf. Wenn diese Überlegungen aber im Raum stehen – und sei es nur als eine denkbare Möglichkeit – was ist dann das Kerngeschäft von Politik? Immer noch mehr und stärkere Waffen oder doch eher Diplomatie und Verhandlungen? Man muss kein Pazifist sein, Humanist reicht völlig, um festzustellen, dass Waffenlieferungen in der Situation eher eine Bankrotterklärung von Politik darstellen.
Dass es um den Kriegsverlauf etwas anders steht, als man gemeinhin liest, hört oder sieht, zeigen diverse Stimmen, die weit weniger positive Einschätzungen bezogen auf die Stärke der ukrainischen Armee abgeben. So äußerte sich beispielsweise Douglas Abbott Macgregor, pensionierter Colonel der United States Army, Politikwissenschaftler und Militärtheoretiker im Juli 2023 gegenüber dem Podcaster Brian Rose: »I think the Ukrainian force ist desperately and frankly on the point of disintegration.« (Ich denke, dass die ukrainische Armee verzweifelt und offen gesagt am Rande des Zerfalls steht.) Und er fuhr fort: »The Russians are going to end this and they’re going to end it on their terms.« (Die Russen werden dies beenden und zwar zu ihren Bedingungen.) Oberst a. D. Jürgen Hübschen, der von 1965 bis 2004 Generalstabsoffizier der Luftwaffe war und Einsätze im Irak geflogen hat sowie als Militärattaché in Bagdad und als Repräsentant der OSZE in Lettland stationiert war, hat am 21. Juni 2023 in den Nachdenkseiten die militärische Lage in der Ukraine analysiert und unter anderem festgestellt: »Monatelang wurde eine ukrainische Gegenoffensive angekündigt, obwohl sich alle militärischen Fachleute darüber klar waren und sind, dass diese Offensive, die angeblich jetzt begonnen hat, keinen durchschlagenden Erfolg bringen wird, weil der Ukraine trotz aller Waffenlieferungen die Voraussetzungen dafür fehlen«, die er dann im Einzelnen aufzählt.
Sein Fazit klingt ernüchternd: Die Ukraine könne diesen Krieg nicht gewinnen. Daran werden auch zukünftige Waffenlieferungen des Westens nichts ändern, sie werden den Krieg nur verlängern. Auch er benutzt den schwer erträglichen Begriff des Abnutzungskriegs und bringt als drastisches Beispiel Bachmut. Die Stadt sei auf Weisung des ukrainischen Präsidenten – gegen den Rat der militärischen Führung – bis zur völligen Zerstörung gehalten worden. Oberst Hübschen bleibt seinem nüchternen Ton treu, wenn er feststellt, dass diese Entscheidung nicht nur zu hohen »personellen Verlusten« geführt habe, sondern auch den Bestand der Artilleriemunition dramatisch habe einbrechen lassen.
Angesichts des sinnlosen Verheizens von Menschen – die Frage ist doch: Wie können diejenigen, die der Ukraine ihre bedingungslose Solidarität versichern, und zwar »as long as it takes«, also so lange es nötig ist, diesem Land und seinen Menschen am besten helfen? Darauf mag es verschiedene Antworten geben mit ernst zu nehmenden Argumenten, aber in der öffentlichen Debatte und der veröffentlichten Meinung gilt nur Unterstützung mit Waffen als Ausdruck des Mitgefühls.
Von Untertönen und Zerrbildern
Berichte und Analysen dienen weniger der Frage, wie kommen wir da raus, wie lässt sich der Krieg möglichst schnell beenden, sodass alle Seiten mit dem Ergebnis leben können, als vielmehr den Überlegungen, wie sich eine militärische Entscheidung zugunsten der Ukraine am besten herbeiführen lässt. Waffensysteme und Munitionsvorräte spielen in Politik und Berichterstattung eine größere Rolle als das Ringen um eine künftige stabile Sicherheitsarchitektur. Dabei vertrauen nicht wenige auf ein baldiges Ende der Amtszeit Putins, um dann mit seinem Nachfolger verhandeln zu können, und träumen davon, es nach Putin mit einem Staatsführer zu tun zu haben, der sich der »westlichen Wertegemeinschaft« nicht verschließt. Nach der Vorgeschichte eine reichlich naive Vorstellung.
Man kann es nicht oft genug wiederholen: Um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können, sind möglichst umfassende Informationen nötig. Der mündige Bürger muss sich eine faktenbasierte Meinung bilden können und dafür ist er auf Berichterstattung angewiesen, die so wahrheitsgetreu wie nur irgend möglich Wirklichkeit abbildet und sich weder als moralischer Lehrmeister aufspielt, noch der Versuchung erliegt, mit ihrer Arbeit selbst Politik machen zu wollen.
Vor diesem Hintergrund werde ich Ihnen jetzt Beispiele der Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien anbieten, die ich für nicht zulässig oder grenzwertig halte. Ich konzentriere mich auf die Öffentlich-Rechtlichen, weil sie mir wichtig sind und ich mich nach wie vor zugehörig fühle, auch wenn ich seit mehr als dreißig Jahren nicht mehr dort angestellt bin. Außerdem spielen die Öffentlich-Rechtlichen wegen ihres gesetzlichen Auftrags eine besondere Rolle. Paragraf 11, Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrags legt fest: »Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben.« Ich kritisiere die Öffentlich-Rechtlichen, verteidige sie allerdings auch, so gut ich kann, wenn ich mit Begriffen wie Lügenpresse konfrontiert werde. Manchmal fällt das Verteidigen schwer, wenn es sich denn tatsächlich herausstellt, dass falsche Videos gezeigt, verfälschende Ausschnitte gewählt wurden et cetera. Aber viel schlimmer als falsche Videos – es sei denn, sie sind bewusst platziert worden in Kenntnis dessen, dass es sich um Fälschungen handelt – sind in der Russlandberichterstattung andere Dinge, weil sie subtiler und nicht so leicht zu fassen sind: wenn wichtige Themen erst gar nicht behandelt werden; wenn Informationen zum Verständnis eines Themas weggelassen werden; wenn Sprache nicht präzise eingesetzt wird, sei es unbewusst, automatisch oder auch absichtsvoll; wenn mit zweierlei Maß gemessen wird; wenn bei Interviews oder Moderationen eine andere Tonalität herrscht, sodass man die Verachtung oder die Häme hört. Konkret:
Wenn wichtige Themen erst gar nicht behandelt werden.
Damit ein Thema öffentlich diskutiert und debattiert werden kann, muss es erst einmal den Weg in die Öffentlichkeit finden. Die erste Schwelle besteht darin, Aufmerksamkeit zu bekommen, was allein schon deshalb schwerfällt, weil das Angebot – nicht zuletzt durch das Internet – so gigantisch ist. Alle wissen, dass Dramatisierung und Skandalisierung diesem Mechanismus geschuldet sind. Alle wissen auch, dass das zwar ganz gut funktioniert, aber letztlich insofern kein gutes Konzept darstellt, weil auf diese Weise, schon gar auf Dauer, Wirklichkeit verzerrt wird. Davon, wie Wirklichkeit wahrgenommen wird, hängen Entscheidungen ab. Also kein unproblematischer Mechanismus. Wer’s zynisch mag: Selbst wenn ein Thema schief oder übertrieben dargestellt wird – es kommt wenigstens vor. Viel gefährlicher scheint mir, wenn die Verzerrung von Wirklichkeit aufgrund selektiver Themensetzung passiert. Der Schluss, das Thema kann nicht existieren, sonst würde ja darüber berichtet, ist in meinen Augen ein Fehlschluss mit dramatischen Auswirkungen. Dazu ausführlicher in »Respekt geht anders«, 2020 im Beck-Verlag erschienen.
Aus meiner aktiven Zeit bei der Tagesschau weiß ich selbst, wie schwierig es ist, die »richtigen« Entscheidungen zu treffen, weil man streng genommen oftmals nur die Wahl hat zwischen »falsch« und »falsch« und nicht zwischen »richtig« und »falsch«. An manchen Tagen häufen sich die für die Gesellschaft relevanten Themen, sowohl im Inland als auch im Ausland und ganz gleich, worauf man verzichtet – in der Gesamtschau ist es falsch. Umso wichtiger, dass bei allen objektiven Schwierigkeiten, die mit einer Themenauswahl verbunden sind, ideologische Scheuklappen keine Rolle spielen und man als Nachrichtenredakteur in der Lage ist, zum Beispiel auch mal Verdienste russischer Diplomatie entsprechend zu würdigen. Das ist in der Regel nicht der Fall. Das lässt sich unter anderem an Syrien zeigen (die Vernichtung chemischer Waffen) und am Iran (das Atomabkommen, das zwischenzeitlich durch den damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump einseitig aufgekündigt worden ist.)
Wenn Informationen zum Verständnis eines Themas weggelassen werden
Sie erinnern sich vielleicht an den Zwischenfall im Schwarzen Meer, in der Meerenge von Kertsch, im Dezember 2018, bei dem drei ukrainische Schiffe und 24 Mann Besatzung in russischen Gewahrsam genommen wurden. In der Berichterstattung war von ukrainischen »Fischerbooten« die Rede. Zunächst kein Wort darüber, dass es sich um ukrainische Marineboote gehandelt hat und der politische Zusammenhang fehlte völlig: Unmittelbar vor diesem Zwischenfall hatte der ukrainische Abgeordnete Igor Mossejtschuk, ein Nationalist und früher stellvertretender Kommandeur des berüchtigten Bataillons Asow, im ukrainischen Parlament damit gedroht, diese neue Brücke über die Meerenge von Kertsch zu sprengen. Es hat eine gewisse Logik, dass Russland nach dieser Vorgeschichte ukrainische Militärschiffe, die sich der Brücke nähern, kontrollieren will. Wenn dieser Zusammenhang fehlt, dann zementiert sich das Bild vom unberechenbaren Russen, der auch vor unverdächtigen Fischerbooten, die da einfach nur herumfahren, nicht Halt macht. Nebenbei bemerkt: O-Töne, also Originalaussagen, hat man sich nur vom ukrainischen Botschafter besorgt, nicht aber vom russischen. Das heißt, die russische Darstellung der Vorgänge ist für die Berichterstattung offenbar nicht von Belang. Unterschwellig schwingt immer mit: Das ist ohnehin alles nicht glaubwürdig und im Zweifel sowieso russische Propaganda.
Diverse Sabotageakte an dieser Brücke in der jüngsten Vergangenheit sowie weitere Angriffe auf die Krim und das russische Grenzland sind eindeutige Zeichen für das damals auf russischer Seite befürchtete Vorgehen der Ukraine. Mittlerweile sind Drohnenangriffe auf Moskau auch keine Seltenheit mehr, wobei die Herkunft der Drohnen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht endgültig geklärt war. Wenn man auf der Basis von Plausibilität vorgeht, dann stellt sich allerdings die Frage, welchen Sinn es macht, dass Russland seine eigene Hauptstadt ins Visier nehmen sollte.
Ein sehr eklatantes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit bezieht sich auf das Getreideabkommen, das Russland nicht mehr verlängert hat. In diesem Abkommen wurden der Ukraine von Russland sichere Transportrouten durch das Schwarze Meer garantiert. Im Gegenzug sollte es für Russland trotz der Sanktionen Erleichterungen vor allem in Bezug auf ihre Düngemittelexporte und die Zahlungsabwicklung über die russische Agrarwirtschaftsbank geben, denn Russland ist weitgehend vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Die Bilanz nach einem Jahr Vertrag zeigt, dass Russland seine Verpflichtungen eingehalten hat, die ihm in Aussicht gestellten Verbesserungen aber nicht umgesetzt wurden. Diese Facette wird in der Berichterstattung und in politischen Statements allerdings weitgehend unterschlagen, mit der Konsequenz, dass sich das Bild des barbarischen Russen verfestigt, der nicht einmal angesichts des Hungers in der Welt zum Einlenken bereit ist.
Wenn Sprache nicht präzise eingesetzt und mit zweierlei Maß gemessen wird
Dieser Punkt ist eine lohnende Fundgrube. Normalerweise heißt es: Herr X oder das Land Y sagt, dass … Bei Russen, Russland oder dem russischen Präsidenten wird das Wort sagen durch behaupten ersetzt. Putin behauptet grundsätzlich. Es wird selten neutral formuliert.
In Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine werden die Verlautbarungen von ukrainischer Seite mit dem Wort offenbar eingeleitet, wohingegen den russischen Aussagen das Wort angeblich vorbehalten ist.
In meinen Russlandbüchern finden sich ganze Kapitel mit dem Titel »Zweierlei Maß«, in denen ich unter anderem solche sprachlichen Beispiele anführe. Aber »Zweierlei Maß« hat nicht nur eine sprachliche Komponente.
Im Oktober 2019 ist die Türkei in Syrien einmarschiert. Trotz aller Kritik war von nachvollziehbaren Sicherheitsinteressen der Türkei die Rede, was auch diverse Interviewpartner beziehungsweise O-Ton-Geber bestätigten: »Man muss die Motivation der Türkei verstehen, auch wenn man die Aktion nicht gutheißt.« An etwas Ähnliches mit Blick auf russische Aktivitäten kann ich mich nicht erinnern und ich spreche jetzt nicht vom Überfall auf die Ukraine im Februar 2022. Auf die Türkei und ihren Einmarsch in Syrien bezogen war von »…nicht in Einklang mit dem Völkerrecht« die Rede und nicht von Völkerrechtsbruch oder völkerrechtswidrig. Da sind wir bei Russland deutlich weniger zurückhaltend.
Oder: Selbst nach der einsamen Entscheidung des US-amerikanischen Präsidenten Trump im Mai 2018, das Atomabkommen mit dem Iran einseitig zu kündigen, überschlugen sich Kollegen, die sonst nicht unbedingt für Zurückhaltung bekannt sind, mit Sätzen wie: »Es ist ganz wichtig, das zu verstehen.« Ja, das finde ich auch, aber in Zusammenhang mit Russland wäre es vielleicht ebenso angebracht, mal etwas zu verstehen.
In der 20-Uhr-Tagesschau vom 1. Juli 2021 wurde über den Tod des ehemaligen amerikanischen Außenministers Donald Rumsfeld berichtet und als biografische Information hieß es: »Er war umstritten, weil er aggressive Verhörmethoden (Hervorhebung durch den Verfasser) in Guantanamo und Abu Greib genehmigt hat.« Das nennt man Folter. Oder man hätte auch den Begriff Waterboarding nennen können, dann hätten die Menschen gewusst, was genau gemeint ist mit den »aggressiven Verhörmethoden«, die Donald Rumsfeld ausdrücklich genehmigt hat.
Was passiert, wenn jemand als »Russland-Freund« bezeichnet wird? Der wandert im Zweifel in eine Schublade, in der sich bereits Russland- und Putin-Versteher befinden, mit deren Aussagen man sich nicht näher befassen muss. Da geht es sicher eher um Propaganda. Wirklich immer? Was passiert, wenn jemand als »Amerika-Freund« bezeichnet wird? Nichts. Jedenfalls nichts Schlimmes. Man darf auch ein Freund Frankreichs sein, aber ein Freund Russlands – das ist suspekt, nicht erst seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine.
Dass das so ist, hängt mit der gebetsmühlenartigen Wiederholung von vielen Kleinigkeiten zusammen, die das Image von Russen und Russland so entstehen lassen, wie es ist und es immer weiter verfestigen. Selbst die Autokorrekturprogramme der Rechner spiegeln diese Sichtweise.
Am 24. März 2021 habe ich eine Diskussionsveranstaltung des Deutsch-Russischen Forums für mich protokolliert. In dem Zusammenhang habe ich folgenden Satz notiert – es ging um die Orientierung von Studenten und Wissenschaftlern bei Austauschprogrammen: »Es gibt viel mehr Westdrang der russischen Elite als Ostdrang der westlichen Elite.« Westdrang wird von der Rechtschreibkorrektur problemlos angenommen, obwohl es im Grunde ein sperriger Begriff ist. Ostdrang hingegen wird nicht akzeptiert, sondern als fehlerhaft markiert. Auch jetzt wieder, wenn ich diesen Text am Rechner schreibe.
Dasselbe passiert übrigens bei den Begriffen »Antiamerikanismus« und »Antirussismus«. Der erste Begriff ist korrekt. Der zweite existiert laut Rechtschreibprogramm nicht. Die Autokorrektur bietet einem als korrekten Ersatz »Antirassismus« an. Objektiv betrachtet gibt es natürlich beides: Antiamerikanismus und Antirussismus.
Wenn bei Interviews oder Anmoderationen eine andere Tonalität herrscht
Als es im April 2019 um Sanktionen gegen Nordkorea ging, meinte der entsprechende Korrespondent in Moskau »Russland legt großen Wert darauf, bei den westlichen Sanktionen gegen Nordkorea mitzumachen – jedenfalls offiziell.« Im Klartext: Die können viel erzählen, aber ob man denen das glauben soll?
Oder wenn es um die jährliche Veranstaltung geht, bei der sich der russische Präsident stundenlang den Fragen von Bürgern stellt – muss man das von vornherein als »Show« abqualifizieren? Es wird dann zwar konstatiert, dass Putin »wie gewohnt kenntnisreich« antwortete und »wie immer mit Kompetenz, mit Zahlen- und Detailwissen glänzte«, aber das wird sofort entwertet/relativiert mit der Bemerkung: »Vielleicht, weil er sich zwei Tage auf die Show vorbereitet hatte, vielleicht auch, weil ihm viele Fragen schon vorher bekannt waren.« – Es kann natürlich nicht sein, dass er weiß, wovon er redet.
Vieles, was in der Russlandberichterstattung kritikwürdig ist, ist zu glatt, um es richtig packen zu können, das heißt formal schafft man durchaus die Kurve zur Verteidigung oder Rechtfertigung dessen, was gesendet wurde. Es ist in dem Sinne also nicht justiziabel. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die ihre Wirkung aber durch die ständige Wiederholung und die Häufung entfalten. Nicht zuletzt spielt auch die Auswahl russischer O-Töne eine Rolle. In der Regel bekommen regierungskritische Stimmen das Wort, oftmals sogar von Exilrussen, oder es handelt sich um offizielle Statements staatlicher Funktionsträger in Russland, aber die klassischen Experten, die bei uns gefragt werden, Wissenschaftler, Fachleute aus den unterschiedlichsten Bereichen, kommen im Programm so gut wie nicht vor. Das ist auffällig.
Auf deutscher Seite wird das Bild dadurch komplettiert, dass vorwiegend politische Statement-Geber befragt werden, die für die transatlantische Sichtweise stehen. Mehr noch, Aussagen mit russlandfeindlichen (nicht nur russlandkritischen) Positionen bilden die Mehrheit. Wenn man böse wollte, könnte man sagen, da leisten dann die Aussagen der Experten das, was sich Reporter oder Moderatoren in der Berichterstattung nicht so deutlich leisten dürfen.
Der negative Eindruck, der erweckt wird, bleibt jedenfalls haften und passt zum bisherigen schiefen Bild, das auf diese Weise immer weiter zementiert wird. Es existiert ein fester Rahmen, ein vorbereitetes Raster, in das Nachrichten aus Russland fallen. Neudeutsch nennt man das Framing.
Noch zwei weitere Dinge sind auffällig. Zum einen, dass in und durch Berichterstattung in einer Weise politischer Druck aufgebaut wird, den ich nach journalistischen Grundsätzen für unzulässig halte, denn Journalisten sind dazu da, Politik zu erklären und nicht dazu, selbst Politik zu machen. Zum anderen, dass – bei allem Verständnis für den Zwang zur Verkürzung und dem Bedürfnis nach Orientierung in einer immer komplizierter werdenden Welt – in den meisten Fällen zu einem polarisierenden Raster gegriffen wird. Die Dinge sind entweder schwarz oder weiß, gut oder böse, »entweder oder« eben, und nicht »sowohl als auch«.
Diese Mechanismen tragen ihren Teil dazu bei, die Gesellschaft zu spalten und die Debatten unnötig zu polarisieren. Das hat fatale Folgen. Zur Problemlösung taugt das Verfahren jedenfalls nicht. Ich gehe davon aus, dass schnell Einigkeit über die grundsätzliche Aufgabe von Journalisten in demokratischen Systemen herzustellen ist: Sie sind dafür zuständig, die Informationen zu liefern, die Menschen brauchen, um begründete Entscheidungen treffen zu können. Zusammen mit Schule und Bildungseinrichtungen sorgen Journalisten dafür, dass es den mündigen Bürger gibt, auf den Demokratien angewiesen sind.
Journalisten sind nach meiner Auffassung von Journalismus nicht dazu da, Menschen auf den vermeintlich richtigen Weg zu führen oder sich als Sprachrohr von Regierungen zu betätigen und schon gar nicht, um an Eskalationsschrauben zu drehen. Auch dafür noch ein paar konkrete Beispiele.
Nehmen wir die 20-Uhr-Tagesschau in der ARD am 4. Juli 2021. Der Bericht kam aus den USA. Thema war ein Hackerangriff, der in Schweden dazu geführt hatte, dass Supermärkte nicht öffnen konnten, weil die Kassen-Software nicht mehr zu gebrauchen war. Der Server stand in den USA. Es ging um den Verdacht, dass der Angriff aus Russland kommt. Die Korrespondentin berichtete: »Biden hat sich sehr zurückhaltend geäußert.« Das war zu dem Zeitpunkt auch so, erst später kam eine gewisse Schärfe dazu, aber am 4. Juli hatte der amerikanische Präsident zum Verdacht, dass der Angriff aus Russland kommen könnte, lediglich gesagt: »Wir wissen es nicht.« Der Beitragstext der Korrespondentin ging dann folgendermaßen weiter: »Wenn der amerikanische Geheimdienst sicher ist, dass die russische Regierung dahintersteckt, dann muss Biden reagieren, sonst wird er unglaubwürdig.« Und als Erklärung fügte sie noch hinzu, dass Biden beim vorangegangenen Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in Genf ausdrücklich gesagt habe, dass er hart reagieren werde, falls solche Hackerangriffe nochmal vorkommen. – Es hört sich häufig in der Berichterstattung so an, als könne man eine Eskalation kaum erwarten.
Dazu passt auch ein Bericht im ARD-Morgenmagazin am 12. Oktober 2020, in dem die Korrespondentin forderte, die EU müsse mehr Druck gegenüber Moskau aufbauen. Das ist eine politische Aussage und keine journalistische. Allenfalls in einem Kommentar zu vertreten, aber es handelte sich um einen Bericht.
Oder an anderer Stelle, am 8. September 2020, die Aussage: »Der Druck wächst, es diesmal nicht bei Worten zu belassen.« Wobei man feststellen muss, dass zum Zeitpunkt dieser journalistischen Aussage der Druck noch durch kein politisches Statement ausgelöst worden war, sondern nur durch die Berichterstattung der Journalisten, die üblicherweise die Moralkarte ziehen und dann finden sich auch schnell die passenden O-Töne. Da steht die jeweilige Opposition gerne bereit. Das ist ein immer wiederkehrendes Schema, das so selbstverständlich geworden ist, dass es kaum noch auffällt.
Das folgende Beispiel vom 6. September 2020 macht mich nach wie vor fassungslos. In der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin« ging es um die Vergiftung des russischen Oppositionellen und Bloggers Alexej Nawalny und die Frage, ob das Auswirkungen auf den Bau der Pipeline North Stream 2 habe. Der damalige Außenminister Heiko Maaß war zu Gast und bekam diese Frage gestellt. Er äußerte sich sehr zurückhaltend, man solle diese Dinge nicht vermischen und erst einmal abwarten, was die Untersuchungen mit Blick auf die Schuldfrage ergeben. Damit war die Kollegin aber nicht zufrieden, sondern hat nachgebohrt. Grundsätzlich ist das auch ihre Aufgabe. So weit, so gut. Insgesamt hat sie dreimal nachgehakt, indem sie immer wieder fragte, aber wenn sich herausstellen sollte, dass Putin oder die russische Regierung dahinterstecken, was dann? Und Heiko Maaß antwortete schließlich hörbar entnervt – ich zitiere wörtlich: »Es wäre falsch, von vornherein auszuschließen, dass es keine Auswirkungen auf das Projekt haben könnte.« Genau das hat er gesagt. Die erste Meldung in den heute-Nachrichten im ZDF – also unmittelbar nach dem Bericht aus Berlin in der ARD – lautete: »Selbst Außenminister Heiko Maas stellt North Stream 2 in Frage.« Nein, das hatte er eigentlich nicht. Aber genauso ging es weiter. Der Kollege in der ZDF-Sendung Berlin direkt formulierte dann: »Heiko Maas hat mit Stopp von North Stream 2 gedroht.« Nein, das hatte er schon gar nicht. – Diese Geschichte ist ein eklatantes Beispiel dafür, wie man offenbar gewünschte Schlagzeilen politischen Entscheidungsträgern in den Mund legt, indem man sie durch bestimmte Fragestellungen in die Enge treibt. Sehr beliebt in dem Zusammenhang ist: »Bitte ganz kurz, ja oder nein?«
Nach meinem Verständnis von Journalismus handelt es sich dabei nicht mehr um kritische Berichterstattung, sondern um Stimmungsmache und lustvolles Drehen an Eskalationsschrauben, um alles noch etwas spannender zu machen und auch noch aus einem anderen Grund. Ich fürchte mittlerweile tatsächlich, dass dieses Verhalten auch dazu dient, um sich bei Kollegen nicht dem Vorwurf auszusetzen, mit Blick auf dieses verabscheuungswürdige russische Regime nicht kritisch genug gewesen zu sein. Gruppendynamische Prozesse sind nicht zu unterschätzen. Und das Etikett »Russland-Versteher« oder gar »Putin-Versteher« ist nahezu tödlich für die Karriere.
Als kleine Nachbemerkung zu diesem Beispiel: Es waren an diesem Abend des 6. September 2020 – bis auf den CDU-Abgeordneten Norbert Röttgen und den ukrainischen Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk – nicht in erster Linie die Politiker, die North Stream 2 in Frage gestellt haben, sondern die Journalisten.
Ausblick
Es fehlt ein politisches Konzept jenseits von Waffenlieferungen und militärischen Überlegungen. »Krieg ist nichts als Drückebergerei vor den Aufgaben des Friedens.« Mit diesem Ausspruch von Thomas Mann habe ich das Kapitel »Wer bedroht wen?« auf Seite 212 eingeleitet. Es lohnt sich, an die politischen Konzepte aus den Zeiten des Kalten Krieges zu erinnern – die Doppelstrategie aus militärischer Stärke und Entspannungspolitik –, auch wenn man die jetzige Situation nicht eins zu eins mit der damaligen vergleichen kann. Es ist notwendig klarzustellen, dass Appeasement-Politik nichts mit Ausstiegsstrategien zu tun hat. Wer mit dem Argument hantiert, die Geschichte zeige, wozu Appeasement-Politik geführt habe – nämlich Hitler zu weiteren Beutezügen zu ermutigen – ist aus meiner Sicht eher ideologisch als analytisch unterwegs. Außerdem – wurde wirklich je ein Krieg auf dem Schlachtfeld beendet, und zwar nachhaltig? Es waren immer Verhandlungslösungen, die zu dauerhafter Befriedung geführt haben. Je mehr allseitige Interessen Eingang in Vereinbarungen fanden, umso dauerhafter. Heinz Gärtner, Professor für Politikwissenschaft an der Universität in Wien und Mitglied des Advisory Board des International Institute for Peace (IIP), hat kürzlich in einem Artikel auf folgende Zusammenhänge hingewiesen. Gärtner vergleicht die Situation Deutschlands nach dem Ende der beiden Weltkriege. Während Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg mit hohen Reparationsforderungen belegt und durch den Versailler Vertrag hart sanktioniert worden war, bekam die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Unterstützung, unter anderem in Form des Marshallplans. Jeder weiß, was daraus geworden ist: Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich eine politische Radikalisierung, die zu Adolf Hitler und zum Dritten Reich führte, nach dem Zweiten Weltkrieg folgten Wirtschaftswunder und Demokratisierung. Auch das lässt sich aus verschiedenen Gründen nicht eins zu eins vergleichen, aber dieser Gedanke taugt zumindest dazu, der gängigen Lesart etwas entgegenzusetzen, nach der man Sanktionen nur scharf und lange genug durchhalten muss, um politisch etwas Positives zu bewirken. Das scheint mir eine Illusion zu sein. Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob und gegebenenfalls wo in der bisherigen Geschichte Sanktionen jemals dazu geführt haben, dass sich die Sanktionierten so verhielten, wie die Sanktionierenden es wollten. Darüber hinaus bleibt festzustellen, dass die verhängten Sanktionen Deutschland wirtschaftlich weit mehr schaden als Russland.
Mit Blick auf Sanktionen lässt es sich nicht vermeiden, unter dem Stichwort Heuchelei auf Folgendes aufmerksam zu machen. Der politische Westen denkt zum Beispiel nicht im Entferntesten daran, Aserbaidschan zu sanktionieren, obwohl dieses Land 2020 Armenien angegriffen hat, und zwar nicht nur die umstrittene Enklave Bergkarabach, sondern zum ersten Mal auch das Kernland Armenien. Auf armenischer Seite waren etwa hundert Tote zu beklagen. Aserbaidschan wird nicht nur nicht sanktioniert, sondern sogar im neuen europäischen Format willkommen geheißen, der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG), in der 27 EU-Länder und 17 weitere Staaten künftig über Themen wie Sicherheit und Frieden, sowie Klima, Energie und Wirtschaft beraten wollen. Zum ersten Treffen in Prag, am 6. Oktober 2022, war neben Armenien auch Aserbaidschan eingeladen und durfte mit aufs Gruppenfoto. Es fällt schwer, den Kompass der wertegeleiteten Außenpolitik zu erkennen, umso mehr als Aserbaidschan seit Dezember 2022 zulässt, dass die einzige Verbindungsstraße zwischen Armenien und Bergkarabach, der Latschin-Korridor, von Dauerprotestierenden blockiert wird. Zunächst konnten noch Hilfsgüter passieren, seit Mitte Juni 2023 funktioniert auch das nicht mehr. »Es wird davon ausgegangen, dass die Proteste von den aserbaidschanischen Behörden unterstützt werden«, kann man bei Amnesty International lesen, die auch von Unterbrechungen der Strom-, Gas- und Treibstoffversorgung berichten. Die Konsequenzen für die etwa 120 000 Menschen, von denen circa 30 000 Kinder sind: kaum noch Lebensmittel oder Medikamente, kein Treibstoff. Der frühere Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, Luis Moreno Ocampo, spricht laut ZDF von Genozid: »Es gibt Gründe für die Annahme, dass Präsident Alijew (der aserbaidschanische Präsident, d. Verf.) genozidale Absichten hegt.« Da ist es an Zynismus kaum zu überbieten, wenn es in einem Bericht auf arte heißt: »Obwohl sich Russland nach dem Krieg 2020 (zwischen Aserbaidschan und Armenien, d. Verf.) vertraglich verpflichtet hat, Bergkarabach zu schützen, unternimmt der russische Präsident weiterhin nichts, um die Blockade zu beenden.« Das Interesse an Ersatzlieferanten für russisches Öl und Gas scheint dann doch über die moralischen Ansprüche der westlichen Wertegemeinschaft zu siegen. Bei Katar und Saudi-Arabien sieht es nicht anders aus.
Zurück zum Thema denkbare Ausstiegsstrategien. Wie könnten die aussehen? Für die Krim und die östlichen Gebiete der Ukraine wird es in absehbarer Zeit keine Lösung geben, die sowohl von ukrainischer als auch von russischer Seite akzeptiert werden wird. Beide Seiten haben sich mit Maximalforderungen blockiert. Die Vorstellung, Russland habe sich diese Gebiete rechtswidrig angeeignet, also müsse es sich auch vollständig aus diesen Gebieten zurückziehen, bevor Verhandlungen überhaupt in Betracht kommen, mag nach Gerechtigkeit für die Ukraine klingen, ist aber naiv und unrealistisch. Das wissen auch die Entscheidungsträger in Washington und westlichen europäischen Hauptstädten. Es wird nichts anderes übrigbleiben, als diese territorialen Fragen, so gut es geht, für eine gewisse Zeit auszuklammern und Übergangslösungen zu finden, für die es Beispiele aus der jüngeren Geschichte gibt.
Eine ernst gemeinte Ausstiegsstrategie hat es mit zwei entscheidenden Gegebenheiten zu tun. Zum einen ist der Krieg in der Ukraine keine ausschließlich ukrainisch-russische Angelegenheit, sondern ein weiterer Stellvertreterkrieg zwischen Russland einerseits und dem politischen Westen in Gestalt der NATO beziehungsweise den USA und der EU andererseits. Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat sich dazu folgendermaßen geäußert: »Russland trägt die alleinige Verantwortung für den Ausbruch des Krieges, aber mittlerweile sind die USA und Europa verantwortlich für die Förderung eines Stellvertreterkrieges.« Zum anderen: Solange eine der beiden Seiten davon ausgeht, den Krieg militärisch gewinnen zu können – was immer das in der konkreten Ausgestaltung bedeuten mag –, ist die Bereitschaft zu verhandeln gering. Mittlerweile hat der Krieg allerdings eine Phase erreicht, die an Stellungskriege vergangener Zeiten erinnert, verbunden mit dem zynischen Begriff »Abnutzungskrieg«.
Auf dieser Grundlage sind mindestens drei parallele Aktivitäten notwendig, um den Teufelskreis zu durchbrechen: Vermittlung von außen zwischen den beiden direkten Kontrahenten Russland und Ukraine, internationale Zusammenkünfte angelehnt an die Schlussakte von Helsinki 1975 beziehungsweise eine Aufwertung der OSZE und schließlich Abrüstungsverhandlungen, nachdem nahezu sämtliche Errungenschaften der Entspannungspolitik auf diesem Gebiet eliminiert wurden, meist auf Betreiben der USA. Das alles muss jemand initiieren, und es irritiert mich als Europäerin sehr, dass wahrnehmbare Aktivitäten in dieser Hinsicht im Wesentlichen von China, den afrikanischen Staaten und dem sogenannten globalen Süden ausgehen. Es irritiert mich umso mehr, als dieser Krieg in Europa stattfindet und in erster Linie Europa betrifft. Es müsste also im ureigenen Interesse der Europäer liegen, diesen Krieg zu beenden und endlich an einer verlässlichen Sicherheitsarchitektur zu bauen, die augenscheinlich Ende der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wesentlich leichter hätte errichtet werden können als jetzt. Es nützt nichts, dem hinterherzutrauern. Wenn ich allerdings an die Ergebnisse der Politik von Michail Gorbatschow denke, die eine belastbare Grundlage für den Bau eines europäischen Hauses abgegeben hätten, dann habe ich das dringende Bedürfnis, mich bei ihm entschuldigen zu wollen. Es ist sehr schnell in Vergessenheit geraten, wie hoch das Risiko war, das der damalige sowjetische Staatspräsident Gorbatschow für sein Land und nicht zuletzt für seine Familie eingegangen ist, um diese Grundlage zu ermöglichen.
Es ist ja nicht so, als gäbe es keine durchdachten Vorschläge, wie man den Krieg mit einem Verhandlungsfrieden beenden kann. Ende August 2023 ist in Zeitgeschichte im Fokus, einer Schweizer Zeitschrift, ein Artikel erschienen, für den die Professoren Peter Brandt, Hajo Funke und Horst Teltschik sowie General a. D. Harald Kujat verantwortlich zeichnen. Das übergeordnete Motto liest sich so: »Legitime Selbstverteidigung und das Streben nach einem gerechten und dauerhaften Frieden sind kein Widerspruch.« Der ausführliche und mit Quellen belegte Artikel beschreibt, warum keine Seite diesen Krieg militärisch gewinnen kann. Die einzelnen Schritte der Ausstiegsstrategie werden sehr konkret in drei Phasen beschrieben: Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, eine europäische Sicherheits- und Friedensordnung.
»Der Krieg hätte verhindert werden können«, heißt es an einer Stelle, »hätte der Westen einen neutralen Status der Ukraine akzeptiert (wozu Selenskyj anfangs durchaus bereit war), auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet und das Minsk-II-Abkommen für Minderheitenrechte der russischsprachigen Bevölkerung durchgesetzt. Der Krieg hätte Anfang April 2022 beendet werden können, hätte der Westen den Abschluss der Istanbul-Verhandlungen zugelassen. Es liegt nun erneut und möglicherweise letztmalig in der Verantwortung des ›kollektiven Westens‹ und insbesondere der USA, den Kurs in Richtung Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zu setzen.«
Es wird Zeit, dass auch der Letzte begreift, wie wichtig es ist, den Punkt nicht zu verpassen, an dem es kein Zurück mehr gibt, weil die Dinge eine Eigendynamik entwickeln, die sich politisch nicht mehr einfangen lassen. Angesichts der militärischen Möglichkeiten und der vollgestopften Nukleararsenale kann das nur im Desaster enden. Im Vergleich dazu dürfte sich selbst die drohende Klimakatastrophe wie ein Spaziergang ausnehmen. Die damit verbundenen Probleme haben sich dann nämlich erledigt.