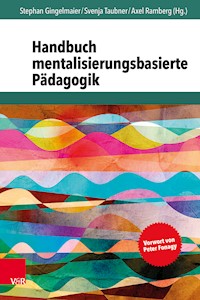
Elemente der Themenzentrierten Interaktion (TZI) E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) ist ein Handlungskonzept zur Arbeit mit Gruppen in unterschiedlichen Kontexten. In vielen pädagogischen Berufen gehört die Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen des TZI-Konzepts zur Ausbildung. Dieser Band stellt Texte zur Verfügung, in denen grundlegende Elemente der TZI einfach, anschaulich und praxisorientiert erläutert werden. Die thematisch anregenden und qualitativ hochwertigen Texte sind sowohl für die berufliche Ausbildung wie auch für die persönliche Weiterentwicklung als Leiter von Gruppen von Nutzen. Sie stammen allesamt aus der Fachzeitschrift »Themenzentrierte Interaktion«, sind aber so gut wie nicht mehr erhältlich. Mit der Wiederveröffentlichung dieser ausgewählten Artikel grundlegende und inspirierende Texte zur TZI für Menschen in pädagogischer Aus- und Weiterbildung, TZI-Ausbildung und andere Interessierte zugänglich gemacht.Die Autoren der Aufsätze sind profilierte Lehrende, Forschende und Praktizierende der TZI aus den Bereichen Psychoanalyse, Psychotherapie, Pädagogik, Sozialpädagogik, Theologie, Philosophie, Erwachsenenbildung, Supervision, Coaching, Organisations- und Personalentwicklung. Jedem Artikel ist ein von den Herausgebern verfasster einführender Text vorangestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anja von Kanitz / Walter Lotz / Birgit Menzel / Elfi Stollberg / Walter Zitterbarth (Hg.)
Elemente der Themenzentrierten Interaktion (TZI)
Texte zur Aus- und Weiterbildung
Vandenhoeck & Ruprecht
Mit 5 Abbildungen und 1 Tabelle
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99674-5
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
© 2015, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen / Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
Inhalt
Vorwort
Themenzentrierte Interaktion (TZI) – eine kurze Einführung
I Zugänge zur TZI finden
Hartmut Grün
9 relevante Aspekte der TZI. Ein TZI-Kompass für »Ortsfremde«
Ruth C. Cohn
Verantworte dein Tun und dein Lassen – persönlich und gesellschaftlich. Offener Brief an Günter Hoppe
Dietrich Stollberg
»Wer den Globe nicht kennt, den frisst er«. Zur Bedeutung des Umfeldes in der themenzentriert-interaktionellen Arbeit
Hermann Kügler
ES oder Thema? Plädoyer für eine präzise Begrifflichkeit
Helga Modesto
Demokratisches Verhalten in der TZI-Gruppe: Eine Herausforderung an die Chairperson
Dietrich Stollberg
Ich leite, du leitest – wer leitet?
Helmut Reiser
Gruppe und Gruppenleitung aus der Sicht der Themenzentrierten Interaktion und des Systemisch-konstruktivistischen Ansatzes
Walter Zitterbarth
TZI und Ethik
II Gruppenprozesse verstehen
Angelika Rubner und Eike Rubner
Entwicklungsphasen einer Gruppe
Hartmut Raguse
Einige Gedanken über Krisen in TZI-Gruppen
Matthias Kroeger
Das sogenannte Störungspostulat: »Disturbances and passionate involvements take precedence«
Angelika Rubner
Über die Wechselwirkung zwischen der Rolle des Einzelnen, der Gegenübertragung des Leiters und dem Prozess der Gruppe
Elfi Stollberg und Gerhard Härle
Über das Beenden von Gruppen
III Mit der TZI arbeiten
Matthias Kroeger
Modell der Selbstsupervision in TZI
Walter Lotz
Beredtes Schweigen – Themenzentrierte Prozessanalyse als Reflexionsinstrument professioneller Praxis
Walter Lotz und Gudrun Maierhof
TZI und Kompetenz-Orientierung im Studium der Sozialen Arbeit
Carolin Bücking
Themen finden, formulieren, einführen – welche Auswirkungen haben sie für das Unterrichtsgeschehen?
Die Herausgeberinnen und Herausgeber
Die Autorinnen und Autoren
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Die Fachzeitschrift »Themenzentrierte Interaktion« erscheint seit über 25 Jahren zweimal jährlich, seit 2008 im Psychosozial-Verlag. Sie ist das Medium, in dem die Theorie und Praxis der Themenzentrierten Interaktion (TZI) in Artikelform reflektiert, diskutiert und weiterentwickelt werden. Viele der bereits erschienenen Artikel sind für TZI-Interessierte und -Auszubildende mittlerweile schwer zugänglich. Die nur in kleiner Auflage publizierten, thematisch anregenden und für das Verständnis von TZI wertvollen Texte kennt und findet man oft nicht. Dies möchten wir ändern.
Mit der Veröffentlichung ausgewählter Texte der TZI-Fachzeitschrift machen wir grundlegende Aufsätze zur Themenzentrierten Interaktion wieder für ein breiteres Publikum zugänglich. Die Auswahl richtet sich an Menschen, die nicht nur Gruppen leiten (wollen/müssen), sondern auch verstehen wollen, was sie da machen und worauf sie in der Leitungsrolle achten können, um ihre Chancen auf eine gelingende Arbeit mit Gruppen zu erhöhen. TZI bietet dafür ein umfassendes Instrumentarium zur Planung, Leitung und Reflexion.
Wir haben aus der Vielzahl interessanter Artikel solche ausgewählt, die jeweils ein grundlegendes Element der TZI im Fokus haben und so für eine Einstiegslektüre geeignet sind. Der jeweils vorangestellte, vom Herausgeberteam verfasste Einführungstext erläutert den Kontext des Artikels, so dass sofort erkennbar ist, worum es geht und welchen Platz dieses Element im System einnimmt.
Im Anhang befindet sich ein Index mit der Auflistung TZI-spezifischer Fachwörter mit Seitenangaben, wo zu diesem Thema Erläuterungen zu finden sind. So ist man bei der Lektüre nicht an eine bestimmte Reihenfolge gebunden, sondern kann sein Wissen zu einzelnen Elementen der TZI gezielt vertiefen. Wer eine kurze Einführung in charakteristische Elemente der TZI sucht, findet diese im TZI-Einführungstext auf Seite 11 ff. Dort erläuterte Fachtermini sind im Buch bei der Einführung zum Artikel kursiv kenntlich gemacht. Ist in einem Text z.B. das Wort Vier-Faktoren-Modell kursiv gesetzt, ist dieser Begriff im Einführungstext kurz erläutert.
Teil I umfasst grundlegende Artikel zur Orientierung im TZI-System. In Teil II steht die Frage im Fokus, wie man Prozesse in Gruppen besser verstehen und beeinflussen kann – ein Themengebiet, das für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen zeitlebens herausfordernd bleibt. In Teil III findet sich eine Auswahl von Beispielen, die zeigen, wie man TZI in der Praxis zur Planung, Gestaltung und Reflexion von Gruppenarbeit nutzen kann.
Wir freuen uns, wenn die Lektüre dieser Texte die spannende Aufgabe der Leitung von Gruppen mit TZI verständlicher macht, inspirierend wirkt und Lust darauf macht, TZI auch praktisch zu erleben, z. B. in Ausbildungsseminaren.
Anja von Kanitz, Walter Lotz, Birgit Menzel, Elfi Stollberg, Walter Zitterbarth
Themenzentrierte Interaktion (TZI) – eine kurze Einführung
TZI ist in den 1960er Jahren als Konzept für die Leitung von Gruppen entwickelt worden. Die Berliner Psychoanalytikerin Ruth Cohn hat die Grundlagen der TZI geschaffen. Sie lebte lange in den USA im Exil und ließ sich von dem dort herrschenden innovativen Klima in der therapeutischen Szene inspirieren. Ihr Hauptanliegen war jedoch weniger die therapeutische Arbeit als vielmehr die Frage, wie man in der Arbeit mit Gruppen verschiedene Ziele miteinander vereinen kann: die persönliche Entwicklung des Einzelnen, eine gute Kooperation als Gruppe, eine fruchtbare Bearbeitung von Sachfragen und Themen sowie einen verantwortlichen Umgang mit der eigenen Umwelt. Sie widmete sich als eine der Ersten intensiv sowohl experimentell als auch theoretisch der Frage, was Gruppenleiter/-innen tun können, um lebendige Lern- und Arbeitsprozesse zu ermöglichen. Vieles, was heute, z. B. im methodischen Setting, oft selbstverständlich ist, hat in der TZI ihren Ursprung. Bis heute ist die TZI im Bereich der Gruppenleitung das führende Konzept.
Was macht das Modell nun aus (s. Grün)1? Der Name Themenzentrierte Interaktion verweist auf das Spezifikum dieses Modells: Die Arbeit an der Sache, verdichtet in einem ausformulierten Thema, steht im Mittelpunkt und ist Ausgangspunkt für die Interaktion der Gruppe. Ein gut gewähltes Thema spricht die Einzelnen der Gruppe so an, dass alle wissen, wovon geredet wird, innere Bilder und Bezüge entstehen können und jede/-r Einzelne sich einbringen kann. Es ist das zentrale Leitungselement, um die inhaltliche Arbeit, den Gruppenprozess sowie den Einzelnen in seiner Entwicklung zu fördern (s. Kügler; Bücking).
Damit dies gut gelingen kann, ist ein Wissen um Gruppenprozesse, verschiedene Phasen in der Gruppenarbeit, Rollen von Einzelnen, Entwicklungspotentiale und -klippen hilfreich (s. A. Rubner u. E. Rubner; Raguse). Gelingt es einer Gruppe nicht, in einen guten Arbeitsprozess miteinander zu kommen, liegt dies selten an der verhandelten Sache selbst. Oft sind Schwierigkeiten und Konflikte auf persönlicher Ebene ursächlich für Probleme bei Arbeits- und Lernprozessen. Beherrschen beispielsweise Angst, Ärger, Ablehnung oder verdeckte Konflikte das Klima der Gruppe, kann thematische Arbeit nicht wirklich gelingen.
In der TZI wird aufgezeigt, wie Struktur, ein gelingender Arbeitsprozess und Vertrauen sich gegenseitig bedingen. Die Struktursetzung ist dabei eine wichtige Aufgabe der Leitungsverantwortlichen (s. Kroeger, Selbstsupervision; E. Stollberg u. Härle). Die Entscheidung, in welcher Struktur und mit welcher Methode zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Gruppe gearbeitet wird, hat großen Einfluss auf die Arbeit als solche, z. B. auf die Möglichkeit der Einzelnen, sich aktiv mit ihren Ideen und Vorstellungen einzubringen, Vertrauen zu anderen aufzubauen, Konflikte offen anzusprechen und gemeinsam mit den anderen Lösungen zu finden. Mittel der Struktursetzung sind z. B. die Gruppengröße (Plenum, Halb- oder Kleingruppe, Einzelarbeit), der Einsatz von Methoden (Blitzlicht, kreative oder erlebnisorientierte Techniken, Übungen/Aufgaben, Plenumsdiskussion etc.) und die Themensetzung (das Gefühl oder den Intellekt ansprechend, an Bekanntem anknüpfend oder Neuland betretend etc.). Gibt die Leitung zu wenig, zu viel oder unpassende Strukturen vor, wird die Gruppe in ihrer Arbeit behindert. Dies erkennt man z. B. daran, dass die gemeinsame Arbeit als chaotisch erlebt wird, Einzelne oder die Gruppe passiv oder desinteressiert wirken, starke negative Gefühle dominieren und man inhaltlich nicht vorankommt, der Arbeitsprozess stagniert.
Die TZI ist in der Humanistischen Psychologie beheimatet, die sich von ihrer Anthropologie her als »dritte Kraft« neben Psychoanalyse und Verhaltenstherapie versteht. Seinen Niederschlag findet dieser Humanismus vorwiegend in den Axiomen und Postulaten der TZI.
Viele Organisationen, die mit Menschen arbeiten, stützen sich heutzutage auf einen ethischen Kodex, in dem orientierende Leitvorstellungen formuliert und daraus resultierende Verhaltensregeln festgehalten werden. Ruth Cohn hatte schon deutlich vor diesem Trend die Notwendigkeit erkannt, dass pädagogisches Handeln an orientierende, wertgebundene Vorstellungen geknüpft sein muss, um Missbrauch zu verhindern. Deshalb waren ihr die der TZI-Praxis zugrunde liegenden drei Annahmen, die sogenannten Axiome, als Orientierung für das eigene Handeln sehr wichtig (s. Zitterbarth):
1. Axiom (existentiell-anthropologisch): Der Mensch ist eine psycho-biologische Einheit und ein Teil des Universums. Er ist darum gleichermaßen autonom und interdependent. Die Autonomie des Einzelnen ist umso größer, je mehr er sich seiner Interdependenz mit allen und allem bewusst wird.
2. Axiom (ethisch): Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und seinem Wachstum. Respekt vor dem Wachstum bedingt bewertende Entscheidungen. Das Humane ist wertvoll, Inhumanes wertbedrohend.
3. Axiom (pragmatisch-politisch): Freie Entscheidung geschieht innerhalb bedingender innerer und äußerer Grenzen. Erweiterung dieser Grenzen ist möglich. Unser Maß an Freiheit ist größer, wenn wir gesund, intelligent, materiell gesichert und geistig gereift sind, als wenn wir krank, beschränkt oder arm sind und unter Gewalt und mangelnder Reife leiden. Das Bewusstsein unserer universellen Interdependenz ist die Grundlage humaner Verantwortung.
Auf der Grundlage dieser Axiome haben sich zwei Folgerungen für die praktische Umsetzung ergeben, die sogenannten Postulate, die auch jenseits des TZI-Modells in der Arbeit mit Gruppen weite Verbreitung gefunden haben.
»Sei deine eigene Chairperson« nutzt das Bild des Verhandlungsführers/der Verhandlungsführerin. Jede/-r muss im Alltag die verschiedenen eigenen Interessen, die Interessen anderer und die der (Um-)Welt abwägen und auf der Basis dieses inneren Abwägungsprozesses, sozusagen einer Verhandlung mit sich selbst, bewusste und verantwortliche Entscheidungen treffen. Die TZI nimmt für sich in Anspruch, mit ihrem Modell Menschen in ihrer Selbstbestimmung, ihrem Selbst-Bewusstsein und ihrer Bereitschaft, Verantwortung für sich, andere und die Sache zu übernehmen, zu unterstützen (s. Cohn). Anders als in manch anderen Konzepten steht hier die Balance zwischen dem Selbst, den anderen und den gegebenen Notwendigkeiten im Vordergrund. Damit will die TZI so etwas wie im positivsten Sinne demokratisches Handeln unterstützen (s. Modesto).
»Störungen nehmen sich Vorrang«. Viele Menschen, die Gruppen leiten, fürchten sich genau davor: dass es zu Störungen kommen könnte, die die Arbeit behindern. Das sogenannte Störungspostulat bringt unmissverständlich zum Ausdruck, dass Arbeits- und Lernprozesse störanfällig sind und dass Störungen sich ihren Raum nehmen. Manche werden stutzen, weil sie dieses Postulat als »Störungen haben Vorrang« kennen. Ruth Cohn hat nach ihrer Emigration in die USA in Englisch geschrieben und bewusst das Wort »take« gewählt. Denn es geht nicht darum, dass Störungen immer, sobald sie auftreten, zum Thema gemacht werden müssen, sondern darum, dass Störungen, seien sie in der Person, in der Sache, im Zwischenmenschlichen oder in der Umwelt begründet, Menschen davon abhalten können, sich dem gemeinsamen Gegenstand mit voller Aufmerksamkeit zu widmen (s. zum Störungspostulat Kroeger). Dies verändert den Blick auf das, was gemeinhin mit Störungen verbunden wird. Die TZI hat einen durchweg positiven Störungsbegriff, denn Störungen (z. B. Widerstand, Unkonzentriertheit, heftige Gefühle) helfen der Leitung und der Gruppe bei der Analyse, was gerade nicht gut läuft bzw. gerade nicht passt. Sie helfen beim Finden einer Entscheidung, was man anders machen könnte, damit die gemeinsame Arbeit besser gelingt. Grundlage dafür ist ein humanistisches Menschenbild, das davon ausgeht, dass Menschen gute Gründe haben, warum sie gerade im Moment anderes tun als von ihnen erwartet. Auch dies ist ein spezifisches Merkmal der TZI.
Ein zentrales Element der TZI ist das Vier-Faktoren-Modell, dargestellt als Dreieck im Kreis (s. Abbildung 1). Es geht von der Gleichwertigkeit der vier Faktoren aus, die die Arbeit einer Gruppe bestimmen: jede/-r einzelne Gruppenteilnehmer/-in inklusive der Leitungsverantwortlichen (ICH), die Gruppe als Gesamtheit (WIR), die Aufgabe/die Sache, derentwegen Menschen zusammenkommen (ES), sowie die Beachtung der (Rahmen-)Bedingungen der Einzelnen, der Gruppe und der Sache (GLOBE; s. D. Stollberg, Globe). Gelingt es, alle vier Faktoren in der Arbeit zu berücksichtigen und auszubalancieren, fördert dies Prozesse des lebendigen Lernens und gelingender gemeinsamer Arbeit. Kommen einzelne Faktoren in der Arbeit zu kurz, leidet über kurz oder lang auch die inhaltliche Arbeit darunter, weil z. B. die Motivation und Beteiligung Einzelner abfällt, Streitigkeiten in der Gruppe zunehmen und angestrebte Ziele nicht erreicht werden können. Der Charme dieses einfach anmutenden Modells liegt darin, dass durch das Vier-Faktoren-Modell die ungeheure Komplexität von Prozessen in Gruppen zunächst reduziert, dadurch überschaubar und einer systematischen Analyse zugänglich gemacht wird. Die am Vier-Faktoren-Modell orientierte Analyse ist die Grundlage, auf der Leitungsverantwortliche strukturelle und methodische Entscheidungen treffen sowie passende Interventionen zur Beeinflussung des Prozesses entwickeln können. Dieses Grundmodell ist weiterentwickelt worden und wird in vielfältigem beruflichem Kontext erprobt und eingesetzt (s. Lotz; Lotz u. Maierhof; Kroeger).
Der Leitung kommt dabei die Aufgabe der dynamischen Balance dieser Faktoren zu. Durch entsprechende Struktursetzung kann sie einzelne Faktoren stärker gewichten und so für eine ausgewogene Berücksichtigung persönlicher, gruppendynamischer, sachorientierter und umweltbedingter Aspekte sorgen bzw. eingreifen, wenn es zu Störungen kommt, die mit der Überbetonung oder Vernachlässigung einzelner Faktoren zu tun haben. Das Anstreben einer dynamischen Balance zwischen verschiedenen Anforderungen und Faktoren ist ein zentrales Anliegen der TZI.
Ein weiteres charakteristisches Merkmal der TZI ist die Vorstellung davon, wie sich ein Leiter/eine Leiterin in den Arbeits- und Gruppenprozess einbringen sollte. Angestrebt ist die partizipierende Leitung, die sich deutlich von autoritären Leitungskonzepten unterscheidet. Durch die Art und Weise, wie sich Leitungsverantwortliche in den Prozess einbringen, handeln sie als »role model« und nehmen so Einfluss auf das Geschehen. Indem sie eigene Gefühle, Assoziationen, Wünsche und Impulse wahrnehmen und diese partiell und bewusst ausgewählt auch in die Gruppe einbringen, entwickelt sich ein Leitungsstil, der sich grundlegend von anderen Konzepten, z. B. dem systemischen Ansatz, unterscheidet (s. Reiser). Eine Gruppe gemäß der TZI Leitende begegnen den anderen Gruppenteilnehmenden auf Augenhöhe und sind bestrebt, ihre Leitungsmacht und -verantwortung zu mindern (s. D. Stollberg, Leitung; Modesto).
Abbildung 1: Das Vier-Faktoren-Modell der TZI, dargestellt als Dreieck in dem Kreis
Die Berücksichtigung und bewusste Gestaltung verschiedener Phasen in der Entwicklung einer Gruppe sind wichtiger Bestandteil des Leitungshandelns (E. Stollberg u. Härle; A. Rubner u. E. Rubner). Beim Blick auf notwendige Leitungsinterventionen am Ende einer Gruppe wird die Idee der TZI deutlich, dass, anders als z.B. in der Psychoanalyse, die Einzelnen in ihrer Chairperson und in ihrer persönlichen Entwicklung am besten da gefördert werden können, wo sich Menschen seit ihrer Geburt am meisten aufhalten und was sie am meisten prägt: in Gruppen.
1Wird im Text so wie hier auf einen Autor/eine Autorin in kursiver Schrift ohne Angabe einer Jahreszahl verwiesen, befindet sich der entsprechende Artikel in diesem Band. Dort sind nähere Erläuterungen zu dem im Text angesprochenen Themenfeld zu finden.
I Zugänge zur TZI finden
Hartmut Grün
9 relevante Aspekte der TZI1
Ein TZI-Kompass für »Ortsfremde«
Wer zum Einstieg das Modell der TZI in komprimierter Form erfahren will, kann sich mit den neun Aspekten der TZI ein Bild vom Gesamtkonzept machen: TZI – ein Modell für lebendiges Lernen und Arbeiten, das die Selbstverantwortung fördert. Hartmut Grüns praxisbezogene Erklärungen ermöglichen auch Menschen aus den Berufsbereichen der Industrie und Wirtschaft, die vielleicht kein pädagogischpsychologisches Vorwissen haben, Zugang zu humanistischen Sichtweisen. Mit diesem Text lässt sich die häufig gestellte Frage »TZI – was ist das eigentlich?« leichter beantworten.
Vorbemerkung
Vor dem Abdruck dieses Artikels bat ich einige TZI-Laien, mir ihren Eindruck zu schildern. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv. Die Leser/-innen erwähnten in ihren Aussagen, dass sie nun eine Vorstellung darüber gewonnen hätten, wie ein TZI-Kurs verlaufen könne. Das hat mich ermutigt, den Artikel zu veröffentlichen, um von einer breiteren Leserschaft – insbesondere aus dem Kolleg(inn)enkreis »TZI und Wirtschaft« – Feedback und praktische Anregungen zu erhalten.
Persönliche Ausgangssituation
In meiner Berufspraxis als Erwachsenenbildner und Trainer fällt in Kontraktgesprächen mit meinen potentiellen Auftraggebern irgendwann das Wort »TZI«. Ich warte dann auf eine erste Reaktion und bin erleichtert, wenn mein Gegenüber – möglicherweise aus eigener Erfahrung – weiß, wovon ich spreche. Dieses Glück habe ich allerdings selten. In den Vorgesprächen werde ich häufig mit folgenden Fragen konfrontiert:
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























