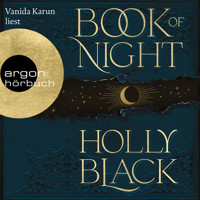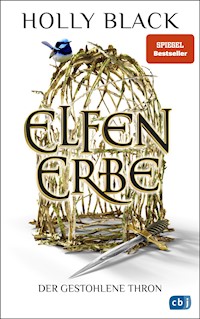
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die ELFENERBE-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein widerstrebender Prinz. Eine geflohene Königin. Und eine Suche, die beide zerstören könnte.
Oak Greenbriar, der 17-jährige Bruder von Jude, Königin von Elfenheim, ist ein enigmatischer und widerstrebender Thronfolger. Schon als Kind stand er im Mittelpunkt eines brutalen Machtkampfs um den Thron und kennt die Höhen und Tiefen seiner Position. Als er gemeinsam mit Suren, der wilden und unberechenbaren Königin des Hofs der Zähne, auf eine Quest geht, verbergen beide ihre wahren Motive voreinander. Denn ihr Bündnis ist fragil und dem anderen zu vertrauen, könnte ein ganzes Reich aufs Spiel setzen …
Die SPIEGEL-Bestsellerautorin Holly Black kehrt mit dem ersten Band einer magischen Dilogie zurück in ihre »Elfenkrone«-Welt – eine schicksalhafte Geschichte voller Intrigen, Gefahr und Leidenschaft über den Elfenprinzen Oak und die Elfenkönigin Suren.
Von der Autorin sind ebenfalls bei cbj erschienen:
Elfenkrone (Band 1)
Elfenkönig (Band 2)
Elfenthron (Band 3)
Wie der König von Elfenheim lernte, Geschichten zu hassen (Band 4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der gestohlene Thron
Aus dem Englischen von Anne Brauner
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2023 by Holly Black Die amerikanische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »The Stolen Heir. A Novel of Elfhame« bei Little, Brown and Company, New York. Published in agreement with the author, c/o BARORINTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A. © 2023 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Aus dem Englischen von Anne Brauner Lektorat: Carola Henke Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München Cover art copyright © by Sean Freeman. Cover design by Karina Granda. Cover copyright © 2023 by Hachette Book Group, Inc. Karte und Innenillustrationen: © Kathleen Jennings he · Herstellung: AJ Satz und E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, PößneckISBN978-3-641-30341-9V002
www.cbj-verlag.de
Für Robin Wasserman, die – Fluch und Segen zugleich – das Zweite Gesicht hat
Eines Abends am Feuer im Kinderzimmer
Saßen wir beieinander und hielten still.
Plötzlich wehte der Wind wie nimmer
Und am Fenster kratzte es schrill.
Eine verhärmte braune Fratze – ich zitterte.
Niemand hörte es oder blickte verwunderlich.
Es schwenkte die Arme, das Flügelpaar flitterte.
Huh! – Ich wusste, holen wollte es mich!
Einige sind unheimlich schauerlich!
Die ganze Nacht tanzten sie im Regen,
Kreiselnd im Reigen, tropfnass und verwegen,
Schlugen die Umhänge dem Fenster entgegen,
Damit ich schrie und weinte, mein Herz beklommen,
Und das Bettzeug fortschleuderte ganz benommen.
Ich sollte im Bett bleiben in dieser Nacht,
Und hättet ihr nur das Licht angemacht,
Hätten sie mich nie aus dem Haus bekommen!
Charlotte Mew
Der Wechselbalg
Prolog
Eine Passantin entdeckte ein kleines Mädchen, das auf dem eisigen Betonboden einer Gasse hockte und mit dem Deckel einer Katzenfutterdose spielte. Als sie endlich ins Krankenhaus gebracht wurde, war sie blau gefroren. Sie war ein hutzeliges Dingelchen, zu dünn, mager wie ein Stöckchen.
Sie kannte ein einziges Wort, ihren Namen: Wren.
Während sie heranwuchs, behielt ihre Haut einen bläulichen Schimmer wie von abgeschöpftem Rahm. Ihre Adoptiveltern packten sie in Jacken und Mäntel und Fäustlinge und Handschuhe, doch im Gegensatz zu ihrer Schwester war ihr nie kalt. Die Farbe ihrer Lippen wechselte wie bei einem Stimmungsring und blieb sogar im Sommer bläulich und violett. Rosa wurden ihre Lippen nur in der unmittelbaren Nähe eines Feuers. Außerdem spielte sie gern stundenlang im Schnee, baute lange Tunnel und lieferte sich Scheingefechte mit Eiszapfen. Ins Haus ging sie nur, wenn sie gerufen wurde.
Obwohl sie knochig und blutarm wirkte, war sie stark. Mit acht konnte sie Einkaufstüten schleppen, die ihre Mutter kaum hochheben konnte.
Mit neun war sie verschwunden.
Als Kind las Wren viele Märchen. Deshalb wusste sie, dass sie unartig gewesen sein musste, als die Ungeheuer kamen.
Sie schlichen durchs Fenster herein, drückten es auf und zerfetzten das Fliegengitter so leise, dass sie an ihren geliebten Plüschfuchs geschmiegt weiterschlief. Sie wurde wach, als sie Klauen an ihrem Knöchel spürte.
Ehe sie schreien konnte, legte ihr jemand die Hand auf den Mund. Ehe sie zutreten konnte, wurden ihre Beine nach unten gedrückt.
»Ich lasse dich los«, sagte eine barsche Stimme mit einem fremden Akzent. »Aber wenn du irgendwen im Haus aufweckst, wirst du es mit Sicherheit bereuen.«
Das erinnerte ebenfalls an ein Märchen, und Wren hütete sich, gegen die Regeln zu verstoßen. Sie gab keinen Laut von sich und rührte sich nicht einmal, als sie sie losließen, obwohl ihr Herz so heftig und schnell schlug, so laut, dass sie ihre Mutter vielleicht damit heraufbeschwören konnte.
Sie hoffte selbstsüchtig, dass es so war und ihre Mutter ins Zimmer kommen, das Licht anschalten und die Ungeheuer vertreiben würde. Das wäre nicht gegen die Regel, oder wenn sie nur wegen ihres trommelnden Herzschlags wach geworden war?
»Hinsetzen«, befahl ein Ungeheuer.
Wren gehorchte. Aber mit zitternden Fingern schob sie ihren Plüschfuchs tief unter die Bettdecke.
Beim Anblick der drei Wesen an ihrem Bett zitterte sie unkontrolliert. Zwei waren groß und elegant mit steingrauer Haut. Die Frau mit den langen bleichen Haaren, die sie mit einer Krone aus schartigem Obsidian bändigte, trug ein Gewand aus silbrigem Stoff, das sich um sie bauschte. Sie war schön, doch der grausame Zug um ihre Lippen warnte Wren, ihr nicht zu trauen. Der Mann, der eine schwarze Krone und Kleidung aus dem gleichen Silberstoff trug, passte exakt zu der Frau, als wären sie Figuren auf einem Schachbrett.
Bei ihnen stand eine riesige, bedrohliche und spindeldürre Kreatur mit pilzbrauner Haut und einem wilden schwarzen Haarschopf. Besonders bemerkenswert waren jedoch ihre langen klauenartigen Finger.
»Du bist unsere Tochter«, sagte das eine graugesichtige Ungeheuer.
»Du gehörst uns«, krächzte das andere. »Wir haben dich geschaffen.«
Sie hatte von leiblichen Eltern gehört, weil ihre Schwester welche hatte, freundliche Menschen, die zu Besuch kamen und ihr ähnlich sahen und manchmal Großeltern oder Donuts oder Geschenke mitbrachten.
Sie hatte sich auch leibliche Eltern gewünscht, doch niemals hätte sie sich vorstellen können, dass ihr Wunsch einen Albtraum wie diesen heraufbeschwören würde.
»Und?«, fragte die Frau mit der Krone. »Bist du auf den Mund gefallen? Oder etwa zu sehr von Ehrfurcht für unsere Majestäten erfüllt?«
Das Wesen mit den Klauenfingern schnaubte unhöflich.
»Das muss es sein«, sagte der Mann. »Wie dankbar du uns sein wirst, von hier wegzukommen, Wechselbalg. Steh auf. Spute dich.«
»Wohin gehen wir?«, fragte Wren. Vor Angst krallte sie die Finger ins Bettlaken, als könnte sie sich an das Leben klammern, das sie eben noch gehabt hatte, wenn sie nur fest genug zupackte.
»Ins Elfenreich, wo du Königin sein wirst«, antwortete die Frau fauchend, statt einschmeichelnd, wie es hätte sein sollen. »Hast du noch nie geträumt, dass jemand kommen und dir verraten soll, du wärst gar kein sterbliches Mädchen, sondern ein Kind der Magie? Hast du nie davon geträumt, aus diesem erbärmlichen kleinen Leben gerissen und in ein grandioses Dasein verfrachtet zu werden?«
Das konnte Wren nicht abstreiten. Sie nickte. Im Hals brannten Tränen, denn darin lag ihre Untat. Das war das Böse in ihrem Herzen, das enthüllt worden war. »Ich höre sofort auf«, flüsterte sie.
»Wie bitte?«, fragte der Mann.
»Wenn ich verspreche, dass ich mir nie wieder etwas wünsche, kann ich dann hierbleiben?«, bettelte Wren mit bebender Stimme. »Bitte?«
Die Hand der Frau landete mit einer derart harten Ohrfeige auf Wrens Wange, dass es wie ein Donnerschlag klang. Es tat weh, doch obwohl ihr die Tränen kamen, war sie zu geschockt und wütend, um zu weinen. Sie war noch nie geschlagen worden.
»Du bist Suren«, behauptete der Mann. »Und wir sind deine Schöpfer. Dein Erzeuger und deine Erzeugerin. Ich bin Lord Jarel und das ist Lady Nore. Unsere Begleiterin ist Bogdana, die Sturmvettel. Und da du nun deinen wahren Namen kennst, zeige ich dir jetzt dein wahres Gesicht.«
Lord Jarel streckte die Hand aus und machte eine zerreißende Geste. Und dann sah ihr aus dem Spiegel über der Kommode ihr monsterhaftes Ich entgegen – ihre Hautfarbe wie geschöpfte Milch wurde durch blassblaues Fleisch ersetzt, das die gleiche Farbe hatte wie eingesunkene Adern. Als sie den Mund öffnete, entdeckte sie Haifischzähne. Nur ihre Augen waren wie zuvor moosgrün und groß und blickten entsetzt.
Ich heiße nicht Suren, hätte sie am liebsten gesagt. Und das hier ist ein Trick. Das bin ich nicht. Doch noch während sie die Worte dachte, hörte sie selbst, wie ähnlich Suren ihrem eigenen Namen war. Suren. Ren. Wren. Eine kindliche Abkürzung.
Wechselbalg.
»Steh auf«, sagte die riesige lauernde Gestalt mit den messerlangen Nägeln. Bogdana. »Du gehörst nicht hierher.«
Wren lauschte den Geräuschen des Hauses, dem Summen der Heizung, dem fernen Kratzen der Krallen, als der Familienhund im Schlaf durch seine Träume raste und mit den Pfoten über den Boden scharrte. Sie versuchte, sich sämtliche Geräusche zu merken. Mit von Tränen verschwommenem Blick prägte sie sich ihr Zimmer ein, von den Buchtiteln auf den Regalbrettern bis zu den Glasaugen ihrer Puppen. Ein letztes Mal streichelte sie das Kunstfell ihres Fuchses und schob ihn weiter nach unten, tiefer unter die Bettdecke. Wenn er dort blieb, war er in Sicherheit. Erschauernd glitt sie aus dem Bett.
»Bitte«, sagte sie noch einmal.
Lord Jarel zog grausam einen Mundwinkel hoch. »Die Sterblichen wollen dich nicht mehr haben.«
Wren schüttelte den Kopf, denn das konnte gar nicht stimmen. Ihre Mutter und ihr Vater liebten sie. Ihre Mutter schnitt die Kruste von ihren Broten und gab ihr ein Küsschen auf die Nasenspitze, um sie zum Lachen zu bringen. Ihr Vater drückte sie an sich, wenn sie einen Film schauten, und brachte sie ins Bett, wenn sie auf dem Sofa einschlief. Sie wusste, dass sie sie liebten. Doch die Zuversicht, mit der Lord Jarel auftrat, erschreckte sie zutiefst.
»Wenn sie dem Wunsch Ausdruck verleihen, dass du bei ihnen bleiben sollst«, sagte Lady Nore erstmals mit sanfter Stimme, »wollen wir es dir erlauben.«
Wren tappte mit klopfendem Herzen in den Flur und rannte ins Elternschlafzimmer, als hätte sie einen Albtraum gehabt. Mit ihren schlurfenden Schritten und den abgerissenen Atemzügen weckte sie sie. Ihr Vater richtete sich auf, zuckte zusammen und legte schützend einen Arm um ihre Mutter, die bei Wrens Anblick losschrie.
»Keine Angst«, sagte Wren, blieb neben dem Bett stehen und zerknüllte die Bettdecke mit ihren kleinen Fäusten. »Ich bin’s, Wren. Sie haben irgendetwas mit mir gemacht.«
»Verschwinde, du Ungeheuer!«, rief ihr Vater barsch. Seine Stimme war so furchterregend, dass sie an die Kommode zurückwich. Sie hatte ihn noch nie so brüllen hören, und schon gar nicht gegen sie gerichtet.
Die Tränen liefen ihr über die Wangen. »Ich bin’s«, sagte sie noch einmal, und ihre Stimme brach. »Eure Tochter. Ihr liebt mich.«
Das Zimmer sah genauso aus wie immer. Die Wände in Hellbeige. Ein breites Bett mit braunen Hundehaaren auf der weißen Bettdecke. Ein Handtuch lag neben dem Wäschekorb, als hätte jemand es geworfen und nicht getroffen. Es roch nach dem Ofen und ein bisschen nach Benzin aus einer Creme zum Abschminken. Doch es war die albtraumhafte Zerrspiegelversion, in der sich alles ins Schreckliche verkehrte.
Unten bellte der Hund, es klang nach einer verzweifelten Warnung.
»Worauf warten Sie? Schaffen Sie das Ding hier raus«, knurrte Wrens Vater mit einem auffordernden Blick zu Lady Nore und Lord Jarel, als würde er gar nicht sie sehen, sondern menschliche Autoritätsfiguren.
Wrens Schwester kam in den Flur, offenbar von dem Geschrei geweckt, und rieb sich die Augen. Rebecca würde ihr bestimmt helfen, Rebecca, die sie in der Schule vor Mobbing schützte und zur Kirmes mitnahm, obwohl alle anderen kleinen Schwestern nicht mitdurften. Doch als sie Wren sah, hüpfte Rebecca erschrocken jaulend ins Bett und schlang die Arme um ihre Mutter.
»Rebecca«, flüsterte Wren, doch ihre Schwester vergrub ihr Gesicht nur noch tiefer im Nachthemd der Mutter.
»Mom«, flehte Wren mit tränenerstickter Stimme, aber auch ihre Mutter wollte sie nicht ansehen. Wrens Schultern zuckten, sie schluchzte herzzerreißend.
»Das ist unsere Tochter«, sagte ihr Vater und drückte Rebecca an sich, als hätte Wren versucht, ihn reinzulegen.
Rebecca, die ebenfalls adoptiert war. Die genau auf dieselbe Weise zu ihnen gehören sollte wie Wren.
Wren kroch aufs Bett und weinte so sehr, dass sie kaum noch sprechen konnte. Bitte lasst mich hierbleiben. Ich bin auch brav. Es tut mir schrecklich, schrecklich leid, was auch immer ich getan habe, aber ihr dürft nicht zulassen, dass sie mich mitnehmen. Mommy, Mommy, Mommy, ich liebe dich, bitte, Mommy.
Ihr Vater wollte sie mit dem Fuß wegschubsen und drückte ihn gegen ihren Hals. Dennoch streckte sie kreischend die Hände nach ihm aus.
Als sie mit ihren kleinen Fingern seine Wade berührte, verpasste er ihr einen Tritt gegen die Schulter, sodass sie vom Bett fiel. Aber Wren kroch zurück, weinte und flehte und wehklagte vor Unglück.
»Das reicht«, krächzte Bogdana. Sie riss Wren an sich und strich ihr mit einem ihrer langen Nägel beinahe sanft über die Wange. »Komm, Kind, ich trage dich.«
»Nein«, rief Wren und krallte die Finger ins Laken. »Nein. Nein. Nein.«
»Es ist nicht recht, dass Menschen dir Gewalt angetan haben, dir, die du uns gehörst«, sagte Lord Jarel.
»Uns, die verletzen«, stimmte Lady Nore zu. »Uns, die bestrafen. Niemals ihnen.«
»Sollen sie wegen dieser Beleidigung sterben?«, fragte Lord Jarel. Es wurde still im Zimmer, nur Wren schluchzte vernehmlich.
»Sollen wir sie umbringen, Suren?«, fragte er noch einmal lauter. »Sollen wir ihr Schoßhündchen hereinholen und es verzaubern, damit es sie angreift und ihnen die Kehlen herausreißt?«
Bei diesen Worten hörte Wren vor Wut und Bestürzung fast auf zu weinen. »Nein!«, schrie sie. Sie konnte sich nicht mehr beherrschen.
»Dann hör zu und lass das Weinen sein«, befahl Lord Jarel. »Du kommst freiwillig mit oder ich erschlage alle in diesem Bett. Erst das Kind und dann die anderen.«
Rebecca heulte verängstigt auf und Wrens Menscheneltern betrachteten sie entsetzter als zuvor schon.
»Ich gehe mit«, sagte Wren schließlich mit einem schluchzenden Unterton, den sie nicht unterdrücken konnte. »Wenn mich niemand liebt, gehe ich mit.«
Die Sturmvettel nahm sie auf den Arm und dann waren sie fort.
Zwei Jahre später geriet Wren ins Scheinwerferlicht einer Polizeipatrouille, als sie auf dem Seitenstreifen des Highways unterwegs war. Ihre Schuhsohlen waren abgenutzt, als hätte sie sie durchgetanzt, ihre Kleidung war steif von Meersalz, und Narben verunstalteten die Haut an ihren Handgelenken und Wangen.
Als der Polizeibeamte sie befragte, konnte oder wollte sie nicht antworten. Sie fauchte alle an, die ihr zu nahe kamen, versteckte sich in dem Raum, in den man sie gebracht hatte, hinter der Pritsche, und weigerte sich, der Dame, die den Polizeibeamten begleitete, einen Namen oder eine Adresse zu nennen.
Es tat weh, wie sie lächelten. Alles tat weh.
Als sie ihr den Rücken zuwandten, war sie weg.
Kapitel 1
An der Neigung des Mondes lese ich ab, dass es halb elf ist, als meine Unschwester durch die Hintertür kommt. Sie ist im zweiten Collegejahr und bleibt lange auf. Während ich aus der Dunkelheit zuschaue, stellt sie eine leere Müslischale auf die oberste Stufe der splitternden und durchhängenden Veranda. In die gießt sie gluckernd Milch aus einem Tetrapack. Sie verschüttet ein wenig. Dann geht sie in die Hocke und blickt stirnrunzelnd zu den Bäumen.
Einen unmöglichen Augenblick lang scheint es, als würde sie mich ansehen.
Ich ziehe mich tiefer in die Finsternis zurück.
In der Luft hängt der Geruch von Kiefernnadeln, gemischt mit welkendem Laub und dem Moos, das ich zwischen meinen nackten Zehen zerdrücke. Die Brise trägt den Gestank fauligen, zuckerhaltigen Bodensatzes herüber, der noch in den Flaschen in der Recyclingtonne klebt, und den Geruch dessen, was unten im Mülleimer verdirbt, sowie das chemisch süße Parfüm meiner Unschwester.
Ich beobachte sie gierig.
Bex stellt die Milch einer Katze aus der Nachbarschaft hin, doch ich tue so, als täte sie es für mich. Ihre vergessene Schwester.
Sie bleibt ein paar Minuten dort stehen, während die Nachtfalter über ihren Kopf hinwegsausen und die Mücken summen. Erst als sie ins Haus zurückkehrt, schleiche ich näher heran und werfe einen Blick durchs Fenster auf meine Unmutter, die vor dem Fernseher strickt. Mein Unvater sitzt in der Frühstücksecke und beantwortet E-Mails auf seinem Laptop. Er legt die Hand an die Augen, offenbar ist er müde.
Am Hof der Zähne wurde ich bestraft, wenn ich die Menschen, die mich großgezogen hatten, Mutter und Vater nannte. Menschen sind Tiere, sagte Lord Jarel gerne, und mit dem Tadel fing ich mir eine atemberaubend brutale Ohrfeige ein. Dreckige Tiere. Ihr seid nicht von einem Blut.
Ich gewöhnte mir an, sie als Unmutter und Unvater zu bezeichnen, um Lord Jarels Unmut zu entgehen, und so halte ich es noch immer, um mich daran zu erinnern, was sie mir bedeuteten und wie es nie wieder sein wird. Um mich daran zu erinnern, dass ich nirgends und zu niemandem dazugehöre.
Meine Nackenhaare stellen sich auf. Als ich mich umdrehe, entdecke ich eine Eule auf einem hohen Ast, die mich mit einem Schwenk ihres Kopfes beobachtet. Nein, doch keine Eule.
Ich hebe einen Stein auf und schleudere ihn auf die Kreatur.
Sie nimmt die Gestalt eines Kobolds an und fliegt schreiend und flügelschlagend in den Himmel. Dort dreht sie zwei Runden und gleitet anschließend höher Richtung Mond.
Das hiesige Kleine Volk ist mir nicht freundlich gesinnt. Dafür habe ich gesorgt.
Noch ein Grund, warum ich niemand bin, nirgends verhaftet.
Nachdem ich der Versuchung widerstanden habe, länger im Hinterhof zu verweilen, in dem ich früher gespielt habe, mache ich mich auf den Weg zu den Zweigen eines Weißdorns am Stadtrand. Ich halte mich an die trüben Gefilde des verschatteten Baumbestands, während meine nackten Füße wie von allein den Weg durch die Nacht finden. Am Eingang zum Friedhof halte ich an.
Der Weißdorn ragt mit seinen weißen Vorfrühlingsblüten hoch über den Grabsteinen auf. Verzweifelte Einheimische, vor allem Teenager, kommen hierher und binden Wünsche an die Äste.
Die Geschichten habe ich schon als Kind gehört. Er wird der Teufelsbaum genannt. Wenn man drei Mal dorthin ging und drei Wünsche daran band, erschien angeblich der Teufel. Er würde einem geben, was man verlangt hatte, und sich im Gegenzug nehmen, was er wollte.
Allerdings ist es nicht der Teufel. Da ich mittlerweile lange genug unter dem Kleinen Volk gelebt habe, erkenne ich in der Kreatur eine Glaistig, eine aus dem Kleinen Volk mit Ziegenfüßen und einer Vorliebe für Menschenblut.
Ich klettere in eine Astgabel und warte. Die Blüten rieseln von den schaukelnden Ästen. Ich lehne meine Wange an die raue Rinde und lausche dem leisen Rascheln der Blätter. Die Gräber auf dem Friedhof rund um den Weißdorn sind über hundert Jahre alt und die Grabsteine sind verwittert und bleich wie Knochen. Da ihnen niemand mehr einen Besuch abstattet, sind sie der geeignete Ort für die verzweifelten Menschen, die nicht gesehen werden wollen.
Ein paar Sterne zwinkern mir durch das Kronendach aus Blüten zu. Am Hof der Zähne fertigte ein Nisse Himmelskarten an, aus denen er die verheißungsvollsten Tage für Folter, Mord und Verrat las.
Ich blicke nach oben, doch ich kann die Rätsel nicht erkennen, die in die Sterne geschrieben sind. Meine magische Erziehung lässt zu wünschen übrig, meine menschliche ist durchwachsen.
Kurz nach Mitternacht kommt die Glaistig mit klappernden Hufen. Sie trägt einen langen burgunderroten Mantel, der bis zum Knie reicht und ihre Ziegenfüße betonen soll. Ihr rindenbraunes Haar ist hochgesteckt und zu einem festen Zopf geflochten.
Neben ihr fliegt ein Waldgeist mit heuschreckengrüner Haut und passenden Flügeln. Er ist kaum größer als ein Kolibri und schwirrt rastlos durch die Lüfte.
Die Glaistig wendet sich an ihren geflügelten Begleiter. »Der Prinz von Elfenheim? Wie spannend, Königliche so in unserer Nähe zu wissen.«
Bei dem Wort Prinz schlägt mein Herz dumpf.
»Verwöhnt, sagt man«, zwitschert der Waldgeist. »Und wild. Viel zu verantwortungslos für einen Thron.«
Das klingt nicht nach dem Jungen, den ich kannte, aber in den vier Jahren seit unserer letzten Begegnung wurde er sicherlich in alle Freuden des Hohen Hofes eingeführt und hat alle vorstellbaren verdorbenen Lüste bis zum Überdruss ausgekostet. Kriecher und Schmeichler dürften heutzutage derart um seine Aufmerksamkeit betteln, dass ich bestimmt nicht einmal nahe genug herankäme, um seinen Mantelsaum zu küssen.
Der Waldgeist fliegt hoch und flitzt davon, zum Glück, ohne sich durch das Astwerk des Baumes zu schlängeln, in dem ich hocke. Ich rücke in Position, um aufmerksam zuzuschauen.
In dieser Nacht kommen drei Menschen mit ihren Wünschen, darunter ein junger Mann mit rötlichen Haaren, mit dem ich in dem Jahr vor meiner Entführung in die vierte Klasse gegangen bin. Seine Finger zittern, als er seinen Zettel mit einem Faden an den Zweig bindet. Dann kommt eine ältere Frau mit einem Buckel, die sich beständig die Augen wischt und deren Zettel mit Tränen befleckt ist, bevor sie ihn mit einem nervösen Zucken befestigt. Der dritte ist ein sommersprossiger Mann mit breiten Schultern und einer Baseballkappe, die er tief ins Gesicht gezogen hat.
Der Sommersprossige kommt bereits zum dritten Mal und bei seiner Ankunft tritt die Glaistig aus der Dunkelheit heraus. Der Mann stöhnt ängstlich auf. Er hat nicht damit gerechnet, dass das alles echt ist. Die meisten glauben nicht daran und blamieren sich durch ihre Reaktionen, ihr Entsetzen und die Laute, die sie von sich geben.
Die Glaistig fordert ihn auf, ihr seinen Wunsch zu nennen, obwohl er ihn schon drei Mal an drei verschiedenen Tagen auf drei verschiedene Zettel geschrieben hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Wünsche jemals liest.
Im Gegensatz zu mir. Dieser Mann braucht Geld, weil er sich geschäftlich verkalkuliert hat. Als er es der Glaistig flüsternd berichtet, dreht er an seinem Hochzeitsring. Anschließend nennt sie ihre Bedingungen – sieben Monate und sieben Tage lang muss er ihr einen Würfel frisches Menschenfleisch bringen. Er kann es sich nach Belieben selbst herausschneiden oder es bei anderen tun.
Eifrig stimmt er zu, und lässt es geschehen, dass sie eine verzauberte Lederschnur um sein Handgelenk bindet.
»Die wurde aus meiner eigenen Haut gefertigt«, sagt sie zu ihm. »Durch sie kann ich dich finden, auch wenn du dich noch so gut vor mir versteckst. Kein menschengemachtes Messer kann die Schnur durchschneiden, und falls du dein Versprechen nicht hältst, wird sie sich zuziehen und die Adern in deinem Arm durchschneiden.«
Jetzt zeichnet sich erstmals Panik auf seinen Gesichtszügen ab, obwohl er sie von Anfang an hätte empfinden sollen. Zu spät, und irgendwie weiß er es auch. Doch schon im nächsten Moment verdrängt er die neue Erkenntnis wieder.
Einiges scheint zu schrecklich, um möglich zu sein. Bald wird er erfahren, dass das Schlimmste, was er sich vorstellen kann, erst der Anfang von dem ist, was sie ihm antun will. Ich kann mich erinnern, wie es mir selbst dämmerte, und werde es ihm hoffentlich ersparen.
Dann fordert die Glaistig den Mann auf, Laub zu sammeln. Für jedes Blatt in seinem Haufen bekommt er einen frischen Zwanzig-Dollar-Schein. Er hat drei Tage Zeit, das Geld auszugeben, bevor es sich in Luft auflöst.
Auf dem Zettel, den er an den Baum gebunden hat, stand, er braucht $40.000. Das sind zweitausend Blätter. Der Mann kehrt einen möglichst großen Haufen zusammen und sucht auf dem gepflegten Friedhof verzweifelt nach weiterem Laub. Er sammelt Blätter an dem kleinen Baumbestand am Rand und rupft Blätter von den wenigen Bäumen mit niedrig hängenden Ästen. Beim Anblick dessen, was er schließlich aufgehäuft hat, muss ich an ein Spiel auf der Kirmes denken, bei dem man die Anzahl von Jelly-Beans in einem Glas erraten muss.
Dabei habe ich schlecht abgeschnitten, und ich fürchte, er kann es auch nicht besser.
Mit einer gelangweilten Handbewegung verzaubert die Glaistig die Blätter in Geldscheine und der Mann stopft sich eilig die Taschen voll. Als der Wind sie aufwirbelt und auf die Straße fegt, rennt er hinterher.
Das erheitert die Glaistig offenbar, doch sie ist klug genug, nicht zu verweilen, um ihn auszulachen. Er soll lieber nicht merken, wie krass sie ihn hereingelegt hat. Sie taucht in der Nacht unter und zieht ihre Magie zusammen, um sich damit zu verhüllen.
Als der Mann sich die Taschen vollgestopft hat, steckt er weitere Geldscheine in sein Hemd, wo sie an seinem Bauch haften und einen künstlichen Wanst bilden. Sobald er den Friedhof verlässt, lasse ich mich lautlos vom Baum gleiten.
Ich folge ihm mehrere Häuserblocks weit, bis ich eine Chance sehe, ihn einzuholen und am Handgelenk zu packen. Bei meinem Anblick schreit er.
Er brüllt wie damals meine Unmutter und mein Unvater.
Obwohl ich bei dieser Reaktion zusammenzucke, sollte ich mich nicht wundern. Ich weiß, wie ich aussehe.
Meine Haut ist blassblau wie die einer Leiche. Mein Kleid mit Moos und Matsch beschmiert. Meine Zähne sind wie dafür gemacht, Fleisch vom Knochen zu reißen. Meine Ohren sind spitz, verborgen unter verfilzten blauen Haaren, die nur wenig dunkler sind als meine Haut. Ich bin keine Pixie mit hübschen Mottenflügeln und auch keine Adlige, deren Schönheit die Sterblichen vor Verlangen in Narren verwandelt. Nicht einmal eine Glaistig bin ich, die kaum eine Verzauberung bräuchte, wenn ihre Röcke lang genug wären.
Der Mann will sich losreißen, aber ich bin bärenstark. Meine scharfen Zähne machen kurzen Prozess mit der Schnur der Glaistig und ihrem Fluch. Obwohl ich nie richtig gelernt habe, mich ordentlich zu verzaubern, habe ich mir am Hof der Zähne beigebracht, geschickt Verwünschungen und Flüche zu brechen. Es war nötig, weil mir so viele davon auferlegt wurden.
Ich drücke dem sommersprossigen Mann einen seiner eigenen Zettel in die Hand. Auf der einen Seite steht sein Wunsch, auf die andere habe ich mit Bex’ Filzstift Nimm deine Familie und hau ab geschrieben. Bevor du ihnen etwas antust. Denn das wirst du tun.
Er blickt mir starr nach, als ich davonrase. Als wäre ich das Monster.
Genau den gleichen Handel habe ich schon oft beobachtet. Alle sagen sich am Anfang, dass sie mit ihrer eigenen Haut bezahlen werden. Aber sieben Monate und sieben Tage sind eine lange Zeit, und es ist nicht gerade leicht, sich jede Nacht einen Würfel Fleisch rauszuschneiden. Es tut furchtbar weh, mit jeder neuen Verletzung verschärft sich der Schmerz. Es dauert nicht lang, bis man mit gutem Gewissen hier und da anderen etwas wegschneidet. Hat man das schließlich nicht alles ihretwegen getan? Von da an geht es schnell bergab.
Erschauernd gebe ich mich der Erinnerung hin, wie meine eigene Unfamilie mich entsetzt und angewidert angesehen hat. Menschen, an deren immerwährende Liebe ich geglaubt hatte. Erst ein knappes Jahr danach begriff ich, dass Lord Jarel ihre Liebe weggezaubert hatte. Daher war er so sicher, dass sie mich nicht mehr haben wollten.
Ich weiß bis heute nicht, ob dieser Zauber immer noch wirkt.
Und ich weiß ebenso wenig, ob Lord Jarel ihren tatsächlich vorhandenen Abscheu vor mir nur verstärkt oder vollständig heraufbeschworen hat.
Das ist meine Rache am Elfenreich, die Flüche der Glaistig aufzutrennen und jeden Zauber, auf den ich stoße, unwirksam zu machen, alle und jeden zu befreien, die umgarnt wurden. Es spielt keine Rolle, ob der Mann zu schätzen weiß, was ich für ihn getan habe. Mir reicht der Frust der Glaistig, wenn ihr ein weiterer Mensch durch die Lappen geht.
Allen kann auch ich nicht helfen. Ich kann sie nicht alle davon abhalten, ihr Angebot anzunehmen und den Preis dafür zu zahlen. Außerdem ist die Glaistig wahrhaftig nicht die Einzige, die solche Händel anbietet. Aber ich gebe mein Bestes.
Als ich endlich zu meinem Elternhaus zurückkehre, liegt meine Unfamilie bereits im Bett. Ich hebe den Riegel und schlüpfe ins Haus. Da ich im Dunkeln gut sehen kann, bewege ich mich problemlos durch die Zimmer, gehe zum Sofa und drücke den halb fertigen Pullover meiner Unmutter an meine Wange. Ich genieße das Gefühl der weichen Wolle, den vertrauten Geruch, und muss an ihre Stimme denken, daran, wie sie am Fußende meines Bettes gesessen und mich in den Schlaf gesungen hat.
Funkel, funkel, kleiner Stern.
Ich schaue in den Mülleimer und hole die Reste vom Abendessen heraus, knusprige Steakstücke und klumpiges Kartoffelpüree pappen mit etwas zusammen, das offenbar zu einem Salat gehörte. Das Ganze ist ein Durcheinander aus zerknüllten Servietten, Plastikverpackungen und Gemüseschalen. Zum Nachtisch gönne ich mir eine Pflaume, die an einem Ende matschig ist, mit ein wenig Marmelade vom Boden eines Glases im Recyclingeimer.
Während ich das Essen herunterschlinge, stelle ich mir vor, wie ich mit ihnen am Tisch sitze. Ich stelle mir vor, ich wäre wieder ihre Tochter und nicht das, was von ihr übrig ist.
Ein Kuckuck, der sich wieder ins Ei quetschen will.
Kaum war ich in die Welt der Sterblichen zurückgekehrt, merkten andere Menschen sofort, dass mit mir etwas nicht stimmte. Das war gleich nach der Schlangenschlacht, als der Hof der Zähne aufgelöst wurde und Lady Nore geflohen war. Da ich nirgends sonst hinkonnte, kam ich hierher. Als mich an diesem ersten Abend ein paar Kinder in einem Park entdeckten, wollten sie mich mit Stöcken vertreiben. Ein größerer Junge stach zu und ich rannte hin und biss ihn mit meinen scharfen Zähnen in den Arm. Sein Fleisch klaffte auf wie eine Blechdose.
Keine Ahnung, was ich meiner Unfamilie antun würde, wenn sie mich erneut verstoßen würde. Ich bin kein harmloses Ding, kein Kind mehr, sondern ein ausgewachsenes Ungeheuer, genau wie jene, die mich entführt haben.
Noch immer verlockt es mich, den Zauber zu lösen und mich ihnen zu zeigen. Diese Versuchung geht nie weg, doch wenn ich mir vorstelle, mit meiner Unfamilie zu sprechen, muss ich auch an die Sturmvettel denken. Zweimal hat sie mich im Wald vor einer Menschenstadt aufgestöbert und zweimal den gehäuteten Kadaver eines Erhängten über meine Hütte gelegt. Angeblich wussten sie zu viel über das Kleine Volk. Ich will ihr keinen Anlass liefern, ihr nächstes Opfer in meiner Unfamilie zu suchen.
Als im oberen Stockwerk eine Tür geöffnet wird, erstarre ich, ziehe die Knie an die Brust und schlinge die Arme darum, um mich möglichst klein zu machen. Minuten später geht die Klospülung und ich atme wieder normal.
Ich sollte nicht herkommen. Manchmal gelingt es mir, mich von hier fernzuhalten, Moos und Käfer zu essen und aus verschmutzten Bächen zu trinken. Oder ich hole mir etwas aus den Mülltonnen der Restaurants und trenne Verwünschungen auf, damit ich mir einreden kann, ich wäre nicht wie die anderen.
Und doch zieht es mich immer wieder hierher. Hin und wieder spüle ich das Geschirr im Spülbecken oder stecke die nasse Wäsche in den Trockner wie ein Wichtelmännchen. Manchmal klaue ich Messer. Wenn ich supersauer bin, reiße ich ein paar von ihren Sachen in Fetzen, aber ab und zu döse ich auch hinterm Sofa, bis sie zur Schule oder zur Arbeit gehen und ich wieder hervorkriechen kann. Dann stöbere ich in den Zimmern nach Überbleibseln von mir, Zeugnissen zum Beispiel und Handarbeiten oder Familienfotos mit mir als Menschenmädchen mit meinen hellen Haaren, dem spitzen Kinn und den großen neugierigen Augen. Sie beweisen die Echtheit meiner Erinnerungen. In einer Kiste, auf der Rebecca steht, habe ich meinen alten Plüschfuchs gefunden und mich gefragt, welche plausible Erklärung sie für ein ganzes Zimmer mit meinen Sachen hatten.
Rebecca nennt sich mittlerweile Bex, ein neuer Name für ihren Neustart am College. Obwohl sie vermutlich behauptet, Einzelkind zu sein, spielt sie fast in jeder guten Erinnerung an meine Kindheit eine Rolle. Wie Bex vor dem Fernsehen Kakao trinkt und Marshmallows zermatscht, bis ihre Finger kleben. Wie Bex und ich uns auf der Rückbank im Auto treten, bis Mom schreit, wir sollen aufhören. Wie Bex in ihrem Kleiderschrank sitzt und wir mit Actionfiguren spielen und Batman hochhalten, damit er Iron Man küsst. Wie wir sagen: Komm, sie sollen heiraten und ein paar Katzen bekommen und glücklich sein bis an ihr Lebensende. Wenn ich mir vorstelle, aus diesen Erinnerungen ausgemerzt zu sein, knirsche ich mit den Zähnen und fühle mich noch mehr wie ein Geist.
Wäre ich in der Welt der Sterblichen aufgewachsen, wäre ich jetzt vielleicht mit Bex im Unterricht oder auf Reisen, oder wir würden Gelegenheitsjobs annehmen und gemeinsam neue Dinge entdecken. Diese Wren würde selbstverständlich ihren Platz in der Welt einnehmen, doch ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie ich mich in ihre Haut mogeln soll.
Manchmal setze ich mich aufs Dach und sehe den Fledermäusen zu, die im Mondschein herumwirbeln. Oder ich beobachte meine Unfamilie beim Schlafen und strecke gewagt die Hand zu meiner Unmutter aus, fast nah genug, um ihr übers Haar zu streichen. Heute Nacht esse ich jedoch nur.
Nachdem ich mit meiner geschnorrten Mahlzeit fertig bin, gehe ich zur Spüle, strecke den Kopf unter den Wasserhahn und schlürfe das süße, klare Wasser. Schließlich habe ich genug getrunken, wische mir mit dem Handrücken den Mund ab und gehe auf die Veranda. Auf der obersten Stufe trinke ich die Milch aus, die meine Unschwester dorthin gestellt hat. Ein Käfer ist in die Schale gefallen und dreht sich auf der Oberfläche im Kreis. Ich trinke ihn mit.
Als ich mich gerade in den Wald zurückstehlen will, kommt vom Innenhof ein Schatten heran, mit Fingern wie Äste.
Mit pochendem Herzen schleiche ich die Stufen hinunter und gleite unter die Veranda, gerade rechtzeitig, bevor Bogdana um die Ecke biegt. Sie ist genauso riesig und furchterregend, wie ich sie von dieser ersten Nacht in Erinnerung habe, ja schlimmer noch, da ich mittlerweile weiß, wozu sie fähig ist.
Mir stockt der Atem, und ich muss mich fest in die Wange beißen, um still und ruhig zu bleiben.
Ich sehe zu, wie Bogdana mit einem Fingernagel über die durchhängende Aluminiumverkleidung streicht. Ihre Finger sind so lang wie Blumenstängel, ihre Glieder spindeldürr wie Birkenstöcke. Unkrautartige Strähnen aus schwarzem, glattem Haar verdecken ihr pilzbleiches Gesicht und die winzigen, boshaft glänzenden Augen.
Sie lugt durch die Fensterscheiben ins Hausinnere. Wie leicht wäre es doch, einen Fensterrahmen hochzuschieben, hineinzuschleichen, meiner Unfamilie im Schlaf die Kehlen durchzuschneiden und allen die Haut abzuziehen.
Meine Schuld. Wäre es mir gelungen, fernzubleiben, hätte sie meine Fährte nicht gerochen. Sie wäre nicht hergekommen. Meine Schuld.
Jetzt habe ich genau zwei Möglichkeiten. Entweder bleibe ich, wo ich bin, und höre ihnen beim Sterben zu. Oder ich locke Bogdana vom Haus weg. Eigentlich habe ich gar keine Wahl, aber die Angst ist seit meiner Entführung aus der Menschenwelt meine ständige Begleiterin. Das Entsetzen ist tief in mein Knochenmark eingebrannt.
Allerdings ist der Wunsch, dass meine Unfamilie am Leben bleibt, stärker als das Bedürfnis, mich in Sicherheit zu bringen. Auch wenn ich nicht mehr dazugehöre, muss ich sie retten, denn wenn sie nicht mehr da wären, wäre auch der letzte Schnipsel meiner Vergangenheit getilgt, und ich würde haltlos weitertreiben.
Nach einem tiefen Atemzug stürze ich unter der Veranda hervor und renne zur Straße, hinaus aus der Deckung des Waldes, wo sie mich locker einholen kann. Achtlos laufe ich über den Rasen, ohne auf die zerbrechenden Zweige unter meinen nackten Füßen zu achten. Jedes Knacken schallt durch die Nachtluft.
Ich sehe mich nicht um, aber ich weiß, dass Bogdana mich gehört hat und sich mit geblähten Nasenlöchern umgedreht und gewittert hat. Bewegung zieht den Blick des Raubtiers an und weckt den Jagdinstinkt.
Das Scheinwerferlicht der Autos tut mir in den Augen weh, als ich auf den Bürgersteig trete. Laub hängt in meinen verfilzten Haaren und mein – ehemals weißes – Kleid hat jetzt eine stumpfe, fleckige Farbe wie das Gewand, das man bei einem Geist erwarten würde. Keine Ahnung, ob meine Augen glänzen wie die eines Tieres. Wundern würde es mich nicht.
Die Sturmvettel verfolgt mich geschwind wie eine Krähe und gewiss wie mein Untergang.
Ich zwinge meine Beine, schneller zu rennen.
Spitze Steinchen und Glasscherben bohren sich in meine Füße. Als ich zusammenzucke und stolpere, glaube ich, den Atem der Hexe bereits zu spüren. Die Angst verleiht mir die Kraft, weiterzustürmen.
Nachdem ich sie nun erfolgreich abgelenkt habe, muss ich sie irgendwie wieder loswerden. Falls sie auch nur einen Moment nicht aufpasst, kann ich entwischen und mich verstecken. Im Verstecken bin ich sehr gut geworden, damals am Hof der Zähne.
Ich biege in eine Gasse. In dem Maschendrahtzaun am Ende der Gasse ist eine Lücke, durch die ich mich hindurchzwängen kann. Ich renne darauf zu und rutsche über Dreck und Müll. Schließlich pralle ich auf den Zaun und quetsche mich in die Öffnung, wo das Metall meine Haut aufkratzt und der Eisengestank schwer in der Luft hängt.
Während ich weiterrase, höre ich, wie der Zaun wackelt, weil Bogdana drüberklettert.
»Bleib stehen, du kleine Närrin!«, ruft mir die Sturmvettel nach.
Die Panik stählt meine Gedanken. Bogdana ist zu schnell, zu sicher. Sie hat schon lange vor meiner Geburt Sterbliche und Elfenvolk gleichermaßen getötet. Wenn sie Blitze heraufbeschwört, bin ich so gut wie tot.
Mein Instinkt rät mir, mich in meinen Teil des Waldes zu schlagen und in dem höhlenartigen Gewölbe zu verkriechen, das ich aus Weidenzweigen gewoben habe. Ich möchte mich auf meinen Boden aus glatten Flusssteinen legen, die ich nach einem Gewitter in den Matsch gedrückt habe, bis die Fläche flach genug war, um darauf zu schlafen. Möchte mich in meine drei Decken kuscheln, obwohl sie von Motten zerfressen, schmutzig und an einer Ecke angesengt sind.
Dort habe ich auch ein Schnitzmesser, das so lang ist wie Bogdanas Finger, aber schön scharf und besser als die beiden anderen Messer, die ich bei mir trage.
Ich flitze auf eine Apartmentanlage zu und renne durch die Lichtkreise. Dann überquere ich Straßen und einen Spielplatz, wo mir das Klirren der Schaukelketten in den Ohren hallt.
Obwohl ich im Aufheben von Verwünschungen besser bin als im Verzaubern, habe ich meine Höhle magisch geschützt, sodass jeder, der sich ihr nähert, von Grauen erfüllt wird. Die Sterblichen meiden den Ort und selbst dem Kleinen Volk wird mulmig.
Ich hege wenig Hoffnung, dass ich Bogdana damit abhalten kann, aber für Hoffnung besteht ohnehin kein Anlass.
Bogdana war die Einzige, vor der sich Lady Nore und Lord Jarel fürchteten. Eine Hexe, die Stürme heraufbeschwören konnte, zahllose Jahre auf dem Buckel hatte und mehr über Magie wusste als die meisten Lebewesen. Am Hof der Zähne habe ich gesehen, wie sie Menschen aufgeschlitzt und verschlungen oder Angehörige des Kleinen Volkes wegen einer Beleidigung mit diesen langen Fingern ausgeweidet hat. Blitze zuckten, wenn sie sich ärgerte.
Bogdana half Lady Nore und Lord Jarel bei dem Plan, ein Kind zu empfangen und mich bei den Menschen zu verstecken. Gleichzeitig hat sie häufig mit angesehen, wie ich am Hof der Zähne gequält wurde.
Lord Jarel und Lady Nore ließen mich nie vergessen, dass ich trotz meines Königinnentitels ihr Eigentum war. Lord Jarel nahm mich gern an die Leine und zerrte mich wie ein Tier umher. Lady Nore bestrafte mich grausam für jede eingebildete Kränkung, bis ich ein knurrendes Biest wurde, das biss und kratzte und außer Schmerz kaum etwas spürte.
Einmal warf Lady Nore mich in die sturmumtoste verschneite Einöde und versperrte die Tore der Festung.
Wenn es dir nicht passt, Königin zu sein, wertloses Balg, dann such dir dein Glück, sagte sie.
Tagelang irrte ich umher. Außer Eis gab es nichts zu essen und nur der kalte heulende Wind war zu hören. Wenn ich weinte, gefroren die Tränen auf meinen Wangen. Doch ich schleppte mich weiter und hoffte gegen jede Vernunft, jemandem zu begegnen, der mich rettete oder mir zur Flucht verhalf.
Bogdana war es, die mich schließlich in ihren Mantel hüllte und zurückbrachte, nachdem ich im Schnee zusammengebrochen war.
Die Hexe trug mich in mein Zimmer mit seinen Wänden aus Eis und legte mich auf das mit Fellen bedeckte Bett. Sie legte die überlangen Finger auf meine Stirn und blickte mit ihren schwarzen Augen auf mich hinunter. Dann schüttelte sie ihre wilden sturmzerzausten Haare. »Du wirst nicht immer so klein und ängstlich bleiben«, sagte sie. »Du bist eine Königin.«
Ihr Tonfall veranlasste mich, den Kopf zu heben. Es hörte sich an, als sollte ich stolz darauf sein.
Als der Hof der Zähne nach Süden in den Krieg gegen Elfenheim zog, kam Bogdana nicht mit. Ich dachte, ich würde sie nie wiedersehen, und das tat mir leid. Wenn sich überhaupt jemand um mich gekümmert hatte, dann sie.
Irgendwie ist es deshalb schlimmer, dass sie mich jetzt verfolgt und durch die Straßen hetzt.
Als ich höre, wie ihre Schritte näher kommen, beiße ich die Zähne zusammen und wappne mich für einen Sprint. Meine Lungen schmerzen, meine Muskeln streiken gleich.
Vielleicht, spreche ich mir gut zu, kann ich ja mit ihr reden. Vielleicht verfolgt sie mich nur, weil ich weggelaufen bin.
Als ich den Fehler begehe, mich umzuschauen, gerate ich aus dem Rhythmus. Ich taumele, und die Sturmvettel streckt eine lange Hand nach mir aus, die messerscharfen Nägel bereit zum Aufschlitzen.
Nein, vermutlich lässt sie doch nicht mit sich reden.
Mir bleibt nur noch eins übrig, also drehe ich mich blitzschnell um und schnappe mit den Zähnen in die Luft, während ich mich daran erinnere, sie in Fleisch zu schlagen. Während ich mich erinnere, wie gut es sich anfühlte, jemandem wehzutun, der mir Angst machte.
Ich bin nicht stärker als Bogdana. Auch nicht schneller oder schlauer. Aber möglicherweise bin ich verzweifelter. Ich will am Leben bleiben.
Die Hexe bremst ab, registriert meinen Gesichtsausdruck und macht noch einen Schritt auf mich zu. In ihrer Miene, in ihren schwarzen Augen, funkelt etwas, das ich nicht verstehe. Triumph. Ich sehne mich erneut nach meinem Schnitzmesser und ziehe eins der kleineren unter meinem Kleid hervor.
Es ist ein Klappmesser und ich muss es erst aufschnappen lassen.
Als ich Hufe klappern höre, denke ich aus unerfindlichen Gründen, die Glaistig würde dazukommen, um meine Niederlage mit anzusehen, um sich daran zu ergötzen. Wahrscheinlich hat sie Bogdana erst darauf aufmerksam gemacht, was ich treibe; sie ist der Grund für all das hier.
Doch es ist nicht die Glaistig, die aus dem dunklen Wald auftaucht. Ein junger Mann in einem goldenen Schuppenpanzerhemd mit Ziegenfüßen und Hörnern tritt in den Lichtkreis vor einem Gebäude. Er hält einen Degen mit schmaler Klinge in der Hand. Seine Miene ist ausdruckslos, als würde er träumen.
Ich bemerke die lohfarbenen Locken, die er hinter die spitzen Ohren gestrichen hat, den granatroten Umhang auf seinen breiten Schultern und die Narbe seitlich am Hals sowie den Stirnreif. Seine Haltung strahlt die Erwartung aus, die Welt möge sich seinem Willen beugen.
Am Himmel zieht es sich zu. Der junge Mann zeigt mit dem Degen auf Bogdana.
Dann flackert sein Blick zu mir. »Ihr habt uns auf eine lustige Verfolgungsjagd geführt.« Seine bernsteinfarbenen Augen leuchten wie bei einem Fuchs, doch es liegt keine Wärme darin.
Ich hätte ihm vorher sagen können, dass er Bogdana nicht aus den Augen lassen darf. Die Hexe sieht ihre Chance und stürzt sich mit ausgestreckten Händen auf ihn, bereit, ihm mit ihren Nägeln die Brust aufzureißen.
Bevor er reagieren müsste, wird sie von einem anderen Schwert aufgehalten, das ein Ritter in seiner behandschuhten Hand hält. Er trägt eine Rüstung aus braunem Leder mit breiten Streifen aus silbernem Metall. Sein brombeerfarbenes Haar ist kurz geschnitten, Misstrauen liegt in seinen dunklen Augen.
»Sturmvettel«, sagt er.
»Aus dem Weg, Schoßhündchen«, befiehlt sie dem Ritter. »Oder ich rufe einen Blitz, der dich an Ort und Stelle erschlägt.«
»Du magst am Himmel das Kommando führen«, kontert der gehörnte Mann mit dem goldenen Schuppenpanzer. »Doch wir befinden uns hier am Boden. Verschwinde, oder mein Freund durchbohrt dich, bevor du auch nur einen Nieselregen heraufbeschwörst.«
Bogdana dreht sich mit schmalen Augen zu mir um. »Ich werde wiederkommen, um dich zu holen, Kind«, sagt sie. »Und dann läufst du besser nicht davon.«
Mit diesen Worten weicht sie in die Dunkelheit zurück. Kaum ist sie weg, versuche ich, an dem Gehörnten vorbeizurennen und zu fliehen.
Er packt mich mit mehr Kraft am Arm, als ich ihm zugetraut hätte.
»Lady Suren«, sagt er.
Ich knurre tief in der Kehle, gehe mit meinen Nägeln auf ihn los und ziehe sie über seine Wange. Meine sind nicht ansatzweise so lang oder spitz wie Bogdanas, aber er blutet.
Er zischt vor Schmerzen, doch er lässt mich nicht los. Stattdessen reißt er mir die Handgelenke auf den Rücken und hält sie fest, da kann ich knurren und treten, so viel ich will. Schlimmer noch, das Licht fällt in einem neuen Winkel auf sein Gesicht, und ich erkenne endlich, wessen Haut ich unter den Fingernägeln habe.
Prinz Oak, Erbe von Elfenheim. Sohn des Hochverräters und Großgenerals sowie Bruder der sterblichen Hochkönigin. Oak, mit dem ich einst verlobt war. Der einst mein Freund war, obwohl er sich anscheinend nicht mehr daran erinnert.
Was hatte der Waldgeist über ihn gesagt? Verwöhnt, verantwortungslos und wild. Das glaube ich sofort. Trotz seiner glänzenden Rüstung ist er so schlecht ausgebildet, dass er nicht einmal versucht hat, meinen Angriff abzuwehren.
Oh, jetzt stecke ich in der Klemme.
»Alles wäre viel einfacher, Tochter von Verrätern, wenn Ihr von nun an genau das tut, was wir Euch sagen«, teilt mir der dunkeläugige Ritter in der Lederrüstung mit. Er hat eine lange Nase und die Ausstrahlung eines Elfs, der lieber salutiert als lächelt.
Ich will fragen, was sie mit mir vorhaben, aber ich habe meine Stimme schon so lange nicht mehr benutzt. Die Worte kommen durcheinandergewürfelt heraus und klingen anders als beabsichtigt.
»Was ist los mit ihr?«, fragt er und betrachtet mich stirnrunzelnd wie eine Art Insekt.
»Vermutlich führt sie ein wildes Leben«, antwortet der Prinz. »Fern von anderen.«
»Hat sie nicht wenigstens mit sich selbst gesprochen?«, fragt der Ritter und zieht die Augenbrauen hoch.
Ich knurre erneut.
Oak legt die Finger an seine Wange, verzieht das Gesicht und lässt die Hand wieder sinken. Er hat drei lange Wunden davongetragen, aus denen Blut rinnt.
Als er sich mir wieder zuwendet, erinnert mich sein Gesichtsausdruck irgendwie an seinen Vater Madoc, der nie glücklicher war, als wenn er in den Krieg ziehen durfte.
»Ich habe dir doch gesagt, dass vom Hof der Zähne noch nie etwas Gutes gekommen ist«, sagt der Ritter kopfschüttelnd. Dann holt er ein Seil und fesselt meine Handgelenke. Sicherheitshalber schlingt er das Seil noch einmal durch die Mitte. Er sticht mich nicht wie Lord Jarel, der mich an die Leine nahm, indem er eine Nadel mit einer silbernen Kette als Faden zwischen meinen Armknochen hindurchführte. Noch habe ich keine Schmerzen.
Aber das kommt noch, da bin ich sicher.
Kapitel 2
Während ich durch den Wald stapfe, schmiede ich Fluchtpläne. Ich mache mir keine Illusionen wegen meiner Strafe. Schließlich habe ich den Prinzen angegriffen. Und wenn sie von den aufgetrennten Verwünschungen wüssten, wären sie noch wütender.
»Sei nächstes Mal besser auf der Hut«, sagt der Ritter mit einem Blick auf Oaks Wunden.
»Am schwersten wurde meine Eitelkeit getroffen«, erwidert er.
»Du machst dir Sorgen um dein hübsches Gesicht?«, fragt der Ritter.
»Es gibt wirklich zu wenig Schönheit auf der Welt«, sagt der Prinz leichthin. »Aber meine größte Selbstgefälligkeit bezieht sich nicht darauf.«
Es kann kein Zufall sein, dass sie plötzlich fast zur gleichen Zeit, gerüstet und kampfbereit, auftauchten, als Bogdana am Haus meiner Unfamilie herumschnüffelte. Sie waren alle auf der Suche nach mir, und was auch immer der Grund sein mag, gefallen wird er mir sicher nicht.
Ich atme den vertrauten Geruch von nasser Rinde und aufgewirbeltem welkem Laub ein. Im Mondschein glänzen die Farne silbrig und die Schatten wabern im Wald.
Versuchshalber bewege ich meine Handgelenke, doch leider ist die Fessel stramm. Ich strecke die Finger und versuche, einen darunterzuschieben, aber die Knoten sind viel zu hart dafür.
»Ich weiß nicht, ob unsere Mission damit einen glücklichen Anfang nimmt«, schnaubt der Ritter. »Hätte der Kobold deine kleine Königin nicht gesichtet, würde die Hexe ihre Haut jetzt als Mantel tragen.«
Der Kobold mit dem Eulengesicht. Ich verziehe das Gesicht, weil ich nicht weiß, ob ich ihm dankbar sein soll. Schließlich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was sie mir antun wollen.
»Ist das nicht gerade die Bedeutung von Glück – rechtzeitig da zu sein?« Oak wirft einen schelmischen Blick in meine Richtung, wie zu einem wilden Tier, das zu zähmen vielleicht Spaß machen könnte.
Ich denke zurück an die Zeit am Hohen Hof, wie er da war, als ich für meine Verbrechen als Königin des treulosen Hofs der Zähne bestraft werden sollte. Ich war zehn und er war gerade neun geworden. Auch damals hatte man mich gefesselt. Ich denke zurück an die Zeit, als er dreizehn war und wir uns im Wald begegnet sind. Ich hatte ihn fortgeschickt.
Mit siebzehn ist er hochgewachsen und viel größer als ich, geschmeidig und muskulös. Das Mondlicht fängt sich in seinem Haar, warmes Gold mit Platin durchzogen, und dem Ponyscheitel um die kleinen Ziegenhörner. Seine Augen glänzen auffallend bernsteinfarben und auf der Nase hat er Sommersprossen. Dazu den Mund eines Schwindlers und die arrogante Ausstrahlung einer Person, der alle Wünsche erfüllt werden.
Die Schönheit des Kleinen Volkes ist anders als die der Sterblichen. Im Elfenreich gibt es Wesen von solch überragender Anmut, dass es schmerzt, sie anzusehen. Wesen, die so herrlich sind, dass Sterbliche bei ihrem Anblick weinen oder von der Sehnsucht besessen werden, sie noch einmal wiederzusehen. Einige sterben vielleicht gleich an Ort und Stelle.
Hässlichkeit kann im Elfenreich ebenso extravagant sein. Im Kleinen Volk gibt es Scheusale, die auf alle Lebewesen abscheulich wirken. Andere wiederum sind so übertrieben grotesk, so wollüstig, dass sie fast schon wieder schön sind.
Nicht, dass Sterbliche nicht reizend sein könnten – im Gegenteil, viele von ihnen sind hübsch –, aber ihre Schönheit fühlt sich nicht an, als würde sie auf einen einprügeln. Ich fühle mich von Oaks Schönheit schon ein wenig erschlagen.
Wenn ich ihn zu lange anschaue, möchte ich einen Bissen herausbeißen.
Ich senke den Blick auf meine schmutzigen, zerkratzten und wunden Füße und betrachte anschließend Oaks Hufe. Aus einem geklauten Biologiebuch weiß ich, dass Hufe aus dem gleichen Stoff sind wie Fingernägel: aus Keratin. Darüber wächst ein feines Fell in derselben Farbe wie seine Haare, das in einem Hosenaufschlag knapp unter dem Knie verschwindet und die seltsame Krümmung seiner Unterschenkel enthüllt. Eine enge Hose bedeckt seine Oberschenkel.
Ich erschauere in der Kraftanstrengung, die es mich kostet, nicht gegen meine Fesseln aufzubegehren.
»Ist Euch kalt?«, fragt er und bietet mir seinen Umhang aus besticktem Samt mit einem Muster aus Eicheln, Blättern und Zweigen an. Er ist schön gearbeitet und wirkt so weit entfernt von Elfenheim absurd fehl am Platz.
Dieses Spielchen kenne ich nur zu gut. Sich galant zu zeigen, während er mich gleichzeitig gefangen hält – als ob die kalte Luft mein einziges Problem wäre. Aber so müssen Prinzen sich vermutlich benehmen. Noblesse oblige und so weiter.
Da meine Hände gefesselt sind, weiß ich nicht, wie er sich das vorstellt. Als ich nicht antworte, legt er mir den Umhang auf die Schultern und bindet ihn am Hals zu. Ich lasse ihn gewähren, obwohl ich die Kälte gewohnt bin. Immer besser, etwas zu haben, als nicht zu haben, außerdem ist der Stoff weich.
Und er bedeckt meine Hände. Das bedeutet, niemand würde etwas merken, bevor es zu spät wäre, wenn es mir doch gelänge, meine Handgelenke zu befreien.
Damit hat er schon seinen zweiten Fehler begangen.
Ich will mich auf meine Flucht konzentrieren und der Hoffnungslosigkeit, die mich überkommt, keinen Raum geben. Selbst wenn ich meine Hände frei bewegen könnte, müsste ich noch weglaufen. Doch wenn mir das gelänge, könnte ich sie wahrscheinlich von meiner Fährte abbringen. Der Ritter mag gelernt haben, wie man einer Spur folgt, aber ich habe jahrelange Erfahrung darin, meine zu verwischen.
Über Oaks Fähigkeiten – falls er denn mehr kann, als ein kleiner Lord zu sein – weiß ich gar nichts. Möglicherweise hat er den Ritter trotz all seines großen Geredes und seines Stammbaums mitgenommen, damit er nicht stolpert und sich aus Versehen mit seinem schicken Degen aufspießt.
Wenn sie mich nur einen Augenblick in Ruhe ließen, könnte ich meine Arme nach unten bringen und durch ihren Kreis nach hinten treten, sodass die gefesselten Hände vor meinen Körper kämen. Und dann würde ich das Seil durchbeißen.
Mir fällt nicht der geringste Grund ein, warum sie mir diese Gelegenheit einräumen sollten. Dennoch wetze ich unter dem Schutz von Oaks Umhang meine Fesseln und versuche, sie möglichst zu dehnen.
Als wir den Wald verlassen, betreten wir eine mir unbekannte Straße. Die Häuser stehen weiter auseinander als in dem Wohnviertel meiner Unfamilie und sind baufälliger, mit verwilderten Rasenflächen. In der Ferne bellt ein Hund.
Dann werde ich auf einen Feldweg geführt, an dessen Ende ein verlassenes Haus mit Brettern vor den Fenstern steht. Das Gras ist so hoch, dass ein Rasenmäher vermutlich daran ersticken würde. Davor stehen zwei knochenweiße Elfenrösser. Die Wölbung ihrer Hälse ist deutlich länger als bei sterblichen Pferden.
»Dorthin?« Ich spreche das Wort klar und verständlich aus, wenngleich meine Stimme immer noch rau ist.
»Zu runtergekommen für Eure Hoheit?«, fragt der Ritter und zieht die Augenbrauen hoch, als wüsste ich nicht, wie schmutzig mein Kleid und meine Füße sind. Als wäre mir nicht bewusst, dass ich keine Königin mehr bin, oder als hätte ich vergessen, wie Oaks Schwester meinen Hof aufgelöst hat.
Ich ziehe die Schultern hoch. Wortspiele wie diese kenne ich – es gibt keine korrekte Antwort, und jede falsche wird bestraft. Deshalb halte ich den Mund und streife mit meinem Blick die Kratzer auf der Wange des Prinzen. Ich habe bereits zu viele Fehler begangen.
»Hört nicht auf Tiernan. Drinnen ist es gar nicht so übel«, sagt Oak mit einem höfischen Lächeln, das mich wohl davon überzeugen soll, dass ich nicht auf der Hut sein muss. Es bewirkt sofort das Gegenteil, denn die Erfahrung hat mich gelehrt, mich vor solch einem Lächeln zu fürchten. Er winkt ab und fährt fort. »Und dann können wir Euch erklären, warum wir dermaßen unhöflich waren.«
Unhöflich. So kann man es auch nennen.
Der Ritter – Tiernan – öffnet die Tür, indem er sich mit der Schulter dagegenlehnt. Da ich zwischen den beiden Männern hineingehe, besteht nicht die geringste Chance zur Flucht. Die verzogenen Holzdielen knarren unter Oaks Hufen.
Offenbar steht das Haus schon eine ganze Weile leer. Graffitis zieren die Blümchentapete, und unter der Spüle wurde ein Schrank herausgerissen, vermutlich um an Kupferrohre zu gelangen. Tiernan geleitet mich zu einem gesprungenen Plastiktisch, der mit ein paar verschrammten Stühlen in einer Küchennische steht.
Auf einem Stuhl sitzt ein Soldat mit einem Flügel anstelle des Arms. Er hat hellbraune Haut, langes mahagonibraunes Haar und überraschenderweise Augen so violett wie Eisenhut. Ich kenne ihn nicht, doch der Fluch, der auf ihm liegt, kommt mir bekannt vor. Oaks Schwester, die Hochkönigin, verwandelte nach der Schlangenschlacht jene Soldaten in Falken, die nicht bereuten, Madoc gefolgt zu sein. Der Fluch besagte, dass sie ein Jahr und einen Tag nicht jagen durften, wenn sie ihre ursprüngliche Gestalt zurückgewinnen wollten. Sie sollten nur von der Freundlichkeit anderer zehren. Ich weiß nicht, was es bedeutet, dass sein Fluch teilweise aufgehoben scheint. Wenn ich die Augen zusammenkneife, kann ich die Fäden der Magie sehen, die sich um ihn schlängeln, sich windend und rankend wie Wurzeln bei dem Versuch, wieder zu wachsen.
Keine Verwünschung, die leicht aufzutrennen wäre.
Außerdem entdecke ich an seinem Mund die dünnen Lederriemen und goldenen Verschlüsse eines Zaumzeugs. Ich erschauere, als ich es wiedererkenne. Auch das ist mir nur allzu bekannt.
Ein Werk des großen Schmieds Grimsen, im Auftrag meiner Eltern.
Lord Jarel legte mir dieses Zaumzeug vor langer Zeit an, als mein Wille lästig war und wie Spinnweben hinweggefegt werden musste. Beim Anblick des Zaumzeugs kommt all die Panik, all das Grauen, all die Hilflosigkeit wieder hoch, die ich gespürt habe, als die Riemen langsam in meine Haut sanken.
Später versuchte der Lord, den Hochkönig und die Hochkönigin damit hereinzulegen. Als es misslang, gelangte das Zaumzeug in ihre Hände, doch es erschüttert mich, dass Oak es einem Gefangenen angelegt hat, einfach so, als wäre es kein Zwang.
»Tiernan hat ihn vor der Festung Eurer Mutter gefangen genommen. Wir mussten uns über ihre Pläne informieren und er war äußerst hilfreich. Leider ist er auch extrem gefährlich.« Oak spricht mit mir, doch ich bin vollkommen auf das Zaumzeug fixiert. »Sie hat eine zusammengewürfelte Truppe aus Lehnsleuten. Und sie hat etwas gestohlen …«
»Mehr als etwas«, sagt der aufgezäumte ehemalige Falke.
Tiernan tritt gegen das Stuhlbein des Falken, doch der lächelt nur zu ihm hoch. Sie können den gezäumten Soldaten zwingen, alles zu sagen, alles zu tun, was sie wünschen, aber er ist in sich selbst viel sicherer angekettet als durch ein Seil. Ich bewundere seinen Trotz, und wenn er ihm noch so wenig nützt.
»Lehnsleute?«, wiederhole ich mit krächzender Stimme die Bemerkung des Prinzen.
»Sie hat die Festung des Hofes der Zähne eingenommen und einen neuen gegründet, nachdem der alte Hof aufgelöst wurde.« Oak zieht die Augenbrauen hoch. »Und sie verfügt über eine alte Magie. Sie kann etwas erschaffen. Soweit wir wissen, vor allem Wesen aus Stöcken und Holz, aber auch aus Körperteilen von Toten.«
»Wie denn?«, frage ich entsetzt.
»Spielt das eine Rolle?«, fragt Tiernan. »Ihr solltet sie unter Kontrolle halten.«
Hoffentlich erkennt er den Hass in meinen Augen. Nur weil die Hochkönigin Lady Nore gezwungen hat, mir nach der Schlacht die Treue zu schwören, nur weil ich ihr Befehle erteilen könnte, bedeutete das noch lange nicht, dass ich gewusst hätte, wie.
»Sie war ein Kind, Tiernan«, sagt Oak und überrascht mich. »So wie ich.«
Im Kamin glühen einige Scheite. Brummig geht Tiernan daneben in die Hocke und legt Holz von einem Stapel nach sowie zerknüllte Seiten, die er aus einem bereits zerrissenen Kochbuch reißt. Als eine Ecke des Papiers Feuer fängt, lodert die Flamme auf. »Nur ein Narr würde der ehemaligen Königin des Hofs der Zähne trauen.«
»Bist du ganz sicher, dass du unsere Verbündeten von unseren Feinden unterscheiden kannst?« Oak zieht einen langen Stock aus dem Holzhaufen, einen Kienspan. Er hält ihn ins Feuer, bis die Spitze Funken schlägt, und zündet anschließend die Dochte der im Raum verteilten Kerzen an. Kurz darauf flackern sie wie warme Lichtkreise und verrücken die Schatten.
Tiernans Blick schweift zu dem gezäumten Soldaten und verweilt dort, bevor er sich mir zuwendet. »Hungrig, kleine Königin?«
»Nennt mich nicht so«, krächze ich.
»Sind wir ein wenig griesgrämig, ja?«, fragt Tiernan. »Wie soll dieser arme Diener Euch denn bitte ansprechen?«
»Wren«, antworte ich, ohne auf seine Spöttelei einzugehen.
Oak beobachtet uns mit halb geschlossenen Augen. Ich kann nicht erraten, was er denkt. »Und möchtet Ihr nun etwas essen?«
Als ich den Kopf schüttele, verzieht der Ritter skeptisch das Gesicht, dreht sich dann um und greift zu einem Kessel, der bereits vom Feuer geschwärzt ist. Er füllt ihn am Wasserhahn im Badezimmer und hängt ihn an eine Stange, die sie provisorisch aus einem Holzstock angefertigt haben. Es gibt keinen Strom im Haus, aber das Wasser läuft noch.
Zum ersten Mal seit Langem denke ich ans Duschen. Wie sich meine Haare anfühlten, wenn sie gekämmt und entknotet waren, oder meine Kopfhaut, ohne vor Schmutz zu jucken.
Oak schlendert zu mir herüber. Ich sitze wegen meiner gefesselten Handgelenke mit gestrafften Schultern da.
»Lady Wren«, sagt er und sieht mich mit seinen bernsteinfarbenen Fuchsaugen direkt an. »Wenn ich Eure Fesseln losbinde, kann ich mich darauf verlassen, dass Ihr in der Zeit, die wir in diesem Haus verbringen, weder versucht zu entkommen noch uns anzugreifen?«
Ich nicke knapp.
Der Prinz lächelt mich spontan und verschwörerisch an. Mein Mund verrät mich, ich lächele zurück. Das erinnert mich daran, wie charmant er früher war, schon als Kind.
Ich frage mich, ob ich die Situation missverstanden habe, ob wir irgendwie auf der gleichen Seite stehen könnten.
Oak zieht ein Messer aus einem Handgelenkschoner, der unter seinem weißen Leinenhemd verdeckt war, und macht sich an meinen Fesseln zu schaffen.
»Nicht durchschneiden«, mahnt der Ritter. »Sonst müssen wir uns ein neues Seil besorgen. Vielleicht müssen wir sie ja wieder fesseln.«
Ich verkrampfe mich in der Erwartung, dass Oak sauer wird, weil Tiernan ihm Befehle erteilt. Als Angehöriger des Königshauses wird er normalerweise nicht von Untergebenen angeleitet, doch der Prinz schüttelt nur den Kopf. »Keine Sorge, ich löse mit der Spitze nur deine ausgeklügelten Knoten.«
Ich mustere den Ritter im Lichtschein des Feuers. Beim Kleinen Volk lässt sich das Alter schwer schätzen, aber er sieht nur wenig älter aus als Oak. Sein brombeerfarbenes Haar ist zerzaust, und in einem seiner spitzen Ohren trägt er ein Piercing, eine silberne Creole.
Ich lege die Hände in den Schoß und reibe mit den Fingern über die Abdrücke des Seils in meiner Haut. Sie wären nicht halb so tief, wenn ich nicht so intensiv versucht hätte, es abzustreifen.
Oak legt das Messer ab und sagt formvollendet: »Verehrte Lady, Elfenheim bittet Euch um Hilfe.«
Tiernan hebt den Blick vom Feuer, schweigt aber.
Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Aufmerksamkeit bin ich nicht gewohnt, und es bringt mich durcheinander, so im Mittelpunkt zu stehen. »Ich habe Eurer Schwester die Treue geschworen«, bringe ich krächzend hervor. Sonst wäre ich nicht mehr am Leben. »Ich unterstehe ihrem Kommando.«
Oak runzelt die Stirn. »Ich will versuchen, es zu erklären. Einige Monate vor der Schlangenschlacht gab Lady Nore eine Explosion unterhalb des Palastes in Auftrag.«
Ich werfe einen flüchtigen Blick auf den früheren Falken und frage mich, ob er etwas damit zu tun hatte. Beziehungsweise ob ich mich an ihn erinnern sollte. Ich habe zum Teil sehr lebhafte Erinnerungen an diese Zeit, während andere verwischt sind wie Tinte auf Papier.