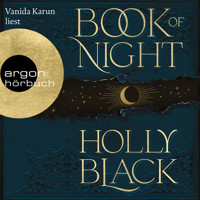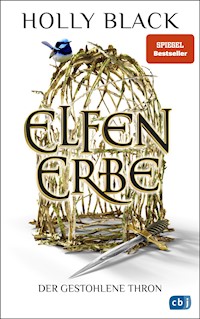6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Holly Black ist zurück - mit einer grandiosen Elfenfantasy!
Die Geschwister Hazel und Ben leben in dem Ort Fairfold, der an das magische Elfenreich grenzt. Seit Jahrzehnten steht dort, mitten im Wald von Fairfold, ein gläserner Sarg, in dem ein Elfenprinz schläft – von Touristen begafft und von der Bevölkerung argwöhnisch beäugt, auch wenn Hazel und Ben die alten Geschichten nicht glauben. Seit Kindertagen fühlen sie sich zu dem schlafenden Jungen magisch hingezogen, ihm vertrauen sie alle ihre Geheimnisse an. Inzwischen ist Hazel 16 und küsst immer neue Jungs, um die Leere in ihrem Herzen zu füllen. Doch als eines Tages der Sarg leer ist und der Prinz erwacht, werden die Geschwister in einen Machtkampf der Elfen gezogen. Hazel muss die Rolle annehmen, in die sie sich als Kind immer geträumt hat: als Ritter gegen ein dunkles Monster kämpfen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Holly Black
Der Prinzder Elfen
Aus dem Amerikanischenvon Anne Brauner
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
© 2015 by Holly Black
Published in agreement with the author c/o
BAROR INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, USA
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Darkest Part of the Forest« bei Little, Brown and Company, New York.
© 2017 für die deutschsprachige Ausgabe by cbt Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Amerikanischen von Anne Brauner
Lektorat: Carola Henke
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München,
unter Verwendung mehrerer Motive von Plainpicture
(Kniel Synnatzschke, PhotoAlto/Eric Audras); Shutterstock
(Ondrej Prosicky, Iakov Filimonov, Amy Johansson,
Artur_eM, Keattikorn, David Dirga, Polarpx, weerapong worranam, ckchiu)
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-16644-1V003
www.cbt-buecher.de
Für Sarah Rees Brennan,eine wundervolle Freundin, die mich sehr inspiriert
Also wirklich, mein Kind, wenn wir dir etwas tun wollten,würden wir dann hier, abseits des Weges lauern,im dunklen Herzen des Waldes?
– Kenneth Patchen
KAPITEL 1
Am Ende eines Waldweges, hinter einem Bach und einem ausgehöhlten Baumstamm mit Asseln und Termiten, stand auf dem Erdboden ein Sarg aus Glas. Darin schlief ein Junge mit Hörnern und Ohren, so spitz wie Messer.
Soweit Hazel Evans wusste, war er immer schon da gewesen. So hatten ihre Eltern es ihr erzählt, die es wiederum von ihren Eltern gehört hatten. Und man konnte machen, was man wollte, er wachte nicht auf, niemals.
Nicht in den langen Sommern, in denen Hazel sich mit ihrem Bruder Ben auf dem Sarg ausstreckte und durch die Glasscheibe starrte, bis sie von ihrem Atem beschlug, während sie kühne Pläne schmiedeten. Er wachte auch nicht auf, wenn die Touristen kamen und glotzten oder irgendwelche Spielverderber schworen, er wäre nicht echt. Auch nicht an den Wochenenden im Herbst, wenn die Mädchen auf seinem Sarg tanzten und ihn zu den blechernen Songs aus ihren iPod-Boxen anmachten, oder als Leonie Wallace ihr Bier über den Kopf hob, als wollte sie dem ganzen verhexten Wald zuprosten. Er zuckte nicht einmal mit der Wimper, als Bens bester Freund Jack Gordon mit seinem Edding IM NOTFALL SCHEIBE EINSCHLAGEN auf die Seite des Sargs schrieb – oder als Lloyd Lindblad es mit einem Vorschlaghammer tatsächlich versuchte. Egal wie viele Partys rund um den Jungen mit den Hörnern stattgefunden hatten – Generationen von Partys, sodass die jahrzehntealten Scherben kaputter Flaschen grün und braun im Gras glänzten und die zerdrückten Blechdosen silbern, golden und rostig im Gestrüpp glitzerten – und unabhängig davon, was auf diesen Partys alles geschehen war –, nichts und niemand konnte den Jungen in seinem gläsernen Sarg wecken.
Als sie klein waren, hatten Hazel und Ben ihm Blumenkränze geflochten und Geschichten erzählt, wie sie ihn retten würden. Damals wollten sie noch jeden retten, der in Fairfold gerettet werden musste. Als sie älter wurde, ging Hazel lieber nachts mit allen anderen zum Sarg, doch es schnürte ihr immer noch die Kehle zu, wenn sie auf das seltsame, schöne Gesicht des Jungen hinuntersah.
Sie hatte ihn nicht gerettet und Fairfold hatte sie auch nicht gerettet.
»Hey, Hazel«, rief Leonie und tanzte für den Fall, dass Hazel ebenfalls auf den Sarg des Gehörnten steigen wollte, auf eine Seite. Doris Alvaro war auch schon oben, in ihrem Cheerleader-Outfit vom Spiel, das ihre Schule am Abend verloren hatte, und ihr brauner Pferdeschwanz wippte. Die Mädchen waren rot im Gesicht, weil sie so viel getrunken und die Mannschaft so ausdauernd angefeuert hatten.
Hazel winkte Leonie zu, aber sie stieg nicht auf den Sarg, obwohl sie Lust dazu hatte. Stattdessen drängte sie sich durch die Menge der Jugendlichen.
Die Fairfold Highschool war so klein, dass trotz der Cliquen (die manchmal nur aus einer Person bestanden, wie zum Beispiel Megan Rojas, die ganz allein die Gothgemeinde bildete) alle zusammen feiern mussten, wenn es irgendwie abgehen sollte. Doch nur weil alle gemeinsam Party machten, waren sie noch lange nicht miteinander befreundet. Bis vor einem Monat hatte Hazel noch zu einer Mädchenclique gehört, die mit dickem Eyeliner und großen, glänzenden Ohrringen, die so scharf waren wie ihr Lächeln, durch die Schule gelaufen war. Sie und ihre Freundinnen hatten sich mit klebrigem hellem Blut, das sie aus ihren Daumen gedrückt hatten, ewige Freundschaft geschworen. Hazel war nicht mehr dabei, seit Molly Lipscomb sie gebeten hatte, ihren Ex zu küssen und ihn dann wieder abblitzen zu lassen. Molly war sauer geworden, als Hazel es tatsächlich getan hatte.
Es stellte sich heraus, dass Hazels andere Freundinnen in Wahrheit Mollys Freundinnen waren. Obwohl sie den Plan mitgetragen hatten, taten sie so, als hätten sie nichts damit zu tun. Sie taten so, als wäre etwas passiert, wofür Hazel sich entschuldigen müsste. Hazel sollte zugeben, dass sie es getan hatte, um Molly wehzutun.
Hazel küsste Jungen aus allen möglichen Gründen – weil sie süß waren, weil sie was getrunken hatte, weil sie sich langweilte, weil sie sie ließen, weil es Spaß machte, weil sie einsam wirkten, weil sie so ihren Ängsten entkam und sie nicht wusste, wie viele Küsse sie noch hatte. Doch außer Mollys Ex hatte sie noch nie mit einem Jungen geknutscht, der mit einer anderen zusammen war. Das würde sie auch nie wieder tun, auf keinen Fall.
Zumindest hatte sie noch ihren Bruder, mit dem sie etwas unternehmen konnte, wenn er sich auch im Moment in der Stadt mit einem Typen traf, den er online aufgegabelt hatte. Und Bens Freund Jack war auch noch da, selbst wenn er sie nervös machte. Und sie hatte Leonie.
Das waren genug Freunde. Eigentlich sogar zu viele, wenn man bedachte, dass sie demnächst wahrscheinlich verschwinden und sie zurücklassen würde.
Mit dieser Vorstellung im Kopf hatte sie darauf verzichtet, sich an diesem Abend eine Mitfahrgelegenheit zu der Party zu sichern, obwohl sie den ganzen Weg am Waldrand entlang und an Bauernhöfen und alten Tabakscheunen vorbei hatte laufen müssen.
Es war eine dieser Frühherbstnächte, wenn Holzrauch in der Luft lag, vermischt mit dem süßlich reifen Geruch von aufgewirbeltem Laub, und alles möglich schien. Sie trug einen neuen grünen Pullover, ihre braunen Lieblingsstiefel und billige grüne Ohrreifen aus Emaille. Ihre roten Locken schimmerten noch immer sommerlich golden, und als sie kurz vor der Party in den Spiegel gesehen hatte, um ein bisschen roten Gloss aufzutragen, hatte sie sich richtig hübsch gefunden.
Liz war für die Playlist zuständig und hatte ihr Handy an die Anlage ihres alten Fiats gehängt. Dance Music dröhnte so laut, dass die Bäume bebten. Martin Silver baggerte Lourdes und Namiya gleichzeitig an und machte sich anscheinend Hoffnung auf ein Beste-Freundinnen-Doppelpack, aus dem ganz bestimmt nichts werden würde, niemals. Molly lachte in einem Halbkreis von Mädchen, während Stephen in einem farbbespritzten Hemd auf seinem Truck saß. Er hatte die Scheinwerfer eingeschaltet und trank Schwarzgebrannten von Franklins Vater aus einem Flachmann.
Irgendetwas machte ihn so fertig, dass es ihm egal war, ob er davon blind wurde. Jack saß etwas weiter weg neben seinem (na ja, sogenannten) Bruder Carter, dem Quarterback, auf einem Baumstamm in der Nähe des gläsernen Sargs. Als sie lachten, bekam Hazel Lust, zu ihnen zu gehen und mitzulachen, aber gleichzeitig wollte sie auf den Sarg steigen und tanzen und drittens wollte sie nach Hause.
»Hazel«, sagte jemand. Als sie sich umdrehte und Robbie Delmonico sah, gefror ihr Lächeln.
»Ich hab dich gar nicht gesehen. Du siehst gut aus.« Das schien ihm nicht zu passen.
»Danke.« Robbie musste einfach gemerkt haben, dass sie ihm aus dem Weg ging. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, aber seit sie auf einer Party mit ihm rumgemacht hatte, verfolgte er sie, als hätte sie ihm das Herz gebrochen, und das war wirklich noch schlimmer. Sie hatte nicht Schluss gemacht oder so; er hatte sie ja nicht einmal um ein Date gebeten. Er starrte sie nur unglücklich an und stellte komische, bedeutungsschwangere Fragen wie zum Beispiel: »Was machst du nach der Schule?« Und wenn sie antwortete »Nichts, einfach abhängen«, schlug er nichts anderes vor und fragte sie auch nicht, ob sie bei ihm vorbeikommen wollte.
Weil Hazel Typen wie Robbie Delmonico küsste, glaubten die anderen, sie würde jeden küssen.
Damals hatte sie richtig Lust darauf gehabt.
»Danke«, sagte sie noch mal etwas lauter und nickte ihm zu, bevor sie sich abwandte.
»Der Pullover ist neu, oder?« Er lächelte ihr traurig zu, als wollte er sagen, dass er wusste, wie nett es von ihm war, das zu bemerken, und er ebenso wusste, dass nette Jungen nicht zum Zug kamen.
Das Komische war, dass er sich eigentlich gar nicht für sie interessiert hatte, bevor sie ihn angemacht hatte. Als sie ihn geküsst hatte – okay, Hände waren auch mit im Spiel gewesen –, war es, als hätte sie sich in eine grausame Liebesgöttin verwandelt.
»Er ist neu, ja«, bestätigte sie und nickte wieder. In seiner Nähe fühlte sie sich so hartherzig, wie er sie offenbar empfand. »Wir sehen uns.«
»Jep.« Er ließ das Wort in der Luft hängen.
Und dann, im entscheidenden Moment, als sie einfach weitergehen wollte, siegte ihr schlechtes Gewissen und sie sagte das, was sie auf keinen Fall hätte sagen sollen und wofür sie sich später am liebsten die ganze Nacht getreten hätte. »Vielleicht nachher.«
Seine Augen leuchteten hoffnungsvoll auf, und sie begriff zu spät, wie er es aufgefasst hatte, nämlich als Versprechen. Doch jetzt konnte sie nichts mehr daran ändern, außer schnell zu Jack und Carter zu flüchten.
Jack, für den Hazel geschwärmt hatte, als sie jünger und dümmer gewesen war, wirkte überrascht, als sie angestolpert kam. Das war sonderbar, weil man ihn eigentlich nie überrumpeln konnte, denn er bekam alles mit. Seine Mutter hatte einmal gesagt, Jack würde den Donner hören, bevor es geblitzt hatte.
»Hazel, Hazel, mit sich im Reinen. Küsst die Jungs, bis sie weinen«, sagte Carter, weil Carter echt blöd sein konnte.
Carter und Jack sahen sich so ähnlich wie Zwillinge. Sie hatten dunkle Locken und braune Augen. Sie hatten dunkelbraune Haut, einen sinnlichen Mund und hohe Wangenknochen, von denen alle Mädchen in der Stadt träumten. Doch sie waren keine Zwillinge. Jack war ein Wechselbalg – Carters Wechselbalg, den die Elfen zurückgelassen hatten, als sie Carter gestohlen hatten.
Fairfold war ein merkwürdiger Ort, der genau in der Mitte des Carling-Forstes lag, einem verhexten Wald, in dem es nur so wimmelte von Lichtalben, wie Hazels Großvater sie nannte, oder Waldgeistern oder dem kleinen Luftvolk, wie es bei ihrer Mutter hieß. In diesen Wäldern war es nichts Besonderes, wenn ein schwarzer Hase im Bach schwamm – obwohl Hasen sich sonst nichts aus Schwimmen machten – oder wenn sich ein Hirsch von einem Augenblick zum anderen in ein rennendes Mädchen verwandelte. Im Herbst wurde ein Teil der Apfelernte für den grausamen und unberechenbaren Erlkönig abgezweigt. Im Frühling wurden Blumengirlanden für ihn geknüpft. Die Städter wussten das Ungeheuer zu fürchten, das sich im Herzen des Waldes zusammengerollt hatte und Touristen mit einem Schrei lockte, der sich anhörte wie das Weinen einer Frau. Die Finger waren Stöcke, das Haar Moos. Es nährte sich von Trauer und säte Verderben. Man konnte es mit einem Singsang hervorlocken, den Mädchen als Mutprobe bei Übernachtungspartys sangen. Außerdem gab es einen Weißdornbaum in einem Steinkreis, wo man erhandeln konnte, was man sehnlichst wünschte. Man musste bei Vollmond ein Stück Stoff von der eigenen Kleidung an die Äste hängen und abwarten, bis jemand aus dem Elfenvolk erschien. Im Vorjahr war Jenny Eichmann dorthin gegangen und hatte den Elfen versprochen, was sie nur wollten, wenn sie ihr einen Platz in Princeton verschafften. Sie war angenommen worden, doch an dem Tag, an dem der Brief mit der Zulassung gekommen war, bekam ihre Mutter einen Schlaganfall und starb.
Aufgrund dieser Wünsche, des Jungen mit den Hörnern und der sonderbaren Visionen besuchten viele Touristen die Stadt, obwohl Fairfold so klein war, dass der Kindergarten direkt neben der Schule lag und man drei Orte weiterfahren musste, wenn man eine Waschmaschine kaufen oder durch ein Einkaufszentrum schlendern wollte. Andere Städte hatten vielleicht das dickste Wollknäuel oder ein riesiges Käserad oder einen Stuhl, auf dem ein Riese sitzen könnte. Sie hatten spektakuläre Wasserfälle oder glitzernde Höhlen mit spitzen Stalaktiten oder Fledermäuse, die unter einer Brücke schliefen. Fairfold hatte den Jungen im Glassarg. Fairfold hatte das kleine Volk.
Und für das kleine Volk waren Touristen leichte Beute.
Vielleicht hatten sie Carters Eltern versehentlich dafür gehalten. Carters Vater stammte nicht aus der Stadt, aber Carters Mutter war keine Touristin. Nach einer Nacht hatte sie begriffen, dass man ihr das Baby gestohlen hatte. Und sie wusste genau, was zu tun war. Sie schickte ihren Mann für einen Tag fort und lud ihre Nachbarinnen ein. Sie backten Brot, hackten Holz und schütteten Salz in eine alte irdene Schale. Als alles fertig war, erhitzte Carters Mutter einen Schürhaken im Kaminfeuer.
Er wurde rot, doch sie rührte sich nicht. Erst als das Eisen weiß glühte, drückte sie die Spitze des Schürhakens an die Schulter des Wechselbalgs.
Der Junge kreischte vor Schmerz so schrill und hoch, dass die beiden Küchenfenster barsten.
Es hatte gerochen, als hätte jemand frisches Gras ins Feuer geworfen, und die Haut des Babys wurde rot und schlug Blasen. Die Brandwunde hinterließ sogar eine Narbe. Hazel hatte sie gesehen, als sie im vergangenen Sommer mit Jack, Ben und Carter schwimmen war. Obwohl sie mit den Jahren dünner geworden war, war sie unverkennbar.
Wenn man einem Wechselbalg die Haut verbrennt, beschwört man seine Mutter herauf. Kurz darauf erschien Jacks Mutter mit einem gewickelten Bündel an der Tür. Den Erzählungen zufolge war sie groß und dünn, ihr Haar hatte die Farbe von Herbstlaub, ihre Haut schimmerte wie Rinde, und ihre Augenfarbe änderte sich von einem Augenblick zum anderen, von geschmolzenem Silber über Eulengold zu stumpfen Steingrau. Niemand hätte sie für einen Menschen gehalten.
»Ihr nehmt uns nicht unsere Kinder weg«, sagte Carters Mutter – jedenfalls in der Geschichte, die Hazel gehört hatte, und sie hatte sie oft gehört. »Ihr führt uns nicht in die Irre und macht uns nicht krank. So wird es hier seit Generationen gehalten und so wird es weiter gehalten.«
Die Elfenfrau wich ein wenig zurück und hielt das Kind, das sie mitgebracht hatte, schweigend hoch, als wäre das ihre Antwort. Es war in Laken gewickelt und schlief friedlich wie in seinem eigenen Bett. »Nimm ihn«, sagte sie.
Carters Mutter drückte ihn fest an sich und atmete mit seinem Geruch nach saurer Milch ein, dass er der Richtige war. Sie sagte, das wäre das Einzige, was das kleine Volk nicht fälschen könnte. Das andere Baby hatte einfach nicht nach Carter gerochen.
Als die Elfenfrau dann die Arme nach ihrem eigenen heulenden Kind ausstreckte, trat die Nachbarin, die es hielt, einen Schritt zurück, und Carters Mutter versperrte der Elfe den Weg.
»Du bekommst ihn nicht zurück«, sagte Carters Mutter, reichte ihr Baby ihrer Schwester und nahm Eisenspäne, rote Beeren und Salz zum Schutz gegen die Magie der Elfenfrau in die Hand. »Wenn du bereit warst, ihn einzutauschen, und sei es nur für eine Stunde, dann hast du ihn nicht verdient. Ich behalte alle beide und ziehe sie groß und das soll deine Strafe dafür sein, dass du unser Gelöbnis gebrochen hast.«
Daraufhin sprach die Elfenfrau mit einer Stimme wie Wind und Regen und spröde Blätter unter schweren Schritten. »Ihr belehrt uns nicht. Ihr habt keine Macht und kein Anrecht. Gebt mir mein Kind, dann segne ich euer Haus, aber ihr werdet es bereuen, wenn ihr es behaltet.«
»Die Folgen sind mir egal, und du bist mir erst recht egal«, sagte Carters Mutter allen zufolge, die jemals diese Geschichte erzählt haben. »Und jetzt raus!«
Und so geschah es, obwohl einige Nachbarinnen murrten, Carters Mutter hätte sich damit großen Ärger eingehandelt, dass Jack in Carters Familie lebte und Carters Bruder und Bens bester Freund wurde. Doch mit der Zeit gewöhnten sich alle an Jack, und niemand wunderte sich mehr, dass seine Ohren spitz zuliefen und seine Augen manchmal silbern aufleuchteten oder dass seine Wettervorhersage besser war als die der Experten in den Nachrichten.
»Und, glaubst du, Ben amüsiert sich besser als wir?« Jacks Frage riss sie aus ihren Gedanken an die Vergangenheit, seine Narbe und sein attraktives Gesicht.
Wenn Hazel es mit dem Küssen nicht ernst genug nahm, nahm Ben es dagegen zu ernst. Er wollte verliebt sein und war viel zu schnell bereit, sein ruhig schlagendes Herz zu verschenken. So war Ben immer schon gewesen, selbst wenn er dafür teurer bezahlt hatte, als Hazel sich erinnern wollte.
Allerdings hatte er online auch nicht mehr Glück als andere.
»Ich glaube, das ist ein langweiliges Date.« Hazel nahm Jack die Bierdose aus der Hand und trank einen Schluck. Es schmeckte säuerlich. »Die meisten sind langweilig, sogar die Lügner. Vor allem die Lügner. Ich weiß gar nicht, warum er sich die Mühe macht.«
Carter zuckte die Achseln. »Sex?«
»Er mag Geschichten«, sagte Jack und grinste sie verschwörerisch an.
Hazel leckte den Schaum von ihrer Oberlippe und wurde wieder fröhlicher. »Jep, stimmt.«
Carter stand auf und musterte Megan Rojas, die gerade mit frisch gefärbtem lila Haar und einer Flasche Zimtschnaps angekommen war; ihre spitzen, mit Spinnweben verzierten Stiefel sanken in die weiche Erde. »Ich hole mir noch ein Bier«, sagte er. »Wollt ihr auch was?«
»Hazel hat mein Bier geklaut«, sagte Jack und nickte ihr zu. Die schweren Silberreifen in seinen Ohren glänzten im Mondlicht. »Kannst du uns also zwei neue mitbringen?«
»Versuch mal, keine Herzen zu brechen, während ich weg bin«, sagte Carter wie im Scherz zu Hazel, doch sein Tonfall war ziemlich unfreundlich.
Hazel setzte sich auf den Teil des Baumstamms, wo eben noch Carter gesessen hatte, und sah zu, wie die Mädchen tanzten und die anderen tranken. Sie fühlte sich wie eine Zuschauerin, ziellos und verwirrt. Früher hatte sie einmal eine Mission gehabt, eine, für die sie alles aufgegeben hätte, aber es hatte sich herausgestellt, dass man nicht automatisch gewann, indem man alles aufgab.
»Mach dir nichts draus«, sagte Jack, als sein Bruder auf der anderen Seite des Sargs außer Hörweite war. »Du hast mit Rob nichts falsch gemacht. Wer sein Herz auf dem Silbertablett serviert, hat nichts Besseres verdient.«
Hazel dachte an Ben und überlegte, ob das stimmte.
»Ich mache einfach immer den gleichen Fehler«, sagte sie. »Ich gehe auf eine Party und küsse irgendeinen Typen, auf den ich in der Schule nie gekommen wäre. Typen, die ich eigentlich nicht mal mag. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie mir hier draußen im Wald eine geheime Seite zeigen würden. Aber sie sind immer gleich.«
»Geht doch nur ums Knutschen.« Jack grinste sie an; einen Mundwinkel hatte er hochgezogen und sie reagierte mit einem innerlichen Zucken. Er lächelte ganz anders als Carter. »Es macht einfach Spaß. Du tust niemandem weh. Es ist ja schließlich nicht so, als würdest du Jungs abstechen, nur damit mal was passiert.«
Sie war so überrascht, dass sie lachen musste. »Sag das mal Carter.«
Sie erklärte ihm nicht, dass sie gar nicht unbedingt wollte, dass etwas passierte, sondern vielmehr, dass sie nicht die Einzige war, die mit einem Geheimnis herumlief.
Jack tat so, als würde er mit ihr flirten, und legte ihr einen Arm um die Schultern, freundlich und lustig. »Er ist mein Bruder, also kann ich dir reinen Gewissens sagen, dass er ein Idiot ist. Du musst dich so gut wie möglich mit den anderen öden Bewohnern von Fairfold amüsieren.«
Sie schüttelte lächelnd den Kopf und drehte sich zu ihm um. Er sagte nichts mehr, und sie merkte, wie nah ihre Gesichter waren.
So nah, dass sie seinen warmen Atem auf ihrer Wange spürte. So nah, dass sie sah, wie die dunklen, dichten Wimpern im Licht zu Gold wurden und wie sanft sein Mund geschwungen war.
Hazels Herz schlug schneller, als die Schwärmerei der Zehnjährigen mit Macht zurückkam. Sie fühlte sich auf einmal wieder genauso verletzlich und lächerlich wie damals. Sie hasste dieses Gefühl. Jetzt war sie es, die Herzen brach, nicht anders herum.
Wer sein Herz auf dem Silbertablett serviert, hat nichts Besseres verdient.
Es gab nur eins, um über einen Jungen hinwegzukommen. Nur eins, das immer funktionierte.
Jacks Blick war unkoordiniert, er hatte den Mund leicht geöffnet. Das war der perfekte Moment, die Distanz zu überbrücken, die Augen zu schließen und ihre Lippen auf seine zu legen. Warm und sanft erwiderte er den Druck für einen einzigen Austausch ihres Atems.
Dann wich er blinzelnd zurück. »Hazel, damit meinte ich nicht, dass du …«
»Nein«, sagte sie und sprang mit brennenden Wangen auf. Er war ihr Freund, der beste Freund ihres Bruders. Er war wichtig. Es wäre niemals okay, ihn zu küssen, selbst wenn er es wollte, was er eindeutig nicht wollte, und was alles nur noch schlimmer machte. »Natürlich nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Gerade habe ich noch gesagt, ich sollte nicht rumlaufen und Typen küssen, und schon tu ich es wieder.«
Sie wandte sich zum Gehen.
»Warte«, sagte er und versuchte, sie festzuhalten, doch sie wollte nicht so lange bleiben, bis er die richtigen Worte gefunden hatte, um sie abzuwimmeln, ohne ihr wehzutun.
Hazel flüchtete mit gesenktem Kopf an Carter vorbei, um sich seinen besserwisserischen Blick zu ersparen. Sie kam sich dumm vor, und noch schlimmer, so als hätte sie die Zurückweisung verdient. Als würde es ihr recht geschehen. Es war eine Art karmischer Gerechtigkeit, die im normalen Leben eigentlich nicht vorkam, jedenfalls nicht so unmittelbar.
Hazel ging direkt zu Stephen. »Gibst du mir was ab?« Sie zeigte auf seinen Flachmann.
Er sah sie mit seinen blutunterlaufenen Augen verdämmert an, hielt ihr aber den Flachmann hin. »Schmeckt dir bestimmt nicht.«
Da hatte er recht. Der gepanschte Schnaps brannte höllisch in der Kehle. Dennoch trank sie noch zwei Schlucke in der Hoffnung, alles vergessen zu können, was auf dieser Party schon passiert war. In der Hoffnung, dass Jack Ben nie erzählen würde, was sie getan hatte. In der Hoffnung, dass Jack so tun würde, als wäre nichts geschehen. Sie wünschte, sie könnte alles ungeschehen machen und die Zeit wie den Faden eines Pullovers aufribbeln.
Auf der anderen Seite der Lichtung sprang Tom Mullins, Linebacker und schwerer Choleriker, im Schein von Stephens Scheinwerfern so plötzlich auf den Sarg, dass die Mädchen absprangen. Er sah total besoffen aus, knallrot im Gesicht, und die Haare standen in alle Richtungen.
»Hey«, schrie er, hüpfte auf und ab und stampfte, als wollte er das Glas zertreten. »Hey, aufwachen, nicht schlappmachen. Komm schon, du alter Sack, raus aus den Federn!«
»Lass es«, sagte Martin und wollte Tom herunterscheuchen. »Schon vergessen, was mit Lloyd passiert ist?«
Lloyd war ein brutaler Feuerteufel, der gern ein Messer mit zur Schule nahm. Wenn die Lehrer die Anwesenheit überprüften, mussten sie sich mühsam erinnern, ob er nicht da war, weil er schwänzte oder weil er mal wieder suspendiert war. Im vergangenen Frühling hatte Lloyd eines Nachts einen Vorschlaghammer zum Sarg mitgebracht. Er richtete nichts aus, doch als Lloyd das nächste Mal etwas abfackelte, verbrannte er sich. Er lag immer noch in Philadelphia im Krankenhaus, wo sie Haut von seinem Hintern auf sein Gesicht verpflanzten.
Es wurde gemunkelt, der gehörnte Junge hätte Lloyd das angetan, weil es ihm nicht gefiel, wenn man seinen Sarg kaputt machen wollte. Andere sagten, derjenige, der den Jungen mit den Hörnern verflucht hatte, hätte auch das Glas verflucht. Wenn also jemand versuchte, es zu zerschlagen, würde er sein Unglück heraufbeschwören. Tom Mullins wusste das alles, aber es schien ihm egal zu sein.
Das konnte Hazel ihm nachfühlen.
»Aufstehen!«, brüllte er und trat und stampfte und sprang auf dem Sarg herum. »Hey, du Faulpelz, aufwaaaaachen!«
Carter hielt ihn am Arm fest. »Komm mit, Tom. Wir trinken Shots. Das willst du doch nicht verpassen.«
Tom sah ihn zögerlich an.
»Komm mit«, wiederholte Carter. »Oder bist du schon zu breit?«
»Jep«, sagte Martin und gab sich Mühe, überzeugend zu klingen. »Du verträgst einfach nichts mehr, Tom.«
Das wirkte. Tom kletterte vom Sarg, ging mit und protestierte lauthals, dass er mehr vertrug als die beiden zusammen.
»Tja«, sagte Stephen zu Hazel. »Mal wieder so eine Nacht in Fairfold, wo alle entweder besoffen oder Elfen sind.«
Sie trank noch einen Schluck aus seinem silbernen Flachmann. Allmählich gewöhnte sie sich daran, dass ihre Speiseröhre wie Feuer brannte. »Kann man sagen.«
Er grinste und seine rotgeränderten Augen funkelten. »Bisschen knutschen?«
So wie er aussah, war er genauso fertig wie sie. Stephen, der in den ersten drei Jahren in der Grundschule kaum ein Wort gesprochen hatte und von dem alle annahmen, dass er manchmal überfahrene Tiere zum Abendessen aß. Stephen, der sich nicht bei ihr bedanken würde, wenn sie ihn fragte, was ihn quälte, weil er wahrscheinlich genauso viel vergessen wollte wie sie.
Hazel war ein wenig schwindelig und sehr unbesonnen. »Okay.«
Als sie von dem Truck fort in den Wald gingen, drehte sie sich noch mal zu der Party im Hain um. Jack beobachtete sie, aber sie konnte seinen Gesichtsaudruck nicht deuten und wandte sich ab. Als sie Händchen haltend unter einer Eiche hergingen, glaubte Hazel, die Äste hätten sich über ihr bewegt wie Finger, doch als sie genauer hinschaute, sah sie nichts als Schatten.
KAPITEL 2
In dem Sommer, als Ben ein Baby und Hazel noch im Bauch war, ging ihre Mutter auf eine Lichtung im Wald, um im Freien zu malen. Sie breitete ihre Decke im Gras aus und setzte Ben, den sie mit Sonnenschutzfaktor 50 eingecremt hatte, mit einem Stück Zwieback darauf, während sie Kadmiumorange und Alizarinblau auf die Leinwand tupfte. Sie hatte bereits fast eine Stunde gemalt, als sie eine Frau bemerkte, die ihr aus dem kühlen Schatten der Bäume zusah.
Die Frau, sagte Mom, als sie die Geschichte erzählte, hatte ihre braunen Haare mit einem Tuch zurückgebunden und hielt einen Korb mit frischen grünen Äpfeln in der Hand.
»Du bist eine wahre Künstlerin«, sagte die Frau, ging in die Hocke und lächelte entzückt. In diesem Augenblick merkte Mom, dass ihr locker schwingendes Kleid handgewebt und besonders fein war. Erst hielt Mom sie für eine dieser Frauen, die selbst Obst und Gemüse anbauten und weiterverarbeiteten und die auch ihre eigene Kleidung nähten. Doch dann sah sie, dass die Ohren der Frau sich zart zuspitzten, und begriff, dass sie zu dem kleinen Volk der Luft gehörte, das unberechenbar und gefährlich war.
Und wie es die Tragödie mit so vielen Künstlern will, war Mom eher fasziniert als verängstigt.
Mom war in Fairfold aufgewachsen und hatte unendlich viele Geschichten über das kleine Volk gehört. Vom Hörensagen kannte sie das Nest der Rotkappen, die ihre Hüte in frisches Menschenblut tunkten und die angeblich in der Nähe einer alten Höhle auf der anderen Seite der Stadt lebten. Sie hatte von einer Schlangenfrau gehört, die sich manchmal am Waldrand blicken ließ, wenn es abends kühler wurde. Sie wusste über das Ungeheuer Bescheid, das aus trockenen Ästen, Baumrinde, Erde und Moos bestand und das Blut aller, die es berührte, in Pflanzensaft verwandelte.
Sie erinnerte sich an das Lied, das sie beim Seilspringen gesungen hatten, als sie noch Kinder waren:
Ein Ungeheuer wohnt im Wald
Bist du nicht brav, holt sie dich bald
Zieht dich unter Ast und Blatt der Eiche
Straft dich für alle dummen Streiche
Ein Nest aus Haar und abgenagten Knochen
Niemals kommst du nach Hause ge-
Sie hatten es mit großer Begeisterung gegrölt und das letzte Wort stets weggelassen, denn sonst hätten sie das Ungeheuer heraufbeschworen – darum ging es schließlich. Doch solange sie das Wort nicht aussprachen, blieb die Magie aus.
Nicht alle Geschichten waren so schrecklich. Das kleine Volk konnte auch großzügig sein. Eine Nixe hatte einem Mädchen aus Bens Spielgruppe die Puppe gestohlen und eine Woche später erwachte das Mädchen im Kinderbett mit einer wunderschönen Perlenkette um den Hals. Das machte Fairfold zu etwas ganz Besonderem, weil es der Magie so nahe war. Diese Magie war gefährlich, ja, aber Magie blieb Magie.
Angeblich schmeckte das Essen in Fairfold besser, weil ihm ein Zauber innewohnte. Man träumte lebhafter und Künstler waren hier inspirierter und ihre Werke schöner als anderswo. Man verliebte sich von ganzem Herzen, die Musik erfreute die Ohren mehr als sonst und die Luft schwirrte vor Einfallsreichtum.
»Ich möchte dich zeichnen«, sagte Mom und holte ihren Skizzenblock und ein paar Kohlestifte aus der Tasche. Sie war auch der Meinung, dass sie in Fairfold besser malte.
Die Frau sträubte sich. »Zeichne lieber meine schönen Äpfel. Sie sind schon der Fäulnis anheimgegeben, während ich die langen Jahre meines Lebens so aussehen werde wie jetzt.«
Bei diesen Worten erschauerte Mom.
Als die Frau ihr Gesicht sah, lachte sie. »Oh ja, ich habe die Eichel vor dem Baum gesehen. Ich habe das Ei vor der Henne gesehen. Und ich werde sie alle wiedersehen.«
Mom atmete tief durch und startete einen zweiten Versuch, sie zu überreden. »Wenn ich dich zeichnen darf, kannst du das Bild behalten, wenn es fertig ist.«
Die Elfenfrau dachte nach. »Ich darf es behalten?«
Mom nickte, die Frau stimmte zu und Mom fing an zu zeichnen. Während sie skizzierte, unterhielten sie sich über ihr Leben. Die Frau sagte, sie hätte früher an einem anderen Hof im Osten gelebt, bevor sie einem Adeligen ins Exil gefolgt wäre. Sie erzählte Mom von ihrer neu erwachten Liebe zur Tiefe des Waldes, aber auch, wie sehr sie ihr früheres Leben vermisse. Im Gegenzug verriet Mom der Elfe ihre Ängste bezüglich ihres ersten Kindes, das mittlerweile gelangweilt und unruhig auf der Decke quengelte und eine neue Windel brauchte. Würde Ben zu jemandem heranwachsen, der sich fundamental von ihr selbst unterschied, jemand, der sich nicht für Kunst und Musik interessierte und ein konventioneller Langweiler war? Moms eigene Eltern waren immer wieder sehr enttäuscht gewesen, weil ihre Tochter so ganz anders war als sie. Was war, wenn es ihr mit Ben genauso erginge?
Als Mom fertig war, verschlug die Schönheit der Zeichnung der Elfenfrau den Atem. Sie kniete sich neben das Baby auf die Decke und legte ihren Daumen an seine Schläfe. Es fing sofort an zu weinen.
Mom stürzte sich auf die Frau. »Was hast du getan?«, rief sie. Ein roter Fleck leuchtete in der Form einer Fingerspitze auf der Stirn ihres Sohnes.
»Da du mir die Zeichnung schenkst, schulde ich dir eine Gefälligkeit.« Die Frau stand auf und ragte höher als irgend möglich über Mom auf, die den weinenden Ben auf den Arm genommen hatte. »Ich kann seine Natur nicht ändern, aber ich habe ihm die Gabe unserer Musik verliehen. Er wird so schöne Musik spielen, dass niemand beim Zuhören an etwas anderes denken kann – Musik, in der Elfenmagie wirkt. Sie wird auf ihm lasten, sie wird ihn verändern und einen Künstler aus ihm machen, unabhängig von allem, was er sich sonst wünscht. Jedes Kind braucht eine Tragödie, damit es wahrhaft interessant wird. Das ist mein Geschenk für dich – Kunst wird alles für ihn sein, ob es dir gefällt oder nicht.«
Mit diesen Worten nahm die Elfe ihre Zeichnung und ließ Bens Mutter, die ihn weinend umschlungen hielt, auf der Decke zurück. Sie war nicht sicher, ob ihr Sohn verflucht oder gesegnet war.
Sowohl als auch, wie sich herausstellte.
Hazel dagegen, die im gezeitenlosen Meer des Fruchtwassers schwamm, war weder das eine noch das andere. Ihre Tragödie bestand höchstens darin, dass sie so normal und durchschnittlich war wie alle anderen Kinder, die jemals auf die Welt gekommen waren.
KAPITEL 3
Als Hazel spätnachts von der Party nach Hause kam, traf sie Ben am Küchentisch an, wo er mit dem Löffel die letzten Brösel seines Müslis aus der Milch fischte. Es war kurz nach Mitternacht, doch ihre Eltern waren noch wach und arbeiteten. Helles Licht strahlte aus dem Atelier hinter dem Haus, das sie sich teilten. Manchmal, wenn sie besonders inspiriert waren oder dringend etwas fertigstellen mussten, schlief sogar einer von ihnen dort.
Hazel machte das nichts aus. Sie war stolz darauf, dass sie anders waren als andere Eltern; so war sie erzogen worden. »Normale Menschen«, sagten sie erschauernd. »Normale Menschen denken, sie wären glücklich, aber das liegt nur daran, dass sie zu dumm sind, etwas anderes zu denken. Da sind wir doch lieber unglücklich und interessant, was?« Dann lachten sie immer. Doch hin und wieder, wenn Hazel durchs Atelier schlenderte und den vertrauten Geruch von Terpentin und Lack und frischer Farbe einatmete, überlegte sie, wie es wäre, wenn sie glückliche, normale, dumme Eltern hätte. Dann bekam sie ein schlechtes Gewissen.
Ben sah sie mit seinen kornblumenblauen Augen an. Er hatte dunkle Augenbrauen, so wie sie. Sein rotes Haar war unordentlicher als sonst und ein Blatt steckte in den wilden Locken.
Hazel zog es grinsend heraus. Sie war betrunken genug, um nicht mehr ganz scharf zu sehen, und ihre Lippen waren ein wenig wund, weil Stephen sie so brutal geküsst hatte. Von diesen Details wollte sie sich gerne ablenken lassen. Sie wollte nicht mehr an diese Nacht denken, auch nicht an Jack und wie blöd sie sich benommen hatte, also möglichst an gar nichts. Sie stellte sich vor, wie sie diese Erinnerungen in einer schweren Truhe verstauen, den Deckel zuknallen, ein Vorhängeschloss anbringen und die Truhe im Meer versenken würde. »Und, wie war dein Date?«, fragte sie.
Er seufzte ausführlich und schob die Müslischüssel über die zerschlissene Tischdecke. »Absolut grauenhaft.«
Hazel legte den Kopf auf den Tisch und sah zu ihm herüber. Aus dieser Perspektive wirkte er wesenlos, als könnte sie durch ihn hindurchsehen, wenn sie die Augen zukniff. »Stand er auf komische Sachen? Clownkostüme? Clownkostüme aus Gummi?«
»Nein.« Ben lachte nicht und sein Lächeln wirkte angestrengt.
Hazel runzelte die Stirn. »Ist alles okay? Hat irgendwas …«
»Nein, nichts dergleichen.« Ben sprach schnell, um ihre Sorge zu entkräften. »Wir sind in seine Wohnung gegangen und da war sein Ex. Mit anderen Worten, der lebte da auch noch.«
Sie dämpfte ihren Aufschrei, denn das klang wirklich schrecklich. »Echt? Und hat er vorher nichts gesagt?«
»Er hatte gesagt, dass es diesen Ex gibt. Punkt. Alle haben einen Ex! Sogar ich! Ich meine, du hast wie viele? Millionen?« Er grinste, damit sie merkte, dass es ein Scherz sein sollte.
Dieser Witz kam bei Hazel gerade nicht so gut an. »Man kann keinen Ex haben, wenn man keine Dates hat«, erwiderte sie.
»Ist ja auch egal. Jedenfalls kommen wir rein und der Typ sitzt völlig fertig vor dem Fernseher. Soll heißen, für ihn ist es eindeutig scheiße, dass ich da bin, und er war auch genauso eindeutig nicht darauf vorbereitet. Mein Date erzählt in der Zwischenzeit, wie cool sein Ex doch ist und dass er sogar auf dem Sofa pennt, damit wir ins Schlafzimmer können. In dem Moment hab ich erst kapiert, dass es nur ein Schlafzimmer gibt und dass ich gehen muss. Aber was sollte ich genau tun? Ich hatte das Gefühl, es wäre nicht nett, egal was ich sage. Von wegen gemeinsam konstruierter Wirklichkeit, Gesellschaftsvertrag, irgend so was. Ich hab’s nicht gebracht.«
Hazel schnaubte, doch er beachtete sie nicht.
»Also habe ich gesagt, ich müsste auf die Toilette. Da habe ich mich versteckt, um mich wieder einzukriegen. Dann habe ich tief Luft geholt und bin rausgegangen, immer weiter, aus der Wohnung und die Treppe runter. Als ich auf dem Bürgersteig stand, bin ich weggerannt.«
Hazel lachte, als sie sich ihren Bruder bei diesem unrühmlichen Abgang vorstellte. »Weil Wegrennen ja auch überhaupt nicht unfreundlich ist.«
Ben schüttelte ernst den Kopf. »Nicht so peinlich.«
Das brachte sie nur noch mehr zum Lachen. »Hast du schon in deine Mails geguckt? Der schreibt dir doch bestimmt und fragt, wo du geblieben bist. Wäre das nicht peinlich?«
»Soll das ein Witz sein? Ich checke meine E-Mails nie wieder!«, sagte Ben nachdrücklich.
»Gut«, sagte Hazel. »Jungen aus dem Internet lügen.«
»Alle Jungen lügen«, sagte Ben. »Und alle Mädchen auch. Ich lüge. Du lügst. Tu nicht so.«
Hazel sagte nichts, weil er recht hatte. Sie hatte gelogen. Sie hatte oft gelogen, vor allem Ben gegenüber.
»Und was ist mit dir?«, fragte er zurück. »Wie ging es unserem Prinzen heute Abend?«
Im Laufe der Jahre hatten Hazel und Ben viele Geschichten um den Jungen mit den Hörnern gesponnen. Sie hatten mit den Textmarkern ihres Vaters und den Kohlestiften ihrer Mutter und noch früher mit ihren Buntstiften Bilder von seinem schönen Gesicht mit den geschwungenen Hörnern gemalt. Wenn Hazel die Augen schloss, konnte sie sein Bildnis heraufbeschwören – das schwarzblaue Wams und die mit goldenem Faden aufgestickten Muster von Phönixen, Greifen und Drachen; die blassen gefalteten Hände mit funkelnden Ringen; die ungewöhnlich langen und leicht spitzen Fingernägel; wadenhohe Stiefel aus elfenbeinfarbenem Leder und das unfassbar schöne Gesicht mit den perfekten Zügen – und wenn man ihn zu lange ansah, hatte man das Gefühl, alles andere wäre unerträglich schäbig.
Er konnte nur ein Prinz sein. Das hatte Ben beschlossen, als sie ihn zum ersten Mal gesehen hatten. Ein Prinz wie die Prinzen im Märchen, mit einem Fluch belegt, der nur von der wahren Liebe aufgehoben werden konnte. Und damals war Hazel sicher gewesen, dass sie diejenige sein würde, die ihn aufweckte.
»Unser Prinz war wie immer«, antwortete Hazel, die nicht über den Abend reden wollte, was Ben aber auch nicht merken sollte. »Alle waren wie immer. Alles war wie immer.«
Sie wusste, es war nicht Bens Schuld, dass sie von ihrem Leben frustriert war. Sie hatte ihren Handel abgeschlossen. Es nützte nichts, das zu bereuen, und noch weniger, ihm dafür zu grollen.
Nach einer Weile kam ihr Vater aus dem Atelier, um sich einen Tee zu machen, und schickte sie ins Bett. Er musste sich beeilen, wenn er seine Illustrationen vertragsgemäß am Montag in der Stadt abliefern wollte. Wahrscheinlich würde er die ganze Nacht aufbleiben und es deshalb merken, wenn sie das Gleiche taten.
Vermutlich leistete ihre Mutter ihm Gesellschaft. Mom und Dad hatten sich an der Kunstakademie in Philadelphia kennengelernt und verliebt, einig in ihrer Liebe zu Kinderbüchern, die dazu führte, dass sowohl Ben als auch Hazel demütigenderweise nach berühmten Hasen benannt worden waren. Nach ihrem Abschluss zogen sie nach Fairfold zurück, pleite, schwanger und bereit zu heiraten, wenn Dads Familie ihnen dafür erlaubte, umsonst im Farmhaus seiner Großtante zu wohnen. Dad baute die dahinterliegende Scheune in ein Atelier um und illustrierte in seiner Hälfte Bilderbücher, während Mom in ihrem Teil Landschaftsbilder vom Carling-Forst malte, die sie in der Stadt vorwiegend an Touristen verkaufte.
Im Frühling und im Sommer wimmelte es in Fairfold nur so von Touris. Sie waren überall, aßen Pfannkuchen mit echtem Ahornsirup im Railway Diner, kauften T-Shirts und Briefbeschwerer mit Kleeblättern in Baumharz bei Curious Curios, ließen sich bei Mystical Moon Tarot die Karten legen, machten Selfies auf dem gläsernen Sarg des Prinzen oder holten sich Sandwich-Pakete bei Annie’s Luncheonette für ein spontanes Picknick am Wight Lake, wenn sie nicht Händchen haltend durch die Straßen schlenderten und so taten, als wäre Fairfold der wunderlichste und verrückteste Ort, an dem sie je gewesen waren.
Jedes Jahr verschwanden mehrere Touristen.
Einige wurden von Wasserhexen in den Wight Lake gezogen und ihre Leichen durchbrachen den dichten Algenteppich und verteilten die Entengrütze. Andere wurden in der Dämmerung von Pferden niedergeritten, die helle Glöckchen in den Mähnen und Angehörige des Leuchtenden Volkes auf dem Rücken hatten. Wieder andere hingen ausgeblutet und angefressen mit dem Kopf nach unten in den Bäumen. Es geschah auch immer wieder, dass Besucher mit einer so entsetzlichen Fratze auf Parkbänken gefunden wurden, dass sie vor Angst gestorben sein mussten. Andere verschwanden einfach.
Nicht wirklich viele. In jeder Saison vielleicht ein oder zwei, doch es passierte häufig genug, dass man es außerhalb von Fairfold hätte merken müssen. So häufig, dass man davor hätte warnen und Reiseratschläge aussprechen müssen, irgendetwas in der Art. Es geschah so häufig, dass die Touristen hätten ausbleiben müssen. Doch das Gegenteil war der Fall.
Vor ungefähr zehn Jahren hatten sich die Elfen mehr zurückgehalten und harmlosere Streiche gespielt. Ein Irrwind packte etwa einen müßigen Touristen, schleuderte ihn in die Luft und setzte ihn meilenweit entfernt wieder ab. Andere waren nach einer langen Nacht ins Hotel zurückgeschwankt und mussten erfahren, dass ein halbes Jahr vergangen war. Hin und wieder wachte jemand mit Knoten in den Haaren auf; Gegenstände, von denen die Leute ganz sicher wussten, dass sie sie in der Tasche gehabt hatten, verschwanden und wurden gegen unbekannte Dinge ausgetauscht. Die Butter wurde vom Teller verspeist, abgeleckt von unsichtbaren Zungen. Geld verwandelte sich in Blätter. Schnürsenkel ließen sich nicht aufbinden und Schatten sahen irgendwie zerlumpt aus, als wären sie weggelaufen, um sich zu vergnügen.
Damals kam es nur selten zu Todesfällen, die auf das kleine Volk zurückzuführen waren.
Touristen, sagten die Ortsansässigen früher mit Spott in der Stimme, und so war es noch immer. Denn alle glaubten – daran mussten sie glauben –, dass Touristen Dummheiten begingen, die sie das Leben kosteten. Und wenn ausnahmsweise jemand aus Fairfold vermisst wurde, hatte er sich wohl wie ein Tourist verhalten, obwohl er es eigentlich besser wusste. Die Einwohner von Fairfold hatten sich angewöhnt, das kleine Volk als unvermeidlich zu betrachten, als Naturgewalt wie Wirbelstürme oder gefährliche Meeresströmungen.
Es handelte sich um eine seltsame Form von Verdrängung.
Sie mussten dem kleinen Volk Respekt erweisen, aber keine Angst vor ihm haben. Die Touristen hatten Angst.
Sie sollten sich vom kleinen Volk fernhalten und sich davor schützen. Die Touristen hatten nicht genug Angst.
Als Hazel und Ben für kurze Zeit in Philadelphia lebten, glaubte niemand ihre Geschichten. Diese beiden Jahre waren sehr seltsam gewesen. Sie hatten lernen müssen, zu verbergen, wie sonderbar sie waren. Doch als sie zurückkamen, war es auch nicht leicht, weil sie nun wussten, wie verrückt Fairfold im Vergleich zu anderen Orten war. Und weil Ben damals, als sie zurückkehrten, beschlossen hatte, seine Magie – und die Musik – für immer aufzugeben.
Und das bedeutete, er durfte nie, niemals erfahren, welchen Preis Hazel dafür gezahlt hatte, dass sie überhaupt weggezogen waren. Schließlich war sie keine Touristin. Sie hätte es besser wissen müssen. Doch manchmal, in Nächten wie dieser, wünschte sie, sie könnte es irgendwem erzählen. Sie wünschte, sie müsste nicht immer so allein sein.
In dieser Nacht, als sie und Ben ins Bett gegangen waren, nachdem sie sich die Schlafanzüge angezogen, Zähne geputzt und sich vergewissert hatten, dass unter ihren Kissen zum Schutz vor Elfenstreichen noch gesalzene Haferflocken lagen, lenkte Hazel nichts mehr davon ab, sich an den schwindelerregenden Augenblick zu erinnern, als sie Jacks Mund gespürt hatte. Doch im Traum küsste sie nicht mehr Jack, sondern den Jungen mit den Hörnern. Er hatte die Augen geöffnet. Und als sie ihn an sich zog, stieß er sie nicht weg.
Als Hazel aufwachte, war sie schlecht drauf, unruhig und melancholisch. Sie schob es darauf, dass sie zu viel getrunken hatte, und nahm ein Aspirin mit dem letzten Schluck aus der Orangensaftflasche. Ihre Mutter hatte einen Zettel mit einem angehefteten Zehndollarschein in die große Keramikschüssel auf dem Küchentisch gelegt, auf dem stand, dass sie Brot und Milch kaufen sollten.
Stöhnend ging Hazel nochmals hoch und zog Leggings und ein weites schwarzes T-Shirt an. Dann legte sie die grünen Ohrreifen wieder an.
Aus Bens Zimmer drang Musik. Obwohl er selbst nicht mehr spielte, lief bei ihm immer etwas im Hintergrund, sogar wenn er schlief. Doch wenn er jetzt schon wach war, konnte sie ihn vielleicht überreden, den Einkauf zu übernehmen, damit sie wieder ins Bett gehen konnte.
Hazel klopfte an Bens Tür.
»Betreten auf eigene Gefahr«, rief er. Als sie die Tür öffnete, hielt er sein Handy ans Ohr, während er gleichzeitig versuchte, eine senffarbene Skinny-Jeans anzuziehen.
»Hey«, sagte sie, »kannst du …«
Er winkte sie zu sich und sprach ins Handy. »Jep, sie ist wach. Sie steht direkt vor mir. Klar, wir sehen uns in einer Viertelstunde.«
Hazel stöhnte. »Was? Wo?«
Er grinste sie lässig an und verabschiedete sich von demjenigen, mit dem er telefonierte. Von Jack, wie Hazel stark vermutete.
Ben und Jack waren schon viele Jahre befreundet und hatten einiges zusammen durchgestanden, zum Beispiel Bens Coming-out und seine besessene Beziehung mit dem einzigen anderen offen schwulen Jungen an der Schule, die mit einer rüden öffentlichen Prügelei beim Homecoming-Lagerfeuer zu Ende gegangen war. Oder Jacks trostlose Depression, nachdem Amanda Watkins mit ihm Schluss gemacht und ihm mitgeteilt hatte, dass sie nur etwas mit ihm hatte, weil sie eigentlich scharf auf Carter war, und dass sie bei ihm das Gefühl hatte, mit Carters Schatten zusammen zu sein. Es tat ihrer Freundschaft auch keinen Abbruch, dass sie einen unterschiedlichen Musik- und Literaturgeschmack hatten und mittags nicht mit den gleichen Leuten zusammensaßen.
So eine kleine Sache wie die, dass sie Jack geküsst hatte, konnte ihre Freundschaft sicherlich nicht trüben. Trotzdem freute Hazel sich nicht gerade auf den Moment, in dem Ben davon erfuhr. Und auch nicht darauf, dass Jack sie den ganzen Nachmittag argwöhnisch im Auge behalten würde – für den Fall, dass sie ihn wieder angrapschte oder so.
Allerdings freute sie sich widerwillig darauf, ihn wiederzusehen. Sie konnte es kaum glauben, dass sie sich geküsst hatten, wenn auch nur für einen Moment. Bei der Erinnerung empfand sie ein peinliches Glücksgefühl. Es fühlte sich an, als hätte sie sich etwas getraut, und das hatte sie lange nicht getan. Selbstverständlich war es ein schrecklicher Fehler gewesen. Sie hätte einiges kaputt machen können – hoffentlich war das nicht bereits geschehen. Sie konnte es nie wieder tun. Jedenfalls fiel ihr keine Möglichkeit ein, wie sie es jemals wieder tun könnte.
Hazel wusste gar nicht mehr, wann sie angefangen hatte, für Jack zu schwärmen. Es war ganz allmählich passiert, dass sie ihn deutlicher wahrgenommen hatte und es spannend fand, wenn er ihr seine Aufmerksamkeit schenkte, obwohl sie dann jedes Mal in nervöses Plappern verfiel. Sie wusste aber noch, seit wann sie ihn richtig toll fand. Sie war zu ihm rübergegangen, um Ben daran zu erinnern, dass einer von Dads Versagerfreunden ihm eine Stunde Musikunterricht geben wollte. In der Küche der Gordons hatte sie einen Haufen Jungen angetroffen, die sich Sandwichs machten und ein Riesenchaos veranstalteten. Jack hatte ihr ein Sandwich mit Hähnchensalat und sorgfältig geschnittener Tomate zubereitet. Als er sich umdrehte, um Brezeln für sie zu holen, hatte sie sein halb gekautes Kaugummi genommen, das er an einen Teller geklebt hatte, und es in den Mund gesteckt. Es hatte nach Erdbeer und seiner Spucke geschmeckt und ihr denselben schmerzlichen Glücksschock verpasst wie der Kuss.
Das Kaugummi klebte immer noch an ihrem Bett, ein Talisman, den sie nicht wegwerfen konnte.
»Wir gehen zu Lucky’s«, erklärte Ben, ohne ihr Einverständnis abzuwarten. »Wir trinken Kaffee und hören Platten. Mal sehen, ob was Neues reingekommen ist. Ach, komm doch mit, Mr Schröder vermisst dich bestimmt schon. Außerdem, wenn du was losmachen willst, was können wir sonntags hier anderes tun?«
Hazel seufzte. Sie sollte sich weigern, doch stattdessen wollte sie sich offenbar noch mehr Ärger einhandeln, indem sie jeden Stein umdrehte, jeden Jungen küsste, immer weiter verknallt war und alle schlechten Ideen in die Tat umsetzte.
»Kaffee kann nicht schaden«, sagte sie, als ihr Bruder einen roten Blazer anzog und seine äußere Erscheinung zu einem Sonnenaufgang arrangierte.
Das Lucky’s lag in einem großen restaurierten Lagerhaus am abgehalfterten Ende der Main Street neben der Bank, der Zahnarztpraxis und einem Geschäft für Wanduhren. Dort roch es nach verstaubten alten Büchern, Mottenkugeln und frisch gemahlenem Kaffee. Regale, die nicht zusammenpassten, füllten die Wände und Flure. Einige waren aus geschnitzter Eiche, andere aus Paletten zusammengenagelt, aber alle Regale stammten ausnahmslos von privaten Flohmärkten, wo die Eigentümer Mr und Mrs Schröder sie billig erworben hatten. Zwei dick gepolsterte Sessel und ein Plattenspieler standen an großen Fenstern mit Ausblick auf einen breiten Bach. Die Gäste durften alle vorrätigen alten Schallplatten abspielen. Bio-Fairtrade-Kaffee wurde in zwei großen Thermoskannen angeboten und auf einem lackierten Tisch standen Becher neben einem angeschlagenen Gefäß mit der Aufschrift: AUF VERTRAUENSBASIS. FÜNFZIG CENTS PRO TASSE.
Am anderen Ende standen Kleiderständer mit Secondhand-Kleidung, Schuhen, Handtaschen und anderem Kleinkram. Hazel hatte im Sommer bei Lucky’s gearbeitet und sich durch gefühlte Hunderte von Müllsäcken im Hinterzimmer gewühlt und aussortiert, was auf die Regale und Ständer kam und was Risse oder Flecke hatte oder unangenehm roch. Sie hatte viele gute Sachen gefunden, als sie in diesen Säcken stöberte. Lucky’s war teurer als Goodwill – wo ihre Eltern sie zum Einkaufen hinschickten, weil sie behaupteten, neue Sachen zu kaufen wäre bourgeois – aber es war auch schöner da, und sie bekam Rabatt.
Jack, dessen Familie in den Augen von Hazels Eltern eindeutig bourgeois war und der neue Sachen im Einkaufszentrum kaufte, ging zu Lucky’s, um sich stapelweise sonderbare Biografien zu besorgen, die er in einer Menge konsumierte wie andere Leute Zigaretten.
Ben kam wegen der alten Schallplatten, die er liebte, auch wenn sie versprangen und kratzten und mit der Zeit immer schlechter wurden. Er behauptete, die Rillen würden die ursprüngliche Wellenform des Klangs abbilden und der Sound wäre echter und ausdrucksvoller. Hazel glaubte, dass er vor allem das Ritual liebte – wenn er die Schallplatte aus der Hülle nahm, auf den Plattenteller legte und die Nadel genau an die richtige Stelle setzte. Dann ballte er die Fäuste, damit er den Rhythmus nicht auf sein Bein trommelte.
Den letzten Teil liebte er vielleicht nicht so, aber er tat es jedes Mal.
Es war ein strahlender, kühler Tag und der Wind färbte ihre Wangen rosig. Als Hazel und Ben den Laden betraten, hob ein Dutzend Krähen von einer Fichte ab und flog krächzend in den Himmel.
Beim Bimmeln der Türglöckchen hob Mr Schröder den Blick und unterbrach sein Nickerchen. Er zwinkerte Hazel zu und sie zwinkerte zurück. Dann sank er grinsend wieder in seinen Sessel.
Auf der anderen Seite legte Jack ein Album von Nick Drake auf den Plattenspieler. Seine volle Stimme füllte den Laden und flüsterte von goldenen Kronen und Ruhe. Hazel versuchte, Jack unauffällig zu beobachten, um seine Stimmung einzuschätzen. Er sah wie immer ein bisschen zerknittert aus in seiner Jeans, zweifarbigen Oxfords und einem ungebügelten grünen Hemd, das den Silberglanz seiner Augen betonte. Als er Hazel und Ben sah, lächelte er – aber bildete Hazel sich nur ein, dass sein Lächeln etwas gezwungen war und nicht zu den Augen reichte? Nicht so wichtig, da sein Blick ohnehin über sie hinweg zu ihrem Bruder schweifte. »Jetzt erzähl mal, wieso du bei deinem Date alles stehen und liegen gelassen hast wie Bruce Wayne, nachdem er das Batsignal gesehen hat?«
Ben lachte. »So war das gar nicht!«
Was hatte sie sich bloß dabei gedacht, ihn zu küssen? Nur weil sie als Kind in ihn verknallt gewesen war? Nur weil sie Lust drauf hatte?
»Jep«, zwang sie sich zu sagen. »Batman lässt nie alles stehen und liegen.«