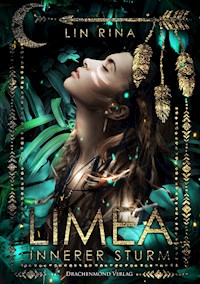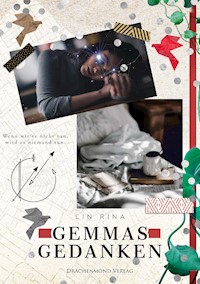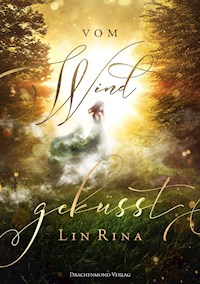Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Drachenmond VerlagHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Roman aus dem Staubchronik-Universum
- Sprache: Deutsch
Ein Roman aus dem Staubchronik-Universum Alles begann mit dem äußerst unwahrscheinlichen Ereignis, dass ein Koffer vom Himmel fiel. London 1890/91 Die Metropolitan Police hat uns gebeten einen Bericht über die kürzlichen Ereignisse im Fall ›David Brighton‹ zu schreiben. Und wie wir - eine vorlaute Studentin und ein schusseliger Mechaniker - es geschafft haben, der ganzen Sache auf die Spur zu kommen, während die Polizei Däumchen gedreht hat. Da Jamie sich aber strikt weigert, zu Papier zu bringen, was wir durchlebt haben, bleibt diese Aufgabe an mir hängen: Elisa Hemmilton, mutige Laien-Ermittlerin, neugierige Spürnase und Siegerin der Herzen[1]. __________________________________ [1] Trägst du nicht etwas zu dick auf, Liz? Wenn dir nicht passt, was ich hier fabriziere, dann hättest du es selber schreiben sollen, mein lieber Jamie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Elisa Hemmiltons Kofferkrimi
Ein Roman aus dem Staubchronik-Universum
Lin Rina
Copyright © 2021 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Stephan Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Stephan Bellem
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
978-3-95991-398-0
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Vorwort der Verfasserin
Es war einmal ein Koffer
Tinte an den Fingern
Verstimmte Geigen
Das hier ist kein Einbruch
Zuhause ist da, wo die Schuhe dreckig werden
Neue Bekanntschaften
Das sah schon vorher so aus
Die Macht der großen Hüte
Blaues Wunder
Wie man ein Verhör führt
Punsch ist auch eine Lösung
Ein Fall für Elisa Hemmilton
Offene Türen
Mr Green
Ich würde bereit sein
Dein Freund und Helfer
Gänseblümchen
Zinnsoldaten
Ein Tanz in der Höhle des Löwen
Erkenntnisreiche Unterhaltungen
Die Kunst, den Spieß umzudrehen
Da stinkt doch was
Schmalzlocke
Ich habe keinen Verehrer
Feiertagsrätsel
Eigentum von Elisa Hemmilton
Wieso fiel der Koffer vom Himmel?
Blumen in Scherben
Davids kleines Geheimnis
Jungfrau in Nöten
Der Zweck heiligt die Mittel
Lass uns abhauen
Bis zum bitteren Ende
Was wirklich geschah
Sehr geehrte Miss Hemmilton,
Epilog
Anmerkungen
Danksagung
Drachenpost
Für Astrid.
Weil du größer träumst als ich und dadurch für mich Sterne in Bücher verwandelst.
Ohne dich hätte ich es nie geschafft, diese Geschichte aufzuschreiben.
Vorwort der Verfasserin
Die Metropolitan Police hat uns gebeten, einen Bericht über die jüngsten Ereignisse im Fall ›David Brighton‹ zu schreiben. Und wie wir – eine vorlaute Studentin und ein schusseliger Mechaniker – es geschafft haben, der ganzen Sache auf die Spur zu kommen.
Da Jamie sich aber strikt weigert, zu Papier zu bringen, was wir durchlebt haben, bleibt diese Aufgabe an mir hängen: Elisa Hemmilton, mutige Laienermittlerin, neugierige Spürnase und Siegerin der Herzen1.
Auch wenn ich gern behaupten würde, dass mir das eine lästige Pflicht wäre, glaube ich eher, dass es mir viel zu viel Spaß machen wird und Jamie am Ende die Augen über mich verdreht.
Ich habe ihm angeboten, den Bericht mit seiner Sicht der Dinge zu kommentieren und ich fürchte, das wird er schamlos in Anspruch nehmen.
Wie dem auch sei, hier folgt mein offen und ehrlicher Bericht über die Ereignisse im letzten Winter und ich schwöre, keine hässlichen Details wegzulassen, auch nicht die illegalen. (Möglicherweise aber dafür all die technischen Ausführungen von Jamie. Die braucht einfach niemand!)
Gut für uns, dass uns der Einbruch in den Anbau der West Brickstone Villa im Nachhinein verziehen wurde. Das mit Ihrem Daumen, Chief Inspector Layer, tut mir aufrichtig leid. Es war keine Absicht. Ich schwöre es.
Und so viele Menschen wurden ja im Großen und Ganzen nun auch nicht verletzt. Zumindest niemand, der es nicht auch verdient hat.
Die Geschehnisse zwischen Weihnachten und Silvester waren wirklich sehr abenteuerlich und möglicherweise habe ich mich deshalb nicht so damenhaft benommen, wie man es von mir erwartet. Aber was geschehen ist, ist geschehen und wenn wir uns alle einig sind, dass meine werte Gönnerin, Miss Brandon-Welderson, diesen Bericht niemals zu Gesicht bekommen wird, dann bleibt es mir auch erspart, zur Strafe für diese Unsittlichkeit zwanzig Seiten aus Newmans Predigten abzuschreiben. Das wäre wirklich nett. Danke.
Gezeichnet
Elisa Hemmilton
Es war einmal ein Koffer
Freitag, 07. November 1890
Alles begann mit dem äußerst unwahrscheinlichen Ereignis, dass ein Koffer vom Himmel fiel.
Es war nicht irgendein Koffer, sondern ein Überseekoffer von Drew & Sons. Ein Modell in dezentem Braun mit Messingbeschlägen und einem Rundzylinderschloss mit vier Stiften.
Wäre er an diesem verregneten Tag schnurstracks auf die gepflasterte Straße geknallt, hätte auch Drew & Sons’ Garantie auf Unzerstörbarkeit nichts geholfen und er wäre am Boden zerschellt.
Doch es kam ganz anders, als er die gläserne Kuppel der Royal University Library durchschlug, vom fein geschnitzten Rundgang abprallte und einen der Tische im Lesesaal zertrümmerte. Obwohl ein erheblicher Schaden von mehreren Hundert Pfund entstand, ein Glaser all seine Vorräte aufbrauchte und ein Teil der medizinischen Abteilung der Bibliothek durch den hereinfallenden Regen zerstört wurde, blieb der Koffer weitestgehend unversehrt.
Lediglich das hochmoderne Schloss ging zu Bruch.
Da es für alle Anwesenden an diesem Morgen wichtiger war, die Bücher vor dem Regen zu retten, von denen trotz großer Bemühungen hundertdreiundzwanzig einen traurigen Wassertod starben, blieb der Koffer an Ort und Stelle liegen. Erst als am frühen Mittag zwei Officer der Metropolitan Police eintrafen, konnte man sich um das eigentliche Problem kümmern.
Constable Evan Miller, ein junger Mann mit hoher Stirn und dichtem blonden Schnurrbart, hievte den Überseekoffer aus den Überresten des Tisches und stellte ihn auf dem Boden ab. Scherben knirschten unter seinen Stiefeln und so wie er dreinschaute, war er sicher nur froh, den Saustall aus Splittern, Pfützen und nassem Papier nicht aufräumen zu müssen, der sich in einer Schneise der Zerstörung von oben nach unten durch die Bibliothek zog.
Der Inhalt des Koffers zeigte sich auf den ersten Blick ernüchternd gewöhnlich. Männerkleidung für mehrere Tage, ein Bowler von Lock & Co. Hatters aus der St James’s Street, Rasierzeug und Zigaretten. Erst nach einigem Wühlen entdeckten sie unter einem Zwischenboden eine dicke Rolle aus Blaupausen, ein in Leder gebundenes Notizbuch und ein zylindrisches Behältnis aus Metall.
»Unfall oder Verbrechen?«, fragte Sergeant Cosmo Warren und stemmte seine viel zu langen Arme in die Seiten. Er erwartete nicht wirklich eine Antwort. Er hörte sich nur selbst gern reden.
»Ich denke, wir können getrost davon ausgehen, dass der Koffer nicht von Gott herabgeworfen wurde«, sagte er und sah den Constable in Erwartung eines Lachers von der Seite an. Miller hatte jedoch noch nicht gefrühstückt und so war ihm nicht nach Witzen zumute.
»Vielleicht ist jemand aufs Dach gestiegen und hat ihn fallen lassen?«, spekulierte der Sergeant weiter. »Dann wäre es definitiv ein Anschlag. Ein aufwieglerischer Akt gegen unser Bildungssystem.«
Der Constable hörte ihm nur still zu und öffnete die Ledermanschette, mit der die Blaupausen zusammengehalten wurden. Vorsichtig legte er die dünnen Papiere auf einem der Tische ab, entrollte sie und betrachtete die erste Seite.
Zahnräder, Gurte, Kabel und ein Haufen Formeln blinzelten ihm entgegen und auch wenn er dem Ganzen eine künstlerische Ästhetik abgewinnen konnte, gab es keinen Anhaltspunkt für ihn, welche Art von Konstruktion er vor sich sah.
»Ich denke ja eher, dass es sich hier um einen Unfall handelt«, meldete sich eine Stimme und die beiden Polizisten wandten sich interessiert zu der Person um, die sie ganz offensichtlich belauscht hatte.
Er war ein hagerer, großer Mann mit ernstem Blick und diesem eigentümlichen Schwung der Lippen, der ihm den Ausdruck verlieh, bis in seine schwarze Seele hinab genervt zu sein.
Thomas Reed ist der Bibliothekar der Royal University Library und bekannt für seine schlechte Laune.
Er nahm sich nicht die Zeit, die Herren auf höfliche Art zu begrüßen und sie taten so, als hätten sie das auch nicht erwartet.
»Wie kommen Sie zu dieser Vermutung?«, erkundigte sich Miller, da Warren den Bibliothekar nur irritiert anstarrte.
Sein Erscheinungsbild gab auch allen Anlass dazu. Die Haare standen ihm wild vom Kopf ab, Nässe bildete Flecken auf seinem dunkelbraunen Anzug und die Fliege hatte er sich bloß um den Hals gelegt, ohne sie zu binden. Doch sollte man sich nicht darüber wundern, wenn man bedachte, dass Mr Reed den Vormittag damit verbracht hatte, nasse Bücher aus Regalen zu retten, die unerwartet dem Londoner Schmuddelwetter ausgesetzt worden waren.1
Mr Reed überging dies gekonnt, so als wäre alles wie sonst.
»Das Glas der Kuppel ist sehr dick«, führte er aus. »Einen Koffer hindurchzuwerfen, sodass es so zersplittert, wie wir es dort oben sehen, hätte viel Schwung erfordert. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Herren, aber ich bin froh, wenn ich so einen Überseekoffer überhaupt gehoben bekomme. Über auf das Dach schaffen und durch eine Scheibe werfen will ich gar nicht nachdenken. Für einen Anschlag auf das Bildungssystem gibt es sicher leichtere und auch effektivere Methoden als diese hier.«
»Es könnten mehrere Personen gewesen sein«, beharrte Sergeant Warren, noch nicht bereit, seine reißerische Theorie aufzugeben und Constable Miller seufzte laut.
Der Bibliothekar schüttelte den Kopf. »Viele Flugschiffe fliegen ihr Wendemanöver über diesem Bereich, bevor sie am City of London Flugplatz landen. Der Koffer könnte herausgerutscht sein. Vielleicht lässt sich bei den Flügen heute Morgen eine defekte Gondel finden.«
Das klang weitaus logischer. Fand zumindest der Constable. Der Sergeant blieb bei seiner eigenen Variante.
Doch sie würden beide unrecht behalten.
»Was auch immer …«, setzte Warren an, doch der Bibliothekar hörte ihm schon nicht mehr zu. Er war an den Constable herangetreten und warf einen Blick über dessen Schulter auf die Blaupausen.
Hätten die Officers genau hingesehen, wäre ihnen die aufflammende Neugierde in seinem Blick aufgefallen. Mr Reed ist zwar ein Stubenhocker und ausgemachter Griesgram, aber an ihm ist ebenfalls ein Visionär verloren gegangen, der jede Art von technischem Fortschritt mit jungenhaftem Enthusiasmus betrachtet.
»Mechanische Baupläne?«, erkundigte er sich interessiert bei Miller und trat an dessen Seite, um besser sehen zu können. Doch obwohl er in seinem Leben schon eine Menge Bücher zu dem Thema gelesen hatte, belief sich all sein Wissen lediglich auf einen kleinen theoretischen Teil des Ganzen.
»Scheint so. Ich weiß aber nicht, ob die uns Aufschluss über den Vorfall geben werden«, entgegnete der Constable und zeigte flüchtig mit der einen Hand in Richtung Glaskuppel.
»Wenn Sie einen Fachkundigen brauchen, kann ich Ihnen wärmstens Jamie Lennox empfehlen. Er ist Uhrmacher und ein raffinierter Mechaniker. Seine Werkstatt ist drüben in Hoxton«, zeigte Mr Reed sich hilfsbereit und zog eine Lesebrille aus der Brusttasche seiner Weste, um einen genaueren Blick zu erhaschen.
Sergeant Warren riss ihm die Pläne unter der Nase weg und rollte sie gröber auf, als notwendig gewesen wäre. »Das wird nicht nötig sein, mein Herr. Wir müssen schließlich nur herausfinden, was passiert ist und nicht in den privaten Unterlagen anderer herumschnüffeln.« Er gab sich überlegen und war sicher auch stolz darauf, ein so vernünftiges Argument vorgebracht zu haben. Doch eigentlich trieb ihn nur der Unmut um, dass die Theorie des Bibliothekars besser war als seine eigene und er dem Mann, der ihn auch noch überragte, keine weitere Möglichkeit bieten wollte, ihn vor dem Constable auszustechen.
»Packen Sie alles ein, Constable Miller. Wir schaffen den Koffer aufs Revier«, befahl er, ohne den Kollegen anzusehen und ließ die Pläne in den Koffer zurückfallen.
Mr Reed verdrehte die Augen über den Sergeanten, dessen simples Wesen er längst durchschaut hatte. Es lag ihm auf der Zunge, etwas Spöttisches zu erwidern, doch ein Blick auf seine silberne Taschenuhr teilte ihm mit, dass er schon spät dran war. Verpflichtungen warteten auf ihn und er riss sich schweren Herzens von dem Geheimnis los, das in dem Koffer schlummerte, der auf so mysteriöse Weise den Weg in seine heiligen Hallen gefunden hatte.
Sergeant Cosmo Warren und Constable Evan Miller packten alles ein, machten sich noch ein paar Notizen und schnappten sich dann je einen Tragegriff an den Seiten des Überseekoffers. Miller ächzte unter dem Gewicht und nicht einmal Warren brachte noch eine seiner altklugen Nichtigkeiten zustande, als die beiden Polizisten die Bibliothek durch den Haupteingang verließen, den Koffer zwischen ihnen.
Sie wussten nicht, dass sie gerade Teil eines bedeutenden Moments gewesen waren. Dem Ende einer Geschichte und dem Anfang einer gänzlich neuen.
Tinte an den Fingern
Mittwoch, 19. November 1890
Jamie Lennox, Uhrmacher und Mechaniker, steckte gerade mit den Fingern in einer Spieluhr fest, als jemand mit lauten Schlägen gegen die Tür seiner Werkstatt hämmerte.
Er war so sehr auf eines der Zahnräder konzentriert, dass er bei dem Geräusch schmerzhaft zusammenzuckte und beinahe seine ganze Reparaturarbeit wieder zunichtegemacht hätte.
Dabei war er bereits seit einer Stunde nervös, weil er mal wieder zu spät dran war. Schon längst sollte er auf dem Weg zur Royal University Library sein, um die dort von ihm eingebaute Suchmaschine aufzuziehen.
Eine Spielerei, die ihm immer noch wie ein Traum vorkam.
Er liebte den Raum im oberen Teil der Bibliothek, der voller klackernder Zahnräder, surrender Gurte und tanzender Federn war. Ein Ballett aus Messing, Eisen und Kupfer. Ein Orchester, das die Musik seiner Seele spielte. Er nannte sie liebevoll Lady Honeyclack.
Als der Bibliothekar Mr Reed vor ein paar Jahren in die kleine Werkstatt am Rande von Hoxton spaziert kam und seinem Vater und ihm den Vorschlag unterbreitet hatte, für ihn eine solche Maschine zu entwickeln, war Jamies Vater überzeugt gewesen, er mache einen Scherz mit ihnen. Doch Jamies Herz war sofort für diese Idee entbrannt.
Eine Suchmaschine, die jeden Buchtitel aus der Bibliothek anhand von Schlagwörtern finden konnte.
Damals hatte sein Vater noch die meisten Konstruktionen entworfen. Gebaut worden war sie schlussendlich von Jamie selbst. Sie war sein persönliches Meisterstück.
Sie würde das allerdings nur bleiben, wenn er seinen Hintern dort hinbewegte und sie regelmäßig aufzog.
Doch eins nach dem anderen. Erst mal musste er an die Tür.
»Ich komme«, rief er gepresst und brauchte einen Moment, bis er seinen Zeigefinger aus den Windungen der Spieluhrmechanik befreit hatte.
Wahrscheinlich hätte er das Ding einfach zur Reparatur an seinen Vater weiterreichen sollen. Dieser war ein klassischer Uhrmacher, während Jamie sich zu großen Maschinen hingezogen fühlte wie eine Motte zum Licht.
Als er zur Tür eilte, wischte er sich die Hände an der Schürze ab, die er bei Reparaturen wegen der Ölspritzer trug, nahm sich jedoch nicht die Zeit, einen Blick in den Spiegel zu werfen. Da er heute bisher keine größeren Maschinerien zu seinem Tagwerk gezählt hatte, ging er davon aus, keine Schmierer im Gesicht zu haben.
Hätte er mal lieber nachgesehen, denn ein schwarzer Streifen zog sich ölig über seine Stirn. Wahrscheinlich war er entstanden, als er sich vorhin mit dem Daumenballen eine kitzelnde Haarsträhne aus den Augen geschoben hatte. Doch Jamie würde das erst später auffallen.1
Wieder hallten die schweren Schläge an der Tür durch den Raum und kündeten von der Ungeduld des Besuchers.
»Jaja! Ich bin doch keine Dampflok!«, tönte Jamie, der in Gedanken noch halb bei der Spieluhr war, griff nach der Klinke und riss die Tür auf.
Womit auch immer er gerechnet hatte, ein Constable der Metropolitan Police war es nicht gewesen.
Einen kurzen Moment starrten sie sich gegenseitig an.
»Mr Jamie Lennox?«, erkundigte sich der Polizist dann höflich und gar nicht so, als wäre er ungeduldig. Er war ein junger Mann, wenig älter als Jamie, hatte auffällig volle Lippen und einen buschigen Schnurrbart.
»Der bin ich. Wie kann ich helfen?«, fragte Jamie sofort und versuchte an der Haltung und Mimik des Constables zu erkennen, ob er sich Sorgen machen musste. Und wenn ja, welcher Art.
Doch die Schultern des Mannes waren locker, er verlagerte sein Gewicht gelassen von einem Bein auf das andere und seine Augen sprachen von Neugierde und Überraschung, während sie sich gegenseitig musterten.
Jamie entspannte sich wieder.
Der Polizist war demnach weder hergekommen, um ihm den Tod eines geliebten Menschen mitzuteilen, noch um ihn zu verhaften. Das hätte sein Gesichtsausdruck sicher verraten.
Davon abgesehen, dass Jamie auch nichts angestellt hatte, für das man ihn verhaften könnte. Aber in dieser Stadt wusste man ja nie.
»Mein Name ist Miller«, stellte der Constable sich knapp vor und zupfte seine dunkelblaue Uniform zurecht. Der kurze Schlagstock baumelte an einer Schlaufe an seinem Gürtel und Jamie musste darauf achten, das schwarz lackierte Holz nicht anzustarren.
Waffen hatten eine eigentümliche Wirkung auf Jamie Lennox. Eine furchtsame Faszination, die ihn ebenso anzog wie auch zu Tode ängstigte.
»Wir benötigen Beratung in einer Sache, die einen Mechaniker erfordert und Sie wurden uns empfohlen.«
Jamie blinzelte irritiert und konzentrierte sich wieder auf sein Gegenüber und die Worte, die es gesagt hatte.
Jamie war empfohlen worden? Von wem? Er war für viele – auch wohlhabende – Stammkunden tätig und hatte zusätzlich dazu noch die Laufkundschaft. Doch wer davon eine solch enge Beziehung zur Metropolitan Police pflegte, um eine Empfehlung aussprechen zu können, konnte er nicht sagen.
»Ich wurde empfohlen?«, erkundigte Jamie sich daher und der Constable nickte eifrig. Sein Helm bewegte sich dabei keinen Millimeter, als wäre er an den Kopf angeschraubt worden.
Wie wohl ein Kopf mit einem Gewinde darauf aussah? Und wenn ein Polizist immer seine Dienstkleidung tragen musste, ging er mit dem Helm dann auch zu Bett?
»Ja. Mr Reed, der Bibliothekar der Royal University Library, sagte, Sie könnten uns sicher weiterhelfen.« Der Constable lächelte gewinnend und trat einen Schritt von der Tür zurück. »Würden Sie mir folgen?«
Jamie wusste, dass er leicht ablenkbar war und daher oft entscheidende Stellen in Unterhaltungen oder anderen zwischenmenschlichen Interaktionen verpasste. Doch hier ging es gerade tatsächlich zu schnell vonstatten.
»Was? Jetzt sofort? Aber ich habe Termine. Ich kann nicht so einfach …«, begann er und hielt dann inne. »Moment, sagten Sie, Mr Reed hat mich empfohlen?«
Der Constable nickte wieder und bewies eine Engelsgeduld mit ihm. Jeder andere hätte zumindest schon das Gesicht verzogen. Das rechnete Jamie ihm hoch an und er beschloss spontan, den Constable zu mögen.
»In Ordnung«, sagte er prompt und sah sich zerstreut nach seiner Tasche um. »Welche Art von Problem liegt denn vor? Nur damit ich weiß, welches Werkzeug ich mitnehmen muss«, erkundigte sich Jamie und war schon auf halbem Weg zurück in die Werkstatt, als der Constable ihn zurückhielt.
»Nein, nein!«, rief er sofort. »Keine Reparatur. Nur Ihre fachkundige Meinung bitte.«
Besser spät als nie, schlich sich die Neugierde in Jamies Geist und ließ seine Fingerspitzen kribbeln.
Es wäre sicher nicht so schlimm, die Wartung der Suchmaschine heute Nachmittag zu verschieben, schließlich wusste der Bibliothekar offensichtlich Bescheid. Und die Metropolitan Police fragte ja auch nicht alle Tage nach seiner Hilfe.
Er würde dem Bibliothekar jedoch eine Nachricht zukommen lassen, um Misskommunikation zu vermeiden.
Ohne Werkzeug das Haus zu verlassen fühlte sich für Jamie so an, wie es für andere Leute wäre, ohne Schuhe loszuziehen. Daher schulterte er trotzdem die Tasche mit seiner Grundausrüstung, schlüpfte in seinen Mantel und vergaß darüber beinahe, die grau verschmierte Schürze auszuziehen.
Schnell kritzelte er ein paar Worte an den Bibliothekar auf ein Stück Papier und steckte es zusammen mit einer Handvoll Pennys in die Manteltasche.
Der Constable wartete brav vor der Tür, bis der Mechaniker nach draußen trat und die Werkstatt hinter sich abschloss.
»Dann los«, sagte Jamie beschwingt und streckte den Rücken durch, um entschlossen und kompetent zu wirken.2
Außerhalb der engen Gasse, in der sich Jamies Arbeitsplatz befand, schien die Sonne auf die Straßen Londons und zeigte die Stadt von ihrer besten Seite. Graues Herbstlaub verdeckte das fleckige Kopfsteinpflaster und der starke Wind trug die strengen Gerüche des Arbeiterviertels mit sich fort.
Eine Droschke wartete auf sie.
Jamie nutzte den kurzen Moment, in dem der Constable mit dem Kutscher sprach, um sich nach einem Burschen umzusehen.
Nicht weit entfernt lungerte Sooty mit seinen Kumpanen herum und er winkte den Straßenjungen zu sich. Ein paar Pennys wechselten den Besitzer und Sooty machte sich mit Jamies Notiz in der Tasche auf zur Royal University Library.
Mit klopfendem Herzen stieg Jamie in die Droschke und presste die Werkzeugtasche fest an seine Brust, als er sich auf die harte Bank neben den Constable fallen ließ.
Er war nervös. Sein Bein zuckte unentwegt und er rutschte immer wieder mit dem Hintern auf der unbequemen Bank hin und her.
Gern hätte er behauptet, dass dies nur einer von vielen Aufträgen war, wie er sie jeden Tag zu erledigen hatte. Doch das entsprach nicht der Wahrheit, er war vorher noch nie von der Polizei konsultiert worden.
Die Fahrt dauerte überraschend lang, was zum einen dem Londoner Verkehr geschuldet war und zum anderen daran lag, dass sie nicht zur nächsten Polizeistation nach Finsbury fuhren, sondern bis rüber ins West End.
Constable Miller zeigte nicht die Güte, ein Gespräch anzufangen und so traute Jamie sich nicht, etwas zu sagen oder gar nachzufragen, was genau ihn denn erwartete. Dabei hätte er wirklich gern geredet; und wäre der Mann neben ihm kein Polizist gewesen, sondern nur irgendwer, hätte er es auch getan.
Die Polizeistation war ein hohes Gebäude, eingequetscht zwischen zwei Häuserfronten, die sie regelrecht zu erdrücken schienen. Die Straße davor war belebt und der Kutscher musste in zweiter Reihe halten, um sie rauszulassen.
Auf dem Bordstein wuselte es geradezu. Herren in teuren Anzügen, die mit eifriger Miene vorbeieilten. Damen, in eleganten Kleidern mit endlos viel Spitze am Saum, flanierten zum nächsten Teehaus.
Der Constable bewegte sich so selbstverständlich auf den Eingang der Wache zu, dass die Leute ihm auswichen oder innehielten und zur Begrüßung mit dem Finger gegen den Zylinder tippten.
So eine Uniform hat eine Menge Macht, dachte Jamie bei sich und versuchte angestrengt, niemandem auf die Füße zu treten, während er dem Constable folgte.
Im Gebäude selbst ging es nicht weniger geschäftig zu. Jamie kam es vor, als summte es wie in einem Bienenstock. Nur dass es am Ende keinen leckeren Honig gab. Zu schade.
»Mr Lennox?«, lenkte Constable Miller seine Aufmerksamkeit auf einen weiteren Herrn, zu dem sie gerade getreten waren, ohne dass Jamie es gemerkt hatte.
Der Mann vor ihm stand so straff da, als hätte ihm jemand einen Besenstiel an den Rücken gebunden. Was ulkig aussah, da seine Arme und Beine lang und dünn wirkten wie die eines Weberknechts.
Sofort begann Jamies Gehirn eine Vorrichtung zu entwerfen, die dem Mann zusätzliche vier Arme schenken würde und gleichzeitig den Besenstiel an Ort und Stelle halten könnte. Mit Kugellagern, Greifzangen, ein paar Drahtwinden und …
Jamie huschte ein Lächeln über die Lippen, er nahm sich jedoch sofort zusammen, als der Mann ihn mit einem scharfen Blick strafte, so als hätte er seine verrückten Gedanken gehört.
»Mr Lennox. Schön, dass Sie die Zeit finden konnten, uns zu unterstützen. Ich bin Sergeant Cosmo Warren. Constable Miller wird rasch mit Ihnen den Papierkram erledigen und danach sehen wir uns hinten bei den Beweismitteln«, sagte er und betonte jedes Wort so, als wäre es von größter Wichtigkeit, es sich zu merken. Vor allem seinen Namen.
Jamie war schlecht mit Namen und murmelte den des Sergeanten eine Weile vor sich hin, um ihn bloß nicht sofort wieder zu vergessen.
Der Constable hielt ihm eine Seite unter die Nase, die er unterschreiben musste, damit er als offizieller Berater der Polizei galt und für seine Zeit auch bezahlt werden würde.
Eilig kritzelte Jamie seine Unterschrift darauf und merkte zu spät, dass der Füllfederhalter undicht war und ihm die Tinte nun dunkelblau an den Fingerspitzen haftete.
Jetzt sollte er sich besser nicht ins Gesicht fassen.
Weil es sich jedoch um Jamie Lennox handelte, der sich diesen Vorsatz machte, fasste er sich natürlich keine Minute später aus lauter Nervosität an die Stirn und hinterließ neben dem Ölschmierer einen blauen Fingerabdruck.
Im hinteren Teil des Gebäudes herrschte trotz des schönen Wetters vergleichsweise Dunkelheit, da nicht viel Licht durch die Fenster in den Raum gelangte. Dafür standen die Häuser zu dicht.
Jamie nestelte immer noch an dem Gurt seiner Tasche, als der Weberknecht-Sergeant, dessen Namen ihm entfallen war, ihn und den Constable eintreten ließ.
Erst als sein Blick auf den Tisch vor ihm fiel und er darauf einen verwaschen braunen Überseekoffer erblickte, ging ihm auf, was das alles zu bedeuten hatte.
Er erinnerte sich an den Vorfall in der Bibliothek. Ein Tag vor etwas weniger als zwei Wochen, an dem es so heftig geregnet hatte, dass er klatschnass beim Haus der Morgens ankam, weil er versprochen hatte, sich die zu langsam laufende Standuhr im Foyer anzusehen.
Sein Vater hatte ihm von dem Vorfall mit dem Koffer erzählt, als er später frierend den Regen aus seinem Mantel schüttelte.
Niemals würde er es vor dem Bibliothekar aussprechen, aber Jamie war insgeheim froh, dass es nur Bücher getroffen hatte und nicht etwa Lady Honeyclack. Regen hätte ihren sensiblen Spiralfedern und sorgfältig ausbalancierten Ankerwellen nicht gutgetan.
»Wir suchen seit einigen Tagen nach dem Besitzer dieses Koffers, können ihn aber nicht ermitteln«, sagte der Weberknecht-Sergeant und öffnete den schweren Deckel.
Erstaunt betrachtete Jamie das noch völlig intakte Reisegepäckstück und konnte sich kaum vorstellen, dass es einen Sturz hinter sich hatte.
»Und wie soll ich da behilflich sein?«, erkundigte er sich und trat näher an den Tisch heran.
Auf den ersten Blick sah er die zersprungene Mechanik des Kofferschlosses. Doch nicht heil geblieben, dachte er sich, traute sich aber nicht, die Hand danach auszustrecken. Sie hatten ihn sicher nicht hergeholt, um ein Kofferschloss zu reparieren.
Wäre auch gar nicht möglich gewesen. Das gequälte Ding hatte das Zeitliche gesegnet.
»Sehen Sie sich das an«, kam der Constable seinem Vorgesetzten zuvor, der bereits mit großspuriger Geste den Mund geöffnet hatte.
Neben dem Koffer lag eine Rolle mit Blaupausen, von denen der Constable die oberste entrollte.
Jamie musste nur einen Blick darauf werfen und es war ihm, als hätte er einen Schritt in eine andere Welt getan. Die Realität blieb dumpf hinter ihm zurück und all die zuckenden Gedanken, die permanent durch seinen Kopf rasten, verstummten. Es war wie aufatmen. Wie feststellen, dass die Sonne schien. Wie ein Schluck Wasser, wenn man durstig war. Aufregung kitzelte ihm auf der Kopfhaut und er strich das Blatt mit den Handballen glatt, damit es sich nicht von allein wieder zusammenrollte.
Vor ihm lag der Plan einer Maschine. Einer großen Maschine. Etwas, das so komplex war, dass es nicht auf einer einzigen Seite Platz hatte.
Die Linien waren fein und gerade, die Angaben knapp und präzise, eine Vollkommenheit in Blau und Weiß.
»Können Sie uns sagen, wem die Pläne gehören?«, fragte eine Stimme, die Jamie an zu viel Butter auf einer Scheibe Weißbrot erinnerte.
Als hätte jemand eine Tür gewaltsam aufgerissen, stürmte die Realität auf Jamie ein und er fühlte sich einen Moment lang überfordert von all den Eindrücken und Gedanken, die wieder auf ihn einpreschten. Der stechende Blick des Weberknecht-Sergeanten, der Geruch nach Bergamotte und Pech vom Constable neben ihm, das brandende Gemurmel der unzähligen Menschen in diesem Gebäude.
Jamie blinzelte und lenkte die Konzentration zurück auf die Frage. »Nein? Sollte ich das wissen?«, erwiderte er und der Weberknecht-Sergeant gab einen unzufriedenen Laut von sich. »Welcher Name steht denn im Koffer?«, fragte Jamie schnell, um sich nicht den Zorn des Spinnenmannes zuzuziehen – auch wenn er nicht glaubte, dass die Metropolitan Police so blöd wäre, dort nicht als Erstes nachzusehen.
»Leider keine aktuellen Angaben«, antwortete der Constable ihm gnädigerweise und lenkte damit den stechenden Blick des Sergeanten auf sich. Flüchtig wies er auf das festgenietete Metallplättchen in der Innenseite des Kofferdeckels und Jamie folgte der Handbewegung automatisch mit den Augen. »Die Adresse hat uns zu einem Verstorbenen geführt, dessen Erbe seine Sachen undokumentiert an Dritte veräußert hat. Eine Sackgasse. Wir haben nur die Pläne.« Der Constable rieb sich die Augen.
War er müde? Er sah müde aus. War sicher auch nicht besonders erholsam, mit einem Helm auf dem Kopf zu schlafen.
Jamie schüttelte den Kopf, irritiert von seinen eigenen versponnenen Gedankengängen.
»Sie sprechen doch bestimmt mit Kollegen Ihrer Branche. Hat da niemand über solch eine Erfindung gesprochen oder gemunkelt?« Die Stimme des Weberknecht-Sergeanten klang nicht mehr so buttrig wie gerade noch. Er verlor ganz allmählich die Geduld, was darauf schließen ließ, dass er sich mehr von dem Gespräch mit einem fachkundigen Berater erhofft hatte.
Aber da konnte Jamie ja nichts dafür. Er war Mechaniker, kein Hellseher.
»Welche Art Erfindung ist es denn?«, traute Jamie sich zu fragen und bekam prompt ein weiteres Schnauben zu hören.
Der Sergeant stemmte seine langen Arme in die Seiten und sah dabei noch mehr aus wie ein Weberknecht. Wenn Jamie wieder zu Hause ankam, musste er ganz dringend einen Entwurf für die mechanischen Arme zeichnen.
»Wir haben gehofft, Sie könnten uns das sagen.«
Jamie lachte ungläubig auf. Es war einfach absurd, zu denken, ein Blick auf die Komplexität des Bauplans könnte schon Aufschluss darauf geben, was er da vor sich hatte.
»Dafür müsste ich mich sehr viel länger hiermit auseinandersetzen.« Er ließ die Hände über der entrollten Blaupause kreisen. »Womit ich kein Problem hätte. Ich würde mich liebend gern Tage und Wochen damit beschäftigen. Wenn ich darf«, fügte er hinzu und bekam allein bei der Vorstellung, diesem Geheimnis auf den Grund zu gehen, Herzklopfen.
Fragend sah er erst zum Sergeanten und dann zum Constable. Zweiterer antwortete ihm mit einem Schmunzeln, das Jamie die leise Hoffnung schenkte, dass dies tatsächlich im Bereich des Möglichen lag.
»Das ist nicht zielführend«, zerstörte die nun sehr harsche Stimme des Weberknecht-Sergeanten Jamies Tagträume.
Wenn er ehrlich war, hatte er aber auch nicht wirklich damit gerechnet, diese Bitte gewährt zu bekommen.
»Gibt es auf dem Plan vielleicht Anhaltspunkte auf den Erfinder?«, erkundigte sich der Constable, dessen Geduldsfaden wohl sehr viel länger war als der seines Vorgesetzten.
Jamie betrachtete den Plan noch einmal genauer und gab sich große Mühe, sich nicht in all den Möglichkeiten zu verlieren, die ihm die Konstruktion offenbarte.
»Nein«, flüsterte er, überflog all die Bezeichnungen, bis er auf zwei zackig geschriebene Lettern am unteren Rand stieß. Ein D und ein B.
»Oh. Da sind Initialen«, rief er erstaunt.
»Was? Wo?« Der Weberknecht-Sergeant drängte sich neben ihn, um selbst einen besseren Blick zu erhaschen und schubste ihn dabei gegen den Constable, der kommentarlos Platz machte.
»Sind Sie sicher? Ich sehe keinen Unterschied zum restlichen Gekrakel.«
Jamie zuckte mit den Schultern. »Es sind die einzigen Buchstaben, die keine Angaben für den Bauplan hergeben«, teilte er seine Erkenntnisse mit. Wie selbstverständlich griff er zu der Rolle mit Blaupausen, die ihm leise zuwisperten, Geheimnisse und Glückseligkeit versprechend und rollte eine weitere Seite aus.
Auch hier befanden sich die Initialen an der exakt gleichen Stelle, was seine Aussage bestärkte.
Auch auf Blaupause Nummer zwei fand sich ein Teil einer größeren Konstruktion. Hier war es einfacher zu erkennen, was dieser darstellen sollte. Wenn Jamie raten müsste, hätte er behauptet, es handle sich hierbei um eine Art automatisierten Verbrennungsofen.
Eine unerträgliche Anziehung ging von den Zeichnungen aus. All die verschiedenen Ebenen aus Linien, Kurbeln, Dampfrohren, versehen mit Materialangaben, Berechnungstabellen und theoretischen Ventildruckmessungen verzauberten ihn.
»Und Sie sind sich ganz sicher?«, holte ihn schon wieder der Spinnenmann zurück in den kargen Raum und ein ärgerlicher Funke schlug in Jamies Bauch. So langsam fiel es ihm zunehmend schwerer, sich von dem fehlenden Vertrauen in seine Aussagen nicht angegriffen zu fühlen.
»Ja doch«, bestätigte er ungehalten und ließ seinen Blick schweifen, um nicht wieder in die Gravitation der Blaupausen zu geraten.
Auf dem Tisch lagen noch mehr Dinge, die sicher alle aus dem Koffer stammten. Der Stapel Kleidungsstücke und der Hut deuteten auf einen Mann hin. Das Rasierzeug sah teuer aus, die Zigaretten waren jedoch von einer billigen Marke. Unter einer karierten Jacke lugte ein Notizbuch hervor.
Moment. Ein Notizbuch?
»Was ist mit dem Buch?«, wollte er sofort wissen und nahm es zur Hand, ohne um Erlaubnis zu fragen. Niemand hielt ihn auf.
Es lag gut in der Hand. Das Leder fühlte sich abgegriffen und speckig an von den unzähligen Malen, in denen es aufgeschlagen und benutzt worden war.
»Ein Notizbuch. Gleiche Handschrift wie auf den Plänen. Enthält aber leider nur Kauderwelsch. Wurde in irgendeiner Geheimsprache verfasst. Zum Teil sind seitenweise nur irgendwelche wirren Zeichen notiert«, tat der Weberknecht-Sergeant es ab, als wäre es dadurch unwichtig geworden und Jamie schlug forsch die Seiten auf.
Im ersten Moment wirkte die Buchstabenfolge tatsächlich wahllos. Doch Jamie war sich ziemlich sicher, dass niemand ein ganzes Buch mit Buchstabensalat füllte, nur um anderen einen Streich zu spielen. Wahrscheinlicher war es, dass es sich um verschlüsselten Text handelte.
Im Kopf versuchte er es mit drei verschiedenen, einfachen Buchstabenverschiebungen, kam aber zu keinem Ergebnis. So einfach wollte es ihm D. B. also nicht machen.
Da die Pläne der geheimnisvollen Maschine sich äußerst komplex zeigten, durfte Jamie davon ausgehen, dass auch die kryptografische Verschlüsslung nicht so leicht zu knacken wäre.
»Ich kann das sicher lesbar machen. Könnte aber Wochen dauern«, bot Jamie an und besah sich eine kleine Skizze weiter hinten im Buch. Abwesend hatte er damit begonnen, an seiner Oberlippe zu zupfen und blätterte weiter.
Das Notizbuch wurde Jamie so unerwartet aus der Hand gerissen, dass er zusammenzuckte.
»Wenn das Buch uns nicht gleich in Großbuchstaben den Namen seines Besitzers verkündet, ist es nicht von Nutzen.« Geräuschvoll ließ der Weberknecht-Sergeant das Buch vor Jamies Nase zuschnappen und legte es achtlos zurück auf die dunkle Tischplatte. Danach rollte er auch die Blaupausen wieder zusammen.
»Dann eben nicht«, murmelte Jamie leise und das Gefühl von Unzufriedenheit und Enttäuschung nistete sich in seiner Brust ein. Man hatte ihm einen kleinen Einblick in eine Welt voller Rätsel und Wunder gewährt und nun musste er damit leben, all dem niemals auf den Grund gehen zu können.
»Wenn das hier niemand abholt, kann ich es dann haben?«, purzelten die Worte aus seinem Mund, bevor er darüber nachgedacht hatte und der Weberknecht-Sergeant lachte auf so arrogante Weise auf, dass Jamie sich dumm vorkam.
»Das ist leider nicht möglich«, sagte der Mann, trat an ihm vorbei und ging auf die Tür zu. »Wir sind hier fertig. Auf Wiedersehen, Mr Lennox«, sagte er knapp und wartete nicht auf eine Antwort, als er aus dem Zimmer trat. »Verschwendete Zeit«, nuschelte er noch und verschwand auf den Flur.
»Ähm … auf Wiedersehen«, antwortete Jamie dennoch aus höflichem Zwang heraus. Schwerfällig atmete er ein, als hätte man ein Gewicht auf seinem Brustkorb abgelegt und fühlte sich so schlecht wie seit Tagen nicht mehr.
Jamie Lennox gehörte zur Arbeiterschicht. Er konnte sich glücklich schätzen, ein Dach über dem Kopf zu haben, regelmäßig etwas zu essen im Magen und eine gut bezahlte Arbeit.
Wenn er Standuhren in Stadtvillen reparierte oder technische Spielereien wohlhabender Herrschaften herrichtete, hatte er öfters mit Menschen zu tun, die gesellschaftlich über ihm standen und auf ihn herabsahen.
Doch so schäbig fühlte er sich danach selten.
Der Constable seufzte so laut, dass es für sie beide reichte und schenkte Jamie einen mitfühlenden Blick.
Zuerst dachte Jamie, er würde etwas zu dem Abgang seines Sergeanten sagen wollen. Doch dann seufzte er nur noch mal, zog ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und reichte es Jamie.
»Sie haben Öl und Tinte an der Stirn. Und Ihre Oberlippe ist ganz blau«, informierte er ihn und Jamie durchzuckte die Scham.
»Na wunderbar«, ächzte er und der Constable lachte. Aber nicht auf die gemeine Art wie der Weberknecht-Sergeant, sondern wie ein Freund.
Hastig rieb Jamie sich mit dem Tuch über das Gesicht, bezweifelte aber stark, damit alle Anzeichen seiner Ungeschicklichkeit von der Haut entfernen zu können.
»Besser?«, fragte Jamie verlegen und der Constable legte ihm zur Antwort nur federleicht eine Hand auf den Rücken.
»Kommen Sie. Ich bringe Sie wieder zu Ihrer Werkstatt«, sagte er und Jamie folgte müde seiner wegweisenden Geste nach draußen.
Verstimmte Geigen
Montag, 24. November 1890
Manchmal wünsche ich mir, mit den Worten Es war ein Tag wie jeder andere zu beginnen. Weil sie so gut klingen.
Aber wenn ich ehrlich bin, ist niemals ein Tag wie der andere. Und das ist vielleicht auch besser so.
Am Mittag des 24. Novembers zum Beispiel erreichte ein schwerer Brief das große Haus in der Park Street, mit dem ich nicht gerechnet hatte.
Er stammte von meinem Professor für Rechtswissenschaften.
Meine ersten schrecklichen Gedanken galten der Befürchtung, meine Semesterarbeit hätte ihn nicht erreicht oder wäre absolut unzureichend, sodass er mir mitteilen müsste, dass ich durchgefallen sei.
Aber dann wäre der Umschlag sicher niemals so dick gewesen.
Ich brach das Siegel und zog überraschenderweise ein Bündel Geldnoten und einen offiziellen Brief aus dickem Papier heraus. Eilig las ich die ersten Zeilen und geriet dabei so aus der Fassung, dass ich vergaß, die Gabel zu benutzen und mir den Rest meines Kuchenstücks mit den Fingern in den Mund schob.
Ungläubig huschte mein Blick über die krakelige Schrift, während ich mir wenig damenhaft die Buttercreme von den Fingern leckte. Allem Anschein nach hatte meine Semesterarbeit den Preis für ausgezeichnete Studienleistungen erhalten.
Das Preisgeld lag vor mir auf dem Tisch.
Ich musste den Brief ein weiteres Mal lesen, um es zu begreifen. Erleichterung und wilder Triumph versetzten meinen ganzen Körper so in Aufruhr, dass ich keinen Moment länger auf dem edlen Stühlchen im Frühstückssalon sitzen bleiben konnte. Ziellos lief ich auf und ab, las die Worte erneut und quietschte vor Begeisterung wie ein Schwein im Schlammbad.
Ich fühlte mich wie die Königin höchstpersönlich und malte mir genau aus, wie ich diese Nachricht zu Beginn des nächsten Semesters ganz genüsslich meiner schnöseligen Kommilitonin Beatrice Fitz-James unter die Nase reiben würde.
Sie vertrat lautstark die Meinung, jemand wie ich, die nicht reich geboren worden war, sondern in den dreckigen Straßen des East Ends aufwuchs, würde das Niveau der Universität senken.
Das Queen Victoria Institute for Women war jung und noch nicht so etabliert wie all die renommierten Universitäten für Männer hier in London. Aber es war meine ganze Zukunft und ich würde alles dafür tun, mich seiner als würdig zu erweisen.
Was Beatrice, das faule, verwöhnte Ding, davon hielt, konnte mir egal sein und doch spürte ich jetzt im Taumel meines Triumphgefühls, dass ihre Worte wohl doch nicht spurlos an mir vorbeigegangen waren.1
Tief in meinen Eingeweiden hatte ich Angst, nicht gut genug zu sein. Meine Leistungen nicht genug, um zu studieren. Mein Charakter nicht genug, um meine Träume zu erreichen. Meine Bemühungen nicht genug für die Frau, die meine Studiengebühren bezahlte.
Doch heute würde ich nicht an all das denken, nahm ich mir vor und reckte die Faust in die Luft. Denn der Brief in meiner Hand bewies, dass ich mir den Platz als Studentin verdient hatte und Miss Brandon-Welderson nicht umsonst ihre Hoffnungen – und immense Geldsummen – in mich setzte.
Kaum hatte ich an sie gedacht, hörte ich schon, wie im Foyer die Geräusche lauter wurden. Ich musste nicht raten, wer da zur Haustür hereingeschneit kam und das gesamte Personal in Aufregung versetzte.
Ich sage euch, wenn eins unverkennbar ist, dann ist es die Stimme von Franzin Brandon-Welderson. Sie ist laut und hat etwas Dissonantes an sich. Wie die Töne auf einer Geige, wenn man mit einem Finger um eine Winzigkeit danebenliegt.
Sofort faltete ich meinen Brief zusammen, grapschte nach den Geldnoten, verstaute beides in der Tasche meines Rockes und schlich mich zu der vom Foyer abgewandten Tür ins Studierzimmer.
Natürlich hatte ich vor, meiner Unterstützerin und Gönnerin die gute Nachricht über meinen Erfolg mitzuteilen. Doch auf keinen Fall vor morgen früh!
Wenn ich ihr den Brief jetzt zeigte, würde sie vor Entzücken ihre kleinen blassen Hände an die leicht errötenden Wangen legen, sich selbst erlauben, genau so viel Freude zu zeigen, dass ihre aufwendige Hochsteckfrisur nicht in Mitleidenschaft geriet und mich dann dazu verdonnern, den Abend zur Feier des Tages, ausstaffiert wie eine Weihnachtsgans, im großen Salon zu verbringen und mich von einer kleinen Gesellschaft aus wohlriechenden Menschen, die ich weder gut kannte noch besonders leiden mochte, großspurig loben zu lassen.
Wenn ich also die Chance haben wollte, heute Abend so zu feiern, dass es auch mir Freude bereitete, würde ich mich jetzt davonmachen müssen.
Versteht mich nicht falsch. Ich schätze Miss Brandon-Welderson über alle Maßen. Eine Gönnerin zu finden, die es mir ermöglicht zu studieren, hätte jemandem wie mir unmöglich sein sollen. Dass wir uns an einem Abend vor etwas mehr als einem Jahr so zufällig über den Weg gelaufen waren, gehörte entweder in die Kategorie Wunder oder Schicksal.
Wenn ich zurückblicke, hätte ich an dem Morgen dieses äußerst interessanten Tages sicher behauptet, es wäre ein Tag wie jeder andere gewesen und damit vollkommen falschgelegen.
Ich hatte Miss Brandon-Welderson damals aus Neugierde einen Gefallen erwiesen und sie mir daraufhin als Gegenleistung eine Zukunft geschenkt, die nicht beinhaltete, den Sohn des Fischhändlers zu heiraten.
Doch wie dankbar ich ihr auch war und wie gern ich ihr meine guten Leistungen präsentiert hätte, diesen einen Abend stahl ich mir für mich. Denn ihre Vorstellung von Spaß und die meine liegen so weit auseinander, dass ein Ozean dazwischen passt.
Ich schlich vom Studierzimmer durch den Speisesaal, an Claire vorbei, die in der Küche Tee aufsetzte und über den Bedienstetenflur bis an die versteckte Tür zum Foyer.
Es dauerte nicht lange, bis Miss Brandon-Welderson lautstark Anweisungen gegeben hatte, Sissi ihren Wintermantel davontrug und der knochige Clifferton ihr mitteilte, dass ich mal wieder empörenderweise den Kuchen direkt zum Mittagessen zu mir genommen hatte, anstatt damit bis zum Tee zu warten.
Alte Petze!2
»Ich spreche mit ihr, Clifferton«, sagte Miss Brandon-Welderson und ich war mir sicher, dass sie das nicht tun würde. Dafür interessierte es sie nicht genug, wie ich mein Essen zu mir nahm. Auch wenn sie sehr bemüht war, eine Dame von Welt aus mir zu machen, behielt sie mehr das große Ganze im Blick und ritt nicht auf jeder noch so kleinsten Kleinigkeit herum wie ihr zauseliger Butler.
»Wo ist sie denn? Wir haben eine Einladung zum Weihnachtsball der Winterglowes erhalten. Sir Percy gedenkt dort seinen fantastischen neuen Kronleuchter zu enthüllen.« Und schon entfernte sich ihre Stimme in Richtung des Frühstückssalons, in dem ich bis gerade eben noch gesessen und Kuchen gegessen hatte.
Ich öffnete die Tür nur einen Spaltbreit und sah, wie Clifferton ihr folgte wie ein Hündchen.
Als die beiden tiefer im Haus verschwanden, schnappte ich mir meinen gefütterten Mantel und meine Umhängetasche von der Garderobe und schlang mir eilig den unendlich weichen Flanellschal um den Hals.
Ich werde mich niemals daran gewöhnen, wie weich dieser Schal ist3.
Draußen hingen die Wolken tief, es war klirrend kalt und der Wind zog ungehindert vom Hyde Park aus durch die Park Street. Ich knöpfte den Mantel sorgfältig zu und war froh über die zwei Paar Socken, die ich mir heute früh übergezogen hatte. Einen Schlag des Schals wickelte ich mir um den Kopf, damit er auch meine Ohren schützte.
Miss Brandon-Welderson hat mir schon den einen oder anderen Hut gekauft. Allesamt seltsame Gebilde, geschmückt mit Seidenblüten und exotischen Federn. Ich verabscheue sie zutiefst und trage sie nur, wenn es ausdrücklich gewünscht ist.
In einem schicken Haus im West End zu leben hat mich verändert, ohne Frage. Es geht schnell, sich daran zu gewöhnen, immer satt zu sein, in einem weichen Bett zu schlafen, das man nicht mit einer Cousine, deren zwei Kindern und einem verlausten Hund teilen muss und sich nicht die Zehen abzufrieren, weil im Winter das Holz knapp wird.
Doch es gibt auch Dinge an mir, die sich nie ändern werden, egal wie sehr Miss Brandon-Welderson oder Clifferton es mir auszutreiben versuchen.
Wie mein Vater gern sagt: Man bekommt das Mädchen aus dem East End raus. Aber niemals das East End aus dem Mädchen.
Der Spruch ist nicht von ihm, das hat sicher mal irgendjemand Schlaues gesagt. Er gibt es nur gern als seine eigene Weisheit aus.
Es waren nicht viele Menschen auf den Straßen. Die meisten Herrschaften fuhren an einem Tag wie heute mit ihren Kutschen oder ließen sich eine Droschke kommen.
Ich lief immer noch viele Strecken zu Fuß, weil ich es von früher gewohnt war, kein Geld bei mir zu haben. Das Wissen um das Preisgeld in meiner Rocktasche wog schwer und ich kam mir vor wie eine Diebin, obwohl ich es ganz rechtmäßig besaß.
Noch nie hatte ich so viel Geld bei mir getragen. Oder gar besessen. Miss Brandon-Welderson zahlte mir wöchentlich ein kleines Taschengeld, aber das war nichts im Vergleich zu dem Preisgeld!
Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich zurückgegangen und hätte den größten Teil davon unter meine Matratze gestopft. Doch jetzt war es zu spät und ich würde damit leben müssen.
Eine Kutsche näherte sich von hinten und ich drehte mich dem rustikalen Gefährt mit Ladefläche zu, als es neben mir langsamer wurde und zum Stillstand kam.
»Miss Hemmilton«, grüßte Will mich und grinste breit, sodass es aussah, als hätte jemand eine waagrechte Kerbe in seinen krausen Bart geschlagen. »Wohin des Weges?«, fragte er mich wie ein Schurke, wie der Wolf aus dem Märchen. Was er nicht war. Er war Miss Brandon-Weldersons Kutscher. Und der überaus zahme Ehemann unserer Köchin Claire.
Ich schüttelte lachend den Kopf über ihn. »Ich wollte meiner Freundin Animant einen Besuch abstatten«, teilte ich ihm mit und er hob zweifelnd die buschigen Augenbrauen.
Das feixe Grinsen wich einer väterlichen Miene und er lehnte sich auf dem Kutschbock ein Stück in meine Richtung. »Aber doch sicher nicht zu Fuß«, stellte er meine Absichten infrage und ich lächelte verschmitzt zu ihm hoch.
»Es ist herzerwärmend, dass Sie mich wie eine Lady behandeln, Will«, sagte ich und tastete die Manteltaschen nach meinen Handschuhen ab.
Er schnaubte. »Sie sind eine Lady«, beharrte er, rutschte zur Seite und klopfte neben sich auf die Bank. »Kommen Sie, ich nehme Sie mit.«
Wäre ich tatsächlich eine Lady gewesen, hätte er mich wohl kaum auf den Kutschbock einer Transportkutsche eingeladen. Doch mir konnte es egal sein. Ich war keine Lady und der Kutschbock hundertmal besser als der beengte Innenraum einer Prachtkutsche, in dem ich meine langen Beine einfalten musste wie ein Leporello.
Will schnalzte mit der Zunge und das Pferd setzte sich in Bewegung. Die Kisten rumpelten hohl auf der Ladefläche.
»Fahren Sie denn in Richtung Universität?«, erkundigte ich mich und der Kutscher zuckte mit den Schultern.
»Nein. Ich hole Gemüse bei Barney«, sagte er und sah mich vieldeutig aus den Augenwinkeln an. »Der Umweg wird es aber wert sein, wenn Sie dabei nicht erfrieren.«
»So schnell erfriere ich nicht.« Ich hatte schon kältere Winter überstanden und da war mir nicht ständig Kuchen vorgesetzt worden, damit ich nicht länger so klapperdürr blieb, wie ich es mein Leben lang gewesen war.
Endlich schaffte ich es, meine Handschuhe aus den Taschen zu fischen und schlüpfte eilig hinein. Auch wenn ich etwas anderes behauptete, war ich froh, nicht laufen zu müssen.
»Ja, Alkohol friert nicht so schnell ein, nicht wahr?«, machte Will seine Scherze und ich fühlte mich gleichermaßen ertappt wie verstanden.
Miss Brandon-Welderson ging davon aus, dass ich meine wilden Zeiten hinter mir hatte und ab jetzt nur noch vornehm Punsch auf Soiréen zu mir nahm, daher fragte sie nicht, was ich vorhatte, wenn ich ausging. Doch es würde für mich nie etwas Schöneres geben, als sich mit Freunden spätabends in einem Pub ein Gläschen zu genehmigen. Sollte jedoch der Butler davon erfahren, müsste ich mich vorsehen.
»Sagen Sie es nicht Clifferton. Bei dem habe ich heute keinen Stein im Brett.« Ich kuschelte mich tiefer in meinen Schal und dachte daran, dass ich bei ihm nie und zu keiner Zeit einen Stein im Brett gehabt hatte.
Will lachte dreckig auf. »Ist er wieder angefressen? Was haben Sie diesmal angestellt?«
Es war schön, ihn so ungezwungen lachen zu sehen und zu spüren, dass er mich als eine seinesgleichen betrachtete, auch wenn ich gekleidet war wie eine Dame.
»Ich habe Ihre Frau überredet, mir den Kuchen schon zum Mittagessen zu servieren«, flüsterte ich verschwörerisch, als sei es ein Verbrechen und der Kutscher spielte mit, indem er die Augen weit aufriss.
»Welch ein Frevel!«, tönte er so laut, dass ein älterer Herr am Straßenrand uns schockiert hinterherblickte.
»An den Galgen mit mir!«, stimmte ich mit ein und die Kutsche zuckelte auch schon um die nächste Kurve. Will fädelte sich in den nun dichter werdenden Verkehr ein und ich beobachtete das Treiben der Stadt.
Die Straßen waren so grau, als hätte der Winter sie aller Farbe beraubt und doch gewann ich dadurch erst das Gefühl, das wahre London zu erblicken. Kantig und ehrlich und schonungslos. Ohne den Pomp der Wohlhabenden, dem Krimskrams und der Scharade einer heilen Welt.
Menschen in dunklen Mänteln und mit ebenso dunklen Hüten überquerten mit hochgezogenen Schultern die Straße, stiegen in Droschken oder versteckten sich hinter Schaufenstern, die lediglich den wolkenverhangenen Himmel spiegelten.
Eine Stadt voller grauer Mäuse und schmutziger Ratten.
»Ach ja, der alte Clifferton«, seufzte Will neben mir, als könnte er sich nicht entscheiden, ob er seine eigene Aussage versöhnlich oder anklagend klingen lassen wollte. »Er hat aber auch seine guten Seiten«, entschied er sich für Ersteres.
Ich rollte darüber mit den Augen. »Sicher«, stimmte ich ihm in ironischem Ton zu. »Stellen Sie sich vor, wie es ohne ihn wäre. Die Disziplin wäre dahin. Das Personal würde verrücktspielen.« Theatralisch legte ich mir eine Hand auf die Stirn.
Will verzog sein Gesicht wieder zu einem gefährlichen Gaunergrinsen. »Und die Damen würden ihren Kuchen womöglich sogar schon zum Frühstück verspeisen«, hielt er dagegen und ich warf die Arme in die Luft.
»Wo kämen wir denn da hin?!«, tönte ich und Will stimmte mit einem bebenden »Anarchie!« mit ein.
Wir lachten beide darüber und ich genoss es, dass mal zur Abwechslung jemand meinen Humor teilte.
Das hier ist kein Einbruch
Der verwitterte Holzhocker stand noch an der gleichen Stelle im Gebüsch, an der ich ihn zurückgelassen hatte. Es war ein altes Ding, das ich vor langer Zeit in einem Teehaus hatte mitgehen lassen.
Er besaß die perfekte Höhe, um einen Fensterriegel an der vom Park abgewandten Seite der Royal University Library mit einem einfachen Buttermesser zu öffnen, wenn man mit einem Bein darauf balancierte.
Woher ich das alles weiß, sei mal dahingestellt. Das hier ist schließlich immer noch ein Bericht für die Polizei.
Ja, im Prinzip ist das Einbruch. Aber Mr Reed ist selbst schuld, wenn er seine Fenster nicht sorgfältig abschließt. Und besser ich komme herein, als jemand, der Schaden anrichten wollen würde.
Ich platzierte den Hocker in einem brach liegenden Blumenbeet unter einem Fenster im Ostflügel, öffnete den Riegel und schob das Messer zurück zwischen meine Brüste.
Es kostete mich einiges an Mühe, mich mitsamt all der Röcke, der Krinoline und dem restlichen Firlefanz meines Kleides nach oben zu hieven, um anschließend elegant wie ein Sack Kartoffeln in den Raum dahinter zu plumpsen.
Es war nicht direkt die Bibliothek, sondern nur ein lang gezogener Arbeitsraum mit getäfelten Wänden, die ihn dunkel und überaus wichtig erscheinen ließen. Meine Freundin Animant Crumb war hier seit kurzer Zeit als Bibliothekarsassistentin angestellt und nutzte diesen Ort für einen Teil ihrer Arbeit.
Eilig sortierte ich meine Röcke, damit Ani mich nicht wieder meines Aufzugs wegen rügte. Dann tasteten meine Finger ganz von allein nach dem Medaillon, das ich stets um den Hals trug und das gut versteckt über meinem Herz ruhte. Es war noch da, wo es hingehörte und ich atmete einmal tief durch, bevor ich das Fenster schloss und die Kälte aussperrte.
Die Luft hier drin roch nach Papier, Tinte und altem Wissen. Genau wie Animant. Sie war so viel schlauer, als ich es je sein würde und ich wusste seit unserer ersten Begegnung auf einer Soirée bei den Kingsleys, dass ich mit ihr befreundet sein wollte. Wie mir das letztendlich gelungen war, weiß nur Gott allein.
Unschlüssig stand ich einen Moment herum, ehe mir aufging, dass sich ein Denkfehler in meinen Absichten befand. Ich hatte Animant vorher nicht Bescheid gegeben und jetzt konnte es lange dauern, bis sie mich zufällig in der Kammer entdeckte.
Seufzend entledigte ich mich der Tasche und des Mantels, ließ mich auf einen Stuhl sinken und sah mich nach etwas zu schreiben um. Besser ich hinterließ ihr eine Notiz, in der Hoffnung, sie später zu treffen, um ihr meine großartigen Neuigkeiten mitzuteilen.
Der ganze Raum war voller alter und neuer Bücher, Holzkisten, verschiedener mechanischer Vorrichtungen, die sicher einem wertvollen Zweck dienten und Zettel ohne Ende. Doch ich fand keinen einzigen Stift, nicht mal einen Grafitstummel in der säuberlich sortierten Kammer.
Auch eine gründliche Untersuchung meiner Tasche förderte nur einen Apfel zutage, den ich letzte Woche eingepackt und vergessen hatte.
Ich biss gerade herzhaft hinein, da hörte ich ein Scharren an der Tür und drehte mich auf dem Stuhl nach hinten.
Einen winzigen Moment setzte mein Herz aus, in dem absoluten Nervenkitzel, dass es sich bei der Person an der Tür nicht um meine Freundin handelte und mich jemand anderes hier erwischen könnte.
Doch es war natürlich Animant, die adrett wie immer in den Raum huschte und leise die Tür hinter sich schloss. Sie schien aufgewühlt zu sein, ihre Wangen rot und aus ihrem sonst so sorgsam frisierten Haar hatte sich eine vorwitzige Strähne gelöst. Auch ihre Gedanken mussten sich meilenweit weg befinden, da sie mich nicht einmal bemerkte.
Irgendetwas war gerade geschehen.
Mich beschlich die irre Zuversicht, dass hinter all den Gefühlswallungen meiner liebsten Freundin ein Mann steckte. Und zwar dieser griesgrämige Bibliothekar Mr Reed.
Wie schon erwähnt, ist Mr Reed berüchtigt für seine schlechte Laune. Da können Sie jeden fragen, der je ein Buch bei ihm entliehen hat.
Er ist der Teufel mit Lesebrille und ich schwöre, dass niemals ein anderer Mann Animants diamantenes Herz hätte erobern können als dieser. Und auch wenn Ani darüber nur wenig spricht, bin ich davon überzeugt, dass auch er Gefühle für sie hegt.
Ich kann nicht genau sagen warum, aber Mr Reed ist mit seiner lotterigen Unhöflichkeit das perfekte Gegenstück zu Animants ordentlich gepflegter Doppelzüngigkeit.
Das meine ich selbstverständlich mit all meiner Liebe und tiefster Bewunderung. Animant ist großartig. Über Mr Reed lässt sich streiten.
Ich schlug das linke Bein über und biss ein weiteres Mal in den Apfel, um auf mich aufmerksam zu machen und hatte Erfolg.
Animant fuhr mit einem erschrockenen Quietschen zu mir herum, die blauen Augen weit aufgerissen, die schmalen Hände in den Wollstoff ihres dunkelblauen Rockes gekrallt.
Die Genugtuung trieb mir ein Grinsen ins Gesicht.
»Ich wollte dich nicht erschrecken«, log ich dreist, kaute und legte den Apfel beiseite, um mich auf die Füße zu schwingen.
Sie überwand ihren Schreck schnell und blickte mir spöttisch entgegen. Sie glaubte mir kein Wort.
»Natürlich.« Ihre Stimme triefte geradezu vor Ironie und sie wandte sich zwei Paketen zu, die auf einem der Tische standen. Sie waren in braunes Papier eingeschlagen und mit dickem Zwirn zusammengeschnürt.
»Aber ich muss dich leider enttäuschen«, fügte sie hinzu. »Da bist du nicht die Erste heute.« Sie klang dabei so betont beiläufig, dass es mir sofort auffiel und ich horchte auf. Es hatte sie also schon jemand erschreckt und dieser Moment schien mehr bedeutet zu haben als nur ein kleiner Schreck, sonst würde sie nicht versuchen, es vor mir zu verbergen. Das konnte nur eins bedeuten.
»Oh, bitte sag, dass es Mr Reed war!«, rief ich begeistert und wünschte mir, mit meiner Vermutung richtigzuliegen. Es war nicht auszuhalten, wie sehr die beiden umeinander herumtanzten und sich nicht eingestanden, dass sie einander zugetan waren.
Ich lehnte mich neben Animant an die Tischplatte und ließ sie nicht aus den Augen, damit sie mir ihre Geheimnisse verriet.
Animant seufzte laut. »Es war Mr Reed«, bestätigte sie und ich musste mich stark zusammenreißen, um meine innere Euphorie über dieses Thema nicht sofort hervorbrechen zu lassen. Denn es schien noch nicht alles zu sein. Sie wich meinem Blick zu sehr aus und friemelte mit nervösen Fingern an dem groben Paketzwirn herum.
Doch ich ließ mich von ihrem Schweigen nicht beirren, blieb hartnäckig und wartete geduldig, dass sie weitersprach.
»Er hat mir im Archiv aufgelauert«, gestand sie schließlich und ich konnte mein Grinsen nicht mehr zurückhalten.
»Mit Absicht?«
Allein die Vorstellung! Der grimmige Bibliothekar, der wie ein Schuljunge durch die finsteren Gänge des Archivs unterhalb der Bibliotheksräume schlich und hämisch kicherte. Wahrscheinlich war es nicht so gewesen, aber die Vorstellung amüsierte mich sehr.
Ani zuckte leicht mit den Schultern und packte unwirsch nach einem Papierschneidemesser mit kurzer, breiter Klinge, das säuberlich aufgeräumt an einem Nagel an der Wand hing.
»Beim ersten Mal nicht«, sagte sie viel zu nüchtern und zerschnitt daraufhin das Band des Päckchens mit so viel Schwung, als müsste sie ihren Emotionen auf andere Weise Luft machen.
»Beim zweiten Mal aber schon?«, fragte ich süffisant und hatte sofort wieder das Bild des Schabernack treibenden Mr Reed im Kopf. In dem Mann steckte mehr, als ich erwartet hatte.
Animant presste die Lippen aufeinander. Ihr war das Gespräch überaus unangenehm und doch war offensichtlich, dass sie darüber reden wollte. Hätte sie es nämlich nicht gewollt, hätte ich keinen Ton aus ihr herausbekommen. Ihr Dickkopf war stärker als meiner und sie besaß eine natürliche Autorität, die einem nur gegeben war, wenn man reich geboren wurde.
»Hast du dich angstvoll an ihn geklammert?«, stichelte ich, um sie aus der Reserve zu locken und schlang mir provokant die schlaksigen Arme um den Körper, als würde ich mich selbst umarmen.
Ani sah mich an und von einer Sekunde zur anderen schoss ihr die Röte so heftig in die Wangen, dass all ihre sorgfältig errichtete Gleichmütigkeit in sich zusammenfiel.
»Mein Gott! Hast du wirklich?«, rief ich lachend und konnte es gar nicht glauben. All diese Überraschungen heute!
»Wie bist du überhaupt hier reingekommen?« lenkte Animant sofort vom Thema ab und fuchtelte mit dem Papierschneidemesser in meine Richtung.
Ich lachte weiter über sie, weil ich nicht anders konnte. »Du hast die Fenster nicht verriegelt«, beantwortete ich ihre Frage dennoch und kam sofort wieder zurück auf das viel wichtigere Ereignis zwischen Ani und ihrem Bibliothekar.
Meine Fantasie öffnete sich surrend wie ein mechanisches Kästchen und ließ ein Heer an wilden Vorstellungen frei. Animant, dicht an Mr Reed gepresst. Er, der es schamlos ausnutzte, sie im Arm zu halten.
Ich war keine Kupplerin und hatte auch keinerlei Talent dafür, auch wenn man mich schon einige Male zur Mithilfe angestiftet hatte. Und doch gab es kaum etwas Spannenderes, als dabei zuzusehen, wie zwei Menschen, die ganz offensichtlich zusammengehörten, sich annäherten.
»Und? Hast du es genossen?«, fragte ich sie mit einem anzüglichen Lächeln und merkte genau in dem Moment, in dem ich es ausgesprochen hatte, dass ich einen Schritt zu weit gegangen war.
Animant atmete schnappend ein. »Nein, habe ich nicht!«, fauchte sie angefressen und knallte das Messer auf den Tisch. »Es ist dunkel und zugig da unten. Ich hatte wirklich Angst!«, versuchte sie mir begreiflich zu machen und ich hob entwaffnend die Hände.
Ich vergaß zu oft, dass nicht jeder so freizügige Gedanken zuließ wie ich. Vor allem nicht die hohe Gesellschaft und ihre Etikette. Ich hatte noch so viel zu lernen.
Schnell ruderte ich zurück. »Schon verstanden«, beschwichtigte ich sie, auch wenn ich insgeheim daran glaubte, dass sie es tatsächlich genossen hatte. Sie konnte es nur nicht zugeben.
Ich ließ es also darauf beruhen und nutzte die Gelegenheit, anzusprechen, weswegen ich überhaupt hergekommen war.
»Ich bin eigentlich hier, um dich einzuladen«, sagte ich, griff umständlich in die Tasche meines Rockes und zog den Brief aus schwerem Papier hervor. Ich reichte ihn ihr und spürte sofort wieder die Aufregung durch meinen Körper rauschen, genau wie in dem Moment, als ich ihn geöffnet hatte.
Mit huschenden Augen las sie die Zeilen so schnell, wie ich es nie fertiggebracht hätte und ich konnte dabei zusehen, wie die Begeisterung in ihrem Gesicht erblühte.
»Das ist ja fantastisch!«, rief sie aus und lächelte mich so offen an, dass auch mir die Freude über diese Nachricht das Herz erneut zum Rasen brachte.
Ani las den Brief ein zweites Mal, so wie ich es auch getan hatte.
»Das habe ich nur dir zu verdanken«, gestand ich ihr und sie hob überrascht den Blick. »Ohne dich hätte ich niemals die Literatur dafür gehabt«, führte ich aus, als sie nicht verstand und grinste sie an.
Animant war mein Engel. Sie hatte mich gerettet, indem sie mir immer wieder Bücher zur Verfügung stellte, die ich für mein Studium benötigte. Leider waren diese in der Bibliothek des Queen Victoria Institute for Women nicht vorhanden. Eine Nachlässigkeit, die meiner Meinung nach unverantwortlich ist.
»Und deshalb will ich dich ausführen. Heute Abend!«, sagte ich und griff nach ihren Händen. Doch dann kam mir ein anderer Gedanke. »Natürlich nur, wenn du nicht schon anderweitige Verpflichtungen hast«, räumte ich daher ein, klimperte mit den Wimpern und das zweideutige Grinsen von vorhin schlich sich zurück auf meine Lippen.
Doch diesmal zuckten auch Animants Mundwinkel. »Habe ich nicht«, nahm sie mir meine geheime Hoffnung, Mr Reed und sie könnten eine Verabredung haben und reckte herausfordernd das Kinn.
»Zu schade«, erwiderte ich vieldeutig und wir begannen beide zu lachen.
Zuhause ist da, wo die Schuhe dreckig werden
Wenn man bedenkt, wie weit reich und arm voneinander entfernt ist, scheint es wunderlich, dass in einer Stadt wie London das West End und das East End geografisch gesehen so nah beieinander liegen.
Das hat mich schon immer schockiert, vor allem weil wir, die wir im East End geboren wurden, uns dieser Tatsache überaus bewusst sind, während die Menschen aus dem West End vollkommen vergessen haben, dass London aus mehr besteht als schicken hohen Gebäuden, prachtvollen Palästen und wunderschönen Grünanlagen.
Ich habe das Privileg, beide Welten zu kennen und muss doch zu jedermanns Entsetzen gestehen, dass ich mich in den Arbeitervierteln sehr viel sicherer fühle als in der herrschaftlichen Park Street.