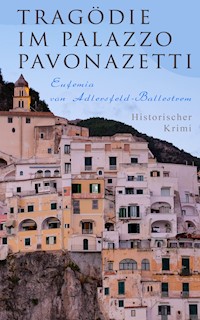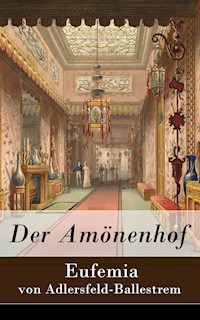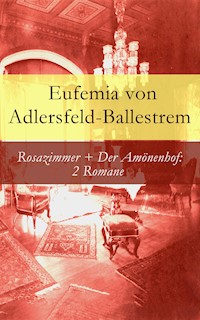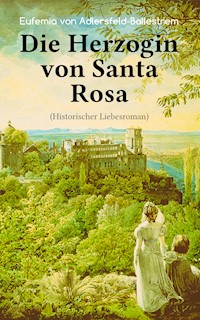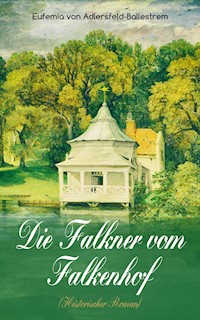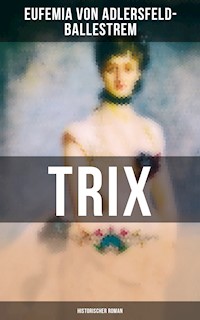Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lange Zeit stand das historische Urteil über Elisabeth Christine als ungeliebte und uninteressante Ehefrau des Preußenkönigs Friedrich II. fest. 1908 erschien die Biografie von Eufemia von Adlersfeld. Sie gehörte zu den wenigen, die dem Bild der bedeutungslosen Ehefrau, die in 46 Jahren so gut wie nie an der Seite des Königs zu finden war, das einer warmherzigen und geistvollen Frau gegenüberstellten. Schon bei der üppigen Verlobungsfeier lässt der Kronprinz erkennen, dass er mit der Hochzeit dem Vater nur Gehorsam zeigt. Sein demonstrativ zur Schau gezeigtes Desinteresse an seiner Frau, an der Ehe überhaupt, begleitet Elisabeth von da an ihr ganzes Leben. Selbst die einzige gemeinsame Zeit am gleichen Ort (auf Schloss Rheinsberg) brachte keine Nähe und schon gar nicht den erwarteten Thronfolger. Trotzdem versucht die junge Frau, mit dem Esprit an der Tafel Friedrichs, an der sie nie sitzen darf, mitzuhalten. Auf ihrem Sommersitz in Schönhausen gibt sie glanzvolle Soireen und Feste und wartet trotzdem immer darauf, vom König wahrgenommen zu werden. Vom Bau von Sanssouci erfährt sie vom Hörensagen, bei einem Wiedersehen nach Jahren findet der König nur banale Worte für sie, hingeworfen in einem Satz. Unverständlich, warum sie ihm nach seinem Tod ernsthaft nachtrauerte. Die unzähligen Briefe und Zitate der Biografie zeigen aber, dass diese Frau ihren eigenen Weg über ihre Bewunderung der großen Persönlichkeit Friedrichs hinaus durchaus gefunden hat. Für uns überliefern die lebendigen Dokumente ein spannendes Bild der Zeit des großen Preußenkönigs. "Man muss eben ein wenig Philosoph in dieser Welt werden … ohne das wäre man beständig in Kummer" – Die Biografie einer bemerkenswerten Königin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem
Elisabeth Christine
Königin von Preußen, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
Das Lebensbild einer Verkannten
Nach Quellen bearbeitet unter Verwendung zum Teil unbenutztenMaterials aus dem Braunschweigischen Landesarchiv zu Wolfenbüttel
Mit einem Titelbild
Saga
Elisabeth Christine
German
© 1908 Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517574
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Vorwort.
Es sind die lebenswahrsten Biographien, in denen die geschilderten Personen mit ihren eigenen Worten direkt zu dem Leser sprechen und der Verfasser nur das verbindende Glied, der Erklärer ist. Dazu gehört vor allem, daß genügend schriftliches Material zur Verfügung steht, also Briefe, Tagebücher, Aufzeichnungen, auf denen sich dann zur Ausfüllung der Lücken Voraussetzungen und Vermutungen aufbauen lassen, die aber nur zu irrigen Anschauungen führen, wenn das Material fehlt. Ich habe den vorliegenden Blättern mit voller Absicht den Untertitel gegeben: „Das Lebensbild einer Verkannten“, denn wenn auch die Gemahlin Friedrichs des Großen in F. W. M. von Hahnke vor fast 60 Jahren einen Biographen gefunden hat, der mit großem Fleiß alles ihm damals zugängliche Material zusammengetragen hat, um dieser bescheiden im Schatten gestandenen Gestalt die ihr im Leben versagt gewesene Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, so hat er doch nur ein sehr verwischtes Bild von ihr entworfen, weil er das Material, schon durch seine Anordnung des Stoffes, nicht richtig verwendet hat und weil er in seiner Darstellung noch zu sehr von dem Gefühl beherrscht wurde, durch eine Unterstreichung der nackten Tatsachen dem Andenken des großen Königs zu nahe zu treten, und das einmal von dem Geschichtsschreiber gemünzte Wort über die „Hochachtung“ des Königs für seine Gemahlin, die er so beispiellos schlecht dabei behandelt hat, zum Leitmotiv seiner Arbeit machte. Auch der Superintendent E. D. M. Kirchner in seinem fleißigen Werke über die „Churfürstinnen und Königinnen auf dem Throne der Hohenzollern“, dem Hahnkes Biographie der Königin Elisabeth Christine fast abschriftlich zugrunde liegt, schrieb in derselben Tonart, nur noch etwas lauter zugunsten dieser merkwürdig dokumentierten „Hochachtung“; beider Stimmen sind verhallt und ihre Arbeiten fast vergessen, und wo der Name der Königin notwendigerweise in den Werken über den großen König gestreift wird, da wiederholt sich dieselbe Phrase: „Sie war zu unbedeutend, als daß der Held Genüge an ihrer Gesellschaft hätte finden können, wenn er auch ihren Tugenden alle Anerkennung zollte und sie mit der größten Hochachtung behandelte usw. usw.“ Der Rest ist — Schweigen. Das sind so ungefähr die Worte in ihrer Quintessenz, mit denen Elisabeth Christine von Braunschweig in der Geschichtsschreibung erledigt wird, aber weder ihre „Unbedeutenheit“ noch auch diese ewig wiederholte „Hochachtung“ haben mir je recht einleuchten wollen, seitdem ich einmal ein Bild von ihr sah, dessen Ausdruck nicht der einer törichten Frau war, zu welcher die sie systematisch gestempelt haben, denen sie ihre Zurücksetzung verdankt.
Dem gütigen Entgegenkommen der braunschweigischen Regierung verdanke ich die Erschließung des Konvolutes von Briefen der Königin Elisabeth Christine an ihren Bruder, den Herzog Karl I., im Landesarchiv zu Wolfenbüttel, aus dem ich manchen feinen Zug für ihr Bild und geschichtliche Tatsachen gezogen habe, die ich bisher noch nirgends erwähnt fand. Ob sonst noch etwas von der ausgedehnten Korrespondenz der Königin — denn sie war eine fast ebenso fleißige Briefschreiberin wie die Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans — existiert, ist fraglich und mir nicht bekannt; ich wäre dankbar für jede diesbezügliche Mitteilung, die in einer hoffentlich ferneren Auflage dieses Buches sicher ihren Platz finden würde. Da alle Schriftstücke der Königin französisch geschrieben sind, woraus ihr, der deutschen Fürstin, kein Vorwurf zu machen ist, da sie darin nur ihrer Zeit und dem Beispiel Friedrichs des Großen selbst folgte, so habe ich mich in Anbetracht dessen, daß vielen Lesern die französische Sprache nicht allzu geläufig ist, entschließen müssen, die Zitate daraus ins Deutsche zu übersetzen, desgleichen die Proben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit im Anhange dieses Buches, der auch, um Wiederholungen zu vermeiden und ein klareres Bild der verwandtschaftlichen Beziehungen zu geben, zwei Stammtafeln der Herzoglich Braunschweigischen und der Königlich Preußischen Familie enthält. Das Verzeichnis der Quellen wird mir das Zeugnis ausstellen, daß ich im Aufbau dieses Lebensbildes nicht flüchtig war.
Ausgerüstet mit diesem Material, sei es mir denn vergönnt, eine Lanze zu brechen für dies arme Verkannte, die freilich selbst keine Geschichte gemacht hat, die politisch nicht mitgewirkt „am sausenden Webstuhl“ ihrer Zeit, aber ich hoffe, daß dies Kapitel zur Geschichte Friedrichs des Großen in dem weiten Kreise des „Vereins der Bücherfreunde“ wie auch außerhalb desselben die Legende von der „unbedeutenden“ Königin zerstören und eine herzliche Teilnahme schaffen wird für eine Fürstin und Frau, welche sich durch ihr stilles Heldentum eine Krone errungen hat, die, obschon nur aus Dornen geflochten, dennoch verdient, in das Licht gerückt zu werden, das auf ihr verdunkeltes Leben einmal noch zurückleuchten soll.
Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem.
Karlsruhe i. B., im Januar 1908.
Es war an einem Freitag, dem 8. November 1715, zwischen 7 und 8 Uhr früh, als die Prinzessin Elisabeth Christine von Braunschweig geboren wurde, das dritte Kind des Herzogs Ferdinand Albert zu Bevern und seiner Gemahlin Antoinette Amalie, Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel.
Der Hof von Bevern war einer der vielen Duodezhöfe, von denen das Deutsche Reich in jener Zeit wimmelte, und Herzog Ferdinand Albert einer der vielen kleinen Fürsten, die genötigt waren, ihren Beruf als Soldat oder in der Diplomatie zu suchen. Für beide Karrieren fehlte es den braunschweigischen Prinzen nicht an Begabung: ihre Tapferkeit steht ebenso außer Zweifel wie ihre geistigen Fähigkeiten. Herzog August von Braunschweig, gestorben 1666, der Großvater des Herzogs Ferdinand Albert II., war ein Fürst von ganz hervorragenden Eigenschaften, — was er für Wissenschaft und Kultur während seiner langen Regierung getan, hat die Geschichte aufgezeichnet, und die Landesbibliothek zu Wolfenbüttel, die seinen Namen trägt, ist heute noch sein schönstes Denkmal. Sein Sohn Anton Ulrich war einer der gelehrtesten Fürsten seiner Zeit, er errichtete der von seinem Vater gegründeten Bibliothek zu Wolfenbüttel ein eigenes Gebäude, gründete eine Ritterakademie daselbst, gestaltete die Universität zu Helmstedt aus, sorgte für die Verbesserung der Gymnasien seines Landes und entfaltete nebenbei eine Prachtliebe, die freilich Unsummen verschlang und ihren sprechendsten Ausdruck in dem nach dem Muster von Versailles erbauten Schlosse Salzdahlum, eine Stunde von Wolfenbüttel, fand.
Sein jüngerer Bruder, Ferdinand Albert I., war mit der Sekundogenitur zu Bevern bedacht worden, dort folgte ihm in der „Regierung“ sein ältester Sohn August Ferdinand, und als dieser 1704 unvermählt starb, dessen jüngerer Bruder Ferdinand Albert II., der Vater der Prinzessin Elisabeth Christine, die dazu bestimmt war, die Königskrone von Preußen und die Dornenkrone eines 64 Jahre währenden Martyriums zu tragen.
Herzog Ferdinand Albert II. bekleidete die Stellung eines Kaiserlichen Flügeladjutanten, als er in den Besitz von Bevern gelangte. Er hatte den spanischen Erbfolgekrieg mitgemacht und bei der siegreichen Erstürmung des Schellenbergs durch den Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, den „Türkenlouis“, und den Herzog von Marlborough am 2. Juli 1704 mitgefochten. Dabei sah er seinen Bruder, den Herzog August Ferdinand, als Generalmajor an der Spitze eines Reiterregimentes fallen und im Herbst desselben Jahres wurde auch er schwer verwundet, als er in der Eigenschaft eines Generaladjutanten des Kaisers Joseph mit diesem an der Belagerung von Landau teilnahm. Der Antritt seiner „Regierung“ sowie seine Vermählung hinderten ihn nicht, der militärischen Laufbahn treu zu bleiben; er focht später unter dem Prinzen Eugen ruhmvoll gegen die Türken und noch im Jahre vor seinem Tode am Rhein wider die Franzosen. Seine große Tapferkeit, sein gerader, ehrenvoller Charakter, seine Rechtschaffenheit, Ordnungsliebe und Gerechtigkeit sowie sein frommer Sinn sicherten ihm die allgemeine Achtung von Freund und Feind, er war ein trefflicher, fürsorglicher Familienvater und dabei von einer Körpergröße, die ihn, wie man sagt, neben seinen sonstigen vielen guten Eigenschaften ganz besonders dem Könige Friedrich Wilhelm I. wert machte.
Seine Gemahlin, die Herzogin Antoinette Amalie, mit der er sich 1712 vermählte, war die jüngste Tochter seines Vetters, des regierenden Herzogs Ludwig Rudolf zu Wolfenbüttel. Als der jüngere Sohn des gelehrten und prachtliebenden Herzogs Anton Ulrich, hatte dieser zuerst in Blankenburg regiert und war seinem kinderlosen Bruder August Wilhelm erst 1731 in der Regierung zu Wolfenbüttel gefolgt. Vermählt mit der schönen und liebenswürdigen Prinzessin Christiane Louise von Öttingen, hatte auch er nur Töchter, und die jüngere Linie zu Bevern stellte die nächsten Agnaten zur Thronfolge. Herzog Ludwig Rudolf aber war nicht nur ein ausgezeichneter Diplomat, er war auch ein großer Freund und Förderer der Wissenschaften, und seine Sonnabende, an denen er die Gelehrten und Geistlichen seines Landes bei sich zu versammeln pflegte, um mit ihnen die Fragen und Fächer des Wissens zu besprechen und zu disputieren, waren weit und breit berühmt und wohl auch etwas gefürchtet von seinen Enkeln, denn er bestand darauf, daß die fürstlichen Kinder, die an seinem Hofe erzogen wurden, diesen Versammlungen beiwohnten, um sie beizeiten an Gelehrsamkeit zu gewöhnen und ihnen die Begierde des Wissens von den Kinderschuhen an einzuimpfen. Es kam wohl dabei oft vor, daß die armen Kinder bei den langen Erörterungen, von denen sie nichts verstanden, einschliefen, aber es blieb doch immerhin etwas davon sitzen, und das war es, was der hohe Herr beabsichtigt hatte.
Seine drei Töchter hatten alle die berühmte Schönheit ihrer Mutter, die sogar von der Markgräfin von Baireuth anerkannt worden ist, geerbt. Die älteste, Elisabeth Christine, wurde 1708 von dem späteren Kaiser Karl VI., der damals noch König von Spanien war, zur Gemahlin erwählt und trat zum katholischen Glauben über — einen Schritt, dessen Verantwortung ihr Großvater, der Herzog Anton Ulrich in seinem Eifer für die Größe seines Hauses allein zu tragen sich vermaß. Diese schöne, geist- und lebensprühende Fürstin, die Mutter der großen Kaiserin Maria Theresia, deren Einfluß die Einführung der pragmatischen Sanktion wohl nicht mit Unrecht zugeschrieben wird, war nicht die erste braunschweigische Prinzessin auf dem deutschen Kaiserthron, denn schon Kaiser Joseph I. hatte die Prinzessin Amalie von Braunschweig-Lüneburg heimgeführt, und was der Lüneburger Linie recht war, war der von Wolfenbüttel, als der älteren, lange billig. Diese Eifersucht hatte den Herzog Anton Ulrich nicht schlafen lassen, bis er sein Ziel erreicht sah. Drei Jahre später erlangte er für die zweite Tochter seines Sohnes ein scheinbar fast noch glänzenderes Los, als die jugendschöne Prinzessin Charlotte den Thronfolger Peters des Großen, den Großfürsten Alexis, heiratete und zum orthodoxen Glauben übertrat. Das Martyrium dieser unglücklichen Ehe ist eines der dunkelsten Kapitel der russischen Hofgeschichte. Schon 1715 starb die junge Großfürstin bei der Geburt ihres Sohnes, des nachmaligen Kaisers Peter II., doch die Legende, daß in ihrem Sarge nur eine Puppe beigesetzt wurde und sie selbst sich nach Amerika gerettet hat, durchlief die ganze Welt und hat Zschokke zu einer seiner schönsten Novellen begeistert. Hat doch auch Johannes Scherr die Möglichkeit der Wahrheit dieses Gerüchtes ohne weiteres zugegeben.
Die dritte der schönen Töchter des Herzogs Ludwig Rudolf ging eine scheinbar sehr bescheidene Verbindung ein, als sie dem kleinen Herzog von Bevern ihre Hand reichte, aber er war der nächste Agnat für den Thron von Braunschweig, und es lag dem Herzog Anton Ulrich daran, keine fremden Einflüsse in das Land zu lassen. Die Ehe ist, trotzdem die Herzen nach damaligem Brauche nichts dabei zu sagen hatten, eine sehr glückliche und mit 15 Kindern gesegnete geworden. Ein Glaubenswechsel fand nicht statt; das junge fürstliche Paar, erzogen in der lutherischen Lehre, hing dieser mit voller Überzeugung und Ergebenheit an, die Richtung des Hofes von Bevern war und blieb eine durchaus religiöse und dieser Boden der Erziehung ist der Prinzessin Elisabeth Christine für ihr ganzes Leben zur unbeirrten Richtschnur geworden. Ihre Mutter, die Herzogin Antoinette Amalie war nicht nur schön und tugendhaft, sie war auch eine sehr kluge und liebenswürdige Frau, daneben heitern Gemüts, und sie besaß ein liebreiches, menschenfreundliches Herz, — Eigenschaften, die sogar von der bösen Zunge der Markgräfin von Baireuth anerkannt worden sind und noch im Jahre 1756 den Kammerherrn der Königin, Graf Lehndorff, gelegentlich eines Besuches in Antoinettenruhe bei Wolfenbüttel, entzückten. Trotzdem hat Friedrich der Große sich zu seiner Schwiegermutter nicht hingezogen gefühlt; er ist im Gegenteil ein gewisses Vorurteil gegen sie sein ganzes Leben lang nie los geworden — vielleicht eben, weil sie in dem Verhältnis einer Schwiegermutter zu ihm stand, deren Tochter er als Gemahlin ablehnte. Er fand sie, wie Baron Seckendorff berichtet, „von inegalem und solchem humeur, so allzeit corrigiren wolle“, — eine ungerechte, von Vorurteilen beeinflußte Beurteilung, welche die Herzogin in keiner Weise erwiderte, denn trotz der wenig freundlichen Haltung, welche der König ihr gegenüber mit Konsequenz einnahm, war sie von Bewunderung und größter Achtung, ja von persönlicher Liebe für ihn erfüllt, wovon ihre Briefe an ihre Tochter, die Königin, ein beredtes Zeugnis ablegen. „Unser geliebter, unvergleichlicher König“ ist eine Bezeichnung, die sie immer wieder anwendet, und noch am 17. Februar 1758 schreibt sie aus Sonderburg: „Alle, die hier sind, wünschen und rufen einhellig: Es lebe Friedrich der Große!“
Über die Jugend der Prinzessin Elisabeth Christine wissen wir nicht viel. Sie selbst hat erzählt, wie ein Ereignis ihr in unauslöschlicher Erinnerung geblieben ist, trotzdem sie damals erst drei Jahre alt war. Es war vor der Geburt des Prinzen Ludwig Ernst am 25. September 1718, als der Herzog in das Kinderzimmer trat und zu ihr und ihren beiden Brüdern sagte: „Kinder, eure Frau Mutter ist sehr krank, betet mit mir, daß Gott sie stärken und uns erhalten wolle.“ Er sei dann niedergekniet und habe laut mit ihnen gebetet. Einige Stunden später sei er sehr froh wiedergekehrt und habe ihnen mitgeteilt, daß ihnen ein Bruder geboren worden wäre, und sie ermahnt, Gott für die gnädige Erhaltung ihrer Mutter zu danken.
Prinzessin Elisabeth Christine, die mit ihren Geschwistern den größten Teil ihrer Erziehung am Hofe ihres Großvaters, des Herzogs Ludwig Rudolf zu Wolfenbüttel, empfing, wuchs dabei frisch und fröhlich zu tannenschlanker Größe, ihres Vaters echte Tochter, empor. Ihr liebliches Gesichtchen mit dem köstlichen aschblonden Haar, das den guten, alten Bielefeld so sehr begeistert hat, dürfen wir uns nach den vorhandenen Bildern von reinster, fröhlichster Kindlichkeit strahlend vorstellen. Das Landesarchiv zu Wolfenbüttel bewahrt eine Reihe von Briefen von ihr auf, die sie in den Kindertagen mit zollhohen Buchstaben an ihren Bruder, den späteren Herzog Karl, geschrieben hat, sowohl in deutscher, wie auch in französischer Sprache, — diese lebhafte Korrespondenz hat erst mit dem Tode des Herzogs aufgehört. Sie unterschreibt im Jahre 1725 noch „Elisabet Christine“, im Jahre 1729, in einem Briefe, in dem sie mitteilt, daß sie jetzt Pastellzeichnungen mache, zuerst „Elisabeht Christine“, und diese Form hat sie ihr ganzes Leben lang beibehalten; später ließ sie den zweiten Namen ganz fort und zeichnete immer nur „Elisabeht“. Sie hat den größten Teil ihrer freien Zeit mit Schreiben ausgefüllt, dennoch aber blieb die Orthographie ihr ein verschlossenes Buch mit sieben Siegeln und in jedem ihrer Briefe überrascht sie durch neue Schreibweisen, — ihre Orthographie blieb inkonsequent im höchsten Grade. Ihre große, klare, charaktervolle Handschrift hat sie evident nach der feinen Hand ihres Gemahls umzumodeln gesucht, es hält oft schwer, ihre feinen Schriftzüge zu entziffern, die aber trotzdem immer fest und charakteristisch bleiben. Ihre gesamte Korrespondenz ist, der Mode der Zeit entsprechend, französisch; der deutsche Ausdruck ist ihr im Laufe ihrer Ehe durch das Beispiel des großen Königs total verloren gegangen, die deutsche Rechtschreibung ihr zum unüberwindlichen Hindernis geworden, trotzdem sie deutsche Bücher viel und mit Vorliebe las, zahlreiche Werke aus dem Deutschen in die französische Sprache übersetzte und mit diesen Arbeiten Trost in manchen trüben Stunden fand, an denen ihr Leben so überreich war.
Doch als das Jahr 1732 anbrach, war von trüben Stunden für die Prinzessin Elisabeth Christine noch keine Rede. Ein zur Jungfrau erblühendes Kind, war sie in der fröhlichen Schar ihrer zahlreichen Geschwister eines der fröhlichsten. Von den schon geborenen 13 Kindern des herzoglichen Paares waren zwölf am Leben, ein weiteres wurde in Bälde erwartet, und die fürstlichen Eltern sahen die Königskrone werden, welche die Politik des nahe verwandten Wiener Hofes für ihre älteste Tochter, die Nichte der Kaiserin, schon eifrig schmiedete.
Am Hofe zu Berlin freilich wurde diese Krone einer andern zugedacht, wenigstens von der Partei der Königin, die von ihrem Lieblingsplane, den Kronprinzen mit ihrer Nichte, der Tochter König Georgs II. von England, ihres Bruders, zu vermählen, nicht ablassen wollte und sich damit im schroffen Gegensatze zu dem Könige, ihrem Gemahl, befand, der unter gewissen Bedingungen dieser Verbindung nicht abgeneigt gewesen war, aus politischen Gründen die Verhandlungen aber abgebrochen hatte. Schon hatte er dem ursprünglichen Plane einer Doppelheirat durch die Vermählung seiner ältesten Tochter, der Prinzessin Wilhelmine, mit dem Prinzen von Wales dadurch ein definitives Ende gemacht, daß er die junge Prinzessin mit dem Erbprinzen von Baireuth vermählt hatte, und die dadurch schwer gereizte Königin setzte nun alle Hebel in Bewegung, um ihrem Lieblingssohne, dem Kronprinzen, die englische Braut zu sichern; aber ihre Intrigen zerschlugen sich an den Gegenminen des Wiener Hofes, der in der englischen Verbindung eine schwere Schädigung seiner Interessen sah und durch den Prinzen Eugen von Savoyen mit Hilfe des Generals Grafen Seckendorff und den bei Friedrich Wilhelm in großem Ansehen stehenden General von Grumbkow mit allen Mitteln darauf hinarbeitete, den Kronprinzen durch eine Vermählung mit der Prinzessin Elisabeth Christine dem gefürchteten englischen Einflusse zu entziehen und damit dauernd für das kaiserliche Haus zu gewinnen.
Diese Verhandlungen wurden in heißem Bemühen schon seit dem Ende des Jahres 1731 geführt und zwar unter dem heftigsten Widerstreben des Kronprinzen selbst, dem die Prinzessin von der Partei seiner Mutter — und nicht zum mindesten von dieser selbst — als dumm, häßlich und mißgestaltet geschildert wurde. „Ich will nicht, daß meine Frau dumm ist, ich muß mit ihr vernünftige Gespräche führen können“, schrieb er an General von Grumbkow, dem er sein Herz auszuschütten pflegte — ob mit Unrecht oder nicht, mag dahingestellt bleiben. „Sie wird die unglücklichste Prinzessin in der Welt sein“, prophezeite er der ihm aufgezwungenen Braut nicht ohne Bedauern, aber doch mit der vollen Absicht, sie dazu zu machen, und als ihm ihre Frömmigkeit und religiöse Erziehung gerühmt wird, schreibt er im vollen Geiste des Widerspruchs: „Ich will lieber das gemeinste Weibsstück von ganz Berlin haben, als eine Betschwester mit einem Gesichte wie ein halbes Dutzend Mucker zusammengenommen.“
Dieser Widerstand ergoß sich aber nur Vertrauten gegenüber in Worte, denn der Kronprinz war damals gar nicht in der Lage, dem Könige, seinem Vater, gegenüberzutreten, dessen Gnade er durch den Fluchtversuch, der allzu bekannt ist, um hier wiederholt zu werden, zu sehr verscherzt hatte, um irgendwelche Unabhängigkeitsgelüste zur Geltung bringen zu können. Dazu beging er noch den Fehler, sich dem Könige gegenüber für dessen Absichten willfährig zu zeigen und seinen Widerstand hinter dessen Rücken auszutoben, aber dieser Fehler darf ihm nicht so sehr zur Last gelegt werden, da ja das unentschuldbare Beispiel seiner Mutter, die mit ihren Kindern gegen den eigenen Gatten und Vater intrigierte, ihn dazu anfeuerte. Man kann gewiß dagegen anführen, daß sie nur das Beste ihrer Kinder gewollt hat, aber der Weg, den sie dazu einschlug, war nicht nur ein falscher, sondern ein direktes Unrecht, das sie an dem Gatten und an ihren Kindern beging, ein Unrecht, das den unseligen Familienzwist heraufbeschwor, dessen Echo noch in fernen Jahren nicht zur Ruhe zu bringen war und ihr bei aller der großen Liebe, die der Kronprinz für sie hegte, in der Folge allen und jeden politischen Einfluß bei ihm entzog.
Die Politik war aber am Ende doch stärker als der Widerstand des Kronprinzen: der Druck, den der Wiener Hof mit Hilfe des Prinzen Eugen und des Grafen Seckendorff durch ihren Agenten Grumbkow ausübte, führte zum gewünschten Ziele, und der Kronprinz willigte, durch seine eigentümliche Stellung zu dem Könige, seinem Vater, gezwungen, in die Verlobung, für deren Zustandekommen der vielgewandte, zwischen zwei Feuern lavierende General 40 000 Gulden von der Wiener Hofburg erhielt. Wenn der Kronprinz damit gerechnet hatte — und es unterliegt keinem Zweifel, daß er es tat —, die Vermählung noch hintertreiben zu können, so hatte er damit nur eine falsche Hoffnung genährt, die sicherlich von der Königin, seiner Mutter, unterhalten wurde. Der König aber, glücklich gemacht durch die Unterwerfung seines Sohnes, hatte ihm am 4. Februar 1732, noch ehe die endgültige Erklärung eintraf, folgenden Brief geschrieben: „Ihr wißt, mein lieber Sohn, daß, wenn meine Kinder gehorsam sind, ich sie sehr lieb habe, so wie Ihr zu Berlin gewesen, ich Euch alles von Herzen vergeben habe und von die Berliner Zeiten, daß ich Euch nicht gesehen, auf nichts gedacht, als auf Euer Wohlsein und Euch zu etabliren, sowohl bei der Armee, als auch mit einer ordentlichen Schwiegertochter und Euch suche, bei meinem Leben noch zu verheiraten. Ihr könnt wohl persuadiret sein, daß ich habe die Prinzessinnen des Landes durch andere soviel als möglich ist, examiniren lassen, was sie vor Conduite und Education, da sich denn die älteste von Bevern, gefunden, die da wohl aufgezogen ist, modeste und eingezogen ist, so müssen die Frauen sein. Ihr sollt mir cito Euer Sentiment schreiben. — Die Prinzessin ist nit häßlich, auch nit schön, Ihr sollt keinen Menschen was davon sagen, wohl aber der Mama schreiben, daß ich Euch geschrieben habe, und wenn Ihr einen Sohn haben werdet, da will ich Euch lassen reisen, die Hochzeit aber vor zukommenden Winter nicht sein kann, indessen werde sehen Gelegenheit machen, daß Ihr Euch etliche Male sehet in alle honneur, doch damit Ihr sie noch lernet kennen. Sie ist ein gottesfürchtiges Mensch und dieses ist alles und comportable sowohl mit Euch als mit den Schwiegereltern. Gott gebe seinen Segen dazu und segne Euch und Eure Nachfolgers.“
Die zweite Hauptperson in diesem Drama, die Prinzessin Elisabeth Christine selbst, verhielt sich vollkommen leidend. Nach der damaligen Sitte, die an Fürstenhöfen noch viel länger geübt wurde als im bürgerlichen Leben, bestimmten die Eltern den Töchtern ihre Ehegatten und die Töchter fügten sich ohne Widerspruch. In diesem Geiste erzogen, hat die Prinzessin auch sicherlich nicht das leiseste „Aber“ verlauten lassen, ihre großen, blauen Augen, die ihr von der feindlichen Partei der Königin sogar auch zur Last gelegt wurden, sahen mit gläubigem Vertrauen in die Weisheit ihrer Eltern und Großeltern wie in den Ratschluß Gottes in die Zukunft, und ihr junges, unberührtes, unschuldiges Herz begann dem unbekannten, strahlenden Königssohne entgegenzuschlagen, der ihre erste und einzige Liebe bleiben sollte.
Inzwischen war Herzog Ludwig Rudolf, der die ganze Angelegenheit in die Hände genommen hatte, aufs eifrigste tätig, die Verhandlungen zu führen und die Eheverschreibungen zu regeln. Wer die im Braunschweigischen Archiv liegenden Entwürfe der Ehepakten liest, müßte glauben, daß es sich um eine Millionenbraut gehandelt hat, deren Brautschatz demgemäß sichergestellt werden mußte. Und doch erhielt die Prinzessin die für heutige Begriffe geradezu lächerlich kleine Summe von nur 25 000 Talern als Mitgift, die von der Landschaft als Prinzessinnensteuer aufgebracht werden mußte, und was daran fehlte, verpflichtete der Herzog sich, beizusteuern. Die Akten für den Eingang dieser Summe liegen auch noch vor; es ist daraus ersichtlich, daß einzelne kleine Gemeinden 7 Taler dazu aufbrachten! Ferner gab der Herzog seiner Enkelin mit: für Geschmeide, Kleinodien, Silbergeschirr „und was sonsten notwendig“ 8000 Taler (wovon nur die Hälfte verbraucht wurde), das Brautkleid und das Bett, das laut Rechnung 567 Taler 29 Groschen gekostet hat, da es einen Himmel von karmesin Samt mit silbernen Tressen hatte, einen Zug Pferde und die Ausrüstung der Hochzeitsfeierlichkeiten. Als Gegenleistung, in umfangreichen Aktenstücken hinterlegt, stellte der König zu den Ehepakten 1) eine Verschreibung der Morgengabe mit Hand-, Spiel- und Kleidergeldern, 2) eine Donationsakte auf die Geburt eines ersten Prinzen, 3) eine Wittumsverschreibung von jährlich 14 000 Talern, die aber bei Vorhandensein eines Leibeserben jährlich 20 000 Taler ausmachen sollte, und 4) eine Rückfallsverschreibung der Mitgift von 25 000 Talern. Außerdem wurden noch alle möglichen Posten umständlich aufgeführt und von beiden Seiten verklausuliert, wobei der Herzog Ludwig Rudolf eigenhändig viele Arrangements, die Geldanlagen sowie auch die Rückfallsverschreibung beanstandet hat. Es wurde ihm jedoch erwidert, „daß die Ratificationen von Seiner Majestät schon unterzeichnet wären und daß eine Änderung dem Könige unangenehm sein würde, daher man estimire, es wäre besser, die Dinge so zu lassen, wie sie einmal beschlossen wären.“ Die Auszahlung der Mitgift war aber, wohl infolge des Eingangs der Prinzessinnensteuer, im Jahre 1733 noch nicht erfolgt, denn von Berlin aus wurde am 29. August dazu gemahnt und um Übersendung der Summe „gleich itzo“ gebeten, worauf der Minister von Münchhausen erwidert: der Herzog wolle doch vorher den Entwurf des Wittums sehen, ob etwann in selbigem einzusehen wäre, wozu diese Gelder verwendet werden sollen. „Euer Excellenz werden solches hoffentlich nicht für gänßlich unnötig halten.“ Unter dem 26. November 1733 wird aber von Berlin dann der Eingang der Heiratsgelder quittiert. Interessant ist auch die Aufstellung des Etats für die künftige Kronprinzessin, nach dem die Hofmeisterin mit 1200 Talern, zwei Hofdamen mit je 300 Talern besoldet wurden. Der Hofmeister und Kammerjunker bezogen ihr Gehalt aus einem andern Etat; der Sekretär war mit 400 Talern, zwei Pagen mit je 40 Talern, ein Kammerdiener mit 150 Talern, eine Nähterin mit 100, drei Lakeien mit je 85, zwei Kammerfrauen mit je 120, ein Lakai für die Hofmeisterin mit 88, eine Magd für dieselbe mit 60, ein Lakei für die Hofdamen mit 88 und eine Magd für dieselben mit 60 Talern Gehalt bedacht. Auf eine Anfrage wegen eines Mundkochs wird von Berlin erwidert, „wenn ein solcher im Etat der künftigen Kronprinzeß nicht vorgesehen worden wäre, so würde damit nur dem üblichen Brauche gefolgt, weil die Kronprinzessin von den Köchen Seiner Majestät bedient würde, oder, wenn sie nicht bei Ihren Majestäten speiste, von denen ihres Gemahls, des Kronprinzen.“ Indes nun die Höfe von Wolfenbüttel und Bevern mit den großen-kleinen Sorgen der Aussteuer und Sicherstellung der Prinzessin vollauf beschäftigt waren, wurde in Berlin von der Gegenpartei dieser Vermählung hinter dem Rücken des Königs nach wie vor Front gemacht gegen ihre Person wie gegen ihr Haus. Zwar hatte der Kronprinz sich am 22. Februar 1732 dem Willen des Königs gefügt und seine Einwilligung zu der Verlobung gegeben, aber das verhinderte ihn nicht, sich im Kreise seiner Vertrauten mit der ohnmächtigen Wut des gegen seinen Willen in Fesseln Geschlagenen dagegen aufzulehnen, und was von seiten der Königin geschehen konnte, ihm die Person seiner Braut widerwärtig zu machen, ihn gegen diese Verbindung einzunehmen und ihm die Größe seines Opfers damit ins Unendliche zu steigern, das geschah redlich. Sie ließ keine Gelegenheit vorübergehen, sich in der Gegenwart ihres Sohnes in den unangenehmsten Betrachtungen und Bemerkungen zu ergehen, wobei sie von ihrer Tochter, der Prinzessin Philippine Charlotte, die mit dem Bruder der künftigen Kronprinzessin verlobt und später ihrer Schwägerin so warm zugetan war, kräftig unterstützt wurde, wenn man der Markgräfin von Baireuth glauben darf. Doch da die neueste Forschung den Memoiren dieser Fürstin eine ganz andere Würdigung zuteil werden läßt, als dies bisher geschah, so darf man keinen Anstand nehmen, sie mit der immerhin notwendigen Einschränkung einiger boshafter Übertreibungen als „Quelle“ zu betrachten.
Am 10. März fand zu Berlin die offizielle Verlobung statt, wozu die Prinzessin mit ihren Eltern in ihrer künftigen Heimat eingetroffen war und ihrem Verlobten, der sie mit ausgesuchter Zurückhaltung behandelte, nun zum ersten Male Auge in Auge gegenübertrat. Diese erste Begegnung entschied für ihr ganzes Leben, — die Neigung, welche dies junge Herz, das noch nie gesprochen, für die strahlende Persönlichkeit des Kronprinzen faßte, vertiefte sich zu einer Liebe, ja, man möchte sagen, zu einer blinden Anbetung, die erst mit ihrem Leben erlöschen sollte. Graf Seckendorff hat es getadelt, daß man die Prinzessin nach Berlin brachte, nachdem sie unlängst an den Pocken erkrankt gewesen, deren Spuren noch zu sehen waren; das kann aber so schlimm nicht gewesen sein, sonst hätte der Kronprinz, der doch zunächst Beteiligte, nicht gerade ihren schönen Teint hervorheben können als den größten Vorzug ihrer Erscheinung.
Der König nahm seine künftige Schwiegertochter mit offenen Armen auf, er überhäufte sie mit Aufmerksamkeiten, mit Geschenken, mit den Beweisen seiner zärtlichen Zuneigung, die ihr die absichtliche Kälte ihres Verlobten weniger fühlbar machten, ja in der Tat geeignet waren, sie in gewissem Sinne zu übersehen, ebenso wie die versteckten, aber gewiß sehr fühlbaren Hostilitäten der Königin.
Die offiziellen Notifikationen der Verlobung an die Eltern und Großeltern der Braut liegen alle von diesem 10. März datiert vor, auch die eigenhändig geschriebene Instruktion des Herzogs Ludwig Rudolf an den Kammerherrn von Münich, den Überbringer eines Handschreibens des Herzogs an den König. Unterstrichen ist darin der Passus, daß der Kammerherr vor dem Könige zu betonen habe „den bekannter Weise erlittenen Verlust Unserer Enkel, des Weiland Russischen Kaisers (Peter II.) und Oesterreichischen Erzherzogs, wonach Uns die Verlobung zur größten Consolation und Freude gereicht“. Diese Erinnerung daran, daß die Verbindung mit dem Hause Braunschweig zugleich eine solche mit den führenden Großmächten Europas bedeute, mag dem Herzog als eine kleine Eitelkeit gedeutet werden, aber sie war vielleicht nicht unangebracht, ebensowenig die Schonung der jenseitigen souveränen Gefühle, wenn der Herzog bestimmt, daß „der Titel von Ostfriesland in der diesseitigen Ausfertigung nach Berlin wegbleiben müsse“. Die gegenseitigen Glückwunschschreiben sind ganz in der konventionellen Form gehalten, die für solche Gelegenheiten üblich war und ist, nur aus dem Schreiben der Königin Sophie Dorothee an den Herzog Ludwig Rudolf mag eine Stelle angeführt werden, weil sie eines gewissen grimmigen Humors nicht entbehrt und den alten, ewig neuen Beweis von der Geduldigkeit des Papiers liefert.
„Es wird Euer Durchlaucht“, schreibt die Königin unterm 17. März, „besagter von Münich hinwieder von meinetwegen eröffnen, wie sehr ich mich über obenerwähnte Verbindung erfreue und daß ich dieselbe als eine der angenehmsten Begebenheiten considerire, welche mir und meinem Hause jemals wiederfahren können — —“
Als Illustration zu diesen Zeilen schreibt die Königin an ihre älteste Tochter, die Markgräfin von Baireuth: „Die Prinzessin ist hübsch, aber dumm wie Stroh, sie hat gar keine Erziehung. Ich weiß nicht, wie mein Sohn sich dieser Äffin (guenuche) anpassen soll.“ — Als die Markgräfin dann nach Berlin kam, erzählt sie: „Die Königin ließ bei der Tafel einige Worte über die künftige Kronprinzessin fallen. ‚Ihr Bruder‘, sagte sie, ihn (den Kronprinzen) dabei ansehend, ‚ist in Verzweiflung, sie heiraten zu müssen und er hat recht, denn sie ist ein wirklicher Dummkopf; sie antwortet auf alles, was man ihr sagt, mit ja oder nein und lacht dazu so töricht, daß einem übel werden kann.‘ — ‚O‘, fiel meine Schwester Charlotte ein, ‚Eure Majestät kennt noch nicht all ihre Vorzüge; ich war eines Morgens bei ihrer Toilette — — (hier folgt eine unwiedergebbare Beschreibung). Ich bemerkte auch, daß sie verwachsen ist; ihre Röcke sind auf einer Seite kürzer, denn sie hat eine hohe Hüfte.‘
„Ich war“, fügt die Markgräfin mit sehr richtigem Gefühl hinzu, „sehr erstaunt über diese Auseinandersetzung in Gegenwart der Dienerschaft und besonders meines Bruders. — Ich bat ihn, mir zu sagen, ob das Porträt, das die Königin und meine Schwester von der Prinzessin von Braunschweig entworfen hatte, wirklich ähnlich sei — — Er erwiderte — —: ‚Die Königin kann sich nicht über dies Fehlschlagen ihrer Pläne trösten, die Verzweiflung darüber läßt sie ihr ganzes Gift über diese arme Prinzessin ergießen. — Was diese betrifft, so hasse ich sie nicht so sehr, als ich vorgebe, ich tue aber so, als ob ich sie nicht ausstehen könnte, um dem Könige meinen Gehorsam um so wertvoller zu machen. Sie ist im Gegenteil hübsch, ihr Teint ist wie von Lilien und Rosen, ihre Züge sind fein und ihr ganzes Gesicht macht den Eindruck einer schönen Person. Sie hat aber keine Erziehung (er meint natürlich eine französische) und sie hält sich schlecht, aber ich schmeichle mir, daß Sie die Güte haben werden, sie zu modeln, wenn sie erst hier ist. Ich empfehle sie Ihnen, meine Schwester, und hoffe, Sie werden sie unter Ihren Schutz nehmen — —.‘“
Diese Äußerung, welche die Markgräfin sicher nicht niedergeschrieben hätte, wenn sie nicht wirklich getan worden wäre, und die der Kronprinz nach Seckendorffs Bericht auch Grumbkow gegenüber bestätigte, indem er diesem sagte: „Ich empfinde keine Abneigung gegen die Prinzessin, sie hat ein gutes Herz, aber lieben werde ich sie niemals können —“, beweist, was die vorhandenen Porträts der jungen Königsbraut bestätigen: daß sie in der Tat eine sehr anmutige Erscheinung war. Schlank, weit über die Mittelgröße hinausgewachsen, trug ihr gertenhaft biegsamer Körper einen kleinen Kopf mit einem süßen, lieblichen Gesichtchen, dessen Schönheit in einem blendenden Teint lag, der mit wundervollem aschblonden Haar Hand in Hand ging. Große, helle, blaue Augen gaben diesem Gesichte den Charakter; der Mund war klein und schön geformt, die Nase vielleicht zu klein und spitz, aber nicht ohne Pikanterie, in den weichen Wangen zwei herzige Grübchen. So hat Antoine Pesne sie wiederholt gemalt, lächelnd, im vollen Zauber einer rührenden Kindlichkeit, und erst auf den späteren Bildnissen der Königin wird ein aufmerksamer Beschauer die Tränen sehen, die von diesen blauen Augen geweint worden sind, denn hinter Pesnes oft manirierter Darstellung steckt im Ausdruck ein gutes Teil von dem, was seine Modelle wirklich waren, was sie erlebt und erlitten haben. Da der Kronprinz in seiner Rolle als Opferlamm, das er in gewissem Sinne ja auch ebensosehr war wie seine Braut, geäußert hatte, „die Prinzessin tanze wie eine Gans“, so veranlaßte Graf Seckendorff, daß ein berühmter Tanzmeister aus Dresden nach Wolfenbüttel kam, um der jungen fürstlichen Braut die vermißte Grazie beizubringen, auch von der gleich jetzt zur Oberhofmeisterin ernannten Frau von Katsch, der Witwe des preußischen Staatsministers, hoffte er den denkbar günstigsten Einfluß auf das Wesen der doch noch stark in den Kinderschuhen steckenden, mit großer Schüchternheit laborierenden Kronprinzenbraut. Ein wöchentlich einmal stattfindender Briefwechsel, der auf Befehl des Königs zwischen den hohen Verlobten eingeführt wurde, sollte diese einander näher bringen, hielt sich aber natürlich in den Grenzen der steifsten Formalität und war der Prinzessin sicherlich ein ebensolch peinlicher Zwang wie dem Kronprinzen, der sich Grumbkow gegenüber darüber beklagt, daß er absolut nicht wisse, was er eigentlich schreiben sollte, und mokiert sich weidlich über die erhaltenen Briefe. Als eine ihm von seiner Braut geschickte Tabakdose von Porzellan zerbrochen anlangte, schrieb er mit beißendem Witze an Grumbkow, „er wüßte nicht, ob sie ihm damit die Unbeständigkeit ihrer Tugend oder vielmehr aller menschlichen Schönheit andeuten wolle“. Der König seinerseits hatte schon von der ersten persönlichen Begegnung mit seiner Schwiegertochter korrespondiert und wurde nicht müde, sie seines Wohlwollens und seiner, wenn auch etwas rauhen Liebe zu versichern. „Indem wir meine teure Prinzessin erwarten, werden wir Sorge tragen, daß Sie Ursach haben werden, mit uns allen zufrieden zu sein“, schreibt er ihr unterm 10. Juli von Aschersleben, „Nehmen Sie dies kleine Geschenk als ein kleines Andenken für meine teure, teure Prinzessin, welche ich schätze und welche in meiner Familie zu haben ich mich glücklich preise. Ich bin überzeugt, daß mein Sohn sich würdig zeigen werde, Ihr Herz mit dem seinen zu teilen, weil ich Sie versichern kann, daß ich mit seiner Führung hier vollkommen zufrieden bin ... indem ich bis in den Tod bin Ihr treuer Vater Fr. Wilh.“
Dieser Schluß war keine bloße Phrase: der König war und blieb bis in den Tod der treueste, vielleicht der einzige Freund, den sie am preußischen Hofe hatte, denn trotzdem die Königin Grumbkow versicherte, „daß sie ihrer künftigen Schwiegertochter jede nur mögliche Sorge angedeihen lassen würde, wovon sie ihr auch schon verschiedene Beweise gegeben hätte, denn wenn sie (die Prinzessin) auch nicht viel Weltklugheit besäße, so hätte sie doch eine gute Veranlagung und das übrige würde sich schon finden und weder an Sorgfalt noch auch an Vertrauen sollte es ihr mangeln —“, so intrigierte sie in der englischen Heiratssache doch weiter und es ist wahrscheinlich ihrem Einfluß zuzuschreiben, daß der englische Gesandte Lord Robinson die Annäherung des englischen Kabinetts an das Wiener anbahnte. Damit wurde in dem Kronprinzen auch die Hoffnung genährt, daß die gefürchtete Braunschweiger Heirat noch in letzter Stunde rückgängig gemacht werden und die „fatale Epoche“, wie er es nannte, damit vermieden werden würde.
Während in Wolfenbüttel die Vorbereitungen zur Vermählung mit allem Eifer betrieben wurden, machte die Prinzessin die erste und einzige Reise ihres Lebens, indem sie ihre Mutter im Dezember zum Besuche der Herzogin von Holstein-Plön nach Hamburg begleitete. Sie schrieb von dort aus dem Könige und ihrem Bruder, dem Herzog Karl, mehrere Briefe; in einem an den letzteren gerichteten drückt sie ihre kindliche Freude über die vielen und schönen Geschenke aus, die sie zum Weihnachtsfest erhalten hätte. Nach Wolfenbüttel zurückgekehrt, gab sie im Januar zu Ehren des Geburtstages des Kronprinzen ein Fest, über das der König ihr seine Freude ausdrückte, als wenn es ihm gegolten hätte, worauf sie erwidert: „Ich wünschte mehr tun zu können, um meine Verehrung für diesen Prinzen und meinen Respekt und Unterwürfigkeit für Eure Majestät ausdrücken zu können.“ Die großen, klaren, wenn auch vielleicht noch etwas unfertigen Schriftzüge der Prinzessin aus diesem Jahre würden dem Graphologen wahrscheinlich einen Aufschluß über ihren Charakter geben. Es sei deshalb erlaubt, zu Nutz und Frommen dieser Wissenschaft, die eine große Gemeinde hat, das Faksimile ihrer Unterschrift hier wiederzugeben:
Und so rückte die „fatale Epoche“ immer näher. Herzog Ludwig Rudolf hatte das von seinem Vater erbaute Schloß Salzdahlum zum Schauplatz der glänzenden Vermählungsfeierlichkeiten bestimmt, und in der Tat eignete sich auch keines seiner anderen Schlösser so sehr zur vollen Prachtentfaltung als dieses. Es ist seitdem vom Erdboden verschwunden; König Jerome von Westfalen hat die historische Stätte niederreißen lassen und die Kunstschätze, die sie enthielt, teils nach Cassel, teils nach Paris entführt. Aus dem letzteren kam nichts mehr davon zurück, doch wurde ein Teil der Gemälde und die überaus kostbare Sammlung von Porzellan und Majoliken, sowie einige wenige der wundervollen, eingelegten Möbel dem Lande zurückerstattet und sind heute im herzoglichen Museum zu Braunschweig das Entzücken der Kenner. Das Schloß selbst war zwar nur ein sogenannter Fachwerkbau, aber von großer Ausdehnung und mit schönen Parkanlagen umgeben; es bot Raum für die glänzende Suite des preußischen Königspaares wie für die herzogliche Familie, für die Prunkräume und die zahlreiche Dienerschaft. Über das Zeremoniell der Trauung, der Tafel usw. sind umfangreiche Aktenstücke bis ins kleinste ausgearbeitet worden; um alles und jedes kümmerte sich Herzog Ludwig Rudolf selbst, in allem wurde angefragt, wie es der König liebt und befiehlt. Für den Fall, daß besonders feine Schüsseln nicht für alle zureichend wären, wurde bestimmt, daß dieselben nur den Majestäten zu reichen und dann vor diese hingestellt werden sollten. Die Hochzeit hat laut Spezifikation vom 3. Januar 1735 die Summe von 35 442 Talern und 7 Pfennigen gekostet, wovon allein 6441 Taler auf die Tafel fielen. Der Konditor berechnete 400 Taler für das Konfekt.
Im Herbst des Jahres 1732 hatte der Kronprinz an Grumbkow geschrieben: „Ich hoffe nicht, daß der König sich in meine Angelegenheiten mischen wird, sobald ich verheiratet bin, denn dann würden sie gewiß einen schlechten Fortgang haben und die Frau Prinzessin könnte darunter leiden. Die Ehe macht großjährig, und sobald ich das bin, werde ich Herr im Hause sein und meine Frau hat nichts zu befehlen. Ich halte den Mann, der sich von Frauen regieren läßt, für den größten Tropf von der Welt und unwürdig, den Namen Mann zu führen. Darum verheirate ich mich, wenn es geschieht, als galant-homme, d. h. ich lasse Madame handeln, wie es ihr beliebt, und tue meinerseits, was mir gefällt, und dann lebe die Freiheit! Ich hebe das schöne Geschlecht. Aber meine Liebe ist flatterhaft. Ich will nur den Genuß. Der Rest ist Widerwille. Danach mögen Sie urteilen, ob ich von dem Holze bin, aus dem man brave Ehegatten schnitzt! Ich gerate in Wut bei dem Gedanken, es zu werden. Aber ich mache aus der Not eine Tugend. Ich werde mein Wort halten. Ich werde heiraten. Aber sobald es geschehen ist, dann heißt es: bon jour, Madame, et bon chemin!“
Diese libertinischen Grundsätze der französischen Schule hatte der Kronprinz in dem elterlichen Hause, das in dem damaligen Europa als ein Muster ehelichen Wandels galt, sicherlich nicht aufgesogen: er hatte sie von seinem Besuche an dem sächsischen Hofe mitgebracht und traf mit ihnen zu seiner Vermählung in Salzdahlum ein. Und hier, am Vorabend dieser verhaßten Verbindung, trat das gänzlich Aufgegebene, Unerwartete, ein: die Annäherung der Londoner und Wiener Kabinette war gelungen und Graf Seckendorff trat vierundzwanzig Stunden vor der Vermählung vor den König, um ihm als Bevollmächtigter Karl VI. „als einen Beweis von des Kaisers Freundschaft“ die Aufhebung der Verlobung des Kronprinzen vorzuschlagen, sowie dessen Vermählung mit der Prinzessin Amalie von England anzubahnen! Als Entschädigung wollte man die Prinzessin Elisabeth Christine mit dem Prinzen von Wales vermählen, falls der König die Verlobung seiner Tochter Charlotte mit dem Prinzen Carl von Braunschweig nicht gleichfalls rückgängig machen und sie mit dem englischen Thronerben vermählen wollte; in diesem Falle wurde dem Prinzen die Hand der zweiten Tochter König Georgs II. zugesichert.
Nun stand Königin Sophie Dorothee mit einem Schlage vor der Erfüllung aller ihrer Wünsche und Intrigen, Kronprinz Friedrich vor der Befreiung eines ihm unerträglichen Zwanges, trotzdem er die Prinzessin Amalie ebensowenig kannte wie seine Braut und die „Befreiung“ nur einen andern Namen führte. Aber diese Wendung zu seinen und der Prinzessin Gunsten kam zu spät, das Schicksal hatte wieder einmal eine der von ihm beliebten Ironien ausgespielt, denn das Projekt scheiterte an dem festen Willen und der Loyalität des Königs, der über die ihm gestellte Zumutung in heftigen Zorn geriet und dem Gesandten erwiderte: „Wenn ich Ihn nicht so wohl kennte und wüßte, daß Er ein ehrlicher Mann, so glaubte ich, Er träumte!“ Damit gab er Seckendorff das ihm überreichte Schreiben des Prinzen Eugen uneröffnet zurück, indem er sagte, „daß er durch keine Vorteile der Welt sich würde bewegen lassen, seiner Ehre und Parole einen solchen Schandfleck anzuhängen und die in vierundzwanzig Stunden zu vollziehende Heirat aufzuschieben oder gar zu verändern.“
Wir wissen es nicht, ob die Königin und der Kronprinz der gleichen Meinung waren, und darum müssen wir es zu ihrer Ehre annehmen.
Und so wurde diese Ehe wirklich geschlossen. Am 12. Juni, einem Freitag, abends 8 Uhr, vollzog der Abt Dreyßigmark in der Schloßkapelle zu Salzdahlum unter Glockengeläut und Kanonendonner die feierliche Vermählung des Kronprinzen Friedrich von Preußen mit der Prinzessin Elisabeth Christine von Braunschweig, und die programmmäßigen Festlichkeiten nahmen ihren Verlauf. Der Vollzug der Ehepakten sowie der Verzicht der Prinzessin waren der Feier vorausgegangen, und daß dem letzteren eine Bedeutung wirklich beigelegt wurde, beweist ein Schreiben vom 22. April 1749 im braunschweigischen Landesarchiv, in welchem der preußische Staatsminister anfragt, „ob die Königin den eidlichen Verzicht bei der Vermählung actus corporalis getan.“
Herzog Ludwig Rudolf hatte alles getan, die Vermählungsfestlichkeiten so reich und prächtig als nur irgend möglich zu gestalten. Karl Heinrich Graun hatte eine Festoper komponiert: „Lo Specchio della fedeltà“; Händels „Parthenope“, sowie das Lustspiel von Destouches „Le Glorieux“ kamen zur Aufführung und damit endete das an Aufregungen und Seelenqualen so überreiche Vorspiel dieses Ehedramas, das wohl im Vorsaal der Hölle, nicht aber im Himmel zum Abschluß gelangt war.
Der englische Hof rächte sich für das Scheitern seiner zu spät gekommenen Bereitwilligkeit für die Pläne der Königin, indem er eine Reihe von satyrischen Darstellungen der Vermählung des preußischen Kronprinzen zirkulieren ließ, die nach Seckendorffs Bericht unwahr und falsch waren, den König trotzdem aber so in Harnisch brachten, daß er noch Anfang Juli nicht dazu zu bewegen war, die offizielle Notifikation nach London ergehen zu lassen. Er reiste, nachdem er, der sonst so Sparsame, nach dem vorhandenen Bericht 832 Dukaten als Geschenk für die Dienerschaft hatte verteilen lassen, am 16. Juni mit der Königin, die zu dem gleichen Zwecke 538 Taler gespendet, nach Berlin zurück, der Kronprinz folgte alsbald nach, und am 20. Juni wurde die nunmehrige Kronprinzessin, welche mit ihren Eltern und Großeltern in die neue Heimat einzog, an der Grenze von der Magdeburgischen Ritterschaft und an der märkischen Grenze von den Kurmärkischen Landständen feierlichst begrüßt. Am 24. Juni trafen die braunschweigischen Herrschaften in Potsdam ein, empfangen von dem preußischen Hofe, an dem auch die Markgräfin von Baireuth eingetroffen war, und ihr verdanken wir eine graphische Beschreibung nicht allein der mit dem Einzuge der Kronprinzessin verbundenen Festlichkeiten, sondern hauptsächlich der dabei herrschenden Stimmung.
Den König fand die Markgräfin in der besten Laune und sehr befriedigt von seiner Schwiegertochter, die er dem Wohlwollen seiner ältesten Tochter empfahl, während die Königin ihrer üblen Laune freien Lauf ließ. „Sie (die Kronprinzessin) wird Ihnen gleich gefallen, denn sie ist ja reizend, aber — —“ sagte sie mit bedeutungsvollem Achselzucken.