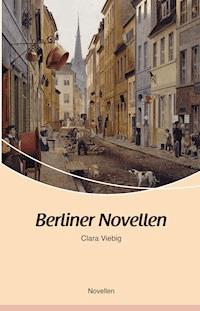Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Es ist auf dem großartigen Empfang des Bankiers Mannhardt, dass die junge Elisabeth Reinharz, die erst seit kurzem – aus der Provinz kommend – allein in Berlin lebt, eine ihrer Novellen zum Besten geben darf. Die Reaktion darauf ist positiv, aber noch verhalten. Es bedarf schon ihres ganzen Einsatzes in der Folgezeit, ihre Werke bei Redakteuren und Verlegern unterzubringen. Gleichzeitig beginnt aber der eine oder andere, sich für Elisabeth zu interessieren, was das Leben für sie nicht einfacher macht. Es vergeht noch einige Zeit, bis sie den richtigen Weg für ihr Leben gefunden hat.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Elisabeth Reinharz‘ Ehe
Es lebe die Kunst!
Roman
Saga
Erstes Buch.
1.
In der Alsenstrasse hielt eine Reihe von Droschken unter den braunen, knospenden Bäumen.
Vom Tiergarten herüber wehte eine angenehme laue Luft mit leisem Frühlingsmahnen.
Oben in der ersten Etage des eleganten Eckhauses waren die Fenster erleuchtet; dreizehn in der Front. In Pausen von halben Stunden reckte sich einer der verschlafenen Kutscher auf seinem Bock, dehnte die steifen Glieder, gähnte und deutete hinauf nach den hellen Fenstern — das konnte noch lange dauern, erst zwölf, die amüsierten sich noch.
In der grossen, komfortablen Wohnung des Bankiers Mannhardt wogte die Gesellschaft; fast hundert Personen, Elite des Geistes.
Das Souper war ausgezeichnet gewesen und soeben beendet. Man wandelte durch die Räume. Wie die Wohnung eingerichtet war, herrlich! Das heisst kein übertriebener Luxus, nirgendwo ein Hauch von Protzentum. Alles fein, diskret, sanfte Farben in harmonischer Abtönung; ein gediegener, vornehmer Geschmack. Möbel aus allen Zeiten, Bouleschränkchen, Rokokosofas, Renaissancestühle; aber jedes am richtigen Platz, von einer graziösen Laune zusammengestellt.
Da war ein lauschiges Eckchen hinter der mit künstlich verschossenem Damast bekleideten spanischen Wand; Blumen dufteten in der venezianischen Schale, und eine geschickte Kopie nach irgendeinem alten Meister schaute darauf nieder — der Lieblingsplatz der Hausfrau. Da sass sie gern, stützte das dunkellockige Köpfchen mit den klugen Augen in die kleine Hand und spann feine Fäden.
Überall Büsten und Statuetten. Verschiedene moderne Meister, die Hausfreunde waren, hatten den Hausherrn verewigt. Hier auf einem Gemälde: am Klavier, die Augen, weit aufgeschlagen, mit einem geistvollen Ausdruck in die Ferne gerichtet. Dort in Gips: ein Buch in der ausdrucksvoll modellierten Hand; diese Büste sollte in Marmor ausgeführt werden. Geschmackvoll reihten sich so moderne Werke denen früherer Jahrhunderte an.
Bankier Mannhardt war in allen Künsten zu Hause und ein Protektor aller Künstler. Seine Bibliothek enthielt sowohl gelehrte Folianten als jede Neuerscheinung auf dem Gebiet der schönen Literatur, Biographien, Memoiren, Notenstösse, Prachtwerke, Autogramme von Musikern, Denkern und Dichtern; die wertvollsten Stücke davon unter Glas in geschmackvollen Rahmen. Er selbst leistete Bedeutendes im Klavierspiel, aber er verschmähte es nicht, bei einer pianistischen Grösse der Residenz noch weiter zu studieren. Die Börse betrieb er nur so nebenbei; in offenherzigen Stunden gestand er es, er hätte eigentlich seinen Beruf verfehlt — Künstler, Künstler, das war’s! Er war sich nur noch nicht klar geworden, zu welcher Kunst ihn seine Begabung am gebieterischsten drängte.
Frau Leonore Mannhardt war die einzige Tochter eines reichen Handelshauses; sie hatte ihren Mann aus Liebe geheiratet. Als kleiner Kommis, aus irgendeinem Winkel Posens gebürtig, war er nach Berlin gekommen; sie hatte ihm die Stellung gemacht. Galante Zungen nannten sie eine zweite Rahel, eine Henriette Herz.
Heute exzellierte Frau Leonore am Klavier; ihr Mann hielt in Gesellschaft stets mit seinen persönlichen Leistungen zurück. Sie sang ein kleines Liedchen, das ihr Gatte, Gott weiss wo, ausgegraben hatte; sie sang es mit angenehmem Stimmchen und feiner Pointierung, begleitete sich selbst, und zwar stehend, die wenigen Akkorde lässig auf dem Klavier anschlagend, das Gesicht mit liebenswürdigem Ausdruck ihren Gästen zugekehrt.
Der Beifall war gross. Sie lächelte und deutete auf ihren Gatten, der mit gekreuzten Armen am anderen Ende des Flügels lehnte.
„O bitte, nicht ich — dort! O nein, meinem Mann gebührt das Verdienst!“
„Nein, nein, Lorle!“ lehnte er lebhaft ab. „Ich bitte dich, ich habe durchaus kein Verdienst hierbei!“ Er warf ihr eine Kusshand zu. „Dir allein gebührt es!“
„Ihnen beiden! Allen beiden!“ Man überschüttete das Ehepaar mit Komplimenten: einzig in seiner Art, dies geniale Zusammenwirken von Mann und Frau. „Mehr, bitte mehr!“
Man umringte den Flügel. Diener mit Kaffee, Bier und Likören konnten sich kaum durchdrängen.
„Bitte, bitte!“
„Es sind ja so viele bedeutende Künstler hier!“ Die Augen der Hausfrau streiften durchs Zimmer, sie neigte sich verbindlich. „So viele Grössen ... ich muss mich verstecken!“
„Lass dich erweichen, Lorle!“ rief Mannhardt. „Bitte, einen Augenblick!“ Er stürzte ins Nebenzimmer. Eine Mandoline am himmelblauen Bands schwingend, kehrte er zurück. „Hier, mein Kind, nun tu’s mir zuliebe!“ Er führte zärtlich ihre Hand an die Lippen: „Singe!“
Man war ganz Ohr.
Und nun klimprige Mandolinenklänge. Mit einer gewandten Bewegung hatte Frau Leonore das himmelblaue Band um den Nacken geworfen; den dunkellockigen Kopf nach links geneigt, den Oberkörper leicht zurückgebogen, lehnte sie in ihrem schlichten weissen Kleide auf einem Taburett.
„Mignon!“ sagte jemand.
Sie klimperte und sprach halb, sang halb dazu; getreu nach berühmtem Muster. Es war die betrübende Geschichte vom Mutterherzen, das der entmenschte Sohn herausreisst und der entmenschten Geliebten bringt. Im raschen Lauf kommt er zu Fall.
„T’es-tu fait mal, mon enfant?“ stöhnt noch das zuckende Mutterherz. Klänge von unbeschreiblicher, rührender Besorgnis, letztes, halb geächztes Stammeln einer übermenschlichen Liebe.
Frau Leonore trug geschmackvoll vor; es ging einem ans Herz. Die Damen wischten sich Tränen ab, die Männer schauten gedankenvoll vor sich nieder. Mannhardt geleitete die Gattin zärtlich besorgt zum Diwan, sie war selbst sehr ergriffen.
Die Diener präsentierten neu besetzte Tabletts. Man trank Champagner, man stiess an:
„Es lebe die Kunst! Hoch! Hoch unsere Wirte!“
Ruhig blickte überm Flügel Meister Sebastian Bach unter einer Allongeperücke, ihn ging das nicht an. Seine Büste stand der neuesten des Hausherrn gegenüber. Frau Leonore hatte darauf bestanden, diese müsste ins Musikzimmer; trotzdem der Hausherr lebhaft protestierte, war sie mit Hilfe einiger Freunde dort aufgestellt worden. Die weissen Gipsgesichter sahen sich voll an.
Es war ein animierter Abend; das Programm wechselte. Eine grosse Sängerin, der Stern des Opernhauses, sang; man öffnete die Fenster, der Musiksaal war zu eng für dieses mächtige Organ.
Unten wachten die Kutscher auf: „Alle Achtung, zetert die!“ Sie lauschten.
Dann deklamierte zur Abwechslung eine junge, talentvolle Schauspielerin. Fräulein Silvia Maschka gehörte der neuen Schule an; von Pathos keine Spur, sie war ganz Natur. Sie hatte Gedichte eines jungen Lyrikers zum Vortrag gewählt. Er war unbekannt, sie protegierte ihn; sie sprach rasch, sehr rasch, kein Mensch verstand ein Wort. Aber man applaudierte ihr, man sagte: „Bravo!“, sie sah so allerliebst aus mit ihrem lebhaften Mienenspiel und den erhöhten Farben.
Auf dem Lieblingsplatz der Hausfrau, hinter der spanischen Wand, hatten sich die Schriftsteller zusammengefunden; sie kamen heute nicht genügend zur Geltung.
Auf dem kleinen Eckdiwan hatten drei Damen Platz genommen. Ein Herr mit Nussknackerzähnen und Ansatz von Embonpoint machte ihnen mit seltener Unparteilichkeit den Hof. Es war Bolten, der Chefredakteur eines sehr beliebten Unterhaltungsblattes; und diese drei waren die Sterne seines Journals. Drei grosse Talente auf einem Sofa!
Links, Alinde Rosen, beherrschte den Salon; entzückende graziöse Plaudereien entstammten ihrer Feder, sie traf den Ton der guten Gesellschaft wie kein anderer Autor; ihre Helden waren unglaublich männlich, ihre Heldinnen unheimlich schön, Verlobung und Hochzeit die Hauptthemata. Jedes Werk ihrer Feder setzte die liebenswürdigen Leserinnen in Brand.
Alinde Rosen war befreundet mit Frau Mia Widmann, der reizenden Blondine in der Mitte, deren Füsschen kaum den Boden erreichten. Diese kleine Frau war eine energische Vorkämpferin der Frauenemanzipation. Mit männlicher Kraft zog sie ins Feld. „Ich schreibe unter M. Widmann. Man hält mich für einen Mann“, sagte sie stolz. Ihr Madonnenköpfchen schwärmte für „freie Liebe“, trotzdem sie selbst Mann und drei Kinder hatte. Mädchen, die arbeiten mussten, nannte Mia Widmann „Märtyrerinnen“ und Mädchen, die nichts taten, „Opfer ihrer Familie“.
Heute war sie sehr erregt. Sie sprach mit ihrer Nachbarin in der rechten Sofaecke, der schönen Frau von Lindenhayn.
„Ist es nicht unerhört? Da verurteilen sie das arme Weib, weil es den Mann, der es verraten hat, niederschiesst. Solche Ungerechtigkeit! Wir dürfen sie uns nicht gefallen lassen!“ Sie warf das Köpfchen hintenüber, dass die kunstvoll gedrehten Löckchen auf der faltenlosen Stirn wippten. „Wir Schriftstellerinnen sind zu Führerinnen, zu Verteidigerinnen der unterdrückten Frauenwelt bestimmt. Wollen wir nicht einen Verein gründen zur ‚Wahrung der geistigen und körperlichen Interessen der Frau’? Wir könnten doch vorderhand schon immer die Woche einmal zusammenkommen und beraten. Und denken Sie, welch interessante Stoffe lassen sich finden, wenn man hinabsteigt ins intime Leben der Frau! Doktorchen,“ sie streckte die Hand nach Bolten aus, „Sie werden Schriftführer. Einen Mann müssen wir haben!“
„Natürlich!“ Der Redakteur küsste die ausgestreckte Hand; er hatte keine Ahnung, von was die Rede war. „Ich bin dabei! Alle drei Damen mit von der Partie?“ Er sah sie schmunzelnd der Reihe nach an: alle drei nicht zu verachten. Frau von Lindenhayn war eine bewunderungswürdige Schönheit, die kleine Widmann pikant, Alinde Rosen hatte noch schöne Reste.
„Von was ist denn die Rede?“ fragte Alinde. Sie hatte bis dahin mit einem blutjungen Bürschchen in Einjährigenuniform kokettiert; sie studierte das Militär. „Von was wird denn gesprochen?“
„Wir wollen uns der leidenden Frauenwelt erbarmen“, antwortete ernst die Widmann. „Wir müssen helfen!“
„Pst!“
In der Tür des Musikzimmers stand die Hausfrau. Fräulein Maschka hatte eben das „Hexenlied“ von Wildenbruch, eine Meisterleistung sinnverwirrender Schnelligkeit, beendet. Ein Beifallssturm brauste, ein Orkan der Begeisterung für Dichter und Interpretin.
Frau Leonore bat um Gehör.
„Himmel, schon wieder eine Rede? Sie hat ja bei Tisch erst geredet“, flüsterte die Widmann.
Bolten nickte geheimnisvoll. „Sie schreibt auch.“
„Verzeihen Sie, wenn ich noch um eine halbe Stunde Gehör bitte“, sprach die Dame des Hauses.
Halbe Stunde —? Eine merkliche Unruhe flog durch die Festräume.
„Hier,“ die Gastgeberin zog mit liebenswürdigem Lächeln ein junges Mädchen vor, das bescheiden hinter ihr gestanden hatte, „hier, Fräulein Elisabeth Reinharz soll uns eine ihrer kleinen Novellen vorlesen. Urteilen Sie dann selbst!“
Was — wer? Vorlesen? Man wurde aufmerksam.
„Wieder eine Dilettantin mehr!“ seufzte Frau Widmann.
„Ein ganz angenehmes, aber unbedeutendes Gesicht!“ Die schöne Lindenhayn hielt sich die langgestielte Lorgnette vor die Augen.
Alinde Rosen war gutmütig. „Sie ängstigt sich!“
„Passen Sie auf, Doktor,“ neckten die drei, „nun bekommen Sie was zu drucken; Frau Mannhardt protegiert wieder!“
„Ich lasse mich nicht bestimmen“, sagte Bolten. „Ich bin auch gar nicht neugierig.“
Sie standen aber doch alle auf und näherten sich der Tür des Musiksaales.
Drinnen, gerade unter dem Kronleuchter, sass das junge Mädchen.
„Wie heisst sie?“ fragte man leise.
„Reinhard oder Reinharz,“ flüsterte es Antwort, „aus Posen, Hinterpommern oder sonstwo her.“
Das Mädchen begann; erst schüchtern, mit belegter Stimme, dann wurde ihr Organ kräftig, sie las ruhig und sicher.
Merkwürdig genug nahm sich die einfache Geschichte in diesem Salon aus; nichts war darin von Geist, keine einzige, auch nur annähernd geistreiche Wendung, nur eine starke ehrliche Empfindung. Wie Duft von erdiger Scholle stieg’s auf; ein Geruch nach Land, nach Stall, nach Bauernstuben, nach nahrhaftem Korn, nach Wiesenheu und harzigen Wäldern zog über die parfümierten Möbel. Grüne Raine, buntblumig und taubesprengt, blaue Kiefernwälder in der Ferne, Heide, raubvögeldurchkrächzt und sturmzerzaust; kräftige Menschen mit starken, unverkümmerten Gefühlen wanderten barfuss über rauhe Ackerschollen. Der Horizont war frei, die Luft ging scharf.
Die Zuhörer sahen sich an.
„Starker Erdgeruch!“ murmelte der kleine blonde Mann in der Ecke, der bekannte Verlagsbuchhändler Maier. Er drängte sich etwas vor und spitzte die Ohren.
„Wie finden Sie’s denn, Maier?“ fragte der vor ihm stehende Herr und drehte sich nach ihm um. „Janz nett, was? Wie, jut sagen Sie? Natürlich; habe ich jleich jesagt!“ Er spielte mit seiner schwer goldenen Uhrkette und lächelte wie ein stets von der eigenen Meinung Überzeugter. „Passen Sie mal auf, ich sage Ihnen, die wird was! Denken Sie dran, Maier, ich hab’s Ihnen jesagt.“
Während Elisabeth Reinharz las, wurden ihre frischen Wangen blasser, ihre hellen Augen schimmerten dunkler, sie schauten ernst. Ihre Brust breitete sich in tiefen Atemzügen, ihre Nasenflügel zitterten wie die eines edlen Renners, der die Freiheit wittert. Ihr Organ tönte voll, jede Empfindung zog über ihr offenes Gesicht; sie hatte die Zuhörer vergessen.
„Hübsches Mädchen!“ Die Herren zeigten viel Wohlgefallen.
Leonore strahlte. Sie fühlte den belebenden Hauch der frischen Mädchenlippen sich ihrem Salon mitteilen. Ihr Schützling gefiel.
„Liebchen, reizend!“ rief sie, als Elisabeth geendet hatte. Sie gab damit das Signal zum Beifall. Sie reckte sich auf die Zehen, um das grosse Mädchen auf die Wange zu küssen.
Auch Mannhardt machte seine Komplimente. „Wie recht meine Frau gehabt hat! Sie haben viel Talent. Meine Frau irrt sich nie in so etwas, nicht wahr, Lorle?“ Er küsste dem Mädchen die Hand und hielt dabei ihre Finger mit besonderem Druck; sie entzog sie ihm rasch mit tiefem Erröten. Wie war das alles so ungewohnt, so komisch! Sie lachte fröhlich auf.
Man beachtete sie jetzt allgemein und redete sie an; vorher war ihr keine Unterhaltung geglückt, denn sie verstand nicht diese prickelnde, alle Gebiete streifende Art. Selbst die drei dort in der Tür, die gefeierten Schriftstellerinnen, nahmen Notiz von ihr.
Frau von Lindenhayn schob ihr mit einem forschenden Blick der schönen, melancholischen Augen den Zeigefinger unter das Kinn: „Nun, Kleine?“
Die Widmann sagte rasch: „Besuchen Sie mich!“
Und Alinde Rosen nahm freundschaftlich ihren Arm: „Kommen Sie, setzen Sie sich mit in unser Schmollwinkelchen! Man kann da so intim unter sich plaudern.“ Ihr Blick suchte unruhig.
„Alles andere“, sie unterbrach sich und lächelte liebenswürdig dem Einjährigen zu, „ist so ermüdend!“ —
Währenddessen strich Leonore von Gruppe zu Gruppe; sie erzählte die Geschichte ihres Schützlings. „Sie müssen sich wirklich ein bisschen für die Reinharz interessieren, lieber Goedecke!“ bat sie den Mann mit der schwer goldenen Uhrkette. „Die Kleine kommt fremd aus der Provinz, da hat sie bis zum Tode ihres Onkels, eines alten, schrulligen Junggesellen, auf dem Lande gelebt — denken Sie an, und das Talent! Es wäre ein Jammer, wenn es in falsche Hände geriete. Ein harmloses Geschöpfchen, und dazu noch eine Waise!“
„M. w., ist janz mein Fall, Talente poussieren. Lassen Sie man jut sein, verehrte Inädige, arrangieren wir, arrangieren wir! Ein Wort von mir an Bolten, und er akzeptiert jleich was von ihr. Ich werde auch mal mit dem Vorstand des literarischen Klubs über das Fräulein reden. Sie kann ja da mal was von ihren Sächelchen lesen am nächsten Vortragsabend. Ist dem Publikum neu, sieht scharmant aus.“
„Ach ja, lieber Goedecke,“ Frau Leonore lächelte erfreut und zugleich ein wenig maliziös, „arrangieren Sie die Sache, Sie haben ja alle in der Tasche. Und Sie,“ sie wandte sich mit verbindlicher Kopfneigung nach der anderen Seite, „was halten Sie von meinem Schützling, Herr Maier?“
Der Verleger lächelte fein, sein blasses, blondes Gesicht mit den etwas plattgedrückten Zügen sah klug drein. „Erdgeruch!“ sagte er wieder. „Hm — nicht unliterarisch!“
Mehr war nicht aus ihm herauszulocken; Frau Leonore musste sich entschliessen, weiterzuziehen.
Nach einiger Zeit jedoch sah man Maier suchend umherblicken und dann im Nebenzimmer verschwinden.
Er fand Fräulein Reinharz hinter der spanischen Wand. Sie sass auf dem Ecksofa, eingeschlossen zwischen Alinde Rosen und Frau von Lindenhayn; die kleine Widmann hatte sich auf die Seitenlehne gehockt. Der getreue Bolten stand bei seinen Damen wie der Hahn auf dem Hühnerhof.
Die Begrüssung fiel ziemlich kühl aus. Maier war reserviert, nur der schönen Lindenhayn schüttelte er die Hand. Dann bat er, mit einem Blick auf das junge Mädchen: „Haben Sie die Güte, mich vorzustellen, gnädige Frau!“
„Herr Verlagsbuchhändler Maier!“ Die Lindenhayn lächelte, ihre dunklen Augen sahen den kleinen blonden Mann ordentlich zärtlich an. „Fräulein Reinharz!“
Maier machte eine knappe Verbeugung. „Schreiben Sie schon lange, gnädiges Fräulein?“
„Nein.“ Elisabeth fühlte ihr Herz klopfen. Welches Glück, der Verlagsbuchhändler Maier liess sich ihr vorstellen! Man hatte ihn ihr bei Tisch gezeigt: Grosser Verleger, ganz moderner Verlag, findet alle Talente. Maier — Maier — unter den vielen sie umschwirrenden Namen hatte sie diesen nicht vergessen.
„Also noch nicht lange. Ist schon viel gedruckt?“ forschte er.
„Ach nein!“ Sie sah ihn ehrlich mit den dunkelbewimperten grauen Augen an. Ein Seufzer folgte: „Leider nicht!“
Es zuckte wie Lächeln um seinen Mund. „Wird schon kommen.“
„Meinen Sie?!“ War das ein Aufleuchten in den grauen Augen, das ganze Gesicht strahlte. Sie fasste, von plötzlichem Impuls getrieben, nach seiner Hand: „Ach, wenn Sie mir helfen würden! Ich möchte so gern vorankommen. Ich muss voran!“ Das letzte stiess sie zwischen den Zähnen hervor, dann pressten sich ihre Lippen aufeinander, ihr Gesicht veränderte sich, ihre weichen Züge wurden straff.
Maier lächelte nicht mehr; jetzt sah er, das rosige Kinn war energisch, und die dunklen Brauen in dem Mädchengesicht waren sicher gezogen. „Geben Sie mir Ihre Adresse, gnädiges Fräulein. — Lützowstrasse?“ Er zog sein Notizbuch heraus. „So. Lützowstrasse acht, drei Treppen.“
„Vier“, verbesserte sie.
„Also vier, schön.“ Er reichte ihr die Hand. „Auf Wiedersehen!“ Er ging nach flüchtigem Gruss gegen die übrigen.
„O diese Verleger!“ Mia Widmann rutschte von ihrer Lehne herunter. „Wo sie etwas Neues wittern, sind sie dahinter her wie der Teufel hinter der armen Seele. Wie hat er es mit der Starzynska gemacht! Solange sie billig zu haben war: enfant gâté; jetzt, wo sie Ansprüche macht, machen kann, lässt er sie links liegen. Denken Sie,“ sie wandte sich an die Lindenhayn, „er hat ihr das Trauerspiel zurückgegeben! Das Packendste, was je geschrieben wurde!“
„Finden Sie?“ sagte kühl die schöne Frau.
Die Widmann fuhr auf: „Töne findet sie darin, Töne! Die ganze unterdrückte Frauenseele macht sich Luft. Es ist unerhört von Maier! Er taugt nichts, wie alle Verleger!“
„Ich finde Maier sehr gut.“
„Sie verlegen doch aber nicht bei ihm?“
Frau von Lindenhayn zuckte die Achseln, es konnte ebensogut „nein“ wie „ja“ bedeuten. Sie verriet nicht, dass sie ihm ihr neuestes Buch angeboren hatte.
„Natürlich ‚nein’,“ sagte Bolten, „sonst hätte ihn unsere Freundin doch nicht gelobt. Ich möchte den Autor sehen, der mit seinem Verleger zufrieden ist. Mit dem Redakteur geht’s ebenso. Ich allein mache eine rühmliche Ausnahme, nicht wahr, meine Damen?“
„Ja, Sie, Doktorchen, Sie!“ Die drei überschütteten ihn mit Komplimenten.
Elisabeth wunderte sich, sie hatte bis jetzt noch nicht gewusst, dass Damen einem Herrn die Cour machen. Sie musste dem Doktor eigentlich auch etwas Angenehmes sagen, Frau Mannhardt hatte ihr eingeschärft, besonders liebenswürdig gegen ihn zu sein. Es fiel ihr gar nichts ein. Eine unsichtbare Hand legte sich auf ihren Mund, eine Stimme tief innen sprach: „Du wirst doch nicht? Einschmeicheln — pfui!“ Sie sass wie ein Stock.
Nun nahte die Dame des Hauses und brachte Goedecke mit.
„Hier, Liebchen!“ Sie winkte Elisabeth zu sich, und diese sprang froh auf; ihr war so beklommen gewesen auf dem kleinen Sofa hinter der spanischen Wand. „Hier, ich möchte Sie mit Herrn Eugen Goedecke bekannt machen, er ist sehr entzückt von Ihrer Novelle.“ Sie huschte fort.
„Ich werde Sie im literarischen Klub vorlesen lassen, Fräulein“, sagte Goedecke. „Sie lesen janz nett. Morjen über vierzehn Tage. Ich schreibe Ihnen noch darüber.“
„Wirklich?!“ Wieder dieses Aufleuchten des Mädchengesichtes. „Was, wo soll ich lesen?“ Sie atmete hastig, wie bei schnellem Lauf. „Wie gütig von Ihnen!“
„Ieben Sie mir Ihre Adresse.“
„Lützowstrasse acht, vier Treppen.“ Sie lachte glückselig. „Ich habe sie auch schon dem Herrn Maier gegeben. Dem grossen Verlagsbuchhändler, wissen Sie!“ Sie biss sich auf die Unterlippe und presste die Hände ineinander, als müsse sie so einen lauten Freudenschrei unterdrücken. „Habe ich ein Glück!“
„Na,“ er sah sie von unten bis oben an, machte ein bedenkliches Gesicht und schüttelte dann gravitätisch den Kopf, „ich möchte Ihnen doch raten, sich da quasi nicht zu illusionieren. Ich kenne Maier. Übrigens, was hat er denn zu bedeuten?“ Er zuckte die Achseln. „Das bisschen Moderne!“
Sie sah ihn ganz enttäuscht an. „Ich dachte doch ...“
„Ja, liebes Fräulein!“ Er lächelte überlegen. „Sie kennen die hiesigen Verhältnisse nicht. Lauter Komplikationen, sage ich, Sie können sich schon auf meinen Scharfblick verlassen. Diese Leute, pah!“ Er machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Aber wieso denn?“ Das Mädchen wurde ganz blass. „Eben sagte noch die Dame, die schöne Frau von Linden ... Linden ... ach, Sie wissen schon, die dort in dem ausgeschnittenen Samtkleid mit dem Brillantstern, die schien viel Wert auf Herrn Maier zu legen!“
„Kunststück! Er wird ihr neuestes Buch verlegen sollen, nimmt ja kein anständiger Verlag. Lauter Nuditäten. Wissen Sie, Fräulein,“ Goedecke beugte sich näher und flüsterte geheimnisvoll, „Intrigen, Komplikationen, nichts weiter. Trauen Sie keinem. Mit dem“, er blinzelte mit einem Auge nach Bolten, „lassen Sie sich man schon gar nicht ein!“
„Aber die Damen, mein Gott, die berühmten Schriftstellerinnen, alle drei sind doch mit ihm ...“
Er liess sie gar nicht ausreden. „Lauter Komplikationen!“ Er klopfte ihr auf die Hand. „Aber seien Sie nur ganz ausser Sorge, ich bin auch noch da, und was ich anfange,“ er rieb sich die Hände und blies die Backen auf, „hat immer Schick. Da habe ich neulich ...“ Er brach ab und fuhr hastig herum: „Rief da nicht jemand meinen Namen? Ach so, Direktor Schwertfeger!“ Er hielt die Hand vor den Mund: „Janz jenialer Direktor. Sucht den dritten Mann zum Skat. Ja, ja, ich komme schon! Verzeihen Sie, Fräulein, ich bin unabkömmlich!“ Er machte eine hastige Verbeugung. „Sie hören noch von mir!“ Fort war er.
Elisabeth sah noch, wie sein schwarzer Frack zwischen Türen und Menschen durchschwänzelte; sie wusste nicht recht, warum, aber sie hatte grosse Lust zu lachen. Der Kopf wirbelte ihr; langsam ging sie zum Sofa zurück.
„Der gute Goedecke hat sich ja ordentlich ins Zeug gelegt“, sagte Bolten.
„Was ist der Herr?“ fragte Elisabeth schüchtern.
Ein heimliches Lächeln glitt über die Gesichter. Keine Antwort.
„Wer ist er eigentlich?“ fragte sie noch einmal.
„Das ‚eigentlich’ ist köstlich! Haha, hahaha!“ platzte der Doktor heraus, er schien sich zu amüsieren. „Ja, mein Fräulein, da fragen Sie etwas viel. Sagen wir“, er dämpfte seine Stimme, „Hans in allen Ecken. Ein reicher Mann mit literarischen Ambitionen. ‚Ich ambitioniere’, würde er sagen. Er sitzt im Vorstand aller möglichen und unmöglichen Vereine, hat Geld bei x Zeitungen, Journalen und Theatern, darf deshalb mehr oder weniger ein Wort mit dreinreden. Im übrigen versteht er von der Literatur soviel wie der Ochs vom Lautenschlagen.“
„Ach!“ Mehr brachte Elisabeth nicht heraus. Sie sass ganz stumm und steif. Es war gut, dass es hier bald zu Ende ging; einzelne empfahlen sich schon. Sie unterdrückte ein Gähnen, eine grosse Müdigkeit kam über sie und eine leis sich regende Enttäuschung. Diese wich erst, als Frau Leonore sie beim Abschied in die Arme schloss.
„Liebes Kind, reizend! Man hat mir unausgesetzt Komplimente gemacht. Ich habe Sie Doktor Bolten warm empfohlen. Verlagsbuchhändler Maier hat auch mindestens eine halbe Stunde mit mir über Sie gesprochen. Zu schade, dass unser Eisenlohr heute nicht hier sein konnte, aber ich hoffe, ein andermal! Ich muss Sie doch mit unserem grössten Dichter bekannt machen.“
„Sie sind so gut!“ Elisabeth beugte sich über Frau Leonores kleine Hand und drückte ihre warmen Lippen darauf.
„Herzchen!“ Leonore wurde ganz enthusiastisch. „Wir müssen uns ‚du’ nennen! Wenn man so gleich denkt und gleich empfindet wie wir. Also ‚du’ — — hörst du? Und wann kommst du wieder zu mir? Morgen, übermorgen? Komm morgen! Wir haben so viel zu plaudern. Und sei fleissig, hörst du, sei fleissig, kleines Genie!“
Das war das letzte Wort. Elisabeth stand unten auf der Strasse und sah die Dunkelheit nicht; es war hell um sie, ganz hell, ihre Augen leuchteten, als spiegelte sich Sonne darin wider.
Sie hatte sich Fräulein Rosen angeschlossen. Elisabeth hätte sich nichts daraus gemacht, zu Fuss zu gehen, aber schon bei dem Gedanken war Alinde ganz entsetzt. „Wo denken Sie hin, zwei junge Mädchen so spät in der Nacht allein! Noch dazu in der Nähe des Tiergartens und in meiner Toilette!“ So nahmen sie eine Droschke.
Elisabeth war sehr gesprächig, das Glücksempfinden, das sie durchströmte, hatte ihr die Zunge gelöst. Die Droschkenfenster ratterten, der Hufschlag des müden Gauls klapperte auf dem Asphalt, die Räder polterten über Strassenbahngeleise, ihre helle Stimme übertönte alles. „Und glauben Sie wirklich, dass ich vorlesen darf? Ach, und wenn der Doktor was von mir druckte! Wie gut die Menschen sind! Was Frau Mannhardt — Leonore“, verbesserte sie sich, „doch alles für mich tut!“
„Sie sind wohl sehr befreundet?“ fragte die Rosen.
„Nein, eigentlich gar nicht; bis jetzt wenigstens nicht. Aber nun. Ich hatte einen Empfehlungsbrief an Herrn Mannhardt, unser Arzt in Meseritz ist ein Verwandter von ihm. Der interessiert sich für mich — ach, mein guter Doktor! Er schrieb Herrn Mannhardt einen langen Brief, und ich ging dann gleich den ersten Sonntag Punkt zwölf hin.“
„Dieser Arzt in Meseritz ist wohl noch ein junger Mann? Na, na!“ Alinde witterte gleich einen Roman; sie drohte schelmisch mit dem Finger.
Elisabeth sah sie gross an. „Er war ein Freund meines Grossonkels“, sagte sie ernst. „Er hat ihm auch die Augen zugedrückt. Er war sehr gut zu mir, es wurde mir schwer, mich von ihm zu trennen. Aber ich wollte nach Berlin, ich musste nach Berlin, ich muss etwas erreichen!“ Die Droschke schien zu eng für den vollen, freudigen Klang dieser Stimme: „Ich muss!“
„Ach ja,“ seufzte die Rosen, „diese Illusionen haben wir alle gehabt!“
„Sie seufzen?“ Elisabeth wurde ganz eifrig. „Sie können sich doch gewiss nicht beklagen. Wer so viel erreicht hat!“
Alinde sprach nachlässig: „So meine ich das ja gar nicht. Man stumpft eben so ab. Im Anfang, wenn einem alles neu ist, ist man schon glücklich, nur seinen Namen gedruckt zu sehen. Jetzt — du lieber Gott! Es berührt mich nicht einmal mehr, wenn ich die glänzendsten Rezensionen oder irgendeinen Essay über mich lese.“ Sie lehnte sich zurück und zog den eleganten Pelzmantel fester um die entblössten Schultern.
Elisabeth sah sie bewundernd an.
„Es erscheint jetzt wieder ein Roman von mir in Boltens Blatt, einer bei Bornemann und einer im Feuilleton der „Süddeutschen Zeitung“. Ich schreibe doch so das Jahr meine zwei bis drei Romane, abgerechnet die kleineren Sachen.“
„Um Gottes willen!“ sagte Elisabeth.
„Jeden Tag Briefe und Briefe, Anfragen von Redaktionen. Ja, es wird auch zu viel! Mein Arzt sagt: ‚Sie überreizen Ihren Geist.’ Aber was soll ich machen? Sie sollen mal meinen Schreibtisch sehen: Haufen unbeantworteter Anfragen. Meine Schreibmaschine klappert den ganzen Tag, aber ich kann doch nicht alle Versprechen einlösen.“
Elisabeth sagte nichts mehr, sie sah nur immer gross drein.
Alinde wurde zutraulich: „Und sowie etwas Neues von mir erscheint, regnet’s Blumen in meine Studierstube. Und reizende kleine Aufmerksamkeiten. Besuchen Sie mich doch, ich zeige Ihnen alles, ja?“
„Das möchte ich wohl.“ Elisabeth reichte ihr die Hand. „Ich danke Ihnen, ich komme sehr gern.“ Und dann mit einem Seufzer: „Ach, wenn ich’s nur jemals halb so weit brächte!“
„Anerkennung tut freilich wohl,“ Alinde lehnte sich noch bequemer hintenüber, „aber das Höchste ist doch die eigene Befriedigung des schaffenden Künstlers. Ich mache ziemlich viel mit, aber selbstverständlich nur zu Studienzwecken. Die feinsten Motive finden sich allein im Salon. Herrliche Stoffe, grossartige Stoffe! Diese wunderbaren Fäden von Mensch zu Mensch, von Mann zu Weib belausche ich. Ach, wenn ich alles erzählen wollte!“
„Entschuldigen Sie!“ Das Mädchen legte die Hand auf den Griff der Wagentür. „Ich steige jetzt aus, hier ist mein Haus. Halt, Kutscher!“
„Adieu, liebes Fräulein!“ Alinde war sehr freundlich. „Sie besuchen mich also?“
Elisabeth stand schon draussen, ihr Gesicht nickte noch einmal in den Wagen zurück. „Sehr gern!“ — — —
Hastig stieg Elisabeth die vier Treppen hinauf zu ihrer Gartenwohnung. Gartenwohnung? Nichts als Dächer, lauter Dächer. Tief unten ein enger Hof mit einem kleinen Rasenfleck in der Mitte. Wie im Traum war sich das Mädchen hier anfangs vorgekommen; sie, die immer gewohut gewesen war, gleich aus der Stube im Garten zu sein, sie musste nun viele, viele Stufen hinauf- und hinabsteigen. Merkwürdig, wie das ganze Berliner Leben, war auch das: immer in Hut und Handschuhen gehen, nie einen Satz über Gräben machen und im Schlendergang den Wald durchstreifen. Rasch genug hatte sie sich eingewöhnt, drei Monate war sie erst hier. Sie nahm die Treppen wie selbstverständlich.
Sie leuchtete sich jetzt mit dem Wachszündhölzchen und schloss geräuschlos die Tür ihrer Wohnung auf. Da war die Küche — und da die zwei Stuben. Auf den Zehen ging Elisabeth, um die alte Mile nicht zu stören, die hinter einem Vorhang in der kleinen Küche schnarchte.
Langsam, wie träumend, legte sie ihre Kleider ab. So spät war sie in ihrem Leben noch nicht zu Bett gegangen, nur vor dreiviertel Jahren im Mai, als der Grossonkel die Augen geschlossen hatte. Sie musste jetzt so sehr daran denken, damals war sie unglücklich gewesen, und heute? So glücklich!
Damals sangen die Nachtigallen draussen im dunklen Landgarten, durch die geöffneten Fenster des Sterbezimmers brachte der Nachtwind einen Duftstrom von den ersten Blüten des Jahres. Im Stall brüllten dumpf die Kühe, die Pferde schnauften, Nero winselte im Hausflur, und die Katze schlich miauend um die Tür — vertraute Stimmen, die ihren Herrn riefen.
Heute alles still. Das Geräusch der grossen Stadr verstummt an der Grenze von Nacht und Morgen. Es war drei Uhr. Ganz allein ...!
Elisabeth sah sich um. Da lag das schwarzseidene Kleid überm Stuhl, die weissen Spitzenrüschen um Hals und Ärmel waren zerdrückt, die weissen Rosen, die Frau Leonore ihr an die Brust geheftet, abgeknickt. Die kleine Küchenlampe, die Mile auf den Tisch gestellt hatte, brannte trüb und gab dem einsamen Zimmer eine traurige, verlassene Stimmung.
Und doch nicht allein! Eine Flut von Gestalten drängte sich mit mächtigem Schwall herein, belebte den Raum, glitt hin und her und schaffte Wechsel und Bewegung. Wie Wellen auf hoher See, brausend, Schaumkämme hebend, sich teilend, sinkend, sich wieder hebend, höher, höher wogten Gedanken in dem Mädchenkopf. Stimmen flüsterten, Namen schwirrten. Hoch oben, weit draussen am graunächtlichen Himmel, glänzte ein Stern wie das Licht im Leuchtturm. Die Gestalten wiesen hin, die Stimmen flüsterten: „Dein Stern!“
Schaudernd, fröstelnd streckte Elisabeth die nackten Arme aus: „Mein Stern. Lass mich ihn erreichen, Gott! Ich muss ihn erreichen, ich werde ihn erreichen!“
2.
Lützowstrasse acht in der zweiten Etage des Vorderhauses wohnte die Familie Kistemacher; Mann, Frau und vier Kinder. Er war Zahnarzt.
Elisabeth war mit ihnen bekannt; die hübschen, lustigen Kinder waren ihr auf der Treppe, im Flur, auf dem Hof begegnet und hatten die Bekanntschaft mit den Eltern vermittelt.
Frau Kistemacher fühlte eine gewissermassen mütterliche Verpflichtung gegen das einsame Mädchen. „Sind Sie denn so ganz allein?“ hatte sie beim ersten Besuch gefragt.
„Ganz allein“, antwortete Elisabeth mit einem Lächeln, das alles Mitleid weit von sich wies. „Ich bin daran gewöhnt. Ich bin nach dem Tode meines Vaters geboren; meine Mutter starb, als ich noch sehr jung war, ich kam dann aufs Land zum Onkel. Er hat mich so erzogen, dass ich allein sein kann. Er war sehr gut; er hätte natürlich lieber einen Jungen gehabt.“
Sie hatte das ganz ohne Bitterkeit gesagt, es war so selbstverständlich; ein Junge hätte wohl das Gut geerbt, sie musste sich mit dem kleinen Kapital begnügen, von dessen Zinsen sie bescheiden genug lebte.
„Haben Sie denn kein Heimweh nach dem Lande?“ inquirierte Frau Kistemacher weiter.
„Nein.“
Heute hatte Elisabeth Heimweh. Sie sass in ihrer Stube am geöffneten Fenster und starrte mit müden Augen über die Dächer.
Weisse Tauben hockten auf einem First und putzten sich; der matte Glanz der Nachmittagbeleuchtung liess die blauen Schieferplättchen weniger düster erscheinen, aber noch immer waren sie dunkel. Des Mädchens Blick suchte sehnsüchtig den Himmel — mussten nicht die ersten Schwalben schwirren? Drehte sich nicht der goldene Hahn des Dorfkirchturms? Ach, nur Telephondrähte spannten lange, blitzende Fäden; die Dächer waren berusst, die weissen Tauben angegraut vom Rauch der Schlote, die Luft schlaff, dick vom emporwirbelnden Staub der Grossstadt.
Sie schloss die Augen, sie hatte den ganzen Tag gearbeitet. Nun war das Manuskript fertig, dort auf dem kleinen Tisch lag es. Leonore hatte ihr eingeschärft, es ja selbst zu Doktor Bolten zu tragen; doch der Mut fehlte ihr plötzlich. Ob’s auch gut war? Was würde er sagen?
Sie hatte mit Enthusiasmus gearbeitet, wochenlang. Mit einem Glücksgefühl sondergleichen hatte sie begonnen, gleich nach jenem Gesellschaftsabend bei Mannhardts. Die Feder hastete übers Papier, die Hoffnung trug ihre Gedanken auf mächtigen Flügeln. Es war etwas in ihr, das sie trieb, spornte, hetzte; sie galoppierte voran wie ein mutiges Ross ohne Zaum und Zügel. Es war ihre erste grössere Arbeit.
„Es hängt ungemein viel vom ersten Auftreten ab,“ hatte Frau Leonore gesagt, „nimm dich zusammen, Herzchen!“
Einem Nachtwandler, der ruhig im Vollmondschein über Dächer und Firste wandelt, war Elisabeth in diesen Wochen ähnlich gewesen. Nun war sie angerufen — sie erschrak, taumelte, ihr schwindelte. „Nimm dich zusammen!“ Wie macht man das, wenn da etwas herausdrängt, herausstürzt aus tiefster Seele, uneinschränkbar wie schäumendes Wildwasser aus der Felsenkluft?
Sie hob die Hände an die Schläfen, die glühten und schmerzten in der quälenden Gedankenflucht. Würde es ihm gefallen? Jetzt wusste sie’s, es würde ihm nicht gefallen. Was war sie denn, wer? Nichts.
Elisabeth senkte die Stirn tiefer und tiefer, bis sie auf dem Fensterbrett lag und ihre fiebernden Pulse an das kalte, fühllose Holz klopften. Ach, nur eine Seele haben, der sie ganz vertraute, die ihr ganz vertraute, die da sprach: Ich glaube an dich!
Die Tür ging auf, Mile steckte den Kopf herein: „Fräuleinchen, ’s is Zeit, wenn Sie zu dem Herrn gehn wollen; halb fünfe.“ Ihr dürrer Arm reckte sich wie eine Fahnenstange, Hut und Jäckchen baumelten daran.
„Ich gehe nicht.“
„I du meine Zeit, warum denn nich?“
„Es gefällt ihm doch nicht.“
„Gefällt ihm nich? Na so was! Allens, was Sie schreiben, is wunderschön; wenn ich nur eine Zeile lese, muss ich weinen. Wenn ich man bloss die Überschrift sehe. Das sollte ihm nicht gefallen?“ Sie rümpfte geringschätzig die Nase. „Dann versteht er nichts!“
„Ach, Mile,“ Elisabeth hob den Kopf und starrte geradeaus, „du verstehst es nicht!“
Wenn sie nur jemand ein paar Stellen vorlesen könnte! Da lag das Manuskript, es lockte und winkte. Elisabeth überlegte — Leonore? Nein. Eine unbewusste Scheu hielt sie zurück. Die wollte immer so viel Eigenes dazutun, hier einen geistreichen Gedanken einflicken und dort. Man wurde zum Schluss irre an dem eigenen Werk, man kannte es nicht mehr.
Nein, das war nun einmal fertig. Elisabeth fasste das Manuskript mit fester Hand. Aber wohin in der Unruhe des Herzens?
Kistemachers fielen ihr ein, das waren so verständige, nette Leute, die hatten gewiss ein Urteil.
Sie sprang eilig die Treppe hinunter.
Kistemachers Kinder waren im Tiergarten, das Ehepaar sass allein. Die Sprechstunde war beendet, Herr Kistemacher hatte gut gegessen und rauchte nun behaglich seine Zigarre. Frau Julie stopfte Strümpfe. Elisabeth wurde freundlich begrüsst.
Frau Kistemacher streckte ihr die rechte Hand hin, die linke liess den Kinderstrumpf, in dem das Stopfei steckte, nicht fahren. „Trinken Sie ein Tässchen Kaffee?“ Schon zog sie den schwarzen Wollfaden wieder aus und ein, sie sah nicht mehr auf.
„Nein, ich danke sehr, ich ...“ Elisabeth zögerte. Sie hielt das Manuskript hinter dem Rücken versteckt.
„Was haben Sie denn da, Fräulein Reinharz?“ Kistemacher beugte sich ein wenig aus seinem Schaukelstuhl vor.
„Ich? Ach!“ Das Sprechen wurde ihr sauer, die Luft war hier so — so — sie wusste nicht, woran es lag, sie kam sich plötzlich ganz überspannt vor.
„Setzen Sie sich doch, Fräulein Elisabeth!“ Das Stopfei wurde aus dem Strumpf gezogen. „Fertig!“ Aber da war schon wieder ein anderer mit einem grossen Loch. „Was die Kinder reissen!“
„Ich ...“, Elisabeth raffte sich auf, „ich wollte Sie sehr bitten ... ich möchte Ihnen gern ...“, sie zog plötzlich das Manuskript hervor, „Ihnen etwas von mir Geschriebenes vorlesen. Ich schreibe.“ Sie senkte tief errötend den Kopf.
„Was, Sie schreiben? Sie, Sie?“ Frau Kistemacher sah nun doch für einen Augenblick auf; da sie die Hände zum Zusammenschlagen nicht frei hatte, drückte sich das ganze Erstaunen in ihren weitgeöffneten Augen aus. „So was! Sie schreiben? Wie interessant! So was!“
„Bitte, Fräulein Reinharz!“ Herr Kistemacher war aufgestanden und ging mit knarrenden Stiefeln im Zimmer auf und nieder. „Das wird uns sehr interessieren. Mich ganz besonders.“ Er lächelte, halb eitel, halb verschämt. „Sie müssen wissen, in meinen Mussestunden verbreche ich zuweilen auch etwas. Es ist mir der genussreichste Zeitvertreib!“
Wer hätte bei Herrn Kistemacher das vermutet! Elisabeth fühlte sich angeheimelt, sie taute auf und erzählte lebhaft; dann las sie einige Stellen aus ihrer Novelle vor. Sie las mit glühenden Wangen, sie fühlte noch einmal alles mit.
„Und meinen Sie, dass es so geht? Dass ich’s so einreichen kann? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir offen Ihr Urteil sagten.“ Erwartungsvoll sah sie Herrn Kistemacher an.
Er hielt ihr lächelnd die Hand hin. „Also Kollegin! Das darf ich schon sagen, ohne mich zu überheben. Ich finde die Novelle sehr gut. Ich würde ja einiges noch anders gemacht haben, aber ich will Ihnen jetzt nicht mehr den Kopf warm machen. Kommen Sie ein andermal lieber vorher zu mir, wir besprechen dann das Ganze miteinander. Warum haben Sie eigentlich nicht daran gedacht, den Helden lieber ...“
„Lass mich doch auch mal was sagen, Hans“, rief Frau Julie dazwischen. „Ich finde die Geschichte entzückend, ganz entzückend! Schade, dass ich nicht mit ganz ungeteilter Aufmerksamkeit zuhören konnte! — Scheusslich, nicht mehr zu brauchen!“ Der Strumpf flog in den Korb. Dann streichelte sie Elisabeth. „Wie nett, dass Sie’s uns zuerst gezeigt haben! Kommen Sie nur zu jeder Zeit und holen Sie sich unseren Rat. Sie schreiben reizend. Die Muttergefühle der Anna sind grossartig geschildert. Wo Sie das nur her haben? Als ob Sie viere gehabt hätten wie ich. Die Szene mit dem kranken Kind ist ganz graulich, ein Glück, dass es am Schluss gesund wird, sonst wäre die ganze Geschichte verfehlt gewesen. Nein,“ sie sprang auf, „nun hole ich aber ein Schlückchen Wein, darauf müssen wir anstossen!“
„Also Sie meinen, es ist gut?“ sagte Elisabeth, froh wie ein Kind.
„Vortrefflich!“ Kistemacher drückte ihr warm die Hand. „Sie sind ein grosses Talent. Dacht’ ich’s doch gleich, als ich Sie das erstemal sah, dass in Ihnen was steckt. Es wird mir eine Freude sein, Ihnen zur Seite zu stehen. Durch meinen Beruf komme ich mit vielen Menschen in Berührung. Ich kenne ein paar Redakteure — sehr genau, wir stehen sehr freundschaftlich —, denen werde ich von Ihnen erzählen!“
„Weisst du was, Hans?“ Frau Kistemacher war Feuer und Flamme. „Du bist immer so anständig und behandelst sie zu Künstlerpreisen, nun können sie auch was nehmen!“
„Werden sie auch, beruhige dich.“ Kistemacher rieb sich die Hände. „Das nächste Manuskript bringe ich Ihnen mit Leichtigkeit unter, mein liebes Fräulein!“
Frau Julie lachte, fasste Elisabeth um die Taille und drehte sich wirbelnd mit ihr herum. „Ich freue mich, ich freue mich riesig! Eine berühmte Schriftstellerin! Und wir haben auch was dazu getan, Sie berühmt zu machen.“
„Ja, es war gut, dass Sie zu uns gekommen sind“, sagte Kistemacher. „Soll ich Sie jetzt auf die Redaktion begleiten? Es ist Ihnen gewiss angenehmer.“
„Nein, das kannst du nicht, Hans. Du weisst, die Kinder kommen gleich nach Hause, und ich muss in die Markthalle, ich kann sie nicht erwarten. Nehmen Sie’s nicht übel, Fräulein Elisabeth, ein andermal recht herzlich gern. Ich begleite Sie auch gern mal!“
So ging Elisabeth allein.
Sie war hastig gelaufen, nun zögerte sie auf der Treppe. Sie nahm Stufe um Stufe, vorsichtig wie ein Lahmer.
Da war ein langer Gang; am Ende eine Tür mit einem Schild:
Redaktionsbureau.
Bitte eintreten ohne Anklopfen.
Sollte sie, sollte sie nicht? Ihr Herz pochte.
Unten im Kellerraum sausten die Maschinen. Ein dumpfes, unheimliches Surren; eine beklommene, von Druckerschwärze durchschwängerte Luft. Arbeiter mit berussten Gesichtern eilten über die Treppe, bleiche Mädchen in grossen Schürzen, Setzer mit wichtiger Miene und abgespannten Zügen.
Es war höchste Zeit, sonst ging der Doktor fort. Ihr Finger krümmte sich, näherte sich der Tür und schnellte wieder zurück.
Eintreten ohne Anklopfen.
Ein tiefer, zitternder Atemzug — endlich drückte sie die Klinke nieder. Nun war sie drinnen. Kein Mensch drehte sich nach ihr um, sie sassen alle mit dem Rücken gegen die Tür. Die Federn kritzelten.
Sie räusperte sich. „Ist Herr Doktor Bolten zu sprechen?“ fragte sie schüchtern.
„Nein, der Doktor ist jetzt nicht zu sprechen“, sagte eine Stimme aus irgendeiner Ecke.
„Bitte, wann kann ich ihn denn sprechen?“ Sie sagte es sehr enttäuscht; nun hatte sie den Gang gewagt, und nun war er umsonst. Das Manuskript in der Hand brannte sie. Wieder ein Tag verloren auf dem Weg zum Stern! „Ich muss ihn sprechen!“
Einer der Herren wandte sich jetzt nach ihr um und musterte sie von Kopf bis zu Füssen. „Sie bringen wohl ein Manuskript? Wir bitten, die Manuskripte per Post einzusenden und Marken zur eventuellen Rücksendung gleich beizufügen. Doktor Bolten lässt sich nicht sprechen.“
Sie drehte verlegen und unschlüssig die Papierrolle in ihren heissen Händen. Staub lag auf ihren Schuhen, auf ihrem Kleid. Staub, Staub fiel nieder von der Decke dieses Raumes und sank schwer auf ihre Seele.
Der Herr lächelte flüchtig, diese grauen Mädchenaugen blickten so betrübt. „Haben Sie irgendeine Empfehlung?“ fragte er freundlicher.
„Die habe ich!“ Sie atmete auf. „Ich kenne den Herrn Doktor. Frau Leonore Mannhardt schickt mich.“
„Darf ich um Ihre Karte bitten?“ Der Herr machte eine Verbeugung.
Sie zog, ungeschickt vor Hast, ihr Visitkartentäschchen heraus.
Der Herr ging ins Nebenzimmer. Die Federn kritzelten. Sonst kein Laut.
Elisabeth wartete. Ihr Herz schlug hart — Hammerschläge —, sie glaubte, man müsse sie hören. Sie presste das Manuskript, dass es knitterte. Fünf Minuten vergingen; zehn Minuten.
Jetzt knarrte die Tür. „Herr Doktor lässt bitten.“ Eine einladende Handbewegung, und sie stand drinnen im Allerheiligsten.
Bolten sass an dem grossen, grünen Diplomatenschreibtisch, das Gesicht der Eintretenden zugekehrt. Stösse von Manuskripten türmten sich rechts und links von ihm auf, auf dem Schreibtisch, auf dem Boden; hinter ihm noch ein Regal voll. Es roch nach vergilbtem Papier und nach Tinte.
Der Doktor schwitzte, sein Gesicht war gerötet, die Haare standen ihm zu Berge.
„Verzeihen Sie, ich bin sehr beschäftigt, ich habe noch Dringendes zu erledigen.“ Er zog seine Uhr heraus und legte sie vor sich auf den Tisch. „Womit kann ich Ihnen dienen? Ich lese die letzte Korrektur zu dem grossen Roman unserer Rosen, die Fahnen müssen heute noch in die Druckerei. Donnerwetter, schon so spät?“ Er nahm die Feder zur Hand und verfolgte die einzelnen Zeilen auf dem langen Papierstreifen. „Bitte, sprechen Sie nur!“
„Frau Mannhardt sagte mir ... sie wollte ... sie hat mit Ihnen gesprochen.“
„Ja, richtig!“ Er entsann sich. „Habe schon das Vergnügen gehabt.“ Er warf die Feder hin. „Ä, sind die Kerle unaufmerksam, wieder dieselbe Geschichte gemacht! Zum Verrücktwerden!“ Er drückte anhaltend auf den Knopf der elektrischen Leitung. „Verzeihen Sie!“ Noch ein Druck auf den Knopf. „Hört denn keiner?“
Der junge Herr von nebenan stürzte herein.
„Warum hören Sie denn nicht? Schicken Sie mal den Faktor herauf; er darf nicht Weggehen, ehe ich ihn gesprochen habe. Der Esel! — So,“ er nahm wieder die Feder, „hier Absatz. „Wie oft soll ich das bemerken! Stehe ganz zu Diensten, Fräulein — Fräulein Reinhof, nicht wahr?“
„Reinharz.“
„Reinhart, richtig!“ Er fasste sich an die Stirn. „Es geht einem so viel durch den Kopf. Ja, ja, entsinne mich, weiss alles: Novelle vorgelesen, mir empfohlen, geben Sie her!“ Er nahm ihr ohne weiteres das Manuskript aus der Hand.
Ihre Finger gaben es ungern frei, ihr war auf einmal, als möchte sie es lieber behalten, als sei es ein Tropfen eigenen Blutes.
Er wog es in der Hand, dann blätterte er darin. „Ziemlich lang! Über dreitausend Druckzeilen.“ Sich halb umdrehend, warf er es auf das Regal hinter sich. „Werde Ihnen schreiben.“
„Wann — wann darf ich auf Bescheid hoffen?“ Sie fragte das so leise, dass man es kaum hörte.
„Bin ungeheuer überhäuft, wie Sie sehen!“ Er machte eine umfassende Handbewegung. „Alle diese Manuskripte harren auf Erledigung. Hier dieser Roman“, er legte die Hand auf ein Manuskript von ungeheurer Dicke, „wartet schon seit Monaten auf mich. Ich komme beim besten Willen nicht dazu.“
„Meines ist ja nicht so korpulent“, sagte sie mit einem Anflug von Lächeln.
Ganz erstaunt sah er sie an: „Sie lachen? Wissen Sie was? Schreiben Sie ’ne Humoreske, das wird Ihnen liegen!“
„Wollen Sie dies nicht erst lesen?“ Sie sah hinüber zu ihrem Manuskript.
„Was ist es denn? Heiter?“
„Nein.“
„Ernst, tragisch wohl gar? Ach, um Gottes willen!“ Er fuhr sich in die Haare.
„Es ist nicht tragisch, nur ernst. Sehr ernst.“
„So — hm. Und wo spielt es? Sie sehen, wieviel ich zu tun habe. Geben Sie mir mal lieber gleich in kurzen Umrissen den Gang der Handlung.“
„Im Dorf“, sagte sie knapp. „Die Magd Anna wird vom Sohn des Bauern, bei dem sie dient, verführt und verlassen. Sie verbirgt sich mit ihrem Kinde im Walde, sie friert, sie hungert ...“
„Hören Sie auf, hören Sie auf!“ Bolten trommelte ungeduldig auf den Tisch. „Ne! Ne-ne-ne-ne, das ist nichts für uns! Gott bewahre! Ein uneheliches Kind! Wie kann ich das meinen Leserinnen zumuten. Bauerngeschichten sind ohnehin schon abgedroschen, gar nicht mehr Mode. Und dann so romantisch, im Walde versteckt! Heutzutage versteckt sich keine mehr im Walde. Hahaha!“ Er lachte, dass man alle seine Nussknackerzähne sah. „Liebes Fräulein, wissen Sie was?“ Er langte hinter sich. „Da, nehmen Sie gleich Ihr Manuskript wieder mit, was soll ich mir erst die Mühe machen.“
Er hielt inne, ihr zitternder Atem streifte ihn, ihre grossen, sprechenden Augen sahen ihn tränenverschleiert an.
„Mag ja ganz literarisch sein“, meinte er gutmütig. „Sie haben Talent, hat man mir gesagt. Aber schreiben Sie mal was aus dem wirklichen Leben, was allgemein interessiert. Am liebsten was Nettes, Fesches, ’ne Humoreske zum Beispiel; Tragisches will kein Mensch lesen. Und dann nicht diese Bauernatmosphäre. Verrohen Sie Ihr Talent nicht, mein Fräulein, die Kunst muss vornehm sein. Wenn ich Ihnen raten soll, lesen Sie viel von der Rosen und von der Widmann — grossartig, einfach grossartig! Bei der Lindenhayn tritt das Erotische in letzter Zeit etwas zu unverhüllt zutage. Wissen Sie, Fräulein, der Schriftsteller kann alles sagen, alles geschehen lassen ...“, Bolten redete sich ordentlich in Eifer, „muss er sogar, der Leser will sich doch nicht langweilen. Aber verblümt. Nicht gleich mit unehelichen Kindern um sich schmeissen. Solche Geschichten — ah, bah!“
„Aber sie sind wahr.“ Des Mädchens Augen schwammen nicht mehr in Tränen, gross und ernst sahen sie den Redakteur an.
„Wahr, wahr! Was heisst wahr?!“ Er zuckte die Achseln. „Die Kunst soll in erster Linie schön sein. Hier,“ er hielt die Korrekturfahne des Rosenschen Romans in die Höhe, „hier können Sie was draus lernen. Und lesen Sie die Widmann, die fasst auch nicht gerade mit Glacéhandschuhen an. Aber der Zweck heiligt die Mittel; sie beschäftigt sich eben mit der brennendsten Frage der Gegenwart: der Frauenfrage. Lernen, liebes Fräulein, lernen.“ Er reichte ihr die Hand, sie tat ihm leid, sie stand wie niedergeschmettert. „Bringen Sie mir die Humoreske. Bedenken Sie,“ er streckte pathetisch den Arm in die Höhe, „ernst ist das Leben, heiter die Kunst!“ Und dann in geschäftlichem Ton: „Nicht zu lang, ungefähr dreihundert bis dreihundertfünfzig Druckzeilen, anmutig, im Salon spielend, verstanden?“
„Ich kann das nicht“, sagte sie. Sie hob stolz den Kopf. „Ich werde das nie können!“
Sie ging. Wie sie die Treppe hinuntergekommen, wusste sie selbst nicht; es fasste sie wie ein Schwindel. Das war die Kunst? Das war der Weg? Sie presste ihr Manuskript an sich wie ein geliebtes Kind.
Langsam ging sie durch die Strassen, die Menschen hasteten, sie wurde gestossen, sie merkte es nicht. Strassenbahnen klingelten, Droschken rollten; Getrappel, Peitschenknallen, Zurufe, bunte Läden, Menschen, Frauen, Kinder. Eine Fülle von Dingen, eine ununterbrochene Reihe von Gestalten, von Existenzen aller Art.
Der Strom des Lebens flutete mächtig in der grossen Stadt, und sie mitten darin. Einsam. Sie fühlte sich einsam; zum erstenmal.
Da floss der Kanal; Bäume standen am Ufer, Bäume, die emporstrebten, die Äste sehnsüchtig nach Licht und Luft reckten. Elisabeth blieb stehen. Langsam sank die Dämmerung nieder. Das Wasser floss schwarz, von keinem Wellchen bewegt. Kein Windhauch. Abend.
Ihr Blick suchte den Himmel, der spannte sich hoch droben überm Kanal mit bleichgrauen Wolken — da, mitten dazwischen ein Stern, unbeweglich, klar und golden.
Des Mädchens Lippen schlossen sich fest aufeinander, sie liessen den Seufzer nicht durch. Wie hatte der alte Prediger in der Dorfkirche gesagt? „Die Pforte ist eng, der Weg ist schmal, wenige sind ihrer, die ihn finden.“
„Ich werde ihn finden!“
Finden ...? Eine Frage, ein Echo verschwebten.
Elisabeth schrak zusammen; hatte sie laut gesprochen? Mit ernstem Blick kam sie nach Hause.
„Nu, Fräuleinchen, was hat er gesagt?“ Mile starb fast vor Neugier. „Der hat sich wohl nich schlecht gefreut?“ Mile durfte sich schon die Frage erlauben, sie war ein altes Faktotum, das jahrelang in des Onkels Haushalt gewirtschaftet und Elisabeth die ersten Stricknadeln zwischen die Kinderfinger geklemmt hatte.
„Es hat ihm nicht gefallen.“ Elisabeth setzte sich in die Sofaecke und lehnte den Kopf ans Polster.