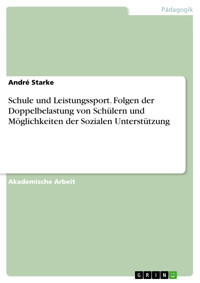39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Didaktik - Sport, Sportpädagogik, Note: 1,0, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Department Sportwissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Der Leistungssport ist entweder pädagogisch, oder er ist gar nichts! So hieß das olympische Credo von Coubertin, das er sich zu Lebzeiten gewünscht hatte (vgl. Grupe, 1998, S. 34). In der heutigen Zeit ist der Ausspruch relevant wie selten zuvor. Die Karriere kann aber auch am Höhepunkt des leistungssportlichen Könnens schnell vorbei sein. Um aber dennoch sein sportliches Talent nutzen zu können, muss ein Weg gefunden werden, den Leistungssport und die Schule zu vereinbaren. Dies geschieht mit Hilfe der Verbundsysteme Leistungssport – Schule. Sie sollen es ermöglichen, die Belastung des Schülers zu verringern. Nach umfangreicher Literaturanalyse zu dem Thema Verbundsysteme Schule – Leistungssport wird in der vorliegenden Arbeit die Eliteschule des Sports als die vorläufig am besten geeignete Form der Verbindung von Leistungssport und Schule gesehen. Im weiteren Verlauf der Arbeit sollen die Unterstützungsleistungen für Schüler, welche ein Verbundsystem besuchen, erläutert und untersucht werden. Die in der vorliegenden Studie zu beantwortende Fragestellung lautet: Bewältigen die Schüler im Verbundsystem der Sportschulen Halle die Doppelbelastung von Schule und Leistungssport auf Grund von Unterstützungsleistungen der Personen verschiedener Instanzen? Dabei soll die Sicht und das subjektive Empfinden der Schüler die Grundlage der Ergebnisse bilden. Diese Arbeit soll jedoch ein möglichst komplexes Abbild der Situation der sozialen Unterstützung an den Sportschulen Halle bieten. Daher greift die durchgeführte Studie auf quantitative und qualitative Methoden zurück. Um einen Hintergrund der Situation der Schüler in einer Eliteschule des Sports zu geben, wird die Eliteschule des Sports thematisiert. Dabei soll kurz die historische Entwicklung, der aktuelle Status und das Konzept erläutert werden. Im weiteren Verlauf wird die Doppelbelastung der Schüler theoretisch fundiert. Die Grundlage bilden Begriffe und Erkenntnisse der Doppelbelastung, welche in der Literatur zu finden sind. Die Bewältigung dieser Belastung durch Unterstützungsleistungen wird in den Blick genommen. Letztlich soll das Ergebnis aufgezeigt werden, dass aus der Doppelbelastung und den empfangenen Unterstützungsleistungen resultiert.Nach der Betrachtung des Forschungsstandes wird die durchgeführte Studie an der Sportschule Halle den Mittelpunkt der Ausführungen darstellen. [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Vorwort
Die wissenschaftliche Hausarbeit beschäftigt sich mit den Eliteschulen des Sports und der Bewältigung der Doppelbelastung von Schule und Leistungssport der Schüler und Schülerinnen. Durch den Titel „Eliteschule des Sports“, den die Sportschule Halle trägt, bin ich auf das Thema aufmerksam geworden. Die Einschätzungen der Schüler und Schülerinnen zum Empfinden der Doppelbelastung und den Umgang damit, sollten Gegenstände meiner Arbeit werden. Um ein Ergebnis zu erzielen, wurde eine Studie an den besagten Sportschulen Halle durchgeführt.
Mein Dank gebührt dem Schulleiter Herr Vorbau, der es ermöglicht hat, die Untersuchung an der Schule durchzuführen. Des Weiteren danke ich den betroffenen Lehrern, welche bereitwillig einen Teil ihrer wertvollen Unterrichtszeit geopfert haben, um mich und mein Vorhaben den Schülern vorzustellen. Der größte Dank gebührt den Schülern, der Klassen Sechs, Neun und Zwölf, welche den Fragebogen der Studie freiwillig und gewissenhaft beantwortet und somit persönliche Belange preisgegeben haben. Auch möchte ich denjenigen Personen danken, die sich zu einem Interview bereit erklärten und dies trotz hoher schulischer und sportlicher Belastung ermöglichten. Ohne Sie wäre diese Arbeit nicht in dieser Form möglich gewesen.
Die Betreuung meiner wissenschaftlichen Hausarbeit übernahmen im Bereich der Sportwissenschaft Frau Dr. Beckmann und Herr Dr. Glettner. Ihnen gehört ebenso mein Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung. Insbesondere Frau Dr. Beckmann konnte mir mit vielen wichtigen Antworten auf meine Fragen weiterhelfen und war immer für mich zu erreichen. Diese Unterstützung bildete die Grundlage dieser Hausarbeit.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Eliteschulen des Sports
2.1 Die geschichtliche Entwicklung der Verbundsysteme
2.2 Das Konzept der Eliteschulen des Sports
2.2.1 Der Hintergrund der Eliteschulen des Sports
2.2.2 Das Internat als Teilaspekt eines Verbundsystems
2.3 Das spezifische Konzept der Sportschulen Halle
2.4 Kapitelzusammenfassung
3 Forschungsstand der Doppelbelastung von Schule und Leistungssport
3.1 Die Doppelbelastung der Schüler von Schule und Leistungssport
3.1.1 Die Doppelbelastung von Schule und Leistungssport
3.1.2 Aspekte der Institution Schule
3.1.3 Gesichtspunkte sportlicher Anstrengungen
3.2 Die Bewältigung der Doppelbelastung durch Unterstützungsleistungen
3.2.1 Begriffsklärung
3.2.2 Soziale Unterstützung durch die Schule
3.2.3 Soziale Unterstützung durch das Internat
3.2.4 Soziale Unterstützung durch den Sport
3.2.5 Soziale Unterstützung durch die Eltern
3.2.6 Soziale Unterstützung durch die Freunde
3.3 Auswirkungen der Doppelbelastung und Unterstützung
3.4 Kapitelzusammenfassung
4 Die Studie
4.1 Konzeptueller Rahmen
4.1.1 Zielsetzungen und Inhalt der Studie
4.1.2 Methodologie und Erhebungsverfahren
4.2 Rekrutierung der Stichprobe
4.3 Die Unterbringung der Leistungssportler
4.4 Erkenntnisse zur Belastung der Schüler
4.4.1 Schulische Anforderungen
4.4.2 Sportliche Anstrengungen
4.4.3 Aspekte der Doppelbelastung
4.5 Aussagen zur Freizeit der Schüler
4.6 Einschätzung der Bewältigung der Doppelbelastung
4.6.1 Unterstützung durch die Schule
4.6.2 Unterstützung durch das Internat
4.6.3 Unterstützung durch den Verein
4.6.4 Unterstützung durch die Eltern
4.6.5 Unterstützung durch die Freunde
4.7 Kapitelzusammenfassung
5 Schlussbetrachtung
6 Literatur
Eidesstattliche Erklärung
Anhang
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Tabellen
Tab. 1. Mittlere zeitliche Gesamtbelastung durch Schule, Hausaufgaben und Training am Sportgymnasium Leipzig (Rost, 2002, S. 119)
Tab. 2. Untergliederung nach Klassenstufen
Tab. 3. Unterbringung der Schüler
Tab. 4. Befindlichkeit der Schüler
Tab. 5. Überwiegend schulische Leistungen
Tab. 6. Sportliche Betätigung der Schüler
Tab. 7. „Wie schätzt du deine sportliche Leistung in deiner Altersgruppe ein“
Tab. 8. Schulische Leistungen in Abhängigkeit der sportlichen Leistungen
Abbildungen
Abb. 1.Grundmodelle der Verbundsysteme von Leistungssport und Schule (Deutscher Sportbund/Bereich Leistungssport, 1998, S. 11)
Abb. 2. Anzahl der Sportschüler an den Eliteschulen des Sports 2003 (Stork, 2008, S. 10)
Abb. 3. Anzahl der Internatsplätze 2003 (Stork, 2008, S. 27)
Abb. 4. Merkmale der Anforderungsstruktur junger Sportler (modifiziert nach Rost, 2002, S. 117)
Abb. 5.Einstellung zum Internatsleben (Leirich, Gwizdek & Schleupner, 1998, S. 33)
Abb. 6. Kreislauf von Hoffnungen, Zuwendung und Erwartungen (Richartz, 1998, S. 427)
Abb. 7. Gründe für nicht bei den Eltern lebende Schüler
Abb. 8. „In der Schule werden oft zu große Anforderungen an mich gestellt“
Abb. 9. „Am meisten belasten mich in der Schule die...“
Abb. 10. „Trainingsumfang der Schüler“
Abb. 11. „Durch den Leistungssport fühle ich mich oft zu sehr beansprucht“
Abb. 12. "In der Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein läuft vieles schief"
Abb. 13. "Es gibt oft Probleme, Schule und Leistungssport unter einen Hut zu bekommen"
Abb. 14. „Meine schulischen Leistungen leiden unter meinem Leistungssport“
Abb. 15. „Ich habe viel freie Zeit"
Abb. 16. „Ich wünsche mir mehr Zeit für Freizeitaktivitäten“
Abb. 17. „Meine Lehrer zeigen eine hohe Fürsorge“
Abb. 18. „Mein Klassenlehrer nimmt wenig Rücksicht auf meinen Leistungssport“
Abb. 19. „Die Kameradschaftlichkeit in den Klassenverbänden ist gering“
Abb. 20. „Die Betreuung im Internat ist hilfreich bei der Bewältigung der Doppelbelastung“
Abb. 21. „Das Internat erspart mir kaum Zeit bei meinem Tagesablauf“
Abb. 22. „Die Leistungserwartung meines Trainers setzt mich sehr unter Druck“
Abb. 23. „Wenn besondere Anforderungen in der Schule auftauchen, nimmt mein Trainer darauf kaum Rücksicht“
Abb. 24. „Mit dem Zusammenhalt in meiner Trainingsgruppe bin ich zufrieden“
Abb. 25. „Meine Eltern sind ein wichtiger Rückhalt in meinem Leben“
Abb. 26. „Ohne die Unterstützung meiner Eltern würde ich der Doppelbelastung von Schule und Leistungssport nicht standhalten“
Abb. 27. „Meine freie Zeit verbringe ich meist mit den Freunden“
Abb. 28. „Meine Freunde sind ein wichtiger Rückhalt in meinem Leben“
1 Einleitung
Der Leistungssport ist entweder pädagogisch, oder er ist gar nichts![1]So hieß das olympische Credo von Coubertin, dass er sich zu Lebzeiten gewünscht hatte (vgl. Grupe, 1998, S. 34). Der olympische Jahrhundertkongress in Paris 1994 bekannte sich erneut zu dieser Aussage. In der heutigen Zeit ist der Ausspruch relevant wie selten zuvor. Der Leistungssport boomt und ist zu einem riesigen Geschäft geworden. Die Sportler und Sportlerinnen[2]beginnen eher mit dem leistungssportlichen Training und trainieren öfter als zuvor, um in der internationalen Spitze mithalten zu können. Die Karriere kann aber auch am Höhepunkt des leistungssportlichen Könnens schnell vorbei sein. Eine schwerwiegende Verletzung führt dazu, seinen Sport nicht mehr ausüben zu können. Auch das Burnout- bzw. Erschöpfungssyndrom führte bei Leistungssportlern, wie Hannawald oder Deisler, zu einem plötzlichen Ende der sportlichen Laufbahn. An diese Stelle tritt der Werdegang mit Hilfe der schulischen Bildung. Sie kann nicht außen vor gelassen werden. Kein Mensch kann und will sich heutzutage auf den Leistungssport reduzieren.
Um aber dennoch sein sportliches Talent nutzen zu können, muss ein Weg gefunden werden, den Leistungssport und die Schule zu vereinbaren. Dies geschah mit Hilfe der Verbundsysteme Leistungssport – Schule, die sich seit dem Jahr 1950 in Deutschland entwickelt haben. Ein solches Verbundsystem ist durch die Doppelbelastung auf Grund der Instanzen Schule und Leistungssport geprägt. Sie sollen es ermöglichen, die Belastung des Schülers zu verringern. Nach umfangreicher Literaturanalyse zu dem Thema Verbundsysteme Schule – Leistungssport wird in der vorliegenden Arbeit die Eliteschule des Sports als die vorläufig am besten geeignete Form der Verbindung von Leistungssport und Schule gesehen. Sie wird vom Initiativkreis „Sport und Wirtschaft“ ausgezeichnet auf Grund eines besonders vorteilhaften Umgangs mit der Doppelbelastung der Schüler durch Leistungssport und Schule. Daher werden die Ergebnisse der Studien zu dem Thema Verbundsystem Leistungssport und Schule auf die Eliteschulen des Sports bezogen.
Im weiteren Verlauf der Arbeit soll es aber nicht darum gehen, ob Verbundsysteme hilfreich oder schädigend für die Persönlichkeitsentwicklung für die Schüler sind und wie diese verbessert werden müssen. Dazu wurden schon zahlreiche Studien durchgeführt (vgl. Kap.0). Vielmehr sollen die Unterstützungsleistungen für Schüler, welche ein Verbundsystem besuchen, erläutert und untersucht werden. Das Selbstbild der schulischen und sportbezogenen Kompetenzen, sowie Bewältigungs- und Verarbeitungsprozesse sollen, obwohl sie durchaus hohe Bedeutung besitzen, nur am Rande dieser Arbeit Erwähnung finden. Erläuterungen zu diesem Aspekt sind bereits in anderen Untersuchungen erhoben wurden (vgl. Richartz & Brettschneider, 1996; Richartz, 2000).
Die in der vorliegenden Studie zu beantwortende Fragestellung lautet: Bewältigen die Schüler im Verbundsystem der Sportschulen Halle die Doppelbelastung von Schule und Leistungssport auf Grund von Unterstützungsleistungen der Personen verschiedener Instanzen? Dabei soll die Sicht und das subjektive Empfinden der Schüler die Grundlage der Ergebnisse bilden. Wie genau die Handlungen der Unterstützung ablaufen und wie die Instanzen dabei empfinden, können kein Bestandteil dieser Arbeit sein. Lediglich die Schülersicht wird in den Fokus gerückt.
Bisherige Untersuchungen waren meist entweder quantitativ oder qualitativ. Diese Arbeit soll jedoch ein möglichst komplexes Abbild der Situation der sozialen Unterstützung an den Sportschulen Halle bieten. Daher greift die durchgeführte Studie auf quantitative und qualitative Methoden zurück.
Um einen Hintergrund der Situation der Schüler in einer Eliteschule des Sports zu geben, wird die Eliteschule des Sports thematisiert. Dabei soll kurz die historische Entwicklung, der aktuelle Status und das Konzept erläutert werden. Im Hinblick auf die Studie werden die Sportschulen Halle dargestellt, an der die Schüler zur Doppelbelastung befragt wurden.
Im weiteren Verlauf wird die Doppelbelastung der Schüler theoretisch fundiert. Die Grundlage bilden Begriffe und Erkenntnisse der Doppelbelastung, welche in der Literatur zu finden sind. Die Bewältigung dieser Belastung durch Unterstützungsleistungen wird in den Blick genommen. Dabei werden die Instanzen näher betrachtet, die auch in der Studie untersucht werden. Letztlich soll das Ergebnis aufgezeigt werden, dass aus der Doppelbelastung und den empfangenen Unterstützungsleistungen resultiert.
Nach der Betrachtung des Forschungsstandes wird die durchgeführte Studie an der Sportschule Halle den Mittelpunkt der Ausführungen darstellen. Der Rahmen der Untersuchung, inklusive Zielsetzungen und Methodologie, und die Rekrutierung der Stichprobe werden vorgestellt. Eine Einordnung zur Unterbringung der Schüler soll dem Leser vergegenwärtigen, welche Auswirkungen ein Leben im Internat für den Spitzensportler[3]hat. Ein Überblick zu der empfundenen Doppelbelastung und der Freizeitgestaltung der Jugendlichen zeigt die Gründe für eine Bewältigung mit Hilfe von Unterstützungsleistungen auf. Diese unterstützenden Personen und ihre Wirkung auf die Schüler werden daraufhin erläutert. Dabei werden sowohl helfende als auch zusätzlich belastende Aspekte einbezogen. Die untersuchten Instanzen sind die Einrichtungen des Verbundsystems, bestehend aus Schule, Internat und Verein, die Eltern und die Freunde der Schüler. Die Anordnung zeigt keine Reihung hinsichtlich der Wichtigkeit der Personen auf.
In der Schlussbetrachtung werden die hauptsächlichen Ergebnisse der Studie aufgegriffen und Schlussfolgerungen gezogen. Es werden Probleme erläutert, die sich während der Untersuchung ergaben und wie diese sich auf den Inhalt der Arbeit auswirkten. Des Weiteren wird ein Ausblick gestellt, der auf mögliche weitere Untersuchungen zu diesem Themenkomplex hinweist.
2 Die Eliteschulen des Sports
2.1 Die geschichtliche Entwicklung der Verbundsysteme
Verbundsysteme sind Einrichtungen, welche die Funktionsbereiche Schule, Internat und Leistungssport in enger Kooperation und Verzahnung vereinen und „das gesamte Ausbildungs-, Unterstützungs- und Betreuungspotential unter eine gemeinsame Zielsetzung stellen“, formulierte die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Kommission „Sport“ (2000, S. 6). Im Folgenden wird die Entwicklung der Verbundsysteme auf der Grundlage der Ausführungen von Elflein (2004, S. 181-198) beschrieben.
In Westdeutschland wurde im Jahr 1955 formell die Zusammenarbeit zwischen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) und dem Deutschen Sportbund (DSB) festgelegt. In der Praxis zeigte sich allerdings nur wenig Kooperation. Ein neues pädagogisches Konzept des Schulsports brachte Ende der sechziger Jahre eine veränderte Einstellung gegenüber dem Leistungssport. Darauf folgte eine Resolution zur Förderung des Leistungssports des DSB 1967, welche von der KMK unterstützt wurde. Die Bildung von Neigungsgruppen, Schulsportvereinen und Sportgymnasien, sowie Tests zur Findung der Talente waren das Ergebnis. 1971 wurden flächendeckende Maßnahmen zur Talentfindung eingeführt und ein Jahr darauf das „Aktionsprogramm für den Schulsport“ gemeinsam erlassen. Nach weiteren praktischen Schwierigkeiten verabschiedete der DSB 1983 eine Grundsatzerklärung zum pädagogischen Auftrag. Im Jahre 1986 wurden die „Grundsätze für die Kooperation zur Förderung des Leistungssports“ veröffentlicht, die eine bis heute gültige Grundposition der Schule im Verhältnis zum Leistungssport aufzeigt. Die Kooperation geschieht mit der Bedingung der „Verantwortung vor dem Schüler als Athlet und [einer] klare[n] Zentrierung auf dessen Wohl sowie Entwicklung seiner Gesamtpersönlichkeit vor dem Hintergrund der schulischen und beruflichen Ausbildung“ (Waschler, 1996, S. 40). Ende der achtziger Jahre bestanden in der Bundesrepublik zehn Schulen mit angeschlossenen Internaten und 18 selbstständige, schulexterne Sportinternate. Unter schulischen Sonderbedingungen wurden etwa 1000 jugendliche Athleten aus 20 Sportarten gefördert (vgl. Brettschneider, Drenkow, Heim & Hummel, 1993, S. 378f).
Bei der leistungssportlichen Entwicklung in Ostdeutschland standen seit 1950 die Kinder- und Jugendsportschulen (KJS) im Zentrum. Am Vorbild der Sowjetunion ausgerichtet, sollten „besondere Schulen zur Förderung des sportlichen Nachwuchses eingerichtet werden, in denen die Körpererziehung einen breiten Raum einnehmen würde“ (Helfritsch, 1997, S. 113). Die rasante Entwicklung wurde schnell deutlich. Waren es im Jahre 1952 noch vier KJS, wurde Ende der fünfziger Jahre mit 23 Einrichtungen schon fast die Höchstzahl erreicht. Sie wurden zu Zentren des Nachwuchsleistungssportes und der allgemeine Schulsport bzw. Sportunterricht entfiel (vgl. Helfritsch, 1997, S. 117). Nach den Olympischen Spielen 1968 wurde der Beschluss gefasst, Sportarten „auszugliedern und sich aus ökonomischen Gründen auf medaillenintensive Sportarten zu konzentrieren“ (Helfritsch, 1997, S. 120). Die Kinder- und Jugendsportschulen basierten auf einer dominierenden sportpolitischen Ausrichtung. Helfritsch und Becker (1993, S. 72) stellten fest: „[Die]Schule zog meist den kürzeren auf Grund der staatlichen Hinwendung zum Hochleistungssport“. Die KJS-Schüler wiesen eine gewisse Lebensfremdheit durch die relative Isoliertheit der Einrichtungen auf. Die Internatsunterbringung war Teil des Systems der Kinder- und Jugendsportschulen.
Mit der Wiedervereinigung Deutschlands wurden die Förderstrukturen der DDR aufgelöst. Die Umwandlung der KJS wurde ab dem Jahr 1993 durch die Förderung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie als Modellversuch „Schulen mit sportlichen Schwerpunkt“ ermöglicht. Drei Jahre später zog der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Walther Tröger, Bilanz:
„Sportbetonte Schulen und Sportinternate mit Partnerschulen sind ein zentraler Baustein im nationalen System der Nachwuchsförderung. Hier werden den jugendlichen Talenten Rahmenbedingungen geboten, damit sie das notwendige umfangreiche Training, die schulische Ausbildung und die individuelle Persönlichkeitsentwicklung reibungslos verbinden können“ (zit. nach Knecht, 1999).
Weitere Ausführungen zur KJS-Forschung und der Wandlung zu Sportbetonten Schulen geben unter anderem Helfritsch und Becker (1993) oder Knecht (1999). In den alten Bundesländern entwickelten sich weiterhin verschiedene Formen von Schulen zur Förderung des Leistungssports.
Abb.1. Grundmodelle der Verbundsysteme von Leistungssport und Schule (Deutscher Sportbund/Bereich Leistungssport, 1998, S. 11)
Mittlerweile haben sich in Deutschland zwei besonders erfolgversprechende Modelle von Verbundsystemen Leistungssport – Schule herauskristallisiert (vgl.Abb. 1). Dem Kooperationsprojekt „Sportbetonte Schule“ werden alle Verbundsysteme mit Sportklassen/Sportzügen und eingebundenem Internat zugeordnet. Diese gingen, bis auf zwei Ausnahmen (CJD Berchtesgaden und Heinrich-Heine Gymnasium Kaiserslautern) aus den ehemaligen Kader- und Jugendsportschulen der DDR hervor. Der Name „Sportbetonte Schule“ wurde 1993 bei einem Treffen der Leiter der KJS Nachfolgeeinrichtungen bestimmt (vgl. Seidelmeier, I., 2005, S. 39ff). „Alle anderen Verbundsysteme, in denen an den partnerschaftlich mit dem Leistungssport zusammenarbeitenden Schulen keine Sportklassen/Sportzüge bestehen, sind als Kooperationsprojekt „Partnerschule des Leistungssports[4]“ definiert“ (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland Kommission „Sport“, 2000, S. 6). Der Deutsche Sportbund bezeichnet diese Einrichtungen als „Sportinternate mit angebundenen Partnerschulen“ (vgl. Deutscher Sportbund/Bereich Leistungssport, 1998). Die Partnerschule des Leistungssports stützt sich auf ein Zweisäulengebilde. Der Sportverein bzw. Sportverband stellt den organisatorischen Kern dar und sichert das sportliche Training. Die kooperierenden Schulen in der Nähe stellen die schulische Ausbildung (vgl. Guhs, 1998, S. 120). Der Unterricht erfolgt in heterogenen Klassen mit leistungs- und breitensportlich orientierten Schülern. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass dies für die leistungssporttreibenden Athleten kein Problem darstellt (vgl. Brettschneider, 1998, S. 107; Stibbe, 2005, S. 306).
Altmeyer (1997, S. 96) fasst die Entwicklung in den Jahren nach der Wiedervereinigung zusammen:
„Während in den neuen Bundesländern im Rahmen eines Modellversuchs „Schule mit sportlichem Schwerpunkt“ an 21 Standorten einige tausend Schüler mit Millionenaufwand in den Genuss einer dem Alter entsprechenden, pädagogisch vertretbaren Koordination von allgemeiner schulischer Bildung und leistungssportlichen Training kamen (vgl. Senatsverwaltung des Landes Berlin, 1996), sind in den alten Bundesländern in den letzten Jahren neben den bereits bestehenden Sportgymnasien und Schulen mit Sportzweig, wie z. B. dem Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern (vgl. Becker, 1990), sogenannte Partnerschulen des Sports im Einzugsbereich der Olympiastützpunkte eingerichtet worden.“
Die Verbundsysteme „Sportbetonte Schule“ und „Partnerschule des Leistungssports“ können als Vorstufe zur „Eliteschule des Sports“ gesehen werden (vgl. Radtke & Coalter, 2007, S. 37f). Um dieses Prädikat zu erhalten, müssen Qualitätskriterien erfüllt werden (siehe dazu Kapitel0).
Aktuell werden „an 40 Eliteschulen des Sports mit zirka 102 Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien […] derzeit mehr als 11.300 Talente gefördert“ (Deutscher Olympischer Sportbund, 2011; vgl.Abb. 2; Stork, 2008). Bei der 3. Konferenz der Eliteschulen des Sports 2003 in Essen beschreibt Stork jedoch „hochsignifikante Unterschiede im Angebot an EDS-Plätzen zwischen alten und neuen Bundesländern“. Die Eliteschulen des Sports sind nicht flächendeckend organisiert. Vor allem im Norden und Nordwesten Deutschlands fehlen Einrichtungen dieser Art.
Abb. 2. Anzahl der Sportschüler an den Eliteschulen des Sports 2003 (Stork, 2008, S. 10)
Auch die internationale Entwicklung zeigt, „dass erfolgreiche Sportnationen entweder „integrative Modelle“ oder „kooperative Modelle“ eines nationentypischen Verbundes zwischen Nachwuchstraining und Schule praktizieren“ (Rost, 2002, S. 120). Im Jahr 2001 wiesen sieben Leistungssysteme „Spezialschulen im öffentlichen Schulwesen für den Leistungssport auf“ (Digel, 2001, S. 253). Eine ausführliche Betrachtung über die internationalen „sports schools“ und einen länderübergreifenden Vergleich geben Radtke und Coalter (2007).
Die Entwicklung und Optimierung der Verbundsysteme führte zu Eliteschulen des Sports, welche als Partnerschulen des Leistungssports oder als Sportbetonte Schulen existieren. Im Folgenden soll das Konzept dieser Schulen erläutert werden. Was macht eine solche Schule aus und wofür steht sie? Zudem soll die Einrichtung des Sportinternats, die zumindest den Verantwortungsbereich „Wohnen“ abdeckt, näher betrachtet werden.
2.2 Das Konzept der Eliteschulen des Sports
2.2.1 Der Hintergrund der Eliteschulen des Sports
Der Titel „Eliteschule des Sports“ ist ein bundesweites Qualitätskriterium, welches seit 1998 durch den Initiativkreis „Sport und Wirtschaft“ an Verbundsysteme mit besonders leistungssportfördernden Strukturen im Vierjahresrhythmus vergeben wird (vgl. Teubert, Borggrefe, Cachay, & Thiel, 2006, S. 12). Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) (2008, S. 5) definiert Eliteschulen des Sports wie folgt:
"Eine Eliteschule des Sports ist eine Fördereinrichtung, die im kooperativen Verbund von Leistungssport, Schule und Wohnen Bedingungen gewährleistet, damit talentierte Nachwuchsathleten sich auf künftige Spitzenleistungen im Sport bei Wahrung ihrer schulischen Bildungschancen vorbereiten können".
Die Eliteschule des Sports bietet dabei viele Gelegenheiten „Herausforderungen zu meistern und Leistungssituationen aktiv und selbstständig zu bewältigen“ (Elbe & Beckmann, 2005, S. 148). Sie konzentriert sich mit der sportlichen Förderung, der schulischen Ausbildung und den sozialen und pädagogischen Unterstützungsmaßnahmen auf drei zentrale Aspekte (vgl. Teubert et al., 2006, S. 12). Das Nachwuchsleistungssport-Konzept 2012 des Deutschen Sportbundes/Bereich Leistungssport (2006, S. 26) gibt die Bedeutung der Eliteschulen des Sports „als Fördereinrichtungen für Talente, die nach mehrjährigem Training zur Förderung ausgewählt werden, nicht für die anfängliche Talentsuche oder -sichtung“ an.
Die Verbundsysteme sind zumeist keine eigenständigen Organisationseinheiten, sondern Kooperationsformen mit unterschiedlichen Zielen. Laut Teubert et al. (2006, S. 23) sind Schulen „pädagogische Einrichtungen, deren Aufgabe in der gesellschaftsadäquaten Qualifizierung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen liegt“. Sport dagegen ist „in Gestalt von Vereinen und Verbänden viel spezifischer an der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen interessiert, nämlich nahezu ausschließlich mit Blick auf deren zukünftigen sportlichen Erfolg“ (vgl. Teubert et al., 2006, S. 23). Diese unterschiedlichen Zielstellungen führen oft zu Interessenkonflikten und Schwierigkeiten zwischen den einzelnen Instanzen (vgl. Neumaier, 1998). Daher ist es entscheidend, „dass Schule und Spitzensport jeweils die Normen und Bedürfnisse der anderen Seite anerkennen und ein intensiver Austausch zwischen den Kooperationspartnern stattfindet“ (Borggrefe, Teubert, Cachay & Thiel, 2005, S. 299). Viele Experten sind der Meinung, dass nur in Verbundsystemen die Möglichkeit besteht, den Trainingsumfängen des Hochleistungssports nachzukommen (vgl. Feldhoff, 2002).
Die Eliteschulen des Sports konzentrieren sich auf die vom Olympiastützpunkt geförderten Schwerpunktsportarten der jeweiligen Region, decken insgesamt aber alle olympischen Sportarten ab (vgl. Radtke & Coalter, 2007, S. 42).
Um an ein solches Verbundsystem zu gelangen und somit optimale Förderung zu erhalten, müssen die Schüler ein Auswahlverfahren durchlaufen bzw. bestimmte sportliche Leistungen vorweisen. Elbe und Seidel (2003, S. 59) geben das Ziel von Auswahlverfahren an:
„Das Ziel von Auswahlverfahren an sportlichen Einrichtungen ist es, diejenigen Sportlerinnen und Sportler zu selektieren, die mit größter Wahrscheinlichkeit in der jeweiligen Sportart in den Höchstleistungsbereich kommen (vgl. Williams & Reilly, 2000; Ziemainz & Gulbin, 2001)“.
Je nach Aufnahmekapazität der Schule können auch allgemein sportlich talentierte Schüler nach einem sportmotorischen Test aufgenommen werden.
Um den Athleten, die von beiden Systemen stark beansprucht werden, die Bedingungen zu erleichtern, muss eine Kopplung von Schule und Leistungssport geschehen. Teubert et al. (2006, S. 29ff) erläutert, dass dies auf der Sachebene nur äußerst begrenzt möglich sei. Laut Gesetzgebung ist ein Austausch von Inhalten, beispielsweise Sport- statt Mathematikunterricht, nicht möglich. Teubert (2009, S. 69) schreibt dazu:
„Die schulischen Vorgaben stellen also Handlungsbedingungen dar, die zumindest im Hinblick auf die Bewertung der Leistungserbringung keinen Spielraum zulassen, da ansonsten die Vergleichbarkeit von Schülerleistungen gefährdet wäre“.
Demzufolge muss auf der Zeit- und der Sozialebene eine stärkere Kopplung stattfinden.
Auf der Zeitebene geschieht dies durch die räumliche Nähe der Funktionsbereiche, durch eine institutionelle Verzahnung schulischer und sportlicher Zeitstrukturen und durch die flexible Abstimmung von sportlichen und schulischen Belastungshöhepunkten (vgl. Teubert et al., 2006, S. 37). Zeichen der Optimierung sind die Vollinternate in Nähe von Olympiastützpunkten oder das zusätzliche Training in den Vormittagsstunden. Eine Möglichkeit zur Entzerrung der zeitlichen Anforderungen ist die institutionelle Schulzeitstreckung, welche den Schülern der Nationalkader der Spitzenverbände ermöglicht wird (vgl. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland Kommission „Sport“, 2000, S. 11). Dadurch kann der zu unterrichtende Inhalt von zwei Schuljahren auf drei Schuljahre gestreckt und somit Zeitressourcen gewonnen werden.
Für eine Verbesserung in Bereichen der Sozialebene sorgen qualifizierte Lehrer und Trainer, besondere Stellen zur Überbrückung der Differenz zwischen Spitzensport und Schule, Personal für den Stütz- und Förderunterricht bzw. der Hausaufgabenbetreuung und Mitarbeiter für weitere kompensatorische Leistungen, wie die Bereitstellung von Mahlzeiten oder Fahrdiensten. Lehrer oder Internatspädagogen mit gleichzeitiger Trainerqualifikation können bei der Vermittlung eine wichtige Rolle einnehmen (Teubert et al., 2006, S. 40ff). Aber auch alle anderen Lehrkräfte sollten sich mit dem Profil einer Spezialschule für Leistungssportler voll identifizieren und sich dementsprechend für das gemeinsame Ziel engagieren (vgl. Deutscher Sportbund/Bereich Leistungssport, 2006, S. 27).
„Das Prädikat [„Eliteschule des Sports“] wird durch den Deutschen Olympischen Sportbund für jeweils einen olympischen Zyklus vergeben“ (Deutscher Olympischer Sportbund/Bereich Leistungssport, 2010, S. 5). Um dieses zu erhalten, müssen die bestehenden bzw. sich neu bewerbenden Schulen, die nachfolgenden, vom Deutschen Olympischen Sportbund (2010) herausgegebenen, Qualitätskriterien zufriedenstellend erfüllen:
- effiziente Bedingungen zur erfolgreichen sportlichen Ausbildung
- gelungene Koordination und Management der Zeitbudgets
- regionale und überregionale Wirkungsmöglichkeit
- gute Abstimmungs- und Organisationsstruktur
- Pädagogische Gesamtkonzeption unter leistungssportlichen Gesichtspunkten
- Sportliche und bildungsbezogene Erfolge
Eine detaillierte Erläuterung der Kriterien inklusive Beurteilungskriterien gibt der Deutsche Olympische Sportbund (2010) in den Qualitätskriterien für das Prädikat „Eliteschule des Sports“. Erfüllt eine Schule diese Kriterien, kann von bestmöglichen Bedingungen ausgegangen werden, eine erfolgreiche Karriere im Spitzensport mit einer qualifizierten Bildung und einer positiven Persönlichkeitsentwicklung zu absolvieren (vgl. Güllich, 2005, S. 89). Emrich, Güllich und Pitsch (2005, S. 103f) fassen die Schülersicht auf einzelne Eliteschulen des Sports zusammen:
„Aus Untersuchungen an einzelnen Eliteschulen des Sports wird berichtet, dass dort aus Schülersicht u. a. positive Bedingungen für die sportliche Entwicklung (Training, Trainer, Sportstätten), eine höhere Zuwendung, Fürsorge und emotionale Anteilnahme seitens der Lehrer, umfangreiche außerunterrichtliche Fördermöglichkeiten und ein stabiles soziales Klassengefüge wahrgenommen werden.“
Um einen regelmäßigen Austausch zwischen den betreffenden Schulen zu gewährleisten, organisiert der Arbeitskreis „Eliteschulen des Sports“ aller zwei Jahre die „Konferenz der Eliteschulen des Sports“ (vgl. Radtke & Coalter, 2007, S. 42). Bei dieser Sitzung werden wichtige Aspekte besprochen, welche das Verbundsystem betreffen. Auch Probleme oder Verbesserungsmöglichkeiten des Internats finden Anklang.
2.2.2 Das Internat als Teilaspekt eines Verbundsystems
Eine wichtige Institution in einem Verbundsystem ist das Internat[5]zur Unterbringung und Verpflegung der Jugendlichen. Unterschieden wird zum Einen in Teilzeit- und Vollzeitinternate und zum Anderen in Internate mit internen oder externen Schulanschluss. Seidelmeier (2005, S. 37) formuliert die zweite Unterscheidungskategorie folgendermaßen: